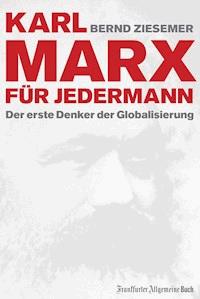Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Campus Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wer den Einfluss verstehen will, den China auf die deutsche Wirtschaft ausübt, muss den Namen Gerhard Ludwig Flatow kennen. Er war wohlhabender Stahldirektor und Kommunist, Abenteurer und Lobbyist, sprach fließend Chinesisch und wurde in den Fünfziger und Sechziger Jahren zum wichtigsten Agenten der Chinesen in Deutschland. Dabei hat er es verstanden, völlig unbekannt zu bleiben – bis der Wirtschaftspublizist und Chinakenner Bernd Ziesemer die Fäden zusammenführte und entdeckte, dass der Maoist und der Industrielle ein und dieselbe Person waren. Nach jahrelanger Recherche, Auswertung von Geheimdienstunterlagen, persönlichen Dokumenten und vielen Gesprächen präsentiert Ziesemer hier die spektakuläre Geschichte einer einzigartigen Persönlichkeit, in der sich zugleich eine ganze Epoche deutsch-chinesischer Beziehungen bis heute spiegelt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 357
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bernd Ziesemer
MAOS DEUTSCHER TOPAGENT
Wie China die Bundesrepublik eroberte
Campus Verlag
Frankfurt / New York
Über das Buch
Wer den Einfluss verstehen will, den China auf die deutsche Wirtschaft ausübt, muss den Namen Gerhard Ludwig Flatow kennen. Er war wohlhabender Stahldirektor und Kommunist, Abenteurer und Lobbyist, sprach fließend chinesisch und wurde in den Fünfziger und Sechziger Jahren zum wichtigsten Agenten der Chinesen in Deutschland. Dabei hat er es verstanden, völlig unbekannt zu bleiben – bis der Wirtschaftspublizist und Chinakenner Bernd Ziesemer die Fäden zusammenführte und entdeckte, dass ein Maoist und ein Industrieller ein und dieselbe Person waren. Nach jahrelanger Recherche, Auswertung von Geheimdienst- und persönlichen Dokumenten und vielen Gesprächen präsentiert Ziesemer hier die spektakuläre Geschichte einer einzigartigen Persönlichkeit, in der sich zugleich eine ganze Epoche deutsch-chinesischer Beziehungen bis heute spiegelt.
Vita
Bernd Ziesemer, Wirtschaftspublizist, arbeitet als fester Kolumnist für Capital, schreibt für die Zeitschrift Internationale Politik, die Financial Times, das Handelsblatt, den Stern und weitere Magazine. Nach seiner Korrespondentenzeit in Asien und Russland war er lange Jahre Chefredakteur des Handelsblatts. Seit 1982 bereiste er China regelmäßig, 1988 studierte er an der Universität Chongqing. Sein erstes China-Buch – Auf dem Rücken des Drachen – erschien 1989. Im Jahr 2012 veröffentlichte er Ein Gefreiter gegen Hitler. Auf der Suche nach meinem Vater, im Jahr 2013 Karl Marx. Der erste Denker der Globalisierung.
https://www.bernd-ziesemer.com/
Übersicht
Cover
Titel
Über das Buch
Vita
INHALT
Impressum
INHALT
Prolog: Von Einflussagenten, treuen Weggefährten und alten Freunden
Kapitel 1
Wie ein junger Kommunist aus sehr gutem Hause in China landet — 1910–33
Kapitel 2
Wie man das nützliche Handwerk geheimer Geschäfte lernt — 1934–39
Kapitel 3
Wie sich ein Kaufmann in einen Spion verwandelt und wieder zurück — 1940–45
Kapitel 4
Wie man mit den chinesischen Kommunisten heimlich Handel treibt — 1946–50
Kapitel 5
Wie ein Deutscher Maos Gefängnis als überzeugter Maoist verlässt — 1951–56
Kapitel 6
Wie mitten im Kalten Krieg Deutschlands Rotchina-Lobby entsteht — 1957–60
Kapitel 7
Wie man für Otto Wolff Geschäfte macht und Politik für die Chinesen — 1960–65
Kapitel 8
Wie in Europa ein merkwürdiges Netz von Maoisten und Industriellen entsteht — 1966–68
Kapitel 9
Wie eine Bruderpartei der KP Chinas erblüht und schnell wieder verwelkt — 1969–80
Epilog: Das heutige Netzwerk der KP Chinas in Deutschland
LEBENSLAUF GERHARD FLATOW
ZEITTAFEL: FLATOWS CHINA
DANK
ANMERKUNGEN
1.
Wie ein junger Kommunist aus sehr gutem Hause in China landet
2.
Wie man das nützliche Handwerk geheimer Geschäfte lernt
3.
Wie sich ein Kaufmann in einen Spion verwandelt und wieder zurück
4.
Wie man mit den chinesischen Kommunisten heimlich Handel treibt
5.
Wie ein deutscher Maos Gefängnis als überzeugter Maoist verlässt
6.
Wie mitten im Kalten Krieg Deutschlands Rotchina-Lobby entsteht
7.
Wie man für Otto Wolff Geschäfte macht und Politik für die Chinesen
8.
Wie in Europa ein merkwürdiges Netz von Maoisten und Industriellen entsteht
9.
Wie eine Bruderpartei der KP Chinas erblüht und schnell wieder verwelkt
Epilog: Das heutige Netzwerk der KP Chinas in Deutschland
QUELLEN UND LITERATUR
Unveröffentlichte Quellen
Gespräche und E-Mails
Eingesehene Archive
Literatur
Periodika
Prolog: Von Einflussagenten, treuen Weggefährten und alten Freunden
Anfang der siebziger Jahre begann ich mich als Jugendlicher wie viele meiner Generation für die Kulturrevolution in China zu begeistern. Ich schwenkte selbst die Mao-Bibel und ließ mir jede Woche die Peking Rundschau auf Dünndruckpapier direkt aus der chinesischen Hauptstadt per Luftpost nach Hause schicken – für lächerliche 12 Mark pro Jahr. Tausende organisierten sich damals wie ich in den maoistischen K-Gruppen und träumten von der Weltrevolution.
Als die große Welle der Begeisterung nach ein paar Jahren wieder abebbte, beschäftigten sich nur noch die wenigsten der ehemaligen Mao-Anhänger weiter mit China. Im Gegensatz dazu wollte ich aber nun wissen, was im Reich der Mitte in diesen Jahren wirklich passiert war und dort weiter vor sich ging. 1982 reiste ich zum ersten Mal quer durch das damals noch sehr arme Land, das gerade erst wieder westliche Einzelreisende akzeptierte, sie aber nur in wenige ausgesuchte Städte hereinließ. Drei Jahre zuvor hatte der neue starke Mann Deng Xiaoping die Öffnung der Volksrepublik und den Beginn von Wirtschaftsreformen durchgesetzt.
Seit meinem ersten Besuch ließ mich das Interesse niemals wieder los. 1988 studierte ich ein paar Wochen an der Fremdsprachenhochschule in Chongqing Chinesisch und kam auf dem Campus mit vielen chinesischen Studenten in Kontakt. Im Sommer 1989 schlug das chinesische Militär bei dem Blutbad in Beijing (»Massaker auf dem Tiananmen-Platz«) gewaltsam Proteste der Bevölkerung nieder. Trotz des folgenden Einreiseverbots für Journalisten gelangte ich noch unerkannt ins Land, um über die harte Repressionswelle gegen Studenten und Intellektuelle zu berichten. Als Asien-Korrespondent deutscher Medien in Tokio flog ich später immer wieder in die Volksrepublik, aber auch in die Staaten an der Peripherie – zum Beispiel nach Taiwan. Ich erfuhr dabei mehr über die Schattenseite eines Regimes, das seit Anfang des neuen Jahrtausends von den meisten deutschen Medien nur noch als »Wirtschaftswunderland« dargestellt wurde.
Diese Lesart der jüngeren Geschichte ist nicht falsch, aber viel zu einseitig. China hatte sich unter der Führung Deng Xiaopings tatsächlich schnell aus der bitteren Armut der Nachkriegsjahre befreit. Landwirtschaft, Industrie, Wissenschaft und Landesverteidigung erlebten einen qualitativen Sprung nach vorn, eine große historische Leistung der Kommunistischen Partei Chinas. Deng Xiaoping hatte diese »vier Modernisierungen« 1978 als Hauptaufgabe festgelegt. Aber diejenigen, die damals eine »fünfte Modernisierung« – die Einführung von demokratischen Rechten – forderten, verschwanden auch unter ihm genauso wie vorher unter Mao ohne fairen Prozess für viele Jahre im Straflager. Diese Brutalität der chinesischen Führung verdrängte die deutsche Wirtschaft. Und sie verdrängt sie größtenteils bis heute.
Als Chefredakteur des Handelsblatts begegnete ich in den Jahren nach der Jahrtausendwende auf dem Höhepunkt des China-Hypes vielen Industriellen, die sich anhörten wie Botschafter des Regimes. Der Vorstandsvorsitzende eines großen deutschen Konzerns sagte mir, wir sollten uns China »zum Vorbild nehmen«, schließlich komme das Land wirtschaftlich schneller voran als Deutschland. Ich schrieb deshalb für meine Zeitung 2005 einen Essay mit dem Titel »Das hässliche China«, der sich mit den zahllosen fatalen Fehlentscheidungen und Verbrechen der kommunistischen Führer beschäftigte. Der Artikel wurde mit dem ersten Preis der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte ausgezeichnet.
Warum reden viele Leute aus der Wirtschaft bis heute über China fast so begeistert wie wir Maoisten in meiner Jugend, obwohl sie anders als wir damals gewiss nicht von der kommunistischen Gesellschaft träumen? Wie konnte sich eine so einseitige Sichtweise auf ein Land durchsetzen, das Millionen von Opfern weitgehend ausklammert? Wie gelingt es totalitären Staaten überhaupt, demokratische Gesellschaften für sich einzunehmen? Wie erobern sie die öffentliche Meinung? Diese Fragen stellte ich mir damals und ich stelle sie mir immer noch. Propaganda wirkt, aber niemals allein und schon gar nicht allein aus der Ferne. Wollen Diktaturen Menschen in anderen Ländern für sich gewinnen und für ihre Zwecke einspannen, dann müssen sie vor Ort, in ihren Zielländern, Netzwerke knüpfen. Und sie müssen dabei die Interessen derer aufgreifen, die sie zu Anwälten ihrer Sache machen wollen.
Vor allem zwei Staaten stechen hervor, wenn es um langfristige Strategien zur Eroberung der öffentlichen Meinung geht: Russland (samt seines Vorgängerstaats, der Sowjetunion) und China. Ihre Netzwerke ziehen sich bis heute rund um den ganzen Globus. Und sie ähneln sich: Man arbeitet zielgerichtet mit Einflussagenten und naiven Mitläufern, mit pensionierten Politikern und alten Freunden, mit eitlen Publizisten und rücksichtslosen Unternehmern, die man bevorzugt bedient, um sie an sich zu binden und von sich abhängig zu machen. Oft bilden sich über Jahre große Einflusskreise um einzelne Personen herum, die man in der breiten Öffentlichkeit nicht kennt, weil sie lieber im Halbschatten arbeiten.
So kann man Wladimir Putins Versuch, Deutschland vor dem Ukraine-Krieg 2022 in die Energieabhängigkeit zu treiben, gut an einer einzigen Person und ihrem Netzwerk erzählen: Matthias Warnig. Ein ehemaliger Stasi-Major und alter Freund Putins aus dessen KGB-Zeit, nach dem Zerfall der Sowjetunion Statthalter für die Dresdner Bank in Sankt Petersburg, ein Vertrauter von Altbundeskanzler Gerhard Schröder und mehreren SPD-Politikern, eng verbunden mit vielen Spitzenleuten der deutschen Energiekonzerne, Angestellter von Gazprom und als Geschäftsführer des Pipeline-Betreibers Nord Stream AG schließlich der entscheidende Mann für die Pläne des russischen Diktators, ganz Westeuropa in den ökonomischen Würgegriff zu nehmen.
Nicht anders China. Die Volksrepublik betreibt seit ihrer Gründung 1949 im Ausland das, was sie selbst »internationale Einheitsfrontarbeit« nennt. Und sie war über weite Strecken ganz besonders erfolgreich damit. Schon In den fünfziger Jahren knüpfte sie mitten im Kalten Krieg ein großes Netzwerk von »China-Freunden« in ganz Europa. Seit den frühen sechziger Jahren baute sie maoistische Parteien in fast allen kapitalistischen Ländern Europas auf (sogar im Zwergstaat San Marino), die ihre Ideologie unter die Jugend und in die ganze Gesellschaft tragen sollten. In den siebziger Jahren gelang es ihr, einzelne konservative Spitzenpolitiker wie Henry Kissinger oder Jacques Chirac fest an sich zu binden, die sich zunächst vor allem ein Gegengewicht gegen die Sowjetunion versprachen, allmählich aber die Weltsicht Beijings übernahmen und die brutale Unterdrückung der chinesischen Bevölkerung durch die Diktatur völlig ausblendeten. So konnte sich die KP Chinas auf sie als Kronzeugen berufen.
Ich war als Journalist dabei, als der CSU-Vorsitzende Franz Josef Strauß 1987 in der Großen Halle des Volkes in Beijing von Deng Xiaoping mit feierlicher Geste und den Worten »Lao Pengyou« (alter Freund) empfangen wurde. In den achtziger Jahren zog China eine Gruppe von Industriellen heran, die auf das große China-Geschäft setzten und sich im Gegenzug als Bewunderer des autoritären Entwicklungsmodells im Reich der Mitte in der europäischen Öffentlichkeit positionierten. Eine Hand wusch die andere. Die Männer (und wenigen Frauen) in der zweiten Reihe, die diese engen Verbindungen für prominente Unternehmer pflegten, blieben dabei in der Regel in der Öffentlichkeit völlig unbekannt. Bis heute.
Dieses Buch handelt von diesen erfolgreichen Versuchen der Kommunistischen Partei Chinas seit den fünfziger Jahren, die öffentliche Meinung in der Bundesrepublik zu erobern: mit Lobby-Gruppen und Freundschaftsgesellschaften, mit maoistischen Mini-Parteien und einigen Großindustriellen, mit ausgesuchten Intellektuellen und Publizisten, die sich nach ihren zahlreichen Einladungsreisen in die Volksrepublik China als Experten gaben, obwohl sie nichts vom wirklichen Leben im Land gesehen und schon gar nicht verstanden hatten.
Ich erzähle von diesen Versuchen am Beispiel eines Mannes, den bis heute nur wenige Eingeweihte kennen, obwohl sich seine Lebenslinie mit vielen Schlüsselfiguren der deutschen Nachkriegspolitik und -wirtschaft kreuzte: Gerhard Ludwig Flatow (1910–80). Er führte ein schillerndes Leben, das 50 Jahre lang auf das Engste mit China verbunden war. Ein erfolgreicher Millionär und Stahlgroßhändler, ein Spion und Einflussagent, ein Lobbyist und Gründer der ersten deutschen Mao-Partei, ein Hasardeur und Strippenzieher, der streckenweise zum wichtigsten Helfer der Chinesen in Deutschland und zu einer Schlüsselfigur in Europa wurde.
Flatow verkehrte mit so unterschiedlichen Menschen wie den beiden deutschen Industriellen Otto Wolff von Amerongen und Berthold Beitz, mit dem Bankier Hermann Josef Abs und Hitlers Wirtschaftsminister Hjalmar Schacht, mit dem langjährigen deutschen Außenminister Hans-Dietrich Genscher und dem Studentenführer Rudi Dutschke. Schon in seinem frühen Leben in China begegnete er legendären Spionen wie dem Deutschen Richard Sorge, der Stalin vergeblich vor Hitlers Angriff auf die Sowjetunion warnte, oder dem nationalchinesischen Geheimdienstchef Dai Li. Und er lernte schließlich selbst das Handwerk der Spionage.
Seit den fünfziger Jahren trat Flatow in der deutschen Öffentlichkeit in Erscheinung, baute in den Sechzigern ein großes China-Netzwerk auf, sprach in den siebziger Jahren gleichzeitig als China-Experte vor konservativen Wirtschaftsvereinigungen und als Maoist auf Ferienlagern junger Kommunisten. Aber niemand enttarnte sein Doppelleben und niemand konnte die Fäden miteinander verknüpfen, die über viele Jahre parallel zueinander verliefen. Und wahrscheinlich konnte ihm auch nur jemand wie ich auf die Spur kommen, der beide so gegensätzliche Welten von innen kennt: den deutschen Maoismus der späten sechziger Jahre und die deutschen China-Geschäfte der letzten Jahrzehnte.
Ich hatte Flatows Namen in den siebziger Jahren einmal in einem maoistischen Blatt gelesen, war ihm jedoch niemals begegnet und wusste auch nichts über seinen Hintergrund. Als ich 40 Jahre später einen Artikel über den Pionier des deutschen Osthandels, den Industriellen Otto Wolff von Amerongen, recherchierte, begegnete ich dem Namen Gerhard Flatow erneut. Dieses Mal als Direktor und Chef des China-Büros des großen Otto-Wolff-Konzerns, der in den fünfziger Jahren 30 000 Mitarbeiter beschäftigte und zu den drei führenden Konzernen der Schwerindustrie zählte. Konnte es sein, dass der Maoist und der Direktor dieselbe Person waren?
Ich begann ein wenig zu forschen und stellte schnell fest: Ja, so war es tatsächlich. Damit begann ein Recherchemarathon über gut sechs Jahre, der mich in deutsche Wirtschaftsarchive führte und auf die Seiten des MAO-Projekts im Internet, das die radikalen Bewegungen der sechziger und siebziger Jahre akribisch dokumentiert. Die Suche nach Gerhard Flatow brachte mich zum amerikanischen Geheimdienst CIA, wo ich zwei Jahre auf eine Antwort auf meine Anfrage warten musste, in die Tiefen des Bundesarchivs oder des Dortmunder Stadtarchivs, des Personalarchivs der Frankfurter Universität oder der Universitätsbibliothek Hamburg.
Eine junge amerikanische Historikerin durchforstete für mich Papiere im Bestand der Hoover Institution in Kalifornien – der wohl besten Fundgrube in der westlichen Welt, wenn es um China geht. Einiges fand sich auch in den National Archives in Großbritannien und den Vereinigten Staaten. Sogar bei den Einwanderungsbehörden in Australien kam ich an Informationen, in den Akten des Roten Kreuzes in Genf und des Internationalen Zentrums für die Verfolgten der Nazi-Diktatur im hessischen Bad Arolsen.
Und wo immer ich den Deckel einer einschlägigen Akte hob, stieß ich sofort auf den Namen Flatow, eine Unmenge an noch nie erschlossenem Material. Trotzdem wäre daraus vielleicht kein Buch geworden, wenn ich nicht auch Nachkommen meines Protagonisten aufgetan und zu früheren Weggenossen Flatows aus den siebziger Jahren Kontakt aufgenommen hätte. Die unveröffentlichten Memoiren seiner ersten Ehefrau Wu Mei ließ ich aus dem Chinesischen übersetzen, auf verschlungenen Wegen kam ich auch an die unveröffentlichten Erinnerungen seines Freundes und langjährigen Mitarbeiters im China-Geschäft Manfred Wilhelm – und schließlich auch an wirre und undatierte Fragmente von Erinnerungen, aus denen Flatow wohl selbst ein Buch machen wollte, es aber niemals schrieb.
Ich konnte so nicht nur ein abenteuerliches, einmaliges, ja irres Leben der Vergessenheit entreißen, sondern erstmals in Deutschland den Prototyp des »alten China-Freundes« porträtieren. In der angelsächsischen Welt spricht man vom fellow traveller – ein in der frühen Sowjetunion erfundener und ursprünglich positiv gemeinter Begriff für die Verbündeten der Kommunisten. Später setzte sich der Ausdruck im Westen als Bezeichnung für die Mitläufer der Sowjetunion (und später Chinas) durch, die sich fest an die kommunistischen Staaten banden, ohne selbst jemals Mitglied deren herrschender Apparate zu werden. Der Typus des treuen bürgerlichen Sympathisanten, der sich als Bündnispartner präsentieren lässt und dessen besonderer Wert für das jeweilige Regime gerade in seiner vermeintlichen Parteilosigkeit und Unabhängigkeit liegt. Eine Figur, die zwischen dem naiven Propagandisten und dem bewussten Einflussagenten changiert und bei der eine Rolle in die andere übergeht. Flatow war für die Chinesen einer der wichtigsten dieser fellow traveller. Und seine Biografie spiegelt zugleich die Arbeit der gesamten deutschen China-Lobby über viele Jahrzehnte hinweg wider und beleuchtet sie in all ihren merkwürdigen personellen Verknüpfungen.
»Das Ende der Naivität« – so überschrieb das Handelsblatt im Frühjahr 2022 einen Artikel über die Volksrepublik China. Spätestens seit der brutalen Null-Covid-Politik der chinesischen Führung, die ein ganzes Land mit Polizeigewalt in die Quarantäne zwang, und der Unterstützung Putins im Ukraine-Krieg setzt sich im Westen eine kritischere Sichtweise durch und das frühere positive Bild der Volksrepublik wandelt sich. Viele nehmen zum ersten Mal wahr, wie stark wir von China abhängig sind. Und durch Putin haben wir Deutschen gelernt, dass ein totalitärer Staat Wirtschaft bedenkenlos als Waffe einsetzt, wenn es seinen eigenen Interessen dient. Die immer aggressiveren Manöver der chinesischen Außenpolitik, die uneingeschränkte Macht des Partei- und Staatschefs Xi Jinping und die Kriegsdrohungen gegen die Inselrepublik Taiwan zwingen uns dazu, endlich genauer hinzuschauen.
Ins Blickfeld rücken damit auch der riesige globale Propaganda-Apparat der chinesischen Kommunisten und ihre Unterwanderungspolitik, mit der sie die öffentliche Meinung in aller Welt manipulieren – bis heute auch bei uns. Anders als in den sechziger und siebziger Jahren, als die westlichen Maoisten der allerersten Stunde auf eine spontane Jugendrevolte und Protestkultur stießen und sich mit ihr verbanden, geht es China heute um die viel mühsamere Eroberung des Mainstreams: mit Konfuzius-Instituten an deutschen Universitäten, mit bürgerlichen China-Vereinigungen und wirtschaftlichen Lobby-Gruppen, mit deutschsprachigen Propaganda-Websites und einem Heer von »Wolfsdiplomaten« (so der chinesische Ausdruck), die über die sozialen Medien die Politik der KP Chinas verbreiten und Kritiker des Regimes angreifen.
Dieses Buch führt mit Gerhard Flatow zurück zu den abenteuerlichen Anfängen dieser Politik, weil man den heutigen Einfluss Chinas in Deutschland und Westeuropa nur verstehen kann, wenn man die Geschichte seiner Entstehung kennt. Eine Geschichte, die von Männern wie ihm mitgeschrieben wurde und über die außerhalb von sinologischen Fachkreisen bis heute so gut wie niemand etwas Genaues weiß. Und wie jede gute Geschichte muss man sie ganz von vorn erzählen.
Kapitel 1Wie ein junger Kommunist aus sehr gutem Hause in China landet
1910–33
Zu Fuß oder auf Fahrrädern, in kleineren Gruppen und in größeren Marschkolonnen, mit roten Fahnen und Transparenten strömen am 1. Mai 1932 einige Tausend in Frankfurt zum Opernplatz. Man sieht Arbeiter in schäbigen Anzügen, Jugendliche in Knickerbockern, Frauen in dünnen Sommermänteln. Bei dem warmen Frühlingswetter legen viele Männer ihre Jacken ab und krempeln die Ärmel hoch. Die meisten Frauen verzichten auf einen Hut und zeigen ihre frechen Bubiköpfe. »Straße frei am 1. Mai«, fordern die Demonstranten: »Kämpft mit dem internationalen Proletariat für soziale und nationale Befreiung«. Am Straßenrand zurren die Beamten der uniformierten Schutzpolizei die Kinnriemen ihrer Tschakos fest, verteilen sich auf den Bürgersteigen und verschränken die Arme vor der Brust. Die 23-jährige Soziologie-Studentin Gisèle Freund, die später eine berühmte Fotografin werden sollte, nimmt die Menschen an diesem Tag mit ihrer kleinen Leica-Kamera auf.1
Über die Eschersheimer Landstraße ziehen in Fünferreihen die Mitglieder der »Roten Studentengruppe«. Viele lachen, man schaut in fröhliche Gesichter. An der Spitze läuft in einem Zweireiher und mit Krawatte Josef Dünner – ein stattlicher Bursche mit dicken schwarzen Haaren und buschigen Augenbrauen. Der charismatische Kommunist studiert seit zwei Jahren Volkswirtschaft an der Goethe-Universität und organisiert unter seinen Kommilitonen unermüdlich Widerstandsaktionen gegen die Nazis. Während seine KPD immer noch vom »Hauptschlag« gegen die »Sozialfaschisten der SPD« redet, bringt der 24-Jährige linke Studenten unterschiedlicher Richtungen in seiner überparteilichen Gruppe zusammen. Die »rote Gräfin« Marion Dönhoff, in ihrem späteren Leben Herausgeberin der Zeit, gehört dazu. Auch der 35-jährige Karl August Wittfogel macht in der Gruppe mit, einer der glänzendsten marxistischen Intellektuellen seiner Generation und seit einigen Jahren eine der jungen Koryphäen am berühmten Frankfurter Institut für Sozialforschung.
Am 1. Mai 1932 fühlen sich die Kommunisten in Frankfurt so stark wie nie. Den Arbeiterparteien und ihren Organisationen gehört an diesem Tag die Innenstadt. Die Nazis lassen sich dort nicht blicken. Und doch sollte der Demonstrationszug, der vom Opernplatz durch das Zentrum in die Altstadt zum Römerberg führt, für 14 lange Jahre der letzte kommunistische Aufmarsch zum »Kampftag der Arbeiterklasse« bleiben. Nur ein Jahr später, nach der »Machtergreifung« der Nationalsozialisten im Januar 1933, zerbrechen die Parteiorganisationen in kürzester Zeit. Und auch die »Rote Studentengruppe« zerstreut sich in alle Winde: Dünner flüchtet in die USA, Wittfogel landet nach seiner Verhaftung für einige Monate in einem Konzentrationslager im Emsland und verlässt danach Deutschland, Gräfin Dönhoff wechselt vorsichtshalber an die Universität Basel, um ihr Studium in der neutralen Schweiz fortzusetzen.
Keinen der Frankfurter Freunde aber verschlägt es nach dem 1. Mai 1932 für so viele Jahre in so weite Ferne wie den Jura-Studenten Gerhard Ludwig Flatow, von dem dieses Buch handelt. Mit Hilfe seiner Familie gelangt der junge Kommunist erst nach Italien und dann 1934 nach China, macht dort Millionenprofite für deutsche Konzerne wie Daimler und Otto Wolff, verstrickt sich immer tiefer in die Welt der Geheimdienste, erlebt 1949 in Shanghai die Ausrufung der Volksrepublik durch Mao Zedong, wandert unter den chinesischen Kommunisten für fünf Jahre ins Gefängnis, nur um anschließend noch überzeugter ihre politische Geschäfte in der Bundesrepublik zu betreiben und am Ende sogar die erste maoistische Partei Westdeutschlands zu gründen.
Eine Karriere zwischen Kommunismus und Kapitalismus wie keine zweite in Deutschland. Und zugleich die Geschichte eines Mannes, der in den späten fünfziger und frühen sechziger Jahren zeitweilig zu den wichtigsten Einflussagenten der Volksrepublik China im freien Westen zählt. Ohne jemanden wie Flatow wären die Wirtschaftsbeziehungen mit China nicht so schnell in Gang gekommen, wären die deutschen Intellektuellen nicht so einfach in den Bannkreis der kommunistischen Heilslehre aus Fernost geraten, die ersten Mao-Bibeln nicht so früh in großer Zahl nach Deutschland gelangt und die Studenten 1968 vielleicht nicht so völlig bedenkenlos mit den Bildern des Großen Vorsitzenden durch Berlin und Hamburg gezogen.
Vor seiner Flucht aus Deutschland gehört der 21-jährige Anfang der dreißiger Jahre zu den eifrigsten Aktivisten der »Roten Studentengruppe«: »Bei allen Aktionen war ich dabei, es musste etwas geschehen«, schreibt Flatow später über die Zeit an seiner Alma Mater in Frankfurt.2 Was ihm nach eigenen Worten an politischem Durchblick fehlt, macht er durch seine Militanz wett. Bei den Schlägereien mit den Nazis mischt der schmächtige Student in vorderster Reihe mit, auch wenn ihm die Statur eines Josef Dünner fehlt. Flatow ist gerade einmal 1,60 Meter groß und nicht besonders kräftig gebaut. Das Foto seiner Frankfurter Studentenakte zeigt einen jungen Mann mit zurückgekämmten schwarzen Haaren und schmalen Lippen, der mit seinem Sakko aus kariertem Harris-Tweed wie ein englischer Gentleman wirken möchte.3
Flatow stammt aus einem großbürgerlichen Haus. Sein Großvater, der Geheime Medizinalrat Louis Flatow (1834–98), und sein Vater Dr. Robert Flatow (1869–1924) praktizierten beide als niedergelassene Ärzte in Berlin. Unter den Vorfahren seines Vaters finden sich Rabbiner und Gelehrte. Robert Flatow heiratete 1905 die Witwe seines Arztkollegen Karl Gebhardt, die selbstbewusste Emmy. Die 1875 geborene Tochter des hessischen Justizministers Emil Gerhard Dittmar (1842–1906) musste die Verbindung mit dem jüdischen Arzt gegen die ausdrücklichen Bedenken ihrer Eltern durchsetzen.4
Die 30-Jährige bringt ihre Tochter Gabriele mit in ihre zweite Ehe – und hält in den nächsten Jahrzehnten die schnell wachsende Familie mit ihrem eisenharten Willen und ausgeprägter Lebenstüchtigkeit zusammen. Alle nennen sie nur Muscho. »Sie war das«, schreibt später einer ihrer Bekannten über sie, »was man eine große und starke Persönlichkeit nannte.«5 Eine gebildete Intellektuelle und studierte Lehrerin, die mehrere Fremdsprachen spricht, mit Schriftstellern und Malern korrespondiert und Bücher sammelt. Zugleich aber eine zupackende Geschäftsfrau und umtriebige Mutter mit großem Organisationstalent und unermüdlicher Energie.
1906 kommt die Tochter Liselotte auf die Welt, ein Jahr später folgt Dorothea (genannt Dojo). Am 1. Dezember 1910 freut sich die Familie über den ersten Jungen, Gerhard Ludwig, 1916 schließlich über das Nesthäkchen Joachim Dietrich (genannt Dieter). Die Kinder wachsen in besten Verhältnissen auf, aber ohne die strenge Erziehung, wie sie in diesen Kreisen eigentlich üblich ist. Die Flatows scheren sich wenig um die nationalkonservative Stimmung in der gehobenen Gesellschaft. Es herrscht ein offener Umgangston, politisch denkt man linksliberal und liest Kurt Tucholskys Zeitschrift Die Weltbühne. Der jüdische Glaube spielt im Alltag der Familie keine Rolle, obwohl Vater Robert eine große Sammlung seltener Judaica besitzt. Als Kinder einer nicht-jüdischen Mutter gehören die Geschwister ohnehin nicht zur Synagogen-Gemeinde, Muscho lässt sie evangelisch taufen. Erst die Nazis erklären sie später zu »Halbjuden«.
Dr. Robert Flatow betreibt in diesen Jahren eine große Privatklinik an der Kronprinzenallee 18–22 im feinen Stadtteil Dahlem. Die Familie wohnt selbst auf dem Gelände.6 Zahlreiche junge Mediziner absolvieren bei dem begabten Arzt ihre Fachausbildung.7 Sein Königin-Augusta-Sanatorium spezialisiert sich auf Magen-, Darm- und Stoffwechselerkrankungen und zieht viele reiche Patienten an. Der Kölner Industrielle Otto Wolff (1881–1940), ein Dauerpatient mit vielen Leiden, bewohnt auf dem Klinikgelände an der heutigen Clayallee immer wieder wochenlang ein eigenes Haus, das nur ihm zur Verfügung steht. Auch Künstler und Intellektuelle lassen sich bei Dr. Flatow gern behandeln. Der Theaterkritiker und Schriftsteller Joseph Chapiro hält sich tagsüber im Sanatorium auf und besucht abends die Premieren in der Stadt, wie er dem bekannten Dramatiker Gerhart Hauptmann berichtet.8
Die Flatows gehören in den frühen zwanziger Jahren zu den vielen sehr wohlhabenden Familien, die diesen Berliner Stadtteil prägen. Man leistet sich genügend Hauspersonal, gediegene Kleidung und gutes Essen. Die Familie fährt regelmäßig an die Ostsee in Urlaub. Man genießt die dörfliche Ruhe in Dahlem, aber auch das großstädtische Treiben in der Reichshauptstadt. Gerhards bildhübsche Halbschwester Gabriele, von allen nur Dada genannt, heiratet in dieser Zeit in eine der reichsten Berliner Familien ein: Ihr Mann Eduard Hans Steinthal erbt von seinem Vater Max, dem Mitbegründer und langjährigen Aufsichtsratsvorsitzenden der Deutschen Bank, ein großes Vermögen und tritt in den Stahlkonzern Mannesmann ein.9 Ein paar Jahre später volontiert Dieter Flatow im Hannoveraner Werk des Unternehmens.
All das prägt Gerhards Charakter schon früh: der enge Zusammenhalt in einer großen Familie, die Begegnungen mit großen Persönlichkeiten, der selbstverständliche Umgang mit Vermögen und Geld, das typische Selbstbewusstsein der großbürgerlichen Stände, aber auch eine Erziehung zur Empathie mit den Armen und Geschlagenen dieser Welt, wie sie so typisch ist für viele Arztfamilien.
Als Robert Flatow am 11. Oktober 1924 mit nur 55 Jahren »aus voller Tätigkeit heraus, am Herzschlag«10 stirbt, übernimmt Muscho gemeinsam mit dem Leitenden Arzt Dr. Paul E. Beeck das Sanatorium. Im späteren Leben Gerhard Flatows wird der Arzt eine große Rolle spielen – allerdings ganz anders, als man zunächst vermuten sollte. Mit einem Inserat in der Weltbühne kündigt Muscho die Fortführung des Klinikbetriebs an. Die Kinder gewöhnen sich schnell an die neue Rolle ihrer Mutter als kaufmännische Geschäftsführerin der Klinik, die Großen kümmern sich um die Kleinen. Gerhard übernimmt die Verantwortung für seinen sechs Jahre jüngeren Bruder Dieter – und legt diese Rolle mit ihrer Mischung aus echter Fürsorge und fortlaufender Bevormundung auch in späteren Jahren nicht ganz ab.
Seit sie Witwe ist, erzieht Muscho ihre Söhne und Töchter zu noch mehr Selbstständigkeit als früher, es geht nun erst recht sehr viel unkonventioneller zu als in den meisten anderen Familien der Oberschicht. Ein Foto von 1926 zeigt den zehnjährigen Dieter beim Boxunterricht – ungewöhnlich in diesen Kreisen.11 Am 5. Juli 1928 reist der 17-jährige Gerhard ganz allein mit seinem kleinen Bruder in die Ferien nach Großbritannien, der Dampfer »Stuttgart« bringt sie von Bremerhaven nach Southampton.12 Eine gewisse Weltläufigkeit und Abenteuerlust gehört in dieser Familie zur geistigen Grundausstattung und zum guten Ton. Diese Kindheitserfahrungen helfen später sehr, als sich die Geschwister über den ganzen Erdball zerstreuen und sich in fremden Ländern bewähren müssen.
Gerhard geht in diesen Jahren auf das elitäre Arndt-Gymnasium. Die ärmeren Berliner verulken die feudalen Absolventen der Lehranstalt als »FeuDahlemer«. Nur sehr wenige Familien in der Stadt können sich das teure Schulgeld leisten. Die Direktoren wollen aus ihrer Schule ein »deutsches Oxford« machen. Bildungsideal ist nicht der vergeistigte Intellektuelle, sondern der gebildete Mann der Tat. Am Arndt-Gymnasium treibt man viel Sport, es gibt eine Schwimmhalle und die Schüler rudern regelmäßig mit ihren Achtern auf den Wannsee hinaus.13
Einige Lehrer Gerhard Flatows verstehen sich selbst ausdrücklich als Reformpädagogen, die mit dem elenden Untertanengeist der alten preußischen Schule brechen wollen. Zahlreiche künftige Offiziere und Diplomaten, aber auch viele Abenteurer und Unternehmer gehen aus dem Arndt-Gymnasium hervor. Ostern 1929 legt Gerhard Flatow dort seine Reifeprüfung ab. Einer seiner Mitschüler verfasst kurz vorher in der Schulzeitung, den Dahlemer Blättern, einen für die damalige Zeit bemerkenswert kritischen Aufsatz mit der Überschrift »Vor dem Abiturium«. Eine der Kernpassagen: »Gerade durch den von ihr unabtrennlich scheinenden Geist des Zwanges erzieht die Schule zur Freiheit«. Der Sinn des Lebens sei schließlich »das, was man daraus macht«.14
Der junge Flatow entschließt sich zunächst, eine ganz normale bürgerliche Karriere daraus zu machen. Am 7. Mai 1929 schreibt sich Gerhard an der Universität Hamburg für Jura ein. Als »erstrebten Lebensberuf« gibt der neue Student den »Staatsdienst« an. Nach nur einem (ohne Seminarbesuch verbummelten) Semester wechselt Gerhard an die Ludwig-Maximilians-Universität in München, wo nun das gehörige Pensum von 33 Wochenstunden auf seinem Studienzettel steht.
In seinen beiden Semestern in München hört Gerhard unter anderem Allgemeine Staatslehre bei dem hoch angesehenen Ordinarius Hans Nawiasky, der wegen seiner jüdischen Herkunft und seiner konservativ-katholischen Ansichten schon sehr früh in das Fadenkreuz der Nationalsozialisten gerät und Deutschland 1933 schließlich verlassen muss. Zum Wintersemester 1930 kehrt Gerhard nach Berlin zurück, um an der Friedrich-Wilhelms-Universität (der heutigen Humboldt-Universität) zwei weitere Semester zu studieren.
Sein Strafrechtspraktikum absolviert Gerhard bei dem liberalen und polyglotten Professor James Goldschmidt, der bei seinen Studenten durch seine wohlvorbereiteten und sehr fordernden, zugleich aber humorvollen Vorlesungen so etwas wie Kultstatus genießt. Auch er zieht sich den Hass der Hitler-Anhänger zu und geht bald darauf ins Exil. Neben seinen Jura-Studien beschäftigt sich Gerhard in Berlin auch mit anderen Fächern wie Volkswirtschaft. Bei Emil Dovifat, dem berühmten Begründer der neuen Wissenschaft Publizistik, absolviert er ein Seminar.15
Insgesamt gibt Gerhard in seinen beiden ersten Studienjahren 1929/30 das Bild eines ganz normalen Studenten ab, der sich nach einigen Anlaufschwierigkeiten auf seine Arbeit an der Universität konzentriert und sich allenfalls durch die dezidierte Auswahl liberaler Professoren von der rechten Mehrheit unter seinen Kommilitonen absetzt, die schon bald in großen Scharen ins Lager der Nazis wechseln, wenn sie sich dort nicht ohnehin bereits engagieren.
Doch 1931 verändert sich schlagartig sein ganzes Leben. Seine Mutter kann das Sanatorium in Berlin nach dem großen Bankenkrach im Deutschen Reich finanziell nicht mehr halten, die Familie verliert ihre bisherige Existenzgrundlage. Am 13. Juli 1931 schließt überraschend die bankrotte Danat-Bank, damals das zweitgrößte deutsche Kreditinstitut. In Berlin bilden sich am Nachmittag lange Schlangen vor den anderen Bankhäusern. Jeder versucht, so schnell wie möglich sein Geld abzuheben. Die Regierung unter dem glücklosen Reichskanzler Heinrich Brüning kann die Panik nicht stoppen.
In den nächsten Wochen gehen im ganzen Deutschen Reich Tausende von kleinen Unternehmen pleite. Bis zum Jahresende steigt die offizielle Arbeitslosigkeit unter den Industriearbeitern auf 40 Prozent. Die Kommunisten interpretieren die große Krise als Vorbotin der Revolution, die Nazis nutzen sie für ihre Propaganda gegen »jüdische Plutokraten«. »Unsere Stunde kommt mit unheimlicher Gewissheit«, schreibt Josef Goebbels (damals Gauleiter der NSDAP in Berlin) in sein Tagebuch.16
Die Flatows sorgen sich über den schnellen Vormarsch der Nazis und über den immer stärkeren Antisemitismus in Deutschland – früh sensibilisiert durch die Erzählungen ihres Vaters Robert17 über den Judenhass in der Geschichte. Wirtschaftlicher Druck und das Gefühl der persönlichen Bedrohung verbinden sich. Der Bruch, der mit dem Verlust finanzieller Sicherheit und eines unbeschwerten bürgerlichen Lebens einhergeht, treibt Gerhard Flatow mit schnellen Schritten nach ganz links. Am Ende dieser Entwicklung tritt der Bürgersohn in den Jugendverband der KPD ein.
Muscho und die beiden Schwestern Liselotte und Dojo beschließen 1931, sich in Süditalien ein neues Leben aufzubauen. Benito Mussolinis Machart des italienischen Faschismus kommt ohne das innere Feindbild vom »jüdischen Volksschädling« aus – und deutsche Juden haben dort zunächst nichts zu befürchten. Im Juli 1932 gibt die Familie ihre letzte Berliner Wohnung Unter den Linden 44 auf, ein Brief der Frankfurter Universität an Gerhard kommt mit dem Vermerk »Unbekannt verzogen« zurück.18
Die beiden Brüder bleiben in Deutschland: Dieter kommt bei seiner Großmutter Lina Dittmar in Darmstadt unter, um seine Schule zu beenden. Gerhard schreibt sich am 9. November 1931 an der Goethe-Universität in Frankfurt ein und wohnt bei seinem Onkel Gustav Dittmar in Offenbach, dem Bruder seiner Mutter. Der Polizeidirektor versteht sich politisch als rechter Sozialdemokrat und legt sich verschiedentlich mit den Nazis an, kann aber auch nicht die Begeisterung seines Neffen für die KPD verstehen. Der angesehene Beamte gehört zu den wenigen, die die Weimarer Republik gegen die extreme Rechte wie gegen die extreme Linke verteidigen. Nach der Machtergreifung im Januar 1933 entfernen die Nazis den 49-jährigen sofort aus seinem letzten Amt als Polizeichef in Darmstadt.19
In Frankfurt gerät Gerhard Flatow Ende 1931 von der ersten Woche an in die politischen Kämpfe der Zeit. Anders als an den meisten anderen deutschen Hochschulen bleiben die Nazi-Studenten an der Goethe-Universität in diesen Monaten noch in der Defensive. Die »Rote Studentengruppe« und andere linke Vereinigungen verteidigen ihr Terrain. Viele Frankfurter Professoren liebäugeln in der einen oder anderen Weise mit dem Marxismus oder anderen sozialistischen Theorien. Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, Karl Mannheim, Paul Tillich prägen die besondere Debattenkultur an der Goethe-Universität. Viele linke Studenten ziehen von einem ihrer Seminare zum nächsten. »An sich war die ganze Atmosphäre, man könnte sagen, auf eine neue Gesellschaft hin gerichtet«, erinnert sich die damalige Studentin und spätere Emigrantin Toni Oelsner.20 Auch sie macht in der »Roten Studentengruppe« mit.
Doch je mehr sich die Stimmung radikalisiert, umso weniger lassen sich die führenden Mitglieder der »Roten Studentengruppe« in den Seminaren und Vorlesungen blicken. Josef Dünner leitet die Marxistische Arbeiterschule (MASch) in Frankfurt und bringt jungen Arbeiterinnen und Arbeitern in Abendkursen die Theorien der sozialistischen Klassiker bei. Andere Studenten wie Gerhard Flatow unterstützen die kommunistische Agitation in den Betrieben oder gehen ganz in der Parteiarbeit auf. Die Gewaltbereitschaft unter ihnen wächst, man glaubt an eine baldige bewaffnete Revolution in Deutschland. Einige Mitglieder der »Roten Studentengruppe« nehmen deshalb sogar Schießunterricht bei einem ungarischen Kommilitonen.21
Auch Gerhard Flatow legt sein Jura-Studium ad acta und stürzt sich mitten ins Getümmel außerhalb der Universität. Am 25. April 1932 leiht der Student sein Reifezeugnis im Sekretariat der Universität aus, um sich in einem Betrieb zu bewerben.22 Im Juni findet man den 21-Jährigen noch einmal kurz an der Goethe-Universität, als sich kommunistische und nationalsozialistische Studenten eine große Schlägerei im Lichthof des Hauptgebäudes liefern. Von der Balustrade werfen die Linken den Nazis, die in SA-Uniformen aufmarschieren, Blumenkübel auf die Köpfe und vertreiben sie aus der Universität. Anschließend geht die Polizei mit gezogenem Gummiknüppel gegen die kommunistischen Studenten vor. Viele von ihnen tragen heftige Verletzungen davon, fühlen sich aber ein letztes Mal als Sieger an ihrer Hochschule.23
Gerhard Flatows Vorbild Dünner handelt sich als Rädelsführer einen strengen Verweis des Rektors ein, der einige Wochen später zu seiner Zwangsexmatrikulation führt, blickt aber sein Leben lang stolz auf die große Schlacht zurück. Die Frankfurter Universität sei eine der wenigen deutschen Hochschulen gewesen, schreibt Dünner später in seinen Erinnerungen, »in denen die Nazis sich blutige Köpfe holten«.24 Flatows Strafe fällt prosaischer aus als die seines Genossen: Die Universität streicht den Jura-Studenten am 11. Juli 1932 nach Paragraf 13 der Studienordnung aus ihrem offiziellen Verzeichnis, weil Flatow die Bezahlung der Studiengebühren versäumt und sich für keine Vorlesungen eingetragen habe. Die weitere Benutzung der universitären Einrichtungen sei »nicht statthaft« und werde »als Straftat verfolgt«, heißt es im Schreiben des Rektorats.25
Im Sommer und Herbst 1932 kommt Gerhard Flatow auf den kommunistischen Kundgebungen und Versammlungen in Frankfurt und Offenbach zum ersten Mal mit einem Thema in Berührung, das sein ganzes weiteres Leben bestimmen sollte: China. Die KPD und Flatows Jugendverband KJVD organisieren in diesen Monaten eine zweite große Kampagne unter der Parole »Hände weg von China!«. Schon 1925 hatte die KPD unter diesem Motto Geld für die chinesischen Genossen gesammelt, reichsweit Flugblätter und Broschüren zu ihrer Unterstützung verbreitet.
Jetzt geht es in der KPD-Agitation vor allem gegen die Japaner, die nach der Besetzung der nordostchinesischen Mandschurei am 1. März 1932 einen Vasallenstaat ausrufen und später den 1912 gestürzten letzten chinesischen Kaiser Pu Yi als Herrscher von ihren Gnaden einsetzen. Die Kommunisten sehen darin einen Schritt zur Einkreisung ihres sozialistischen Vaterlands Sowjetunion, dessen Verteidigung sie für ihre wichtigste politische Aufgabe halten. Der offene Krieg »der japanischen Bourgeoisie gegen die werktätige Bevölkerung Chinas« beweise schlagend die unmittelbare »Gefahr des imperialistischen Kriegs gegen die Sowjetunion«, heißt es damals in einem Aufruf des KJVD.26
Auch in Frankfurt beschwören die Kommunisten auf Flugblättern und Plakaten nun den »heldenmütigen Widerstand« gegen die Japaner. Flatows Bekannter Karl August Wittfogel, der seit der Veröffentlichung seiner fulminanten wissenschaftlichen Abhandlung über die »Wirtschaft und Gesellschaft Chinas« im Jahr 1931 als Asien-Experte der KPD gilt, hält Vorträge über die politischen Kämpfe im Reich der Mitte. Als Mitherausgeber der Zeitschrift The Anti-Imperialist Review veröffentlicht der kommunistische Wissenschaftler mehrere Beiträge zum Thema. Die unbedingte Unterstützung der chinesischen Revolution sei jetzt, so schreibt er dort, »zwingendes Gebot des proletarischen Internationalismus«.
Rund um das 1925 gegründete China-Institut der Goethe-Universität, zur Zeit Flatows die führende sinologische Forschungseinrichtung im Deutschen Reich, bilden sich Diskussionszirkel zur Unterstützung Chinas. Einige linke Chinesen studieren in Frankfurt und kommen bei den Solidaritätsaktionen in Kontakt mit ihren deutschen Kommilitonen. Die beiden Kommunisten Du Renzhi und Liu Simu, die später für den sowjetischen Spion Richard Sorge in Shanghai arbeiten, hören 1932 Vorlesungen bei Max Horkheimer und Karl Mannheim am Frankfurter Institut für Sozialforschung und knüpfen eifrig Verbindungen für die 1921 gegründete KP Chinas.27
Viele Linke wie Flatow lesen in diesen Monaten begeistert den Roman Die Gefährten der kommunistischen Schriftstellerin Anna Seghers und die ersten China-Reportagen ihres Genossen Egon Erwin Kisch, die 1932 erscheinen und die chinesischen Revolutionäre als Helden verklären. Kisch versammelt seine Zeitungsstücke in seinem Buch China geheim, das im Januar 1933 herauskommt und zum Bestseller wird, bevor die Nazis es verbieten.
Bekannte Schriftsteller wie Friedrich Wolf, Ludwig Renn, Lion Feuchtwanger und andere linke Intellektuelle unterschreiben 1932 einen Appell zur Unterstützung der »chinesischen Massen«.28 Die Anhänger der KPD träumen sich den baldigen Sieg der Kommunisten in China zurecht, das nach ihren Vorstellungen zum zweiten Bollwerk der Weltrevolution neben Stalins UdSSR werden soll. Auch Bertolt Brecht beginnt in dieser Zeit, sich mit China zu befassen.
Eine romantische Verklärung der chinesischen Revolution setzt sich durch, die auch Gerhard Flatow berührt. Auf das Reich der Mitte mit seiner so unterschiedlichen Kultur und seinen so ganz anderen Geistestraditionen lassen sich alle möglichen exotischen Vorstellungen projizieren. Die KP Chinas erscheint aus der Ferne viel mächtiger, als sie es zu diesem Zeitpunkt nach ihren vielen Niederlagen wirklich ist.
Maos Name taucht in diesen Monaten zum ersten Mal häufiger in der deutschen KPD-Presse auf, die sich auf zahlreiche Artikel in den offiziellen Organen der Moskauer Kommunistischen Internationale stützen kann. Die populäre Arbeiter-Illustrierte-Zeitung des »roten Pressezaren« Willi Münzenberg berichtet mit großen Bilderstrecken über das Elend in China und die Kämpfe gegen die Japaner. Das Thema China ist so wichtig für die extreme Linke geworden, dass sich der KPD-Vorsitzende Ernst Thälmann in einer Broschüre zur Reichstagswahl 1932 ausdrücklich als »Bundesgenosse« der chinesischen Revolution präsentiert.
Flatow kann allerdings Ende 1932 noch nicht ahnen, wie schnell aus seiner eigenen jugendlichen Begeisterung für China eine lebenslange Verbindung mit dem Riesenreich werden sollte. Doch die Ereignisse in Frankfurt überschlagen sich – wie in ganz Deutschland. Aus der Reichstagswahl am 6. November 1932 geht die NSDAP auch in Hessen mit 41,5 Prozent der Stimmen als stärkste Partei hervor. Die Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler löst am 30. Januar 1933 keine großen Proteste in Hessen aus. Einen Tag später demonstrieren in Frankfurt immerhin 2 000 Kommunisten und Sozialdemokraten zum ersten (und letzten) Mal gemeinsam gegen die Nazis.
Am 4. Februar 1933, einem Samstag, erlässt Hitler schließlich in Berlin die »Notverordnung zum Schutz des Deutschen Volkes«. Nun rollt in Frankfurt eine breite Verhaftungswelle gegen alle Nazi-Gegner an.29 Mehrere Mitglieder der »Roten Studentengruppe« gehören zu den Verfolgten. Karl August Wittfogel flüchtet aus der Stadt, doch die Geheime Staatspolizei nimmt ihn am 13. März 1933 in Konstanz unter dem Verdacht fest, »unter dem Deckmantel der Wissenschaft aktive kommunistische Propaganda getrieben zu haben«30.
Auch Gerhard Flatow kann sich einer Festnahme nicht entziehen. Der genaue Zeitpunkt, die Umstände und Dauer seiner Verhaftung bleiben allerdings im Dunkeln. Er selbst macht in seinen Aufzeichnungen keine klaren Angaben. Seine erste chinesische Ehefrau Wu Mei schildert die Ereignisse viele Jahrzehnte später lediglich so: Gemeinsam mit anderen Studenten habe Gerhard versucht, die Arbeiter eines Frankfurter Betriebs zum Streik aufzurufen. Daraufhin sei es zu seiner Verhaftung gekommen. »Glücklicherweise« sei ein Onkel Flatows ein »hoher Nazi-Beamter« gewesen, der seine Freilassung durchgesetzt habe.31 Gemeint ist damit wohl der Bruder seiner Mutter, der jedoch alles andere als ein Nazi war. Als hoher Polizeibeamter verfügte Flatows Onkel aber tatsächlich über gute Beziehungen zur Frankfurter Polizei und zur Justiz der Stadt. Er konnte sie damals vermutlich auch noch einsetzen, um seinen Neffen freizubekommen.
Die Familie überzeugt den 22-Jährigen, seinen Schwestern nach Italien zu folgen. Das Klippendorf Positano südlich des Vesuvs an der Amalfiküste – damals ein bitterarmes Fischerörtchen, das in den fünfziger Jahren zum Traumziel des internationalen Jetsets avancierte – wird für einige Monate seine Zwischenstation auf dem Weg nach China. Seine Mutter und die Schwestern betreiben seit 1932 das »Café Gloia« in Positano, das zum Mittelpunkt einer zunächst kleinen, aber in den nächsten Jahren stetig wachsenden deutschen Exilgemeinde wird.32
In den dicht aneinandergedrängten Häusern, die sich auf mehreren Terrassen vom Strand bis fast zum Gipfel des Bergs hinaufschlängeln, stehen damals zahlreiche einfache Wohnungen ohne Wasserleitung und elektrisches Licht leer, die billig zu mieten sind. Viele Italiener haben Positano verlassen, um anderswo Geld zu verdienen. Deutsche Künstler und Intellektuelle, die vor Hitler und den Gefahren in ihrer Heimat flüchten, aber auch einige Abenteurer und »weltquere Käuze«33 ziehen in ihre Quartiere ein.
Intellektuelle wie die Schriftsteller Walter Meckauer und Armin T. Wegner oder Künstler wie Kurt Craemer und Karli Sohn-Rethel, die meisten von ihnen Juden, finden dort vorübergehend Unterschlupf. Und je mehr Emigranten nach Positano kommen, desto wichtiger wird die Rolle der Flatows in der kleinen deutschen Exilgemeinde. Dojo versorgt die Ärmsten unter den armen Emigranten regelmäßig mit einer billigen Portion Spaghetti, etwas Brot und Obst.
Muscho richtet gleichzeitig eine Teestube samt kleiner Galerie ein, in der die Exilanten stundenlang debattieren und streiten. Sie verkauft dort auch deutsche Zeitschriften, auf die sich alle stürzen. Später führt sie mit ihren Töchtern die größere Pension »San Matteo« – eine Herberge in einer beeindruckenden Villa mit Kuppelgewölben, gemauerten Rundbögen und Nischen im maurischen Stil mit einem herrlichen Blick über das Meer.34
Dojo heiratet den Italiener Giulio Rispoli und betreibt mit ihm das florierende Restaurant Buca di Bacco am Strand, das heute noch existiert und im Besitz der Rispolis geblieben ist. Als die italienischen Faschisten auf Druck der Nazis 1942 gegen die deutschen Juden im Land vorgehen, geraten auch die beiden Flatow-Schwestern ins Visier. Am Ende aber gehören sie zu den sieben deutschen und österreichischen Juden (von insgesamt 25), die in Positano bleiben dürfen. Lediglich ihren Exilanten-Club müssen sie auf Befehl der italienischen Polizei schließen.35 Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs bleibt Dojo allein in Italien zurück. Ihr Haus aber erweist sich für die ganze Familie bis zu ihrem Tod (und sogar darüber hinaus) als Fixpunkt und Sehnsuchtsort.36
Gerhard Flatow hätte sicherlich wie seine Mutter und seine Schwestern in Positano überwintern können. Doch die Enge des italienischen Örtchens und die Öde eines isolierten Emigrantenlebens mit seinen ewigen Streitereien und steten Eifersüchteleien ist nichts für einen jungen Mann, der sich in der Welt beweisen will. An eine vernünftige Arbeit ist dort nicht zu denken, an kommunistisches Engagement schon gar nicht. Gerhard verschnauft deshalb nur ein paar Monate in Positano, mehr nicht.
Es ist ein ganz alter Freund und Kollege seines verstorbenen Vaters, der Gerhard aus der erzwungenen Untätigkeit und Langeweile rettet: Dr. Paul Beeck. Der frühere Leibarzt des Industriellen Otto Wolff im Berliner Sanatorium der Flatows arbeitet seit einigen Monaten im Konzern seines reichen Freundes und Patienten mit. Der schwer kranke Stahlmagnat will ihn sogar zum Teilhaber seiner Unternehmensgruppe machen und als Nachfolger aufbauen. Doch zunächst soll der Arzt eine Art Gesellenstück abliefern: Beecks Aufgabe ist es, in China ein »lebensfähiges Unternehmen« aufzubauen, um danach mit »dem Glanz, dem Wissen und dem Erfolg eines großen Auslandspioniers« in die oberste Führungsebene des Konzerns einzutreten, wie Otto Wolff 1936 in einem Brief an seinen Vertrauten bekräftigt.37