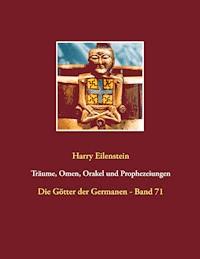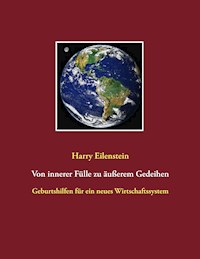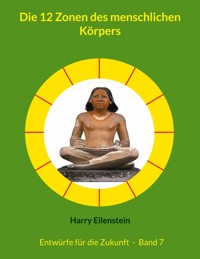Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Der Weg der Sonne
- Sprache: Deutsch
Maran wandert von seinem Bergtal in das Mittlere Reich, wo er eine ganz andere Kultur kennenlernt. Dort trifft er den Abenteurer Arrel und erforscht zusammen mit ihm die Magie - und findet weit mehr als er gesucht hatte ... sowohl Bedrohliches als auch Schätze, von denen er vorher noch nie etwas gehört hatte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1467
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1: Die Wanderung
Kapitel 2: Die Seestadt
Kapitel 3: Dunkelheit
Kapitel 4: Der Zauberlehrling
Kapitel 5: Die drei Zauberbücher
Kapitel 6: Wachschlaf und Mea-Räder
Kapitel 7: Geister im Haus und Hausgeister
Kapitel 8: Flüche und Besessenheit
Kapitel 9: Der Dämon
Kapitel 10: Das Grüne Buch
Kapitel 11: Kernu
Kapitel 12: Sterngucker
Kapitel 13: Die Wandelsterne
Kapitel 14: Urriese und Nachtreiter
Kapitel 15: In der Schmiede
Kapitel 16: Wurzeln
Kapitel 17: Horizonte
Kapitel 18: Die Frage
- Kapitel 1 -
Die Wanderung
Die Sonne erhob sich gerade erst über den Horizont, als Maran vom Gezwitscher der Vögel erwachte. Er aß ein Stückchen Brot und rollte dann seine Decke zusammen, band sie auf seinen Rucksack, hob ihn auf den Rücken, schulterte seinen Bogen und seinen Köcher und nahm seinen Speer als Wanderstab in die Hand.
Er ging am Waldrand entlang zurück bis zu dem Pfad am Fluß und dachte dabei an seinen Großvater-Bruder Adlon.
„Ob er wohl auch hier übernachtet hatte?“
Da fiel ihm auf einmal ein, daß ja auch Krad nach seiner Verbannung bachabwärts in die Große Ebene gegangen war – war der hier irgendwo ein paar Tagesmärsche vor ihm an dem Fluß?
Maran stand am Waldrand und blickte auf die Ebene hinaus, die sich allmählich in die Ferne hin senkte. Hier und da waren Wälder in der Ebene, aber der größte Teil von ihr, den er sehen konnte, waren Felder und Weiden. In der Ferne sah er ein Dorf – es schien am Ufer des Flusses zu liegen.
„Dort führt wohl mein Weg entlang … Aber wohin will ich eigentlich in der Großen Ebene? Zur Hauptstadt? Ans Meer? Zum Großen Wall? An das Nordgebirge?“
Maran blickte etwas ratlos in die Große Ebene hinaus – sie war wirklich groß … Das war nicht mit dem Seetal zu vergleichen – die Ebene schien noch viel größer zu sein als der gesamte Wald mit den Drei Neuen Dörfern …
„Am besten gehe ich erst einmal zum Großen Fluß – den will ich auf jeden Fall sehen. Und dann werde ich mein Orakel fragen, wo es weitergeht und wo ich Asar finden werde. … Ich hoffe, daß ich noch genügend zu essen habe bis ich den Großen Fluß erreiche. … Und dann? Woher bekomme ich dann etwas zu essen?“
Maran ging ein paar Schritte am Ufer das Flusses entlang. Dann blieb er stehen und blickte zurück zum Wald, der bisher seine Heimat gewesen war – oder eher der Wald, in der seine Heimat gelegen hatte … denn nun war das Seetal-Dorf leer und verlassen …
Als er über den Wald zu den Bergen hin blickte, sah er oben über den Gipfeln einen Adler kreisen. Ein Adler hoch oben im Süden – ein Adler im Süden wie in der Schwitzhütte …
„Heißt das, daß der Adler mir Weitsicht und eine gute Orientierung senden wird? … Hoffentlich …“
Dann ging Maran weiter den Pfad am Rauschenden entlang. Hier und da mündeten weitere Pfade von den Viehweiden in den Flußpfad und er wurde nach und nach breiter. Das Dorf lag noch immer weit vor ihm. In der Ferne sah er einmal eine Herde von Rindern und einmal auch eine Gruppe von Pferden.
„Wahrscheinlich sind dort hinten auch Hirten bei den Kühen und Pferden … Die Bauern hier werden ihre Tiere ja kaum alleine lassen.“
Maran sah, daß die Ebene hier am Rand der Berge noch nicht wirklich ganz flach, sondern sanft hügelig war. Weiter vorne hörten diese weiten, flachen Hügel jedoch auf. Maran hatte noch nie eine so große ebene Fläche gesehen – in seiner Heimat war alles stets bergig gewesen – Hänge, Täler, Gipfel …
Allmählich kam er dem Dorf näher und sah, daß das Dorf deutlich größer war als das Seetal-Dorf und auch größer als das Weidental-Dorf. Rings um das Dorf waren auch viel mehr Felder mit Getreide, Rüben, Rote Beete, Möhren, Sellerie, Fenchel und vielem anderen als im Seetal. Vermutlich war hier alles größer …
Um das Dorf lag ein Kreis von Gärten mit Obst und Gemüse und an dem Flußpfad und an einigen anderen Wegen, die er aus der Ferne sehen konnte, standen links und rechts Obstbäume: Äpfel, Birnen, Pflaumen, Kirschen, Mispeln, Ebereschen … Ab und zu standen auch ein paar Haselnußsträucher zwischen den Obstbäumen.
Diese Gärten, Obstbäume und Felder gefielen Maran – das sah doch ganz ähnlich wie im Seetal aus. Die Bauern hier waren wohl doch nicht so sehr viel anders als im Seetal.
Als er zum Dorfrand kam, hörte er mehrere Hunde bellen und ein Bauer trat aus einem der Häuser und blickte Maran mißtrauisch entgegen.
„Verschwinde von hier! Wir brauchen hier keine Rumtreiber und Bettler! Verschwinde! Sonst lassen wir die Hunde los!“
Maran blieb verwirrt stehen. „Ich will nur am Fluß weiterlaufen.“
„Verschwinde! Sofort!“
Da kamen einige Jungen aus dem Dorf und begannen Maran mit Steinen zu bewerfen.
„Ich geh ja schon schon! Hört auf damit!“
Er lief ein Stück zurück und folgte einem Pfad in die Felder hinein.
„Verschwinde! Fort von unseren Feldern!“
Die Jungen liefen ihm hinterher und warfen weiter mit Steinen nach ihm.
Maran rannte den Pfad entlang und schließlich kehrten die Jungen ins Dorf zurück. Er ging in einem weiten Bogen um das Dorf herum und kam schließlich wieder zu dem Flußweg zurück.
Maran war noch immer verwirrt.
„Was ist denn hier los? Warum lassen die mich nicht einfach den Weg weiterlaufen? Ich habe denen doch nichts getan … Und ist das hier nicht üblich, daß man Wanderern weiterhilft? In den Sieben Tälern erhält doch jeder etwas zu essen, der durch das Tal kommt, und bei uns wird auch jedem angeboten, im Haus zu übernachten … Gibt es selbst das nicht hier in der Großen Ebene? Das wird nicht so einfach, hier zu leben …“
Nach dieser Begegnung mit dem Bauern und den Jungen in dem Dorf hatte Maran einiges von dem Schwung verloren, den er am Morgen noch gehabt hatte, und trottete langsam den Weg am Fluß entlang. Nach einer Weile bemerkte er, wie langsam und bedrückt er am Fluß entlanglief.
„Maran! So geht das nicht! So kommst Du nirgendwohin. Die Leute sind seltsam hier und Du weißt nicht, wie die hier leben, aber wenn Du Dich jetzt hängen läßt, geht gar nichts mehr. Du mußt lernen, wie die hier leben und was man hier machen kann und was nicht. Wenn ich die Menschen hier nicht verstehen kann, wird es schwer werden, hier das zu finden, was Asar mir zeigen will.“
Er raffte sich zusammen und ging wieder kraftvoller und aufrechter den Weg am Ufer des Rauschenden entlang. Links und rechts von dem Fluß standen hohe Pappeln und hier und da auch einmal ein paar Weiden oder Erlen. Ab und zu sah er ein paar Wildgänse im Fluß und am Ufer standen immer wieder mal ein paar Kraniche. Einmal sah er auch einen Silberreiher.
Als die Sonne schon halb zur Himmelsmitte emporgestiegen war, hörte er gemächlichen Hufschlag und ein Knarren hinter sich. Er drehte sich um und sah einen Karren voller Heu, der von einem Pferd gezogen wurde. Vorne auf der Bank auf dem Wagen saß ein alter Bauer.
Erwartete der Bauer von ihm, daß er fortlief? Oder sonst etwas tat?
Als der Karren näherkam, trat Maran zu Seite auf das Gras am Wegesrand und wartete, um den Karren vorüber zu lassen.
Der Bauer begann nicht, ihn zu bedrohen, und er fuhr auch nicht einfach wortlos an ihm vorüber.
„Brrr … halt an, Brauner! … Na, Junge – wo willst Du denn hin?“
Anscheinend gab es auch in der Großen Ebene freundliche Menschen …
„Ich will zum Großen Fluß.“
„Na – da wirst Du heute wohl nicht mehr hinkommen. Willst Du mitfahren? Auf der Bank ist noch ein Platz frei.“
„Wirklich? Ja, gerne … aber ich bin noch nie auf solch einem Karren gefahren.“
„Was? Na, dann wird’s aber Zeit. Komm rauf!“
Maran kletterte auf den Karren hinauf, legte seinen Rucksack, seinen Speer, seinen Bogen und seine Pfeile hinter sich aufs Heu und setzte sich auf die Bank neben den alten Bauern. Der Bauer schnalzte mit der Zunge und das Pferd ging gemächlich weiter. Das Pferd war deutlich größer als die Pferde aus den Vier Alten Tälern und als die Pferde der Händler, die ab und zu ins Seetal gekommen waren.
Maran schaute zu dem Bauern neben sich. Er war ein wenig rundlich und sah freundlich und gemütlich aus.
„Na, Junge – was läufst Du so bewaffnet durch die Gegend? Der Krieg ist noch an der Westgrenze – und ich hoffe, daß er auch dort bleiben wird.“
„Bewaffnet? Mein Speer und Pfeil und Bogen?“
„Ja – willst Du zum König und ihm Deine Dienste im Krieg anbieten? Dafür bist Du eigentlich noch ein bißchen zu jung.“
„Nein, nein, ich will nicht in den Krieg. Ich bin nur durch den Wald gewandert und da gibt es Wölfe und Bären – da geht doch niemand ohne Speer hinein.“
„Ach so … ich hatte mich schon gewundert. Du siehst überhaupt nicht wie ein Krieger aus – dafür scheinst Du mir viel zu sanftmütig zu sein. … Sonst hätte ich Dich auch nicht gefragt, ob Du mitkommen willst.“
Maran mußte genau hinhören, wenn der Bauer sprach – er konnte die Sprache verstehen, aber sie klang ziemlich seltsam und manche Wörter erkannte er nicht gleich.
„Wie weit ist es denn noch zum Großen Fluß?“
„Einen guten Tagesmarsch, wenn Du immer am Rauschenden entlang gehst – ich denke, daß Du morgen Mittag dort ankommen wirst. Wir kommen demnächst nach Nußhof – das ist das Dorf, in dem ich wohne. Danach kommt noch Talingen und dann die Seestadt am Großen Fluß. Das vorige Dorf, aus dem Du gerade kommst, heißt Rauschufer.“
Maran prägte sich die drei Namen ein.
Nach einer Weile blickte Maran zu dem Bauern neben sich. „Kann ich Dich etwas fragen?“
„Natürlich – frag nur. Was willst Du denn wissen?“
„In dem vorigen Dorf – in Rauschufer – da hat mich ein Bauer angeschrien und mir mit den Hunden gedroht, wenn ich näher komme, und die Jungen aus dem Dorf sind mir hinterhergelaufen und haben mich mit Steinen beworfen. Warum haben die das getan?“
„Hast Du nicht von dem Krieg gehört? Da haben alle Bauern und Städter Angst vor jedem, der eine Waffe trägt … Vielleicht ist das ja ein Söldner, der sich einfach nimmt, was er haben will? Oder ein Räuber, der auch noch alle tötet, die sich wehren? Der Krieg bringt Unruhe ins Land und da denken alle nur noch an ihre eigene Sicherheit und vergessen die Gastfreundschaft. Und Dich kannten sie nicht in Rauschufer und Du trägst ungewöhnliche Kleidung und bist außerdem bewaffnet … Da hatten sie Angst vor Dir …“
„Angst vor mir? … Das ist wirklich das erste Mal, daß irgendjemand Angst vor mir gehabt hat … Hat hier in der Ebene niemand einen Speer gegen die Wölfe bei sich, wenn er aus dem Dorf geht?“
„Nein … das brauchen wir hier nicht. Hier sind fast nie Wölfe – die bleiben oben in den Bergen. Manchmal kommt mal ein Rudel hier herunter, wenn der Winter besonders streng ist, aber normalerweise braucht man hier keinen Speer mitzunehmen, wenn man aufs Feld geht.“
Sie schwiegen eine Weile und das Pferd zog den Karren langsam über den staubigen Weg am Fluß entlang.
Maran dachte über das nach, was er alles schon gehört hatte.
„Die Obstbäume am Weg in der Nähe des Dorfes …“
„Ja? Was ist mit denen?“
„Die gehören doch zu dem Dorf, oder?“
„Ja.“
„Darf da jeder aus dem Dorf sich Äpfel und Birnen pflücken?“
„Ja – aber in Maßen, daß die anderen auch noch genug bekommen.“
„Und wenn da jemand den Weg entlang wandert – darf der sich auch einen Apfel pflücken?“
„Hm – wenn Du einen Apfel aufhebst, der schon am Boden liegt, wird niemand etwas sagen. Wenn Du einen pflückst, solltest Du Dich besser nicht sehen lassen, denn manche mögen das nicht – denen ist ihr Obstkorb wichtiger als die Gastfreundschaft.“
Der Bauer schüttelte nachdenklich seinen Kopf.
„Das ist früher, als König Gentor der Weise noch gelebt hat, anders gewesen. Der war wirklich ein Landesvater, der sich um alle gekümmert hat. Da war es im Land sicher, die Felder waren alle bestellt und den Handwerkern und den Händlern ging es gut. König Gentor hat auch die Obstbäume an den Straßenrändern pflanzen lassen – manche gab es natürlich auch schon vorher, aber nun sind es sehr viel mehr. König Gentor hat wirklich viel für die kleinen Leute getan – aber sein Sohn … König Galladin der Rasche denkt mehr an sich selber und an seine Macht – er ist nicht für das Land da, sondern das Land soll für ihn da sein. Aber so ist das nun einmal … jeder König ist anders …
Wenn Du so fragst – hast Du Hunger?“
„Ein bißchen …“
Der Bauer griff in einen Korb, den er unter der Bank stehen hatte. „Hier, nimm – ein Stück Brot und eine Ecke Käse. Das wird Dir Kraft geben für Deinen Weg zum Großen Fluß. … Wieso willst Du eigentlich dorthin?“
„Ach, das ist eine lange Geschichte …“
„Na, dann erzähl mal – es ist ja noch ein Stückchen bis nach Nußhof.“
„Ja … eigentlich sind es zwei Gründe. Sklavenjäger haben die Dörfer in den Bergen überfallen und die, die nicht gefangen oder getötet worden sind, sind geflohen.“
„Sklavenjäger? Die sind noch schlimmer als die Söldner! Gut, daß uns der König vor denen schützt!“
„Die kommen nicht zu euch?“
„Nein – denn dann würde der König gegen sie in den Krieg ziehen.“
„Hm – dann ist der König ja doch zu etwas gut …“
Der Bauer lachte.
„Wie kommst Du dazu, so etwas zu sagen, Junge?“
„Naja, ich weiß ja eigentlich nicht viel über den König und darüber, wie ihr hier lebt, aber wegen dem, was ich bisher gehört habe, dachte ich bisher, daß der König alles nur schwieriger macht.“
„Da hast Du ja auch nicht ganz unrecht – wenn der König sich als Beschützer des Volkes sieht und auch so handelt, geht es allen besser als ohne den König … aber wenn der König nur an sich denkt … naja, dann wäre es ohne ihn einfacher …
Aber warum bist Du denn alleine geflohen? Sind alle anderen aus Deinem Dorf tot?“
„Nein – sie leben noch, aber sie sind geflohen. Ich bin nur nicht mit ihnen gegangen, weil … ja, weil ich immer wieder geträumt habe, daß ich in die Große Ebene gehen soll.“
„So, so – Du folgst also einem Traum …“
Der Bauer schaute ihn von der Seite her an und Maran hatte das Gefühl, daß er wußte, daß Maran nicht alles gesagt hatte. Aber sollte er dem Bauern von Asar und von den Orakeln erzählen? Das fühlte sich nicht ganz richtig an …
„Und was willst Du nun am Großen Fluß, Junge?“
„Ich weiß es selber noch nicht so genau …“
„Nun ja – es ist Dein Weg und wenn Du glaubst, daß Du am Großen Fluß das findest, womit es Dir gut geht …“
Maran war die Richtung, die das Gespräch gerade nahm, nicht ganz recht. Deshalb frug er den Bauern nach etwas anderem.
„Kennst Du drei Händler, die Pranto, Darlos und Vantir heißen?“
„Drei Händler? Die mit Pferden unterwegs sind und allerlei Sachen bei sich haben und weit umherziehen?“
„Ja.“
„Die kenne ich – die kommen jeden Sommer hier in die Dörfer. Wenn sie weiter in die Berge hinauf wollen, packen sie alles auf ihre Pferde, aber wenn sie hier in der Ebene bleiben, haben sie Karren dabei, die von ihren Pferden gezogen werden. … Ja – das sind ehrliche Händler, denen man vertrauen kann. Die kennst Du aus Deinem Dorf, nehme ich an?“
„Ja, die kamen manchmal im Sommer auch zu uns … aber jetzt nicht mehr … es gibt kein Dorf mehr …“
Der Bauer nickte bedächtig.
„Sklavenjäger … als wenn das Leben nicht auch ohne sie schon schwer genug wäre …“
Maran aß das Brot und die Ecke Käse, die der Bauer ihm geschenkt hatte. Das Brot schmeckte anders als das Brot, daß er im Seedorf gebacken hatte – ob es hier in der Ebene andere Getreidearten gab als in den Bergen?
„Kannst Du mir etwas über das Reich der Mitte erzählen?“
„Was willst Du denn wissen?“
„Ich weiß eigentlich nur, daß es hier einen König gibt und daß die Hauptstadt am Großen Fluß liegt … Was sollte man denn wissen, wenn man hier wandert?“
„Hm … es ist immer schwer, etwas zu sagen, wenn man die genauen Fragen nicht kennt … Da kann ich Dir nur allgemein etwas erzählen.
Das Wichtigste ist, daß der König gerade im Westen Krieg führt. Die beiden Fürstentümer im Osten an der Küste sind dann auch unruhig – weil der König ja nicht im Westen und im Osten zugleich sein kann.
Aber was solltest Du wissen? Wenn Du aus den Bergen kommst, dann kennst Du vielleicht nicht einmal Münzen?“
„Was ist das?“
„Das sind kleine Stücke aus Gold, Silber oder Kupfer. Damit bezahlen wir.“
„Bezahlen? Etwas zählen?“
Der Bauer lachte gutmütig.
„Ja – zählen und zahlen … Du kannst Brot gegen Äpfel tauschen, Du kannst aber auch Brot gegen Münzen tauschen und dann später Deine Münzen gegen Äpfel tauschen.“
„Dann sind Münzen so etwas wie eine Aufbewahrung für den Anspruch, etwas tauschen zu können?“
„Gut gesagt – ja, so etwas ist das.“
„Hm … also so etwas wie ein Speicher …“
„Ja.“
„Und wo bekommt man diese Münzen?“
„Du bekommst sie, wenn Du etwas arbeitest.“
„Was meinst Du damit?“
„Nun ja, wenn Du einem Bauern bei der Heuernte hilfst oder einem Schmied am Blasebalg oder einem König im Krieg – dann bekommst Du Münzen dafür.“
„Das ist schon komisch hier bei euch – bei uns gab es die Dorfgemeinschaft und alle haben für alle gesorgt. Wozu hätten wir da Münzen brauchen können?“
„Das gibt es bei uns in den Dörfern auch noch ein bißchen – wenn irgendwo Not ist, helfen alle. Und die Häuser, die Wassergräben und die Teiche werden auch gemeinsam gebaut.“
„Das freut mich.“
Der Bauer schaute ihn fragend an.
„Wirklich! Dann ist es hier doch noch ein bißchen so wie bei mir daheim in den Bergen. Es ist nur alles so viel größer hier, daß ihr euch anscheinend noch andere Dinge ausgedacht habt, die es bei uns nicht gibt.“
„Es gibt drei Arten von Münzen, die Du kennen solltest – also drei Arten, die im ganzen Königreich gelten. Daneben gibt es noch andere und die Fürstentümer an der Küste und die im Westen hinter dem Wall haben natürlich andere Münzen – aber die brauchst Du vorerst nicht zu kennen.
Die Goldmünzen sind am wertvollsten. Dann gibt es die Silbermünzen – zwölf Silbermünzen sind so viel wert wie eine Goldmünze. Und zwölf Kupfermünzen entsprechen einer Silbermünze.“
Maran dachte nach. „Dann sind hundertvierundvierzig Kupfermünzen also eine Goldmünze?“
„Ja.“
„Aber was ist denn eine Kupfermünze wert? Ich meine, was kann ich für eine Kupfermünze eintauschen?“
„Für drei Kupfermünzen bekommst Du ein Brot. Für eine Kupfermünze zwei Äpfel.“
„Ich glaube, daran werde ich mich erst mal gewöhnen müssen …“
Maran schwieg eine Weile und dachte über das nach, was er gehört hatte.
„Wenn ihr immer gegen Gold tauscht – führt das dann nicht dazu, daß alle gierig nach Gold werden?“
Der Bauer schaute Maran überrascht an. „Das hast Du aber schnell erkannt, mein Junge!“
„Und geht dann nicht die Gemeinschaft ein bißchen verloren – ich meine, dieses Gefühl, eine große Familie zu sein, in der alle nach allen anderen schauen und in der man dafür zu sorgen versucht, daß es allen gut geht?“
„Hm … da kannst Du schon recht haben, Junge. So genau weiß ich das nicht, da ich nicht weiß, wie das bei euch im Tal gewesen ist.“
„Na ja, wenn ich Brennholz aus dem Wald geholt habe, dann habe ich auch immer welches für die alten Leute im Dorf und für die Schwangeren geholt.“
„Ja, doch, das gibt es auch hier noch ein bißchen – aber das ist bei uns nicht mehr das ganze Dorf, sondern nur noch die Familie, die füreinander sorgt … oder vielleicht noch die Sippe.“
Sie schwiegen wieder eine ganze Weile und Maran schaute umher. Überall waren Felder – vor allem mit Getreide. Hier und da waren kleine Wälder und er sah in der Ferne viel mehr Dörfer als sich jemals hatte vorstellen können.
„Als was willst Du denn als Tagelöhner arbeiten, mein Junge?“
„Was ist ein Tagelöhner?“
„Ah ja – das kennst Du natürlich auch noch nicht. Du schaust, wer für einen Tag Hilfe braucht und Du gehst mit ihm und erhältst dafür ein paar Münzen. Wieviel Du erhältst, hängt davon ab, was zu tun ist, wie gut Du bist und wie großzügig der ist, der einen Helfer sucht.“
„Ich weiß nicht – ich habe noch nicht darüber nachgedacht, was ich da machen könnte. Ich könnte vielleicht auch in der Stadt Flöte spielen.“
„Flöte spielen? Nun ja … wenn Du gut bist, geht das vielleicht – aber nicht in den Dörfern, sondern nur in den Städten.
Wir sind auch gleich in Nußhof. Danach mußt Du zu Fuß weitergehen.“
Als sie in das Dorf kamen, schauten einige Frauen, die auf dem Dorfplatz standen, neugierig auf Maran, der neben dem Bauern vorne auf dem Karren saß.
„Hier – da drüben – das ist mein Hof.“
Der Mann hielt vor dem Bauernhaus an und sie stiegen beide von dem Karren herab. Der Alte reichte Maran die Hand.
„Alles Gute auf Deiner Wanderung, mein Junge. Ich hoffe, Du findest das, was Du suchst.“
„Danke. Ich helfe Dir noch, das Heu vom Karren zu holen.“
„Ja? Das nehme ich gerne an. Das muß da vorne in die Scheune.“
Der alte Bauer öffnete das Scheunentor und sie trugen gemeinsam das Heu hinein. Als sie schließlich fertig waren, waren sie beide am Schwitzen.
Maran setzte seinen Rucksack auf, schulterte Bogen und Köcher und nahm seinen Speer in die Hand.
„Danke, daß Du mich mitgenommen hast!“
„Solche Gesellschaft habe ich doch gerne! Warte – hier ist noch etwas für Dich.“
Er reichte ihm drei Kupfermünzen.
„Die wirst Du brauchen können, wenn Du hungrig wirst.“
Maran schaute den alten Bauern erstaunt an.
„Warum gibst Du mir die?“
„Nun, Du hast mir mit dem Heu geholfen.“
Maran schaute zwischen dem Bauern und den Münzen in seiner Hand hin und her.
„Ich habe Dir nicht wegen der Münzen geholfen – man hilft doch einander, wenn man sieht, daß der andere Hilfe gebrauchen kann.“
Der Bauer legte seine Hand auf Marans Arm.
„Mein Junge – Du hast ein gutes Herz, aber Du solltest wachsam sein, wenn Du hier in der Ebene wanderst. Hier ist nicht Dein Dorf – und hier sorgt jeder vor allem für sich selber.“
„Aber Du hast doch auch nach mir geschaut.“
„Das habe ich wohl gerade etwas zu hart gesagt – hier schauen die Menschen mehr nach sich selber und weniger nach den anderen als das bei Dir in Deinem Dorf gewesen ist. Hier, nimm die Münzen – Du wirst sie brauchen können. Nimm sie als Geschenk, wenn Dir das noch zu ungewohnt ist.“
Maran nickte und nahm die Münzen.
„Danke. … Mögest Du immer gesund und bei Kräften bleiben!“
Der Bauer schaute Maran überrascht an – so einen Gruß war er offenbar nicht gewohnt. Dann lächelte er.
„Und mögen Deine Füße nie ermüden und Dich sicher zu Deinem Ziel tragen!“
„Danke.“
Dann ging Maran über den Dorfplatz. Am Rand des Dorfes schaute er sich zwischen den Häusern noch einmal zu dem Bauern um, der noch immer an seinem Haus stand und ihm nachblickte. Maran winkte ihm noch einmal zu und ging weiter zum Fluß hinüber. Dort folgte er dem Weg, der an dem Rauschenden entlang führte.
Zwischen dem Weg und dem Ufer wuchs Schilf und während er nordwärts wanderte, hörte er viele Wasservögel, die in dem Schilf nisteten. Oben über ihm schrie ein Mäusebussard in der Luft. Maran schaute zu ihm empor und antwortete ihm, doch der Mäusebussard kümmerte sich nicht um Marans Ruf.
Es war sehr warm und das Summen der Bienen und Hummeln, die zu den vielen Blüten am Wegrand flogen, machte ihn nach einer Weile ein wenig schläfrig, doch er legte sich nicht ins hohe Gras am Wegrand, sondern ging immer wieder mal zum Flußufer hinunter und wusch sich sein Gesicht mit dem kalten Wasser, um wieder etwas munterer zu werden. Einmal sah er in dem Fluß einen Karpfen und an einer anderen Stelle einen dicken Flußkrebs.
Während er auf dem Weg dahinlief, ging Maran innerlich in seine Hütte der Erinnerungen und zeichnete seine Landkarte weiter und markierte die drei Dörfer Rauschufer, Nußhof und Talingen. Die Seestadt, die er morgen erreichen wollte, trug er noch nicht ein, da er ihre Lage noch nicht genau kannte.
Nach einer Weile fiel Maran auf, daß auch der alte Bauer den Fluß 'Rauschender' genannt hatte. Warum eigentlich? Der Fluß floß hier doch vollkommen still durch die Ebene – er rauschte doch bloß oben in den Waldbergen … Hieß das, daß die Menschen aus der Ebene und aus den Bergen früher einmal mehr miteinander zu tun gehabt hatten? Eigentlich konnte das ja kaum anders sein …
Maran wanderte an dem Fluß entlang. Nachdem er das Dorf Nußhof verlassen hatte, war er erst durch die Gärten rings um das Dorf gekommen und dann durch die Gemüsefelder. Darauf folgten die Getreidefelder und schließlich die Weiden für die Rinder, Pferde und Schafe. Mittlerweile sahen die Viehweiden verwildert und teilweise auch ganz ungenutzt aus. Nach und nach gingen sie in einen Wald über, der jedoch nicht sehr groß war.
Als Maran wieder aus dem Wald heraus kam, näherte sich die Sonne schon allmählich dem Horizont im Westen. Irgendwo dort hinten lag die Hauptstadt und hinter ihr der Wall, durch den der Große Fluß in die Ebene kam. Und hinter diesem Wall lebten die Sklavenjäger, die seine Eltern gefangen oder getötet hatten.
„Ob ich Brad und Linnan wohl jemals wiedersehen werde? Wo mögen sie jetzt wohl sein? Und selbst wenn sie noch leben und wenn ich sie finden sollte – wie könnte ich sie dann befreien?“
Maran spürte, wie ihm diese Gedanken und Gefühle seine Kraft raubten und ihn in eine graue Hoffnungslosigkeit einzuhüllen begann.
Er schüttelte sich und stampfte einmal kräftig auf, um diesen grauen Schleier wieder loszuwerden.
„Ich werde leben! Und ich werde sie irgendwann wiederfinden! Und ich werde gut leben! Ho!“
Maran schaute sich nach einem Platz um, an dem er schlafen konnte. Er ging von dem Weg am Fluß fort und hinüber zu einer Gruppe von Birken und Ebereschen, die auf einer verwilderten Viehweide standen. Dort legte er seinen Rucksack auf die Erde, legte seinen Bogen, seinen Köcher und seinen Speer daneben und setzte sich hin. Er aß ein Stück von seinem Brot, das allmählich zur Neige ging – seinen Käse hatte er schon aufgegessen.
Als er so dasaß und die Sonne untergehen sah, fühlte er sich einsam und mutlos und von der ganzen Welt bedroht. Vielleicht sah er alle seine Verwandten und Freunde aus dem Seetal-Dorf nie wieder … Und wovon sollte er hier in der Großen Ebene leben? … Und wenn heute Nacht Räuber oder Sklavenjäger kamen und ihn mitnahmen oder töteten? …
Nach einer Weile stand Maran auf und schüttelte sich. „So geht das nicht weiter, Maran! Wenn Du das so weitermachst, rufst Du alles Unheil zu Dir! … Hm – was kann ich denn tun? Ich brauche Schutz, Sicherheit und Vertrauen … Wie kann ich das machen? … Dieser Platz hier zwischen den Birken soll heute Nacht meine Heimat sein … hm … Wie kann ich das machen? …“
Auf einmal kam ihm plötzlich ein Bild und er stand auf und ging drei Schritte von seinem Schlafplatz fort und öffnete seine Hose. Dann pinkelte er einen Kreis rings um seinen Schlafplatz im Abstand von drei Schritten.
Maran stellte sich in die Mitte dieses Schutzkreises und spürte nach, wie sich sein Schlafplatz verändert hatte. … Es war jetzt ganz sein Platz – das war deutlich. Der Ort war geschützt. Aber so ganz zufrieden war Maran noch nicht.
Da setzte er sich in der Mitte des Kreises mit seinen Schienbeinen auf der Erde und mit seinem Hintern auf seine Fersen hin und rief das Bild und die Kraft der Schwitzhütte an diesen Ort: die zwölf Stäbe, die im Kreis standen … die vier Tiere … Großmutter Erde und Großvater Himmel … Wadan-Wer … und am Schluß Asar …
„Ja, jetzt ist es gut – so kann ich hier schlafen.“
Maran saß noch eine Weile reglos da und spürte in diese Ebene hinein, in die Erde, in die Bäume, in die Dörfer … in den Wind, in den Fluß … Es war alles noch sehr fremd für ihn, aber nach und nach bekam er ein wenig Gespür für dieses Land, in dem er nun wanderte …
Schließlich legte er sich hin und schlief schon bald ein.
Am Morgen erwachte er vom Gesang der Vögel. Er öffnete die Augen und sah über sich eine Amsel auf den Zweigen einer Birke – sie war von allen Vögel am lautesten.
Er setzte sich auf und aß seinen Rest Brot. Den Apfel, den er noch hatte, hob er sich für später auf. Er löste das Bild des Schutzkreises und der Schwitzhütte, das er am Vorabend erschaffen hatte, wieder auf, schulterte seinen Rucksack, seinen Bogen und den Köcher und nahm seinen Speer wieder als Wanderstab in die Hand.
Maran ging zurück zum Fluß und lief dann an ihm auf dem Weg entlang weiter flußabwärts nach Norden hin, wo er noch heute hoffentlich den Rhiannon, den Großen Fluß erreichen würde.
Als die Sonne schon halbhoch am Himmel stand, sah Maran ein drittes Dorf vor sich am Ufer des Flusses – das mußte Talingen sein, von dem der alte Bauer gesprochen hatte.
Als Maran näher kam, sah er, daß dort eine hölzerne Brücke über den Fluß führte. Er betrachtete sie – so eine Brücke hatte er noch nicht gesehen: Sie war auf Pfosten errichtet worden, die im Flußbett standen, sie war breiter als der Karren des Bauern, der ihn heute morgen mitgenommen hatte, sie hatte an beiden Seiten ein Geländer und sie sah aus, aus ob sie auch unter einer großen Last nicht zusammenbrechen würde.
Was die Menschen in der Großen Ebene wohl sonst noch alles erbaut haben mochten? Aus Holz und vielleicht sogar aus Stein?
Maran blickte auf das Dorf, das gut hundert Schritte vor ihm lag. Es war noch etwas größer als die beiden vorigen Dörfer, die er gesehen hatte – die auch schon deutlich größer waren als die Dörfer im Seetal, im Wildwassertal und im Weidental.
Was konnte er tun, damit er hier nicht auch gleich wieder vertrieben wurde? Sollte er gleich in einem großen Bogen rings um das Dorf gehen? Aber er konnte ja auch nicht immer alle Dörfer vermeiden …
Er schaute sich um und sah einen kleinen Bach, der von links her zum Rauschenden floß. An der Stelle, an der der Bach am nächsten zum Dorf entlangfloß, holte eine Frau mit zwei Krügen Wasser aus dem Bach.
Maran ging auch zu dieser Stelle und trank dort etwas Wasser aus dem Bach. Er legte seinen Rucksack ab und setzte sich auf einen Baumstamm in der Nähe des Baches. Er holte seine Geierflügelknochen-Flöte aus einem Rucksack und begann zu spielen – erst eines der Lieder des Sommersonnenwenden-Festes: „Die beiden Finken“. Danach spielte er „Das neckende Mädchen“. Doch dann spürte er in den Bach hinein, der vor ihm entlangfloß und begann das Lied dieses Baches zu spielen – sein langsames Fließen, seine Windungen durch die Große Ebene, den Geschmack von dunkler Erde, das Gras und das Schilf an seinem Ufer, das satte Gelb der Sumpfdotterblumen, das Dahinschnellen der kleinen Fische in ihm, das langsame Staksen des Flußkrebses …
Nach einer Weile kamen ein paar Kinder um zu schauen, wer da auf der Flöte spielte. Sie setzten sich in einiger Entfernung von ihm an den Bach und hörten ihm zu – zwei kleine Mädchen nahmen sich an den Händen und tanzen zu seinem Bach-Lied.
Eine Weile später kamen ein paar Alte aus dem Dorf und stellten sich zu den Kindern und hörten Maran zu.
Dann kamen auch einige Frauen und Männer in mittlerem Alter. Die meisten von ihnen gingen nach kurzer Zeit wieder fort, doch eine junge Frau und ein Mann, der die Hand der Frau nicht losließ, blieben am Bach stehen. Maran lächelte der Frau während seines Flötenspiels zu, was dem Mann gar nicht zu gefallen schien, denn er runzelte seine Stirn und zog die Frau mit sich fort.
Da trat eine der alten Frau über den Bach und kam zu Maran herüber. „Junger Mann – es ist gefährlich, Niran zuzulächeln, denn Skan ist sehr eifersüchtig. Ich würde mich nicht wundern, wenn er gleich zurückkommt. Vielleicht gehst Du lieber schnell weiter, bevor es Ärger gibt.“
Maran hörte auf zu spielen und schaute die alte Frau verwundert an. „Ich habe doch nur gelächelt, weil sie so freundlich war und so hübsch – ich habe doch niemanden beleidigt …“
„Du scheinst nicht von hier zu sein, junger Mann, sonst wüßtest Du, daß Lächeln manchmal auch zu fließendem Blut führen kann. Geh jetzt lieber – schnell!“
Doch da kam der Mann, den die Alte 'Skan' genannt hatte, schon wieder zum Bach und schaute Maran grimmig an.
Doch bevor er noch etwas sagen oder bevor Maran seinen Rucksack wieder aufsetzen konnte, kam vom Dorf her ein sehr stämmiger Bauer gerannt und brüllte: „Haltet den Dieb! Haltet den Dieb! Er hat mein Gold gestohlen! Haltet ihn!“
Skan sprang über den Bach und packte Marans Arme und drehte sie ihm auf den Rücken.
„Hab ich Dich! Ich wußte doch gleich, daß Du ein Räuber und Verführer bist! Jetzt wirst Du sehen, was solche wie Du hier bei uns ernten!“
Er wandte sich zu dem stämmigen Bauern.
„Hol Deine Peitsche, Kedan!“
Maran versuchte Skan abzuschütteln, aber Skan war viel stärker als er.
Maran wandte sich an die alte Frau.
„Ich habe nichts gestohlen, ich bin doch gerade erst zu dem Dorf gekommen! Durchsucht doch meinen Rucksack – da sind keine Münzen drin – nur drei Kupferstücke!“
Doch Skan war das egal.
„Dann hast Du es irgendwo versteckt und holst es Dir nachher – ich kenne solche wie Dich!“
„Aber ihr könnt doch niemanden peitschen ohne zu wissen, daß er schuldig ist!“
„Wir wissen es – gibt doch Deine Tat zu, dann bekommst Du vielleicht zwei Hiebe weniger!“
Maran wußte nicht, was er tun sollte – er hatte nicht gewußt, daß hier in der Ebene die Richtigkeit so wenig geachtet wurde und daß sie hier dachten, daß sie mit dem Zufügen von Schmerzen irgendetwas besser als zuvor machen konnten.
Da sah er den stämmigen Bauern mit einer Peitsche in seiner Hand zurückkommen.
Maran suchte verängstigt nach einem Ausweg. Da sah er auf einmal innerlich Asar vor sich. Er sprach zu Maran nur das Wort „schaue“.
Der stämmige Bauer kam näher und ließ sich Zeit, da er offensichtlich den Anblick von Marans Angst genoß.
Maran dachte verzweifelt nach.
„Was soll ich denn schauen? Einen Ausweg? Eine Bitte? … Nein – ich soll schauen, wo die Münzen des Bauern liegen.“
Maran schloß die Augen und versuchte ruhig zu werden. Wo lagen die Münzen des Bauern? Maran sah eine Kammer vor sich, in der auf dem Boden eine Stofftasche lag. In der Kammer lagen Äpfel, Käse, Brote und ähnliches.
Maran öffnete seine Augen – der Bauer holte gerade zum Schlag aus.
„Halt! Halt! Ich sage Dir, wo Deine Münzen liegen.“
„Ha! Du gibst also zu, daß Du der Dieb bist?!“
„Nein! Nein, ich bin kein Dieb! Aber ich habe gesehen, wo Deine Münzen sind! Sie sind einer Tasche, nicht wahr?“
„Woher weißt Du von der Tasche?! Das kann nur der Dieb wissen!“
„Nein! So warte doch! Du hast sie verloren – sie liegt auf dem Boden in einer kleinen Kammer, in der Äpfel, Käse und Brot liegen. Schau dort nach! Dort liegt Deine Münzentasche!“
Der Bauer holte wieder zum Schlag aus.
„Du willst Dir nur Zeit verschaffen, um eine Gelegenheit zur Flucht zu finden. Nichts da, Bürschchen! Du sollst jetzt meine Peitsche schmecken.“
Doch da hielt die alte Frau den Arm des Bauern fest.
„Sieh nach, ob Dein Gold in Deiner Kammer liegt, Kedan! Werde nicht versehentlich ungerecht, weil Du es mit der Gerechtigkeit so eilig hast. Und es hat niemand gesehen, daß dieser Jüngling Dein Gold gestohlen hat.“
„Das ist mir egal. Er ist ein Fremder – da können ihm ein paar Peitschenhiebe nicht schaden!“
Doch da kamen noch ein paar weitere von den Alten aus dem Dorf herbei und stellten sich zwischen Maran und Kedan.
„Sieh erst einmal in Deiner Kammer nach, Kedan. Wir sorgen dafür, daß er nicht flieht.“
Kedan murrte, aber ging dann ins Dorf zurück. Es blieb lange fort und Maran versuchte sich nicht vorzustellen, was passieren würde, wenn es gar nicht stimmte, daß der Bauer sein Gold in seiner Kammer verloren hatte.
Schließlich kam der Bauer wieder zurück und er hielt statt seiner Peitsche eine kleine Stofftasche in seiner Hand. Er sah ein bißchen betreten aus.
Als er am Bach angekommen war, schaute er umher.
„Na gut – ich war zu eilig, Die Tasche lag wirklich in meiner Vorratskammer …“
Da ließ Skan Maran los.
Kedan wandte sich an Maran und schaute ein wenig mißtrauisch.
„Aber woher wußtest Du, daß sie da lag?“
„Ich weiß es nicht. Mein Urgroßmutter konnte alles Verlorene finden – sie wußte immer, wo es liegt. Vielleicht habe ich das ja ein bißchen von ihr geerbt. Das war das erste Mal, daß ich etwas Verlorenes auf diese Weise wiedergefunden habe.“
Die alte Frau, die für Maran gesprochen hatte, betrachtete Maran nachdenklich.
„Junger Mann, Du scheinst ja nützliche Fähigkeiten zu haben. Hast Du noch mehr davon?“
Maran blickte sie ratlos an. Was wollte sie von ihm?
„Ich hätte da noch etwas für Dich. Es wäre gut für uns, wenn Du bei einer Sache eine Lösung wüßtest. Mein Sohn, der hier neben mir steht, hat ein Mangold-Feld. Kedan, der da vor Dir steht, hat eine Schafherde. Nun haben die Schafe vorgestern den Mangold meines Sohnes aufgefressen. Mein Sohn verlangt von Kedan die Schafe als Ausgleich, aber Kedan findet, daß mein Sohn besser auf seine Felder aufpassen soll. Jetzt streiten sie sich schon zwei Tage lang und beide sind arge Hitzköpfe. Wie kann da der Dorffrieden wiederhergestellt werden?“
Maran dachte eine Weile nach.
„Kedans Schafe haben den Mangold gefressen und Dein Sohn verlangt nun die Schafe als Ausgleich?“
„Ja.“
„Das scheint mir nicht angemessen, aber es sollte einen Ausgleich für den Schaden geben.“
„Und was wäre dieser Ausgleich?“
„Dein Sohn hat verloren, was auf seinem Feld gewachsen ist, nicht wahr?“
„Ja.“
„Und sein Mangold wird wieder wachsen?“
„Ja.“
„Nun, dann sollte Kedan Deinem Sohn das geben, was auf seinen Schafen wächst – die Wolle, aber nicht die Schafe, denn auch die Wolle wird wieder nachwachsen. So entspricht der Ausgleich dem Schaden.“
Alle schwiegen eine Weile.
Dann nickte der Sohn der alten Frau.
„Das klingt passend – wenn Du, Kedan, mir die Wolle der Schafe gibst, die meinen Mangold gefressen haben, dann soll unser Streit vergessen sein.“
Kedan zögerte ein wenig, doch dann reichte er dem Sohn der Alten die Hand.
„Gut, ich gebe Dir die Wolle, und dann soll der Streit vergessen sein.“
Die Alte blickte Maran an.
„Danke, junger Mann, da hast Du ja schnell eine Lösung gefunden. Ich möchte Dir etwas zum Dank für Deine Hilfe geben. Was kannst Du denn brauchen?“
„Ein Brot?“
„Ja, gerne.“
„Ich möchte noch etwas zu dem Streit sagen.“
„Was denn?“
„Vielleicht wäre es gut, wenn Dein Sohn und Kedan gemeinsam dafür sorgen würden, daß die Schafe auf der Weide bleiben …“
Die Alte blickte nachdenklich auf ihren Sohn und auf Kedan.
„Ja, das wäre gut … vielleicht schaffen die beiden Hitzköpfe das ja irgendwann mal … Es ist immer besser, Schaden zu vermeiden als ihn hinterher irgendwie wieder auszugleichen – an dem Verlust ändert das ja nichts … Unser Dorf hat ja auch nun nach der Einigung den Mangold, den die Schafe gefressen haben, nicht zurückbekommen. Der Schaden bleibt – er ist nur besser verteilt worden … Aber jetzt hole ich Dir mal Dein Brot.“
Die Alte ging ins Dorf und auch die meisten anderen kehrten zu dem, was sie vorher getan hatten, zurück.
Nach kurzer Zeit kehrte die Alte mit einem Brot zurück und reichte es Maran.
„Danke!“
„Bitte, junger Mann! Du hast uns geholfen, den Dorffrieden wiederherzustellen, und Du hast es geschafft, daß wir keine Ungerechtigkeit begangen haben. Da hättest Du eigentlich mehr verdient als nur ein Brot. … Wo willst Du denn hin? Oder bist Du ein Flöter, der umherzieht und von den Geschenken für sein Flötenspiel lebt?“
„Ich will erst einmal zum Großen Fluß. Und wovon ich leben will? Ich weiß es noch nicht so recht …“
„Der Weg zum Großen Fluß führt durch das Dorf und dann immer am Rauschenden entlang.“
Sie gingen nebeneinander ins Dorf zum Dorfplatz. Dort wuchsen in der Mitte drei alte Eichen, zwischen denen die Statue einer Frau stand.
„Wer ist diese Frau?“
„Das ist Mara, die Mutter, die Göttin.“
Maran schaute die Frauenstatue an.
„Sie ist freundlich … und sie gibt uns die Fülle … und sie ist stark … Bei uns nennen wir sie 'Ma', also einfach 'Mutter'.“
„Ja, es wäre seltsam, wenn es irgendwo ein Volk gäbe, für das die Muttergöttin nicht die Wichtigste wäre.“
„Ja, das denke ich auch …“
Die Alte reichte Maran ihre Hand.
„Ich wünsche Dir alles Gute, junger Mann! Und mögest Du finden, was Du suchst!“
„Möge Dir Mara noch viele Jahre in Gesundheit schenken!“
Maran ging über den Dorfplatz und durch die Häuser an seinem Rand hindurch zum Fluß und folgte dann dem Weg in Richtung Seestadt.
Maran gingen viele Gedanken durch den Sinn. Wieso hatte er auf einmal sehen können, wo die Goldtasche des Bauern lag? Hatte er das wirklich von seiner Urgroßmutter Ura geerbt? Oder hatte ihm da Asar geholfen?
Maran dachte auch über Diebstahl nach.
„Eigentlich gibt es Diebstahl ja nur, weil sie hier nicht als Gemeinschaft leben … im Seetal würde man einfach nach dem fragen, was man braucht und die anderen würden helfen … Dieses 'mein' und 'dein' ist wohl nicht das Weiseste, was die Menschen hier in der Großen Ebene erdacht haben …
Was machen sie hier nur mit jemandem, der hungert und sich deshalb einen Apfel pflückt? Gilt der schon als Dieb, den man bestrafen muß? Oder sieht man hier wenigstens ein, daß jemand, der am Verhungern ist, einfach essen muß?
Das hätte ich die alte Frau fragen sollen … die hätte die Antwort gewußt … Was tut man hier mit Dieben? Einfach nur bestrafen? Das Gestohlene zurückgeben und den Schaden ausgleichen … das scheint es auch hier zu geben.
Aber versucht man hier auch, dem Dieb die Folgen seines Handelns zu verdeutlichen, damit er zur Einsicht kommt?
Wenn ich das so recht bedenke, scheint mir, daß sie hier glauben, daß man die Vermeidung von Unrichtigkeit besser durch die Angst vor den Folgen als durch die Einsicht in die Folgen erreichen kann. Sie bestrafen das Unrichtige – aber machen sie auch allen deutlich, was durch die Richtigkeit an Gutem entstehen kann?
Das fühlt sich hier alles so hart an, wie sie das hier in der Ebene machen … Es wird von außen her aufgedrückt – es kann nicht von innen her wachsen. Das Handeln wird von Angst vor Strafe geprägt und nicht durch die Einsicht in die guten Früchte des richtigen Handelns …
Kann man hier dann überhaupt noch derjenige werden, der man eigentlich ist? Eigentlich sollte sich doch die Eichel durch freundliches Gießen ungehindert zur Eiche entfalten können – aber hier wird durch Strafen der Wuchs der Eiche festgelegt … Mir ist das zu eng!
Hm … und wenn ich das mit dem Diebstahl weiterdenke? Ist hier der Diebstahl zum Überleben erlaubt? Das weiß ich nicht – vermutlich wird auch das bestraft, wenn die hier so sehr auf das 'mein' und auf das 'dein' achten … und alle Abweichung bestrafen … und alles mit ihren Münzen messen … Da schauen dann alle auf die Münzen statt auf die Menschen … Na ja – vielleicht sehe ich das auch zu schwarz – ich bin ja erst eineinhalb Tage hier in der Ebene …
Wie sehe ich das denn? … Wenn hier wirklich alles irgendeinem Einzelnen gehört, dann wird jeder Diebstahl bestraft. Wenn sie noch ein bißchen auch die Menschen sehen, werden sie den Diebstahl zum Überleben nicht bestrafen, sondern nur den Diebstahl von größeren Mengen an Brot oder Äpfeln …
Aber haben die Händler mir nicht erzählt, daß der König Kriege führt, um sein Reich zu vergrößern? Das ist doch auch Diebstahl! Sogar ein sehr großer Diebstahl! Und der ist dann erlaubt? Und wird vielleicht sogar als gut angesehen?
Dann gilt das Diebstahl-Verbot also nur innerhalb des Königreiches – aber zwischen zwei Königreichen hat der Stärkere Recht und erhält alles …“
Maran blieb stehen, als ihm diese Gedanken kamen und er schüttelte den Kopf.
„Nein – ich weiß einfach noch viel zu wenig über die Weise, wie die Menschen hier leben. Es kann doch nicht sein, daß sie hier so unsinnige Sachen tun, wo man doch sofort merkt, daß da was nicht stimmt …“
Maran dachte noch eine Weile nach, aber ging dann schließlich weiter.
„Es bringt nichts, darüber nachzudenken, wenn ich noch so wenig erlebt habe. Erst mal schauen, dann denken …“
Er lief weiter am Fluß entlang und betrachtete all das, was er bisher in der Großen Ebene erlebt hatte.
„Vielleicht sollte ich vorsichtiger sein … aber was kann ich tun? … Hm … Die Dörfer meiden? … Das geht nicht wirklich – ich brauche ja manchmal ein Brot und will vielleicht auch mal nach dem besten Weg fragen … Mich so kleiden wie die Menschen hier? … Geht auch nicht – ich habe nicht solche Kleidung … Meine Waffen verbergen ist auch nicht möglich … Aber ich kann immerhin mein Messer verstecken … Viel ist das nicht, aber immerhin ein bißchen …“
Er öffnete seinen Gürtel, löste die Messertasche vom Gürtel und band sie so an seinen Gürtel, daß sie in der Hose hing und man sie nicht sofort sehen konnte.
Dann wanderte er weiter an dem Fluß entlang und sah gegen Mittag in der Ferne eine Reihe von hohen Pappeln, die sich vom Westen auf der linken Seite nach dem Osten auf der rechten Seite hin erstreckte. War dort der Große Fluß? Und die Seestadt?
Als er nach und nach näher kam, sah er vor sich viele Häuser bei den hohen Pappeln – das mußte an der Mündung des Rauschenden in den Großen Fluß sein. Er konnte auch eine breite Straße erkennen, die vor den Pappeln entlang führte. Über dieser Straße lag eine feine Staubwolke – dort mußten viele Menschen entlanggehen oder auch Karren fahren und Pferde laufen …
Was mochte ihn dort am Großen Fluß in der Seestadt erwarten? War das der Ort, zu dem ihn Asar gesandt hatte?
- Kapitel 2 -
Die Seestadt
Kurz vor der Stadt führte eine steinerne Brücke über den Rauschenden. Maran blieb staunend stehen und betrachtete diese Brücke – bisher hatte er nur steinerne Fundamente von Häusern und von den Tempeln auf dem Bauchberg gesehen, aber nicht solche Steinbauten. Er lief zu der Brücke und ging auf ihr bis zur Mitte. Er blickte über die Steinmauer an der Seite der Brücke über die Brüstung in das Wasser hinab und dann den Fluß hinauf.
Als er zu der anderen Seite der Brücke ging und flußabwärts schaute, sah er, daß der Rauschende in einen See mündete. Links von der Mündung des Flusses lag die Seestadt. Nach rechts hin erstreckte sich der See weit nach Osten – dort lag eine große Insel mitten in dem See. Ob der See sich auch nach Westen hin noch weiter erstreckte, konnte Maran nicht genau erkennen, weil dort die Seestadt vor ihm lag, aber da der er kein westliches Seeufer sehen konnte, ging der See dort wohl noch weiter.
Maran stand dort und staunte – das war das größte Gewässer, das er bisher gesehen hatte. Der See war noch deutlich größer als der See des Rauschenden in den Waldbergen. Ein kleines Stück flußabwärts war auf der Stadtseite eine Anlegestelle für Boote – manche dieser Boote schienen Maran wirklich riesig zu sein. Ob sein Großvater-Bruder Adlon einst hier einen der Boots-Besitzer gefragt hat, ob er auf seinem Schiff mitfahren und arbeiten kann?
Er begann die Stadt genauer zu betrachten. Ganz hinten im Winkel von Fluß und See war ein Teil der Stadt durch eine hohe und anscheinend auch dicke Mauer von der übrigen Stadt abgetrennt. Dort waren einige hohe und prächtige Gebäude aus Stein. Darum herum lag ein viel größerer Teil der Stadt, in der kleinere und meist hölzerne Häuser standen. Auch dieser Teil der Stadt war von einer Mauer eingefaßt, die jedoch nicht so hoch wie die andere Mauer war. Rings um diesen äußeren Teil der Stadt standen noch einmal viele kleine Häuser, die oftmals eher Hütten waren.
In dieser Stadt mußten mindestens vier-Dutzend-mal so viele Menschen wohnen wie im Seetal-Dorf! Wie sollte man sich dort nur zurechtfinden?
Als Maran die Seestadt betrachtete, wurde ihm deutlich, daß die Menschen hier unmöglich alle einander kennen konnten. Er schaute sich nachdenklich das Gewimmel der Menschen an, die er am Stadt-Ufer des Flusses sehen konnte.
„Kein Wunder, daß die Menschen hier das Gefühl der Dorffamilie verloren haben … so viele Menschen, wie hier zusammenleben … Sie leben zusammen und müssen sich trotzdem gegenseitig fremd sein … Wie kann man nur so leben? … Dafür haben sie wohl all diese seltsamen Dinge wie den König und die Münzen erfunden … weil sie dachten, daß es damit einfacher werden würde …“
Nachdem Maran da eine ganze Weile auf der Brücke gestanden hatte, schaute er nach rechts auf das andere Ufer hinüber. Dort führte ein Weg schräg zum Ufer des Sees hinüber und dann an ihm entlang weiter. Das mußte der Weg sein, der erst an dem See und dann an dem Großen Fluß entlang führte bis er schließlich zum Meer kam.
Als Maran den Weg betrachtete und schaute, bis wo er ihn in der Ferne erkennen konnte, überkam ihn ein seltsames Gefühl, das er erst nicht so recht begreifen konnte. Dann erkannte er, daß das die Sehnsucht war, diesem Fluß bis zu seiner Mündung ins Meer zu folgen. War das dieses Fernweh, von dem sein Großvater-Bruder Adlon manchmal erzählt hatte? Dieses Fernweh, das für Adlon so fest mit den Schreien der Möwen verbunden war?
Schließlich schaute Maran wieder zu der Stadt hinüber. Nun war er hier am Großen Fluß – aber was wollte er hier? Asar hatte ihn hierher gesandt … und nun?
Maran stand eine ganze Weile ratlos da. Dann schüttelte er sich ein bißchen und ging entschlossen zum Ufer zurück und folgte dem Weg zu der Stadt. Auf der Straße fuhren Bauern mit Karren voller Holz oder mit Säcken voll Getreide. Maran sah auch einige Reiter mit glänzenden Rüstungen und langen Schwertern. Zwischen ihnen trieb ein Junge ein Schwein zu der Stadt. Er sah auch viele Menschen, die sehr arm aussahen. Andere fuhren in vierrädrigen Karren, vor die zwei Pferde gespannt waren – diese Männer sahen sehr reich aus und waren meistens auch recht beleibt.
Maran ging die Straße entlang und schaute sich die Hütten und die kleinen Häuser links und rechts an. Ihm wurde erst so nach und nach wirklich deutlich, wieviele Menschen hier in dieser Stadt lebten.
Schließlich kam er an die äußere Stadtmauer. Die Straße führte durch ein Tor in die Stadt hinein. Auf beiden Seiten des Tores standen Wächter, die jedoch ärmlich gekleidet aussahen und nicht solche glänzenden Rüstungen wie die Reiter trugen, die Maran schon gesehen hatte.
Ein paar Schritte vor dem Tor saß am Straßenrand ein älterer, bärtiger Mann, der nur noch ein Bein hatte. Wieso hatte der Mann ein Bein verloren? Bei einem Unfall? Oder im Krieg?
Als Maran näherkam, streckte der Alte seine Hand aus.
„Bitte etwas zu essen! Bitte ein paar Münzen!“
Maran trat näher zu ihm.
„Hast Du keine Familie, die für Dich sorgt? Kein Dorf, in dem Du zuhause bist?“
Der Alte schaute Maran an und schien zu überlegen, ob Maran ihn verspotten wollte.
„Familie? Dorf? Heimat? … Ich habe nur noch diesen Leib – das ist alles …“
Maran wußte nicht so recht, was er tun sollte. Man konnte doch diesen Mann nicht einfach so hier auf der Straße lassen … Aber was konnte er hier tun? …
Er setzte seinen Rucksack ab, holte das Brot heraus, daß ihm die alte Frau in Talingen geschenkt hatte, brach es in zwei Teile und gab die eine Hälfte dem Einbeinigen.
„Ich würde Dir gerne mehr helfen, aber weiß nicht, wie ich das machen könnte.“
Der Alte schaute Maran eine Weile an. Dann schüttelte er den Kopf.
„Du bist nicht von hier, nicht wahr? Du bist ganz woanders aufgewachsen – in einem Dorf außerhalb der Großen Ebene – stimmt's?“
„Ja – woran merkst Du das?“
„Du kennst nicht die Armut und das Leid in den Städten und folgst in Deinem Tun Deinem Herzen und verschließt noch nicht Deine Augen vor dem Leid in der Welt. … Das ist hier sehr selten.“
„Und Du? Kommst Du von hier?“
„Ich bin in einer Stadt im Osten am Meer geboren worden, aber seit ich im Krieg ein Bein verloren habe, bin ich hier in der Seestadt. Wie sollte ich auch mit nur einem Bein woanders hingehen können?“
„Sorgt denn der König nicht für die Männer, wenn sie im Krieg verletzt worden sind?“
Der Einbeinige lachte bitter.
„Du bist wirklich noch nicht lange in der Ebene, oder? Der König hat meinen Leib gekauft und als er beschädigt war, hat er ihn weggeworfen!“
„Ich habe gehört, daß der König der Vater des Landes sein sollte, der schaut, daß es allen gut geht. Ist das nicht so?“
Der Alte schüttelte fassungslos den Kopf.
„So sollte es sein – aber welcher König ist schon so?“
Dazu wußte Maran nichts zu sagen. Nachdem sich beide eine Weile schweigend angesehen hatte, griff Maran ein wenig verlegen nach seinem Rucksack und setzte ihn auf.
„Ich will in die Stadt, aber ich komme nachher noch mal vorbei. Bis dann!“
„Paß auf Dich auf!“
Maran ging weiter zu dem Stadttor, vor dem die beiden Wächter standen.
„Halt! Ein Kupferstück, wenn Du in die Stadt willst. Ein Kupferstück für jeden von uns beiden!“
„Warum?“
„Warum?“
Der Wächter sah Maran ungläubig an.
„Weil mein Speer spitz ist und Dir ein Loch in den Bauch machen wird, wenn Du nicht zahlst! Und Du wirst Deine Waffen hier lassen.“
„Warum soll ich die hierlassen? Und warum soll ich euch zwei Kupferstücke geben?“
„Noch ein 'warum' und ich zeige Dir, wie spitz mein Speer ist!“
Da gab Maran dem Wächter zwei von den drei Kupferstücken, die er hatte, und reichte ihm seinen Speer, seinen Bogen und seinen Köcher. Der Wächter steckte die Münzen in seine Tasche und legte den Speer, den Bogen und den Köcher in eine Kammer, die sich innen an der Stadtmauer befand.
Da die Wächter nun nicht mehr auf Maran achteten, ging er in die Außenstadt hinein. Die Straßen waren mit flachen Steinen gepflastert und deutlich sauberer als in der Armenstadt vor der äußeren Stadtmauer. Maran ging durch die Gassen und schaute sich die Häuser an.
Hier gab es tatsächlich Häuser mit zwei Zimmern übereinander statt nur nebeneinander! Dann war das steinerne Haus mit mehreren Zimmern übereinander, das er mehrmals innerlich gesehen hatte, als er noch im Seetal gewesen war, vielleicht doch etwas, was es wirklich gab!
In der Nähe der inneren Stadtmauer gab es Gassen, in denen Handwerker wohnten – alle Schreiner in einer Gasse, alle Bäcker in einer Gasse, alle Metzger in einer Gasse, alle Schneider in einer Gasse … Warum war das so? Wäre es nicht einfacher, wenn die sich auf die ganze Stadt verteilen würden?
Vor den Häusern der Handwerker hing immer ein Zeichen, an dem man erkennen konnte, welches Handwerk in diesem Haus ausgeübt wurde – eine Brezel bei den Bäckern, ein Schlachterbeil bei den Metzgern, eine Schere bei den Schneider …
Maran wunderte sich über diese Handwerker-Ordnung.
„Wahrscheinlich hat das auch wieder dieser König bestimmt, damit er leichter alles sehen kann …“
Als er durch eine Gasse kam, in der anscheinend nur Heiler wohnten, bleib er stehen, da ihm eine Geschichte eingefallen war, die ihm seine Großmutter Mana einst erzählt hatte.
„Wie war das gewesen? … Mana war schwer krank und ihr Mann Adi hat Bergkristalle gefunden und ist mit ihnen in eine Stadt in der Großen Ebene gegangen und hat sie einem Heiler dafür gegeben, daß er mit ihm kam und Mana heilt. Ob Adi damals wirklich in dieser Gasse hier gestanden hat und sich gefragt hat, welchen Heiler er bitten soll, mitzukommen?“
Schließlich ging Maran zu der inneren Stadtmauer, die ein gutes Stück höher war als die äußere Stadtmauer. Er lief einmal ganz an ihr entlang – von der Flußseite aus durch die Außenstadt bis zu hin zu der Stelle am Seeufer, an dem die Außenstadt endete.
An der inneren Stadtmauer gab es nur ein großes Tor zwischen zwei Türmen. Maran betrachtete diese Türme – das waren solche Häuser mit mehreren Zimmern übereinander, wie er sie innerlich gesehen hatte. Ob er vielleicht irgendwann einmal in einem solchem Haus wohnen würde?
Durch das Tor konnte er ein paar Häuser in der Innenstadt sehen – sie sahen aus, als wenn in ihnen Könige wohnen würden … Die Männer und Frauen, die er dort sehen konnte, trugen Kleider, die sehr kostbar aussahen – warum die nur solche Kleider trugen? Die sahen nicht so aus, als ob man gut in ihnen wandern oder Korn sensen könnte … Als er eine Weile geschaut hatte, sah er auch eine Gruppe von Männern, die alle dieselben Kleider und Rüstungen trugen und die alle auf dieselbe Weise bewaffnet waren und die sich zudem noch alle gleich bewegten … das war schon alles ziemlich seltsam hier in dieser Stadt …
Als Maran versuchte, durch das Tor in die innere Stadt zu gehen, hielten die Wächter ihn auf und bedrohten ihn mit Speeren, an deren Spitze auch noch ein kleines Beil befestigt war. Sie sprachen nicht einmal mit ihm, als er sie bat, sie durchzulassen, sondern stießen mit ihren Speeren nach ihm, sodaß er schnell davonlief.
Auf der linken Seite des Tores war vor der inneren Stadtmauer ein größerer freier Platz, auf dem vielen kleine Stände waren, an denen Brot, Gemüse, Obst, Werkzeuge, Stoffe und vieles andere angeboten wurde. Das mußte einer der Märkte sein, von denen die Händler, die manchmal ins Seetal gekommen waren, gesprochen hatten.
„Nun – da ich nur eine einzige Kupfermünze habe und die Händler auf diesem Markt mir sicherlich nichts nur gegen ein Flötenspiel geben werden, brauche ich eigentlich gar nicht erst zu schauen, was es dort alles gibt, was ich gerne hätte …“
Aber Maran ging dann trotzdem über den Markt und sah sich alles an. Auf den Tischen der Stände lagen Werkzeuge und Stoffe und noch vieles andere, was er noch nie gesehen hatte.
Doch schließlich hielt er inne und sprach mit sich selber.
„Maran – Warum bist Du hier? Du suchst nach Asar – und der steht hier bestimmt nicht auf diesem Markt herum. Du fragst besser mal jemanden nach dem Korngott. Aber wen?“
Er schaute sich um und entdeckte eine Frau, die Stoffe verkaufte – sie sah recht freundlich aus.
Er ging zu ihrem Stand hinüber.
„Na, junger Mann – braucht Ihr einen schönen Stoff? Obwohl Ihr eigentlich nicht so wirkt, als ob ihr viele Münzen hättet … Aber nichts für ungut. Womit kann ich Euch helfen?“
„Äh … ich habe wirklich nur eine einzige Kupfermünze und wollte nichts kaufen. Aber könnt ihr mir sagen, wo ich Asar finde? Oder ein Haus des Asar oder so etwas ähnliches?“
„Wer soll denn Asar sein?“
„Nun ja – der Korngott.“
„Ach – Astar. Heißt der dort, wo Ihr herkommt, Asar? Es gibt einen Astar-Tempel in der Innenstadt, aber da werdet ihr sicherlich nicht eingelassen werden.“