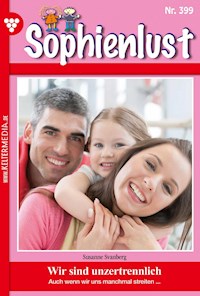Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Martin Kelter Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Sophienlust
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Die Idee der sympathischen, lebensklugen Denise von Schoenecker sucht ihresgleichen. Sophienlust wurde gegründet, das Kinderheim der glücklichen Waisenkinder. Denise formt mit glücklicher Hand aus Sophienlust einen fast paradiesischen Ort der Idylle, aber immer wieder wird diese Heimat schenkende Einrichtung auf eine Zerreißprobe gestellt. Diese beliebte Romanserie der großartigen Schriftstellerin Patricia Vandenberg überzeugt durch ihr klares Konzept und seine beiden Identifikationsfiguren. Das kleine Mädchen reichte Else Rennert artig die Hand. Es war vier Jahre alt, hatte ein hübsches Gesichtchen, umrahmt von blondem Haar, beherrscht von großen grauen Augen. »Willkommen in Sophienlust!« Die mütterliche Heimleiterin lächelte freundlich. »Wie heißt du denn?« »Maren«, antwortete ein dünnes Kinderstimmchen. Schutzsuchend griff das Kind nach der Hand seiner Begleiterin. Zu ihr hatte es bereits Vertrauen. Diese Begleiterin war Denise von Schoenecker, die jugendliche Schirmherrin des Kinderheims Sophienlust. Sie war selbst Mutter und liebte Kinder über alles. »Es wird dir bei uns gefallen«, versicherte Denise und streichelte dabei die kleine warme Hand. »Wenn du magst, bringt dich Schwester Regine zu den anderen Kindern. Du wirst staunen, wie viele hübsche Spielsachen sie haben.« Denise sah dabei auf die Kinderschwester, die sich ebenfalls in Frau Rennerts Büro aufhielt. Schwester Regine hatte eben mit der Heimleiterin das Programm für die kommenden Wochen durchgesprochen. Denn Else Rennert fuhr in den nächsten Tagen zu einem längeren Kuraufenthalt. Sie hatte diese Erholung bitter nötig, denn die unermüdliche Arbeit zehrte an ihren Kräften. Maren nickte eifrig.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 150
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sophienlust – 335 –
Marco träumt von Liebe
Ein kleiner Junge hat viel Schweres erlebt
Susanne Svanberg
Das kleine Mädchen reichte Else Rennert artig die Hand. Es war vier Jahre alt, hatte ein hübsches Gesichtchen, umrahmt von blondem Haar, beherrscht von großen grauen Augen.
»Willkommen in Sophienlust!« Die mütterliche Heimleiterin lächelte freundlich. »Wie heißt du denn?«
»Maren«, antwortete ein dünnes Kinderstimmchen. Schutzsuchend griff das Kind nach der Hand seiner Begleiterin. Zu ihr hatte es bereits Vertrauen.
Diese Begleiterin war Denise von Schoenecker, die jugendliche Schirmherrin des Kinderheims Sophienlust. Sie war selbst Mutter und liebte Kinder über alles.
»Es wird dir bei uns gefallen«, versicherte Denise und streichelte dabei die kleine warme Hand. »Wenn du magst, bringt dich Schwester Regine zu den anderen Kindern. Du wirst staunen, wie viele hübsche Spielsachen sie haben.« Denise sah dabei auf die Kinderschwester, die sich ebenfalls in Frau Rennerts Büro aufhielt.
Schwester Regine hatte eben mit der Heimleiterin das Programm für die kommenden Wochen durchgesprochen. Denn Else Rennert fuhr in den nächsten Tagen zu einem längeren Kuraufenthalt. Sie hatte diese Erholung bitter nötig, denn die unermüdliche Arbeit zehrte an ihren Kräften.
Maren nickte eifrig. Ihre Mutti hatte ihr so viel von dem schönen Kinderheim erzählt, daß sie richtig neugierig war. Ohne zu zögern wechselte sie in Schwester Regines Obhut über.
Das war nicht weiter erstaunlich, denn zu der erfahrenen Erzieherin fanden alle Kleinen rasch Kontakt. Aber auch die älteren Buben und Mädchen kamen gern mit ihren Sorgen und Problemen zu Schwester Regine. Vertrauensvoll schaute Maren jetzt zu Regine Nielsen auf und verließ an deren Seite den Raum.
»Ich habe Maren bei ihrer Mutti in Maibach abgeholt. Hier sind die Geburtsurkunde und der Impfpaß. Frau Baumann hätte ihr Töchterchen gern selbst hergebracht, aber es war ihr nicht möglich. Sie mußte dringend ins Krankenhaus. Nierenversagen mit kolikartigen Schmerzen. Frau Dr. Frey hat Frau Baumann behandelt und danach bei mir angerufen. Es ging alles sehr schnell. Ich konnte nur ganz kurz mit Marens Mutter sprechen. Sie hofft, daß sie in einigen Wochen wieder gesund ist. Aber ich weiß nicht.« Denise schüttelte bekümmert den Kopf. »Aus Andeutungen von Frau Dr. Frey muß ich schließen, daß Marens Mutter kränker ist, als sie ahnt.«
Frau Rennert nahm die Dokumente, die Denise auf ihren Schreibtisch gelegt hatte, und steckte sie in einen neu anzulegenden Ordner, den sie mit »Maren Baumann« beschriften würde.
»Das tut mir leid«, murmelte die Heimleiterin teilnahmsvoll. »Was sagt denn Marens Vater dazu?«
»Das Ehepaar Baumann lebt seit einigen Jahren getrennt. Frank Baumann ist Ingenieur und für eine deutsche Firma in Venezuela tätig. Er scheint dort recht gut zu verdienen, denn er überweist, wie mir Frau Dr. Frey mitteilte, regelmäßig den Lebensunterhalt für seine Familie. Frau Baumann hat keine finanziellen Sorgen.«
»Sollte man ihn nicht benachrichtigen?«
»Daran habe ich auch gedacht. Ich habe Frau Baumann den Vorschlag gemacht, dieses zu übernehmen, aber sie hat es rundweg abgelehnt. Für sie ist die Trennung endgültig.«
Denise dachte in diesem Augenblick an die schmerzgepeinigte Frau, die trotz starker Spritzen einen verkrampften Eindruck gemacht hatte. Als Denise in der Maibacher Wohnung eingetroffen war, waren auch die Sanitäter mit der Krankentrage schon dagewesen. Sie hatten die Patientin so rasch wie möglich in die Klinik bringen wollen. Doch Frau Baumann hatte gebeten, ihrem Kind diesen Anblick zu ersparen und zu warten, bis Denise mit der kleinen Maren die Wohnung verlassen hatte. So war nicht mehr viel Zeit für Gespräche gewesen. Nur das Wichtigste war erörtert worden.
»Sobald es Frau Baumann etwas besser geht, werde ich sie im Krankenhaus besuchen.«
»Wir sind im Moment voll belegt, und jedes weitere Kind bringt zusätzliche Arbeit. Ich meine, daß alles wird zuviel für Sie, Frau von Schoenecker. Vielleicht sollte ich meinen Erholungsaufenthalt verschieben.« Else Rennert machte ein bekümmertes Gesicht. Es fiel ihr schwer, sich von ihren Pflichten und Aufgaben in Sophienlust zu lösen.
Denise schüttelte lächelnd den Kopf. »Auf gar keinen Fall«, antwortete sie in ihrer charmanten Art. »Sie haben diese Kur lange genug verschoben. Sie müssen einmal ausspannen, damit Sie uns erhalten bleiben, Frau Rennert. Natürlich werden wir alle Sie sehr vermissen. Doch um so schöner wird das Wiedersehen sein. Ich wünsche mir, daß Sie sechs Wochen lang nicht an lärmende Kinder denken, nicht an Speisezettel, Wäsche oder reparaturbedürftige Jeans. Sie sollen sich einzig und allein erholen.«
Else Rennert setzte die Brille ab und seufzte leise. »Es wird mir schwerfallen. Ich werde diese Rasselbande vermissen und die schöne Umgebung von Sophienlust.«
»Aber nein! Ihr Kurdomizil liegt im Allgäu. Und dort ist es genauso schön wie hier.«
Else Rennert war davon nicht überzeugt, aber sie schwieg. Eigentlich war es Denise von Schoenecker gewesen, die sie immer wieder gebeten hatte, endlich einmal für einige Wochen auszuspannen. Doch je näher der Abreisetermin rückte, um so unruhiger wurde Else Rennert. Sie konnte sich nicht vorstellen, wochenlang von ihren Schützlingen getrennt zu sein. Eigentlich hätte sie sich auf die Urlaubszeit freuen müssen. Aber sie konnte es nicht.
*
»Telefon für dich«, rief der Trainer des Tennisclubs Ferdinand Weimer zu.
Der Siebenunddreißigjährige schlug den weißen Ball immer wieder gegen eine hohe Betonwand. Er hetzte hin und her, um den aufspringenden Ball zu erwischen und sofort kraftvoll zurückzuschleudern. Er verbrachte täglich mehrere Stunden mit diesem Training. Dabei ging es ihm nicht um sportlichen Ehrgeiz, sondern mehr darum, den hübschen jungen Damen des Clubs zu imponieren.
»Ich habe keine Zeit. Das siehst du doch.« Wieder schlug Ferdinand Weimer mit seinem Schläger nach dem Ball.
»Es scheint aber wichtig zu sein. Also, bitte komm!« Mathias Schott war zwölf Jahre jünger als Ferdinand Weimer und seit etwa zwei Jahren mit ihm befreundet. Ferdinand hatte ihm die Stelle als hauptberuflicher Trainer in der neuen Tennishalle verschafft.
Also mußte er sich gut mit ihm stellen. Eine so angenehme Tätigkeit gab es nicht oft.
»Wer ist es denn?« fragte Ferdinand, ohne sich von seinem Spiel ablenken zu lassen.
»Die Firma.« Mathias beobachtete seinen Freund aus zusammengekniffenen Augen. Eines mußte man Ferdinand lassen: er hatte eine ausgezeichnete Kondition. Sein schlanker, elastischer Körper sorgte dafür, daß man ihn allgemein wesentlich jünger schätzte. Er selbst unterstrich dieses noch durch besonders jugendliche Kleidung. Alles in allem sah er fabelhaft aus. Fast konnte man neidisch werden. Allerdings war er sich immer des Eindruckes bewußt, den er auf seine Verehrerinnen machte. Die Folge war eine lässige Arroganz.
»Sie kann mir gestohlen bleiben. Vielleicht begreift man endlich, daß ich keine graue Büromaus bin.« Wieder schlug Ferdinand kräftig zu. Er war stolz darauf, keinen einzigen Ball zu verpassen.
»Ich habe aber versprochen, dich ans Telefon zu holen«, beharrte Mathias.
»Nur, wenn du später mindestens drei Sätze mit mir spielst.«
»Ich kann nicht. Ich habe gleich Stunde. Von zehn bis elf die kleine Föller.«
Ferdinand fing geschickt den Ball auf und warf ihn in den Korb.
»Was bezahlt dir der Papa?« fragte er im Näherkommen. »Vierzig die Stunde, nicht wahr? Ich gebe dir das Doppelte. Na, was ist?« Großspurig klopfte er sich mit dem Tennisschläger an die sonnenbraunen Waden. Das Solarium, das er in einem Nebenraum des eigenen Hallenschwimmbades hatte einrichten lassen, sorgte dafür, daß er auch im Winter aussah, als käme er direkt aus dem Urlaub.
»Und was erzähle ich der kleinen Föller?« Etwas unsicher zog Mathias die Augenbrauen hoch. Daß sein Freund mit seinem Reichtum prahlte, daran hatte er sich längst gewöhnt. Dabei gehörte das gesamte Vermögen dessen Frau. Sie hatte die Papierfabrik, die Grundstücke und die Häuser von ihren Eltern geerbt. Und sie verwaltete die beachtliche Hinterlassenschaft auch. Ferdinand war der Nutznießer dieses Reichtums.
»Das ist dein Problem. Es wird dir schon eine Ausrede einfallen.« Pfeifend ging Ferdinand zur angegliederten Cafeteria, wo sich das Telefon befand.
Antonio, der italienische Kellner, hielt ihm den Hörer entgegen.
»Presto Signore… Prokurist von Firma… warten ungeduldig.«
»Schon gut, Antonio.« Mit weltmännischer Geste nahm Ferdinand den Hörer entgegen, meldete sich kühl und mit herablassender Höflichkeit. »Was gibt es denn so Dringendes? Ist denn meine Frau nicht da?«
In den nächsten Sekunden verschwand das Lächeln aus seinem sonnengebräunten Gesicht. Er schluckte. Sein Atem ging rascher. »Das ist doch nicht wahr«, stieß er schließlich hervor. »Das kann doch nur ein makabrer Scherz sein. So etwas gibt es doch nicht.«
Wieder lauschte er in die Muschel, wobei Antonio ihn verstohlen beobachtete.
»Ich glaube es nicht«, keuchte Ferdinand kurz darauf. Der Schläger rutschte ihm aus der Hand, fiel polternd auf die Marmorfliesen. »Ich glaube es einfach nicht. Ja, ja, selbstverständlich…« Seufzend reichte Ferdinand den Telefonhörer über die Theke. Das Gespräch war beendet.
»Einen doppelten Whisky, Antonio!«
Der Italiener beeilte sich, den Wunsch des Stammgastes zu erfüllen. »Schlechte Nachrichten?« fragte er, als er das Glas über den Tisch schob.
Ferdinand gab keine Antwort. Er machte eine ungeduldige Handbewegung, als wollte er ein lästiges Insekt verscheuchen. Seit er durch seine Heirat zu Reichtum und Ansehen gekommen war, pflegte er mit kleinen Angestellten nicht mehr zu reden. Eine Ausnahme bildete nur Mathias. Er hatte immerhin ein Sportlehrerstudium begonnen, wenn er auch keinen Abschluß hatte.
»Was ist los?« fragte jetzt der junge Trainer, der nach Ferdinand das Lokal betreten hatte.
»Du glaubst es nicht.« Ferdinand leerte sein Glas in zwei langen Zügen. Der Alkohol rann durch seine Kehle, hinterließ eine angenehme Wärme. Dieses trug wesentlich dazu bei, daß er sich erstaunlich rasch von seinem Schock erholte. »Du siehst hier den Chef der Vereinigten Papierfabriken vor dir«, erklärte er mit sarkastischem Lächeln.
Mathias zog die Augenbrauen hoch. »Was soll das heißen?« fragte er verständnislos.
»Constanze ist vor wenigen Minuten gestorben.« In Ferdinands Stimme war keinerlei Bedauern. Er hatte die Erbin der Vereinigten Papierfabriken ohnehin nur des Geldes wegen geheiratet. Sie war keine Schönheit gewesen, sondern ein Durchschnittsmensch. Deshalb hatte er es stets vorgezogen allein auszugehen. Dabei hatte er es mit der ehelichen Treue nie so genau genommen.
»Was sagst du da?« Mathias beugte sich etwas vor.
»Verstehst du kein Deutsch?« Ferdinand schob das Glas über die Theke. »Noch einen Whisky.«
»Constanze ist…« Mathias kannte die blasse, etwas magere Frau seines Freundes recht gut. Manchmal war sie sonntags mit dem Jungen gekommen, hatte aber dennoch irgendwie bedrückt gewirkt.
»Sie ist tot. Aus, fertig.« Ferdinand machte eine gleichgültige Handbewegung. Er nahm den Whisky entgegen und zischte: »Verschwinde, Antonio!«
»Aber wie konnte sie denn so schnell…« Mathias war betroffener als der Ehemann. »War sie denn krank? Oder war es ein Unfall? War sie mit dem Auto unterwegs?«
»Du fragst ein bißchen viel.« Ferdinand setzte das Glas an die Lippen. Er trank regelmäßig und vertrug deshalb eine Menge Alkohol.
»Na, hör’ einmal, du hast mir einen ganz schönen Schrecken eingejagt.«
»Schrecken? Wenn ich es mir richtig überlege, konnte mir gar nichts Besseres passieren. Keine vorwurfsvollen Blicke mehr, wenn ich nur selten im Büro auftauche, keine unliebsamen Fragen, wenn ich übers Wochenende wegfahre, keine Skrupel, wenn ich betrunken nach Hause komme. Nur Vorteile…« Ferdinand pfiff durch die Zähne.
»Wie kam denn das so plötzlich?« forschte Mathias erneut.
»Genaues weiß ich noch nicht. Der Prokurist sagte mir nur, daß Constanze im Büro zusammengebrochen ist. Man hat sofort einen Arzt gerufen. Doch bis er kam, war sie schon tot. Herzversagen. Nun ja, sie hatte einen angeborenen Herzfehler.«
»Sag’ mal, hast du davon gewußt?« Verblüfft schaute Mathias den Älteren an.
»Klar. Deshalb konnte Constanze auch keine Kinder bekommen. Ich selbst habe ja nie Wert auf ein Kind gelegt, aber sie wollte unbedingt eines haben. Deshalb haben wir vor fünf Jahren Marco adoptiert. Er war damals zwei – ein schreiender kleiner Giftzwerg.« Ferdinand verzog das Gesicht. »Wäre es nach mir gegangen, hätten wir ihn keine drei Tage behalten. Aber Constanze war verrückt nach dem Kleinen. Sie hat ihn maßlos verwöhnt. Es ist höchste Zeit, daß damit Schluß ist.«
»Was willst du damit sagen?« fragte Mathias verwirrt.
»Das ist doch sonnenklar.« Ferdinand sprach etwas langsamer als sonst, weil der Alkohol sein Denken beeinflußte. »Als erstes werfe ich diesen Schmarotzer hinaus.«
»Du hast zuviel getrunken.« Nur Mathias Schott konnte sich Ferdinand Weimer gegenüber eine derartige Bemerkung erlauben. »Eine Adoption kann nicht rückgängig gemacht werden.«
»So? Dann muß ich mir eben etwas einfallen lassen.« Ferdinand preßte die Lippen zusammen. Seit fünf Jahren störte ihn das Kindergeschrei in der Villa, die Constanze von ihren Eltern geerbt hatte. Seit fünf Jahren wartete er auf eine Gelegenheit, die Bürde, die das Kind seines Erachtens darstellte, abzuschütteln. Oft hatte er mit Constanze darüber gesprochen. Doch sie hatte Marco immer verteidigt.
»Soviel ich weiß, ist der Junge sogar erbberechtigt.«
»Himmel, hilf!« Ferdinand fiel das Testament ein, das Constanze vor etwa einem Jahr von ihrem Anwalt hatte aufsetzen lassen. Danach ging ihr Vermögen je zur Hälfte an ihren Mann und das Kind. Hatte sie damals schon geahnt, daß sie nicht mehr lange zu leben hatte? Ferdinand hatte nicht daran geglaubt. Deshalb hatte er das Testament auch nicht ernst genommen. Irgendwann hatte er Constanze zu einer Änderung überreden wollen. Aber seiner Ansicht nach hatte das noch Zeit gehabt. Und jetzt hatte er die Chance verpaßt. »Verdammt«, zischte er wütend. »Ich denke gar nicht daran, mit diesem hergelaufenen Hurensohn zu teilen.«
Mathias war derartige Ausdrücke von seinem Freund gewohnt.
»Es wird dir nichts anderes übrigbleiben«, meinte er sachlich.
»Da täuschst du dich aber gewaltig. Wenn es um blanke Euros geht, bin ich recht erfinderisch.« Ein boshaftes Lachen begleitete diese Äußerung.
Das war Mathias Schott unangenehm. »Entschuldige, ich muß raus. Die kleine Föller kommt zum Training.«
»Sag’ ihr, daß du keine Zeit hast. Sie soll morgen kommen. Du kannst mich doch jetzt nicht allein lassen. Du bist mein Freund, Mathias.« Ferdinand Weimer hielt den Jüngeren am Arm fest.
»Ich kann nur dafür sorgen, daß du keinen Whisky mehr bestellst und dafür unverzüglich zur Fabrik fährst. Dort wartet man auf dich.«
»Die sollen mich ’mal… Jetzt bin ich der Chef. Keiner hat mir etwas zu sagen. Und wer nicht spurt, der fliegt. Constanze war viel zu gutmütig. Da gibt es Leute im Betrieb, die schon fünfunddreißig Jahre da sind. Wie soll denn da ein modernes Management entstehen? Zuerst feuere ich meine Sekretärin. Das Pummelchen mit der Brille ist doch viel zu alt. Constanze hat sie für mich eingestellt. Nach welchen Gesichtspunkten, das kannst du dir ja denken.«
»Immerhin hat sie deine Arbeit gemacht. Das solltest du nicht vergessen«, erinnerte ihn Mathias, der so gut wie kein anderer wußte, daß sich Ferdinand Weimer gern mit fremden Federn schmückte.«
»Jetzt brauche ich keine Tätigkeit mehr vorzutäuschen, denn ich bin niemandem mehr Rechenschaft schuldig. Ich darf ganz offiziell meinen Neigungen nachgehen. Wenn du dir Mühe gibst, engagiere ich dich vielleicht sogar als Gesellschafter. Vor allen Dingen aber brauche ich im Büro ein paar flotte Bienen. Man muß ja schließlich auch repräsentieren.« Ferdinand reckte hochmütig den Kopf.
»Ich glaube, daß du im Moment andere Sorgen hast.« Mathias betrachtete den Freund skeptisch. Er empfand dessen Verhalten als taktlos.
»Sorgen? Keineswegs. Ich habe nicht zu hoffen gewagt, daß ich so rasch wieder ein freier Mann sein würde.« Ferdinand lachte ungeniert. »Weißt du, was das bedeutet, Mathias? Ich kann die tollsten Mädchen an Land ziehen, ohne eine Scheidungsklage befürchten zu müssen. Wenn das kein Grund zur Freude ist.« Seine dunklen Augen funkelten vor Begeisterung.
Mathias Schott erwiderte nichts. Er zog nur die Stirn in Falten.
»Was machst du denn für ein Gesicht?« empörte sich Ferdinand Weimer. »Ich habe gar nicht gewußt, daß du ein Spießer bist. Wenn das so ist, werde ich mir einen anderen Gesellschafter suchen müssen.«
»Tu das«, brummte Mathias und wandte sich ab. Er würde wie vorgesehen dem Töchterchen des Fabrikanten Föller Unterricht erteilen.
*
»Was ist das für ein Essen?« fuhr Ferdinand Weimer die Haushälterin an, die schon bei Constanzes Eltern die Hausarbeit zur vollsten Zufriedenheit versehen hatte.
Die Frau in der blütenweißen Schürze hatte verweinte Augen.
»Mein Gott, Herr Weimer, ich bin noch ganz durcheinander. Der Prokurist hat hier angerufen und nach Ihnen gefragt. Dann hat er mir erzählt, was geschehen ist. Es ist entsetzlich. Ich kann es nicht begreifen. Die arme Frau Constanze. Sie war ja erst dreiunddreißig… So jung noch…«
Wieder weinte die Hausangestellte. Constanze Weimer war für sie eine gleichbleibend freundliche, verständnisvolle Chefin gewesen, die sich auch manchen privaten Rat bei ihr geholt hatte. Recht gut erinnerte sich Frau Lusch noch an die Zeit, in der Constanze ihren späteren Ehemann kennengelernt hatte. Sieben Jahre war das nun her. Damals hatte die Haushälterin von einer Heirat abgeraten. Doch Constanze war verliebt gewesen und hatte Ferdinand Weimer durch eine rosarote Brille gesehen. Die Hochzeit hatte bald stattgefunden. Aber wahrscheinlich hatte die junge Frau diesen Entschluß schon nach kurzer Zeit bereut. Doch sie hatte sich nie beklagt. Zweifellos hatte sie um die Liebschaften ihres Mannes, über die die ganze Firma sprach, gewußt. Trotzdem hatte es im Hause Weimer keinen Streit gegeben.
»Danach habe ich Sie nicht gefragt. Ich darf doch erwarten, daß Sie wie üblich Ihre Pflicht tun und etwas Genießbares auf den Tisch bringen.« Strafend schaute Ferdinand zuerst auf den Gemüseeintopf, dann auf Frau Lusch. Seine gute Laune war verflogen. Er war von der Tennishalle aus direkt in die Fabrik gefahren. Dort waren vom Prokuristen inzwischen alle Formalitäten erledigt worden. Constanze war bereits abgeholt worden.
Was Ferdinand jedoch weit mehr als die unnütze Fahrt zum Werk ärgerte, war die Bemerkung, die dieser leitende Angestellte ihm gegenüber gemacht hatte. Die junge Schauspielerin, mit der er, Ferdinand, das vergangene Wochenende verbracht hatte, habe Constanze in der Fabrik besucht und ihr schonungslos die Wahrheit gesagt. Darüber habe sich Constanze so aufgeregt, daß es zum Herzschlag gekommen war.
Natürlich hatte Ferdinand alles bestritten, wie er es gewöhnlich zu tun pflegte, wenn man ihm auf die Schliche kam. Doch der Prokurist hatte seine Ausreden angezweifelt. Daraufhin hatte Ferdinand ihm gekündigt. Da der Mann aber schon über dreißig Jahre lang dem Betrieb angehörte, mußte man ihm ein Jahr lang das Gehalt zahlen. Wenn das nicht ärgerlich war…
Auf Frau Lusch machten Ferdinands Äußerungen wenig Eindruck. Sie stand noch zu sehr unter dem Eindruck der Todesnachricht.
»Am schlimmsten wird es für Marco sein. Das arme Kind weiß noch gar nichts«, jammerte sie. Schon wieder liefen die Tränen über die faltigen Wangen. »Marco hat bis dreizehn Uhr Schule. Frau Constanze hatte ihn dann immer mit dem Auto abgeholt. Übernehmen Sie das jetzt?«
»Ich denke ja gar nicht daran. Constanze hat den Jungen viel zu sehr verwöhnt. Er wird lernen müssen, daß das vorbei ist.«