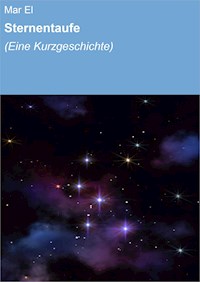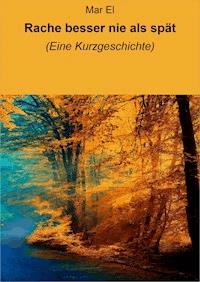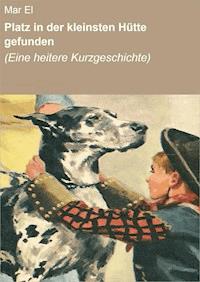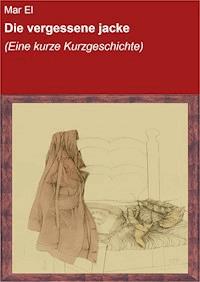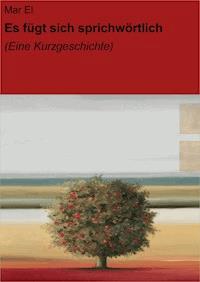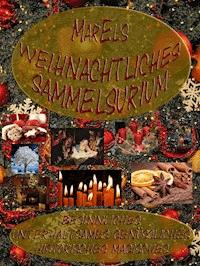
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks Self-Publishing
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Sonderpreis ~ Sonderpreis ~ Sonderpreis Kurze Geschichten, Rezepte und vor allem viel viel Wissenswertes rund um Weihnachten! Eben ein Sammelsurium. Der Leser wird überrascht sein, was und welche Bedeutung die vielen weihnachtlichen Bräuche haben. Oder weiss jemand, wofür z.B. der Stollen steht? Was sind die Raunächte? Wie feiert man in Japan Weihnachten? Und warum kommt der Nikolaus am 6. Dezember? Wer Erklärungen zu vielen Themen der Weihnachtszeit sucht, könnte hier fündig werden. Nur wer hier Dekoideen sucht, wird vergeblich suchen. Dazu gibt es genug Material in den Zeitschriften, meint die Autorin. Unterstützt wird es von kleinen Filmchen auf Youtube.de
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 476
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mar El
MarEl's weihnachtliches Sammelsurium
besinnliches, unterhaltsames, genüssliches, historisches und magisches
Dieses eBook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Vorwort
Die Adventszeit
Die Weihnachtsgeschichte
Feiertage im Dezember und Heilige rund um die Weihnachtszeit
Weihnachtsbrief eines Dichters
Symbole, Bräuche und Wissenswertes rund um die Weihnachtszeit
Du meine Güte, es weihnachtet …!
Gewürze und Kräuter rund um die Weihnachtszeit
Früchte, Gemüse und einiges mehr rund um die Weihnachtszeit
Des Autors liebste Rezepte rund um die Weihnachtszeit
Kuschelbär sucht Anhang
Andere Länder - andere (Weihnachts-) Sitten
Als Weihnachten noch nicht Weihnachten hieß ...
Das Weihnachtsfest mit ganz anderen Augen sehen
Impressum
Vorwort
Ich widme dieses Buch all denjenigen, die immer an mich geglaubt, mich unterstützt und zu mir gehalten haben.
Liebe(r) LeserIn!
Advent, das Weihnachtsfest! Was für eine Zeit!
Wenn man es erwähnt, verdrehen viele angenervt die Augen. Trotzdem macht man den Weihnachts-Wahnsinn jedes Jahr immer wieder mit - meistens, ohne zu hinterfragen.
Aber was ist es, dass wir uns jedes Jahr aufs Neue so intensiv mit diesem Fest beschäftigen? Das muss jeder für sich selbst ausmachen.
Als Kind habe ich diese Zeit stets als Besonders empfunden. Jedes Jahr aufs Neue hat nur wenig genügt, um den "Geist der Weihnacht" heraufzubeschwören. Die ersten Backbleche Weihnachtsplätzchen und ein Adventsgesteck, schon war man wieder dabei. Die winterliche Dezemberluft war immer ein bisschen klarer, das Zuhause war immer ein bisschen heimeliger und man war umgeben von geheimnisvollen Energien weihnachtlicher Vorfreude. Später habe ich mal in einem Buch gelesen, dass in der Weihnachtszeit besonders viele Engel anwesend sind und diese speziellen Energien verbreiten. Wenn es so ist, finde ich den Gedanken sehr schön, denn ich liebe Engel sehr.
Manchem werden vielleicht Abschnitte dieses Buches sehr religiös erscheinen und sich davon eventuell sogar abgestossen fühlen. Aber man sollte bedenken, dass wir mit Weihnachten ein christliches Hochfest feiern, eben "das Fest des Jahres". Trotz aller Bemühungen, mich stets "weltlich" auszudrücken, liess es sich meines Erachtens manchmal einfach nicht vermeiden, gewisse Themen auf "kirchlich-dramatische" Art und Weise auszudrücken, um deren Bedeutung klarzumachen.
Und nun wünsche ich viel Spass beim Lesen!
Übrigens:
Wer glaubt, dass die wohlgefüllten Regale mit Weihnachtsartikeln in den Geschäften bereits im August eine reine Erfindung des Einzelhandels ist, täuscht sich! In Deutschland wurde schon vor Jahrhunderten ab dem 24. August mit der "Zurüstung" für die weihnachtliche Festtafel begonnen. An diesem Tag, dem Bartholomäustag, wurden die Karpfen in den Teichen, bzw. die Gänse gemustert und mit der besonderen Mast begonnen. Der frühe Beginn hatte den Vorteil, einen Teil der Weihnachtsvorfreude in die festlose Zeit mitzunehmen und rechtzeitig für das Weihnachtsfest vorzusorgen.
Die Adventszeit
Der Advent
Der Begriff Advent stammt ursprünglich aus dem Griechischen und bedeutet wörtlich übersetzt „Erscheinung“. Im Römischen Reich hieß es Ankunft, Anwesenheit oder auch Besuch eines Amtsträgers, ganz besonders die Ankunft von Königen oder Kaisern (adventus Divi => „Ankunft des (göttlichen) Herrschers“). Es konnte so aber auch die Ankunft der Gottheit im Tempel ausgedrückt werden. Dieses Wort übernahmen die Christen, um ihre Beziehung zu Jesus Christus zum Ausdruck zu bringen.
Die Tradition der Adventszeit lässt sich bis zum Anfang des 5. Jahrhundert in Ravenna/Italien zurückverfolgen. In den Anfängen war die Adventzeit als Vorbereitung auf die Geburt Christi eher eine Buß- oder Fastenzeit, die zwischen dem 11. November und dem 6. Januar zelebriert wurde. In dieser Zeit durfte weder gefeiert, schon gar nicht getanzt werden. Es war also eher eine besinnliche Zeit, bis sich nach und nach das weihnachtlich-freudige Motiv der „Menschwerdung Gottes“ durchsetzen konnte.
In Rom gab es eine Adventsliturgie erstmals im 6. Jahrhundert. Papst Gregor der Große setzte da erstmals die Zahl der vier Adventsonntage fest, was keinesfalls willkürlich passierte. Im Mittelalter glaubte man nämlich, dass die Erde 4000 Jahre vor Christi Geburt erschaffen wurde. Damit stand jede Adventswoche für 1000 Jahre, die die Gläubigen auf die Ankunft des Erlösers warten mussten. Diese Praxis hat sich aber nicht überall verbreitet, in Mailand feiert man heute noch 6-wöchige Adventszeit. Auch im mozarabischen Kalender in Spanien umfasst die Adventszeit sechs Sonntage, ebenso in der Syrisch-Orthodoxen und anderen orientalischen Kirchen. In der Orthodoxen Kirche und in der Syrisch-Orthodoxen Kirche beginnt die Fastenzeit zur Vorbereitung auf Weihnachten am 15. November, also knapp sechs Wochen vorher.
Im Advent sehen wir nicht nur zurück auf die Ankunft des Herrn, wie sie uns in der Bibel als "Weihnachtsgeschichte" überliefert ist, sondern auch voraus auf die zukünftige Ankunft des Herrn als Herrscher dieser Welt. In der Spannung zwischen beidem erfahren wir im Advent den Herrn als denjenigen, der auf uns zukommt, sich uns immer wieder neu zuwendet und uns einlädt, sich ihm zuzuwenden.
1. Advent
Mit dem 1. Sonntag im Advent beginnt das neue Kirchenjahr und es hat das Thema „Der Einzug in Jerusalem“. Damit ist das Kommen Jesu Christi in diese Welt gemeint.
Die Botschaft des 1. Advents lautet: Der Messias ist da. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis er weltweit und öffentlich sein Erlösungswerk als Messias vollendet.
„Ein König kommt! Ein König aus dem Hause Davids, der Recht und Gerechtigkeit im Lande üben wird.“
Das alte (römische!) Evangelium vom Einzug Jesu in Jerusalem bestimmt den 1. Sonntag im Advent und verleiht ihm ein besonderes, in mancher Hinsicht festliches, Gepräge. Denn Jesus inszenierte sich zum ersten Mal öffentlich als der seit vielen Jahrhunderten geweissagte Messias, der den Menschen Erlösung gibt. Gott wird Mensch in seinem Sohn Jesus Christus. Er ist unser Friede und unser Licht (Hoffnung) in der Dunkelheit, was uns Wärme und Geborgenheit schenkt. Wissen wir es, zu würdigen?
2. Advent
Der 2. Sonntag im Advent steht unter dem Thema „Der kommende Erlöser“ - die Hoffnung der Christenheit, die Rückkehr des Gottessohnes, bzw. die Vergebung der Sünden.
Er erinnert daran, dass in der Person Jesu der verheißene Messias erschienen ist.
Messias ist die griechische Übersetzung von Christos (lat.: Christus). Wörtlich übersetzt heißt der Begriff "der Gesalbte", der den Menschen Heil bringt - für Leib und Seele. Deshalb wird Jesus auch als Heiland der Welt bezeichnet.
Nicht als katastrophale Bedrohung empfunden, sondern sehnlich erfleht, bzw. inständig erhofft, wird sehnsüchtig auf die Ankunft Christi geharrt.
3. Advent
Der 3. Sonntag im Advent wird von den christlichen Kirchen als „Gaudete“ (das Zeichen, dass die Ankunft Christi nicht mehr weit entfernt ist) bezeichnet und hat als Leitthema "Der Vorläufer des Herrn". Es behandelt die Freude auf die Ankunft des Gottessohnes und erinnert gleichzeitig an den Wegbereiter und Vorläufer Jesu, Johannes den Täufer.
Johannes ist der letzte Prophet des Alten Bundes (zwischen Gott und der Menschheit) und er darf mit eigenen Augen denjenigen sehen, den er selbst verkündet: Jesus Christus, den Herrn.
Er ist mit Jesus verwandt und nur wenige Monate älter. In der Einöde der Wüste in der Nähe des Flusses Jordan kündigt er einen Heilbringer an. Einen von dem die ganze Welt erfahren soll und er gibt sich als dessen Wegbereiter aus. Vom Geist getrieben lebt Johannes als Asket in der Wüste. Er isst sehr wenig und trägt nur die allernötigste Kleidung. Doch seine Sendung durch Gott und sein authentischer Lebenswandel geben ihm eine große Autorität und weisen ihn als Prophet aus. Die Menschen kommen zu ihm und hören ihm zu. Durch ihn bekommen die Menschen die Botschaft der alten Propheten, auf die sie so lange gewartet haben. Nämlich dass der Messias jetzt kommen wird und die Menschheit sich auf sein Kommen vorbereiten soll.
Wenn sie aber die Wunder, die passieren, nicht mit dem Herzen sehen können, werden sie auch das Heil nicht sehen, das sich vor ihren Augen ereignet. Das ist die Situation der Menschen zu allen Zeiten. Es gibt so viele wirklich wichtige Dinge im Leben, aber das übersehen wir ständig. So braucht es auch in unserer Zeit Menschen, die den Ruf Gottes hören und Gott ihre Stimme geben für das, was er den Menschen sagen möchte. Menschen, die die eigene Botschaft verkünden und nicht das Wort Gottes, sind falsche Propheten, von denen es schon genug gibt und nicht gebraucht werden. Die Welt braucht Menschen, die selbstlos leben und nicht die anderen an sich binden möchten.
4. Advent
Am 4. Adventssonntag lautet das Leitmotiv "Die nahende Freude" und ist Maria, der Mutter Jesu, gewidmet. Der letzte Sonntag vor der Ankunft des Gottessohnes steht für Verwirklichung, Ordnung, Manifestation, Ganzheit, Vollendung.
Wir treten in diesen Tagen in die stimmungsvolle Atmosphäre der Vorbereitung auf das Weihnachtsfest ein.
„Wir warten in Frieden, in der Zeit der Stille, finden zu uns selbst und sind bereit, das neue Licht (Jesus) zu empfangen.“
In der heutigen Konsumgesellschaft erleidet diese Zeit bedauerlicherweise eine Art kommerzieller "Verunreinigung", die ihren wahren Geist, der geprägt ist von geistiger Sammlung, Schlichtheit und einer nicht äußerlichen, sondern tief innerlichen Freude, zu verfälschen droht.
Es ist daher von der Vorsehung gewollt, dass - gleichsam wie ein Eingangstor zu Weihnachten - das Fest jener Frau gefeiert wird, die die Mutter Jesu ist und die uns besser als alle anderen dazu anleiten kann, den menschgewordenen Sohn Gottes zu kennen, zu lieben und anzubeten. Lassen wir uns also von ihr führen und von ihrer Liebe beseelen, damit wir uns mit ehrlichem Herzen und offenem Geist darauf einstellen, im Kind von Betlehem den Sohn Gottes zu erkennen, der auf die Welt gekommen ist, um uns zu erlösen.
Adventkranz
Die Tradition des Adventskranzes geht auf den lutherischen Theologen und Erzieher Johann Hinrich Wichern (1808 - 1881) zurück, der obdachlose Kinder und Jugendliche in einem von ihm 1833 eingerichteten Hamburger Waisenhaus, dem "Rauhen Haus", betreute und auch die Möglichkeit bot, einen Beruf zu erlernen. 1839 ließ Wichern im Betsaal ein altes Wagenrad mit 23 Kerzen aufhängen (19 kleine rote Kerzen für die Werktage und 4 große, weiße für die Sonntage). Beginnend vom 1. Advent wurde jeden Abend eine Kerze mehr entzündet. Irgendwann begann man, das hölzerne Rad mit Tannengrün zu umbinden.
Im Jahre 1860 führte Wichern den Adventskranz auch im Waisenhaus Berlin-Tegel ein. Seine Idee verbreitete sich langsam in Norddeutschland. 1925 hing der erste Adventkranz mit 4 Kerzen in einer katholischen Kirche in Köln, seit 1930 fortan auch in München. Um 1935 wurden auch die ersten häuslichen Adventkränze kirchlich geweiht, so wie es bis heute Brauch ist. Dieser Brauch verbreitete sich bis heute weltweit.
Die maximal 28 Kerzen wurden auf 4 reduziert. Es werden meist rote Kerzen verwendet, sinnbildlich für das Blut, was Jesus für die Menschheit vergoss - oder gemäß den liturgischen Farben der Adventszeit drei violette und eine rosa Kerze (für den Gaudete-Sonntag, dem 3. Sonntag im Advent).
Ursprünglich soll der Adventskranz die Zunahme des Lichts ausdrücken, so dass die Geburt Jesu Christi, der für die Christen das “Licht der Welt” bedeutet, zunehmend erwartet wird. Dazu kamen mit der Zeit Deutungen zur Kreisform, zum Tannengrün, zu den verschiedenen Farben der Kerzen und Schleifen. Er wird gern auf den Erdkreis und die 4 Himmelsrichtungen gedeutet. Zudem symbolisiert der Kreis die Auferstehung und somit das Licht der Ewigkeit, mit der Farbe grün wird auf das Leben hingewiesen und die Kerzen stellen das kommende Licht dar, das die Weihnachtsnacht erleuchtet.
Im katholischen Teil Irlands wird eine 5. Kerze in der Mitte des Adventskranzes der 4 Kerzen hinzugefügt. Sie wird an Heiligabend entzündet. Zudem gibt es Traditionen, in denen die Farben der Kerzen denen der Liturgie an den jeweiligen Sonntagen angepasst wird (violett, rot, rosa und weiß). In Schweden dagegen ist die erste Kerze weiß und die restlichen drei violett. Die weiße steht hier für die Paradiesfarbe.
Adventskalender
Die freudige Erwartung in der Adventszeit war schon immer gegenwärtig. Vor allem die Kinder zählen seit jeher ungeduldig die Tage bis zur Bescherung runter. Was war naheliegender, dass man etwas erfand, was nicht nur bildlich veranschaulichte, wie die Tage bis zum Fest immer weniger wurden, sondern zudem auch noch das Warten erleichterte.
Im protestantischen Umfeld fand man die ersten Adventskalender, die es im Laufe der Jahrhunderte in vielen Methoden und Formen gab.
Einige Beispiele:
Man hing jeden Tag ein religiöses Bild mehr auf.
Man malte 24 Kreidestriche an die Wand oder Tür, wovon jeden Tag ein Strich wegewischt wurde (Strichkalender).
Man legte 24 Strohhalme in eine Krippe, wovon jeden Tag ein Halm weggenommen wurde.
Dann gab es Weihnachtsuhren, die jeden Tag ein Stück weitergestellt wurden.
Oder man brannte eine mit 24 Markierungen verzierte Kerze jeden Tag ein Stück runter.
Der erste Adventkalender entstand im 15. Jahrhundert. Dieser Adventkalender zeigte ein Bild mit Maria, dem Kleinen Jesus und einem Baum. Die Zweige des Baumes trugen 24x den Buchstaben "A" für "Ave Maria".
Der erste selbstgebastelte Adventskalender ist vermutlich Mitte des 19. Jahrhundert entstanden.
Der erste gedruckte Adventskalender entstand Anfang des 20. Jahrhundert und bestand aus zwei Teilen. Ein Teil war ein bedruckter Karton mit 24 nummerierten Feldern, wo Verse aufgedruckt waren. Der zweite Teil war ein Blatt mit 24 Bildchen, wo man jeden Tag eins ausschneiden und auf den Karton mit den Versen kleben musste.
Der Adventskalender gewann schnell an Beliebtheit. Anfangs wurde er ausschließlich mit religiösen Bildern bedruckt, später wurden die Bilder eher weihnachtlich-weltlich. Im 2. Weltkrieg wurden Bildkalender, so auch der Adventskalender, aus Mangel an Papier verboten. Erst in der Nachkriegszeit wurden Adventskalender wieder hergestellt
Die Beliebtheit der Adventskalender ist bis heute ungebrochen. Es gibt unzählig viele Formen von Adventkalendern, mit Bildern, Schokolade oder andere Kleinigkeiten für Groß und Klein.
Die Idee zu diesem Gebet ist entstanden, als ich es in einer ähnlichen Form auf einer Social Media-Seite gelesen habe. Zum ersten Mal in meinem Leben war ich von einen Gebet berührt. Ja, sogar zu Tränen gerührt, obwohl es nie in einer Kirche gesprochen wurde - oder vielleicht sogar genau deswegen? Es kommt einfach direkt aus den Herzen. Seit ich es kenne, lese und spreche ich es regelmäßig. Es gibt mir Kraft, Mut, Hoffnung und Trost.
Advents-Gebet
Advent ist Latein und bedeutet Ankunft
Ankunft?
Wir sind ohne Rast und im Herzen unruhig
Bitte gib uns Ruhe und Frieden, damit wir diese Tage
mit deiner Hilfe besonders erleben können.
Hilf uns, auf dass wir mit Geduld warten,
in der wachsenden Erkenntnis, dass das Besondere
seine Zeit braucht, sich zu entwickeln.
Warten auf das allergrößte Geschenk,
das Du uns jemals gemacht hast.
Warten auf den Zauber der Heiligen Nacht.
Warten auf die Wunder der Weihnachtszeit.
Warten auf die Ankunft Deines Sohnes.
Und auf die vielen kleine Zeichen der Engel.
Begreift das größte Geheimnis
als das wunderbarste Geschenk und
die unaussprechliche Freude, die Du, Herr,
uns in der Heiligen Nacht zuteilwerden lässt.
Lass‘ dich verzaubern von dieser Zeit
voller Licht und Liebe,
wo so viele Wunder geschehen.
Sehnsüchtig warten wird auf Dich, Herr,
und in der Stille der Heiligen Nacht hört
man Dich durch den Flügelschlag der Engel.
„Fürchtet euch nicht“
Die Weihnachtsgeschichte
(zum Vorlesen)
Zu jener Zeit ordnete Kaiser Augustus an, dass alle Menschen in seinem Reich gezählt und für die Steuer erfasst werden sollten. Diese Zählung war die erste und wurde durchgeführt, als Quirinius Statthalter der Provinz Syrien war.
Und alle gingen hin, um sich einschreiben zu lassen, jeder in die Heimatstadt seiner Vorfahren. Auch Josef machte sich auf den Weg.
Aus Galiläa, aus der Stadt Nazaret, ging er nach Judäa in die Stadt Davids, nach Betlehem. Denn er stammte aus der Familie von König David.
Dorthin ging er, um sich einschreiben zu lassen, zusammen mit Maria, seiner Verlobten; die war schwanger. Während sie dort waren, kam für Maria die Zeit der Entbindung. Sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe im Stall.Denn in der Herberge hatten sie keinen Platz gefunden.
In jener Gegend waren Hirten auf freiem Feld, die hielten Wache bei ihren Herden in der Nacht. Da trat der Engel des Herrn zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie, und sie fürchteten sich sehr.
Aber der Engel sagte zu ihnen: "Habt keine Angst! Ich habe eine große Freudenbotschaft für euch und für das ganze Volk. Heute ist euch der Retter geboren worden, in der Stadt Davids: Christus, der Herr! Und dies ist das Zeichen, an dem ihr ihn erkennt: Ihr werdet ein neugeborenes Kind finden, das liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe."
Und plötzlich war bei dem Engel ein ganzes Heer von Engeln, all die vielen, die im Himmel Gott dienen; die priesen Gott und riefen: "Groß ist von jetzt an Gottes Herrlichkeit im Himmel; denn sein Frieden ist herabgekommen auf die Erde zu den Menschen, die er erwählt hat und liebt!"
Als die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander: "Kommt, wir gehen nach Betlehem und sehen uns an, was da geschehen ist, was Gott uns bekannt gemacht hat!"
Sie liefen hin, kamen zum Stall und fanden Maria und Josef und bei ihnen das Kind in der Futterkrippe. Als sie es sahen, berichteten sie, was ihnen der Engel von diesem Kind gesagt hatte.
Und alle, die dabei waren, staunten über das, was ihnen die Hirten erzählten. Maria aber bewahrte all das Gehörte in ihrem Herzen und dachte viel darüber nach.
Die Hirten kehrten zu ihren Herden zurück und priesen Gott und dankten ihm für das, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles genauso gewesen, wie der Engel es ihnen verkündet hatte.
Die Weihnachtsgeschichte ist die am häufigsten erzählte Geschichte der Welt. In der Weihnachtszeit, Heiligabend in der Kirche, in vielen Familien unter dem Weihnachtsbaum, im Fernsehen oder als Krippenspiel – Milliarden Menschen haben die Geschichte vom Jesuskind, das von der Jungfrau Maria in einem Stall in Bethlehem zur Welt gebracht wurde, schon gehört und hören sie jedes Jahr immer wieder gern aufs neue. Die wenigsten allerdings wissen, dass sie immer nur eine Variante der Weihnachtsgeschichte hören. Allein schon in der Bibel gibt es drei unterschiedliche Fassungen.
Die Fassung, die meistens am Heiligen Abend verlesen wird, ist größtenteils der Auszug aus dem Lukas-Evangelium. Er stellt eine in sich autorisierte Fassung dar, denn in ihm lassen sich historische Stichpunkte finden, wie der römische Kaiser Augustus oder die erste Volkszählung in Judäa. Zudem ist es eine sehr “menschliche” Geschichte. Die Wanderer Maria und Joseph sind müde, finden keine Herberge und sind froh, in einem Stall unterzukommen. Bei Matthäus ist von einem Stall keine Rede. In seiner Version werden auch nicht Hirten vom Feld durch einen Engel zum Heiland geführt, sondern drei Weise aus dem Morgenland, die einem Stern folgen. Johannes schließlich lässt seine Weihnachtsgeschichte nur als abstrakte Paraphrase über die Menschwerdung des Sohn Gottes erscheinen.
Im Mittelalter wurden noch einige Ausschmückungen in die Weihnachtsgeschichte eingefügt. Vor vielen hundert Jahren war das Zusammenleben von Mensch und Tier unter einem Dach normal – folglich tauchen auch Ochse und Esel im Stall von Bethlehem auf. Sie stellen ihre Krippe dem Jesuskind als Babybett zur Verfügung, wovon die Bibel noch nicht ausging. Die drei Weisen aus dem Morgenland wurden zu Königen befördert und erhielten die Namen Melchior, Kaspar und Balthasar. Die schöne Geschichte von der Geburt Jesu, die wir heute hören, ist meist eine Mischung aus allen Elementen.
Feiertage im Dezember und Heilige rund um die Weihnachtszeit
Zugegebenermaßen ist dieses Kapitel wesentlich umfangreicher geworden, wie ich es mir zu Beginn meiner Recherchen ausgemalt habe. Das lag vor allem daran, dass offensichtlich meine Kenntnisse über die Weihnachtszeit mehr als lückenhaft war. Aber nichtsdestotrotz hat es sich gelohnt, denn, um viel Wissen bereichert, hat dieses Kapitel maßgeblich dazu beigetragen, dass ich die gesamte Weihnachtszeit und den Heiligabend mit ganz anderen Augen sehe. Es ist eine Zeit, deren Bedeutung über den ganzen Stress, „Fresserei“ und „Schenkerei“ weit hinausgeht. So ist der erste Feiertag im Zusammenhang mit Weihnachten bereits im Monat März.
25. März
Mariä Verkündigung
Das Hochfest feiert die Verkündigung der bevorstehenden Geburt des Christus-Kindes an Maria. Der Tag wird auch "Annunziata" genannt und leitet sich von der lateinischen Bezeichnung des Festtags Annunziatio ab, was Verkündigung bedeutet. Es ist der Tag neun Monate vor Weihnachten, an dem der Erzengel Gabriel Maria mit dem Englischen Gruß die Geburt Jesu ankündigte. Der Legende nach war Maria gerade dabei, das purpurne Garn für den Tempelvorhang zu spinnen, nach anderen Überlieferungen schöpfte sie gerade Wasser aus einem Brunnen.
Das Fest wurde bereits Mitte des 6. Jahrhunderts in Konstantinopel (heute: Istanbul) zelebriert. Ab dem 7. Jahrhundert wurde das Fest auch in Rom gefeiert. Dieser Tag galt damals als Frühlingsbeginn und war gleichzeitig der damalige Frauentag. Für Martin Luther war dieser Tag einer der edelsten und wichtigsten Feste überhaupt. In den orthodoxen Kirchen zählt er zu den zwölf Hauptfesten. Den Rang eines Hochfestes in der katholischen Kirche nimmt der Tag erst seit 1969 unter dem Namen „ Fest der Verkündigung des Herrn“ ein. Man wollte damit weg von dem Schwerpunkt Mariens, hin zu der „Feier des Herrentages“.
Legende
Als Elisabet mit Johannes dem Täufer im sechsten Monat schwanger war, sandte Gott den Erzengel Gabriel nach Nazareth in Galiläa zu einem jungen Mädchen mit Namen Maria. Sie war noch unberührt und verlobt mit einem Mann namens Josef, einem Nachkommen Davids.
Der Erzengel kam zu ihr und sagte: „Sei gegrüßt, Maria, der Herr ist mit dir. Er hat dich zu Großem auserkoren!“
Maria erschrak über diesen Gruß und überlegte, was er bedeuten sollte.
Da sagte der Engel zu ihr: „Hab keine Angst, du hast Gnade bei Gott gefunden! Du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird Großes leisten und 'Sohn des Höchsten' genannt werden. Gott, der Herr, wird ihn auf den Thron seines Ahnherrn David erheben. Und er wird für immer über die Nachkommen Jakobs regieren. Seine Herrschaft wird nie zu Ende gehen.“
Maria fragte den Engel: „Wie soll das zugehen? Ich bin doch mit keinem Mann zusammen!“
Er antwortete: „Gottes Geist wird über dich kommen und seine Kraft wird das Wunder vollbringen. Deshalb wird auch das Kind, welches du zur Welt bringen wirst, heilig sein und „Sohn Gottes“ genannt werden. Auch Elisabet, deine Verwandte, bekommt einen Sohn, trotz ihres Alters. Sie ist bereits im sechsten Monat und es hieß doch von ihr, sie könne keine Kinder bekommen. Für Gott ist nichts unmöglich.“
Da sagte Maria: „Ich gehöre dem Herrn und bin bereit. Es soll an mir geschehen, was du gesagt hast.“.
Wissenswertes rund um Mariä Verkündigung
Der 25. März ist ein Fest, das meist in die Fastenzeit fällt, die mit diesem weihnachtlich geprägten Tag unterbrochen wird. In der feierlichen Messe wird der Bericht aus dem Lukas-Evangelium verlesen.
Die Verheißung der Geburt Jesu an Maria wird in der Bibel nur im Lukas-Evangelium dargestellt.
Die Verkündigungsszene, die Begegnung zwischen dem Engel und Maria, ist durch die Jahrhunderte ein häufiges Motiv der Kunstgeschichte und wird besonders in der Renaissance vielfältig dargestellt. Der Erzengel Gabriel ist meistens gemeinsam mit Maria abgebildet. Häufig weisen Madonnenlilien darauf hin, dass Maria jungfräulich ist. Es gibt in der künstlerischen Darstellung der Verkündigung unterschiedliche Phasen/Einzelphasen: Botschaft, Begrüßung und Gespräch.
Mit dem Fest hat sich, bedingt durch das Datum, Frühjahrsbrauchtum verbunden. Der Tag gilt als günstig für die Saat und das Setzen von Bäumen. Außerdem wird das Vieh an dem Tag das erste Mal ausgetrieben.
Das Fest galt in Europa lange Zeit als Jahresbeginn, in England bis in das 16. Jahrhundert.
Bauernregeln
Ist Marien schön und klar, naht die ganze Schwalbenschar.
Wenn der Sonnenaufgang an Mariä Verkündigung ist hell und klar, so gibt es ein gar gutes Jahr.
Schöner Verkündigungsmorgen, befreit von vielen Sorgen.
Ist Maria schön und helle, kommt viel Obst auf alle Fälle.
29. September
Gedenktag für den Erzengel Gabriel (sowie Erzengel Raphael und Erzengel Michael)
Der Name von Erzengel Gabriel bedeutet „die Macht Gottes“ oder auch „die Kraft Gottes“. Er ist der Engel der Verkündigung. So verkündete er Maria, dass sie den Sohn Gottes gebären werde und Zacharias, dass seine Frau Elisabeth Mutter von Johannes dem Täufer werde. Gabriel war der Engel, der Daniel den Sinn der messianischen Offenbarung erklärte, und der als Bote Gottes Zacharias, Joachim, Josef, Maria, Hirten und Königen erschien. Als Verkünder der Geburt Jesu, wurde Erzengel Gabriel auch der Engel der Geburt und der Hoffnung. Zu seiner Aufgabe gehört es, die ungeborenen Seelen der Kinder durch die Schwangerschaft bis zur Geburt zu geleiten.
Die Stelle zwischen Nase und Oberlippe wird die Markierung des Gabriel genannt, weil er die Babys dort berührt, um sie zu ermahnen, die heiligen Gesetze zu beachten. Durch seine Rolle als Engel der Verkündung gilt Erzengel Gabriel als Schutzpatron des Fernmelde- und Nachrichtendienstes, der Boten, Postboten, Postbeamten und Briefmarkensammler und gegen eheliche Unfruchtbarkeit.
Auch die Volksüberlieferung kennt Erzengel Gabriel als den, der die Seele aus dem Paradies holt und während der neun Monate der Schwangerschaft erzieht.
Erzengel Gabriel wird oft mit einer weißen Lilie, dem Symbol der Reinheit und Spiritualität dargestellt. Auf seine Energie sollten wir zurückgreifen, wenn wir uns mit dem uns innewohnenden Funken Gottes verbinden wollen. Durch diese Verbindung können wir Klarheit über unsere Situation und unsere Gedanken schaffen. Diese Klarheit wiederum nimmt die beklemmende und hemmende Unsicherheit von uns. Erzengel Gabriel bestärkt uns bei der Klärung von offenen Fragen und Situationen und stärkt unsere Entscheidungskraft.
Die Energie des Erzengels Gabriel ist hoffnunggebend, freudig, leuchtend und erhellend. Entwicklung, Bewegung, Veränderung zählen zu seinen Bereichen; so begleitet er auch jeden Neubeginn, damit er sich in göttlichem Einklang vollziehe.
Die Aufgaben (Themen) von Erzengel Gabriel werden oft mit Unklarheit, Zweifeln, Unsicherheit, Hoffnung, Reinigung, Licht, Klarheit, Klärung, Entscheidung, Lebensfreude, Neubeginn, Veränderung, Wünschen, starren Strukturen beschrieben.
Diese sehr abstrakte Form der Beschreibung von Erzengel Gabriel möchten wir mit Beispielen ergänzen, welche es uns erleichtern, in den Themen von Erzengel Gabriel gegebenenfalls unsere eigene Lebenssituation zu erkennen.
Die Energie von „Erzengel Gabriel“ wird zum Beispiel eingesetzt,
um sein Lebensziel zu erkennen
zur Bestimmung von neuen Zielen
um sich seiner Wünsche bewusst zu werden und diese formulieren zu können
in Entscheidungssituationen
bei Verdrängungen
bei Hoffnungslosigkeit u. Depressionen
wenn man in einer destruktiven Phase steckt
um gewonnenes Wissen zu festigen
zur Heilung des Inneren Kindes
um innere Bilder, Träume und Visionen zu verstehen
um Trost in Situationen der Veränderung zu erhalten
um Unsicherheit in Sicherheit und Entscheidungskraft zu wandeln
zur Begleitung in der Schwangerschaft
4. Dezember
Gedenktag der heiligen Barbara
Vorab sollte man erwähnen, dass man über die heilige Barbara nichts historisch gesichertes weiß. Alles stammt aus überlieferten Erzählungen und Legenden. Aber auch in Legenden sind oft Kerne von „Wahrheiten” enthalten, die es lohnt, zu finden und zu entschlüsseln. Wahrheiten, die über den Tag hinaus Gültigkeit besitzen und meistens ausgesprochen gut versteckt sind. Legenden sprechen normalerweise in Bildern und Symbolen. Wir sprechen heute direkt, mit Maßangaben und präzisen Zahlen und ohne verborgenen Sinn. Unsere oft oberflächliche Sprache hat wenig Tiefe, kennt oft nur eine leicht verderbliche Aktualität. Wie Pilatus scheuen wir vor der Wahrheit zurück und relativieren: „Was ist Wahrheit?” Unsere literarische Überlieferung, speziell die religiöse, hat aber Tiefen, Wahrheiten, die noch entdeckt werden können.
Die Barbara-Legende ist vermutlich vor dem 7. Jahrhundert im byzantinischen Raum entstanden. Über Byzanz gelangt sie um das Jahr 700 nach Italien. Als die Türken um das Jahr 1000 Kleinasien überrennen, erreichen die Reliquien das Kloster S. Giovanni Evangelista in Torcello. Sie sollen dort „in Sicherheit” verwahrt werden. Die Goldene Legende, die „Legenda aurea”, erwähnt im 13. und 14. Jahrhundert die heilige Barbara noch nicht. In liturgischen Heiligenkalendern ist sie aber schon nachweisbar. Wohl erst im 15. oder 16. Jahrhundert wurde die „Legenda aurea” um die heilige Barbara ergänzt. Das ist auch der Zeitpunkt, wo sie in der Volksfrömmigkeit den „heiligen” Daniel, den Propheten Daniel, ablöst, der bis dahin Patron der Bergleute war, weil er nach den Heiligen Schrift in der „Löwengrube” gesessen hatte (Dan 6,2-29). Seit dem 14. Jahrhundert wurden die Bergbaugebiete in Sachsen, Schlesien und Böhmen besondere Kultlandschaften der heiligen Barbara. Die Verehrung in den Alpen, mit Ausnahme in Tirol, stammt überwiegend aus der Gegenreformation des 17. und 18. Jahrhunderts. Im Ruhrgebiet fand die Barbaraverehrung Einzug mit den Bergarbeitern im neu eröffneten Bergbau.
Die Legende
Barbara, die schöne Tochter des Dioskuros, ein äußerst wohlhabender Kaufmann, wuchs in Konstantinopel (heute: Istanbul) während der Regierungszeit von Kaiser Maximinus Daia Anfang des 4. Jahrhunderts auf. Ihr wurde jeder Wunsch von den Augen abgelesen, weil ihr heidnischer Vater nicht wollte, dass sie zur Christin wurde oder sich zu einer Heirat verleiten ließ, die entgegen seines Glaubens war. So durfte sie auch in einem Turm eigene Gemächer bewohnen. Sie wurde von guten Lehrern unterrichtet. Einer dieser Lehrer, ein Freund des Schriftstellers Origines, erzählte ihr vom Christentum. Schließlich ließ sie sich heimlich taufen. Um einen heimlichen Treffpunkt für andere Christen zu haben, erbat sich Barbara von ihrem Vater die Einrichtung eines Badehauses, was er ihr sofort erfüllte. Barbara ließ zu den beiden Badezimmerfenstern ein drittes hinzufügen, als „Lob des dreifaltigen Gottes“.
Eines Tages hielt ein junger Mann um die Hand der schönen Barbara an und der Vater war nicht abgeneigt, sie ihm zu gewähren, weil der junge Mann von ähnlichen Stand und vermögend war. Sie wollte ihn aber nicht heiraten. Der Vater bedrängte sie nicht, sondern setzt auf Zeit und ging erst einmal auf eine lange Reise. Nach seiner Rückkehr eröffnete ihm Barbara, dass sie Christin ist und nicht daran denkt, einen Heiden zu heiraten. Der Vater reagierte unerbittlich und jähzornig stellte er sie vor die Wahl. Entweder sie heiratet die Heiden oder wird grausam bestraft. Daraufhin floh sie vor dem Vater, der sie mit gezücktem Schwert verfolgte, in einem Felsspalt, der sich wie ein Wunder für sie öffnete.
Ein Hirte beobachtete dies und verriet sie an den Vater, der sie dann auch fand, nach Hause schleppte und sehr schwer misshandelte. Aber das bestärkte sie noch in ihrem Glauben. Nachdem seine Untaten gegen die eigene Tochter nicht halfen, sie umzustimmen, brachte er sie zum römischen Statthalter Marcianus. Der sollte sie nach Reichsrecht wegen Hochverrat zum Tode verurteilen. Dieser ließ sie derart brutal durchprügeln, dass ihre Haut nur noch in Fetzen vom Körper runterhing und niemand mehr daran glaubte, dass sie die Nacht lebend übersteht.
Aber in der Nacht erschien ein Engel des Herrn, der alle Wunden heilte und ihr Beistand für die Qualen, die ihr noch bevorstanden, versprach. Der verbitterte Statthalter ließ sie in der Öffentlichkeit mit Keulen schlagen, die Brüste abschneiden und mit Fackeln foltern. Zu guter Letzt wurde sie zum Tode durch Enthauptung verurteilt. Vor ihrem Tod betete Barbara, daraufhin erschien wieder ein Engel und hüllte sie in ein schneeweiß leuchtendes Gewand. Letztendlich enthauptete der grausame Vater, der darum gebeten hatte, seine Tochter selbst. Er wurde kurz darauf auf dem Nachhauseweg vom Blitz getroffen und verbrannte, was sich alles der Legende nach im Jahr 306 am 4. Dezember unter Kaiser Maximinus Daia zutrug.
Wissenswertes rund um die Heilige Barbara
Schon in vorchristlicher Zeit war dieser Tag von besonderer Bedeutung. Sagen-Gestalten aus vielen verschiedenen europäischen Mythologien erscheinen in der Nacht zum 4. Dezember und erschrecken die Menschen. Diese werden von der Bevolkerung mit dem sogenannten "Bärbeletreiben" verjagt, damit das Glück, Schutz und Fruchtbarkeit einziehen kann.
Die heilige Barbara gilt als Patronin für Bergleute, Baumeister, Feuerwehrleute, Turmwächter und Glockengießer.
Wer die heilige Barbara anruft, wird nicht ohne Sterbesakramente sterben und hat somit die Garantie für den Eintritt in das himmlische Paradies. Da das Mittelalter und die vergangenen Jahrhunderte weniger nach dem verborgenen Sinn gefragt haben, war ihnen lediglich die Verheißung von Bedeutung.
Traditionell werden am 4. Dezember Barbara-Zweige von Obstbäumen, aber auch Flieder, Mandelbäumchen oder Forsythie, abgeschnitten und in Vasen aufgestellt. Zum Weihnachtsabend sollte der Zweig blühen und den Glanz verdeutlichen, den die Geburt des Erlösers gebracht hat. Außerdem sollen die Zweige mit seinen Blüten in der kalten und dunklen Winterszeit symbolisch Licht ins Haus bringen. Jedes Familienmitglied hat seinen eigenen Zweig, um daraus das Glück fürs kommende Jahr ableiten zu können.
Daneben gibt es den Barbara-Weizen. Am Barbaratag werden auf einem Teller Weizen- oder Gerstenkörner ausgesät, die bis Weihnachten aufsprießen sollen. Dieses „winterliche Grün“ ist als Teller-Saat oder Adonis-Gärtchen bekannt. Ist es bis Weihnachten voll zu einem dicken Büschel gewachsen, verspricht es reichen Erntesegen und ist zu Weihnachten ein Hinweis auf „das Licht der Welt“, nämlich Christus.
Außerdem finden in vielen Gegenden, besonders im süddeutschen Raum, Österreich und Schweiz Umzüge oder Aktionen unterschiedlichen Charakters zu Ehren der heiligen Barbara statt.
Bauernregeln
Knospen an St. Barbara, sind zum Christfest Blüten da.
Barbara im weißen Kleid, verkündet gute Sommerzeit.
Geht St. Barbara in Grün, kommt's Christkindel in Weiß.
Und wo hat die heilige Barbara als zweifache Lichtbringerin in der Vorweihnachtszeit ihren Platz?
Sie mahnt uns, auf dass wir uns immer des gegenwärtigen Todes bewusst sind und wachsam zu bleiben, sensibel für das eigene Versagen und einsichtig für die eigene Schuld. Sie leuchtet uns auf dem rechten Weg in den Himmel. In ihr spiegelt sich das Licht der Christusnähe. Eben dies drücken die Barbarazweige aus, in denen uns die Heilige gleichfalls zur Lichtbringerin wird. Was am Barbaratag als Zweig wie tot aussieht, wird in der Heiligen Nacht blühen und das Leben in seiner Fülle zeigen. In den Blüten leuchtet uns das Leben entgegen. In der längsten Nacht des Jahres wird der Sieg des Lichtes angekündigt.
6. Dezember
Nikolaustag
Nikolaus kommt am 6. Dezember und bringt Süßigkeiten oder kleine Geschenke, das weiß jedes Kind. Dass dieser ein Heiliger ist und Bischof vom Myra war, ist nicht überall bekannt. Vor allem dort nicht, wo der Weihnachtsmann den Nikolaus als Hauptgabenbringer ersetzt hat.
Geschichtsforscher haben überdies noch festgestellt, dass manche Begebenheit aus dem Leben des gleichnamigen Abtes Nikolaus in die Nikolauslegende Eingang gefunden hat. Bischof Nikolaus von Sion nahe Myra in der Türkei hat im 4. Jahrhundert gelebt, Abt Nikolaus von Pinara bei Minare in der Türkei lebte 200 Jahre später.
Historisch gesicherte Nachrichten über das Leben und wirken vom heiligen Nikolaus gibt es nicht.
Der Kult um Nikolaus begann zu Beginn des 6. Jahrhunderts an und verbreitete sich auch in Griechenland, wo er als „Überheiliger“ verehrt wird. Kaiser Justinian weihte ihm Mitte des 6. Jahrhunderts eine Kirche in Konstantinopel (heute: Istanbul). Über die byzantinische Tradition wurde Nikolaus, nach Maria, der am meisten verehrte Heilige Russlands. Überhaupt ist der heilige Nikolaus einer der beliebtesten Volksheiligen mit vielen legendären Erzählungen, die vor allem seine menschenfreundliche und hilfsbereite Art bezeugen. In Rom wurde die Nikolaus-Verehrung ab dem 8. Jahrhundert zelebriert und verbreitete sich von dort aus zunehmend in süd- und mitteleuropäischen Raum.
Legende
Der heilige Nikolaus wurde in Patara (Lycien/Kleinasien) als Kind reicher und gottesfürchtiger Eltern geboren. Er war ein außerordentlich fleißiger und gelehriger Schüler und las nur Bücher, die seiner Tugend oder der Wissenschaft dienten. Nie hatte er Interesse, mit anderen Kindern zu spielen, geschweige denn, mal Streiche auszuhecken. Überhaupt vermied er alles, was als „böse“ angesehen wurde und züchtigte seinen Leib mit Fasten, Wachen und Bußgürteln. Auf diese Weise bewahrte er seine erste Unschuld in allen Gefahren.
Als er mit seiner Gelehrsamkeit und in allen Tugenden sehr gute Fortschritte gemacht hatte, wurde er von seinen Onkel und Taufpaten, dem Bischof von Myra, zum Priester geweiht und als Abt im Kloster Sion nahe seiner Heimatstadt eingesetzt. Er führte sein Amt mit großer Sorgfalt und Pünktlichkeit. Von dem Tag seiner Ernennung an verdoppelte er die Strenge gegen sich selbst, im Gebete und in allen anderen guten Werken. Die reiche Erbschaft, welche ihm durch den Pest-Tod seiner Eltern zugefallen war, verwendete er nur zur Linderung und zum Troste der Notleidenden.
Inzwischen hatte der heilige Nikolaus durch seine innige Liebe zu Jesus das Verlangen, die heiligen Orte im gelobten Lande zu besuchen und einen Platz zu finden, wo er Gott in aller Stille dienen konnte. Kaum hatte er am Tage der Abreise das Schiff bestiegen, prophezeite er den Schiffsleuten, dass bald ein entsetzliches Unwetter aufziehen würde. Die Schiffsleute, welche die Sache besser verstehen wollten, glaubten ihn nicht und lachten ihn aus. Als kurze Zeit später tatsächlich ein so heftiger Sturm auf dem Meer tobte, dass alle Reisenden sich für verloren hielten, ersuchten sie den Heiligen, dafür zu sorgen, dass die augenscheinliche Gefahr des Unterganges abgewandt wird. Kaum begann der heilige Nikolaus mit seinem Gebet, legte sich das Unwetter und der Sturm nahm ein Ende.
Nach seiner Ankunft im gelobten Lande wurde er in einer göttlichen Offenbarung ermahnt, zurückzukehren. Er gehorchte, schiffte sich bei nächster Gelegenheit wieder ein und kam zurück ins Kloster, wo er vorher eingesetzt war. Lange blieb er dort aber nicht, denn Gott verlangte von ihm, dass er sich nach Myra, der Hauptstadt von Lykien begeben sollte. Dort sollte zu dem Zeitpunkt eine Bischofswahl stattfinden, da der Amtsinhaber gerade gestorben war. Aus diesem Grunde hatten sich die benachbarten Bischöfe versammelt, um zu beratschlagen, wer denn sein Nachfolger werden sollte. Während sie dies taten, offenbarte ihnen Gott, sie sollten denjenigen zum neuen Bischof wählen, der am folgenden Morgen als erstes die Kirche betreten würde und dessen Name Nikolaus wäre.
Der heilige Nikolaus betrat als erstes die Kirche, ohne etwas von dieser Offenbarung zu wissen. Ein hierzu bestellter Bischof nahm ihn sogleich bei der Hand und führte ihn zu den versammelten Bischöfen, die ihm den göttlichen Willen anzeigten und ungeachtet seiner Tränen und Einwendungen die bischöfliche Weihe erteilten. Sogleich lebte Nikolaus noch heiliger als zuvor. Er übte noch strenger Buße, aß täglich nur einmal, allerdings nie Fleisch und nahm seine Nachtruhe für kurze Zeit nur auf einem Strohsack. Sehr viel Zeit verwendete er für Andachtsübungen. Er predigte an allen Sonn- und Festtagen, besuchte alle Pfarreien, sowie die Kranken, Gefangenen und Armen in der Stadt, unter welche er fast alle seine Einkünfte austeilte.
Die Legende zeichnet ihn als temperamentvollen Streiter und zugleich als Mann der fähig war, diplomatisch zu vermitteln und Gnade vor Recht ergehen zu lassen. In Myra gab es noch immer sehr viele Heiden mit ihren Götzentempeln und es wurden sehr viele Beamte vom Kaiser Licinius eingesetzt, die das Heidentum wieder einführen sollten. Nikolaus tat sein Möglichstes, um dies zu verhindern. So ging er, ohne die Gefahr, Verfolgung oder den Tod für sich selbst zu befürchten, durch alle Gassen, in alle Winkel und Häuser und ermunterte die Christen zur Standhaftigkeit. Dabei wurde er im Jahr 310 zusammen mit vielen anderen von den kaiserlichen Beamten ergriffen, in den Kerker geworfen und immer wieder schwer gefoltert. Erst unter Kaiser Constantin der Große konnte er befreit werden und so der Marter entkommen. Wie groß war seine Freude, als der Kaiser erlaubte, die Götzentempel niederzureißen und christliche Kirchen zu erbauen. Er selbst legte Hand an und ruhte nicht, bis in seinem Bistume alle Götzentempel zerstört waren. Unter anderen zerstörte er auch den großen prunkvollen Tempel der Heidengöttin Diana, die in den Küstenorten Lykiens als Patronin der Seefahrer verehrt wurde. Nikolaus' Gedenktag, der 6. Dezember ist in der Mythologie Dianas Geburtstag.
Bei diesen außerordentlichen Gnadengaben blieb der heilige Nicolaus so demütig, dass er am Ende seines Lebens nur durch die Barmherzigkeit Gottes die Seligkeit erhoffte. Gott tröstete ihn aber hierüber mit den Worten: „Nikolaus, ich werde deine Treue belohnen.” Als der Herr seinen Heiligen von dieser Welt zu sich in die ewige Freude nehmen wollte, bat ihn Nikolaus, ihm einen Engel zu senden. Mit gebeugtem Haupt sah er die Boten Gottes zu sich schweben und begann den Psalm "In te domine speravi" bis zu den Worten "in manus tuas" zu beten, das spricht "Herr, in deine Hände befehle ich meinen Geist". Er starb an einer leichten Krankheit mit dem Troste der heiligen Sakramente am 6. Dezember vermutlich im Jahre 345 in Myra. Damit schied der St. Nikolaus von dieser Welt und es ward ein süßer himmlischer Gesang vernommen. Zur Ruhe gebettet wurde er in einem Sarkophag aus Marmor in Myra.
Wissenswertes rund um den heiligen Nikolaus
Der heilige Nikolaus ist der Patron von Russland, Lothringen, Amsterdam, Kanton und Stadt Fribourg/Schweiz, Meran, Bari und New York; sowie der Kinder, Schüler, Mädchen, Jungfrauen, Frauen mit Kinderwunsch, Gebärenden, alten Menschen, Ministranten, Feuerwehr; der Pilger und Reisenden; der Sinti und Roma; den Gefangenen, Dieben und Verbrecher; der Eigentümer und Bettler; der Seeleute, Schiffer, Fischer, Flößer, Schiffsbauer, Matrosen, Fährleute, Kaufleute, Bankiers, Pfandleiher; der Richter, Rechtsanwälte und Notare, der Apotheker, Bauern, Bäcker, Müller, Korn- und Samenhändler, Metzger, Bierbrauer, Schnapsbrenner, Wirte, Weinhändler, Fassbinder, Parfümhersteller und -händler, Schneider, Weber, Spitzen- und Tuchhändler, Knopfmacher, Brückenbauer, Steinmetze, Steinbrucharbeiter, Kerzenzieher; für glückliche Heirat und Wiedererlangung gestohlener Gegenstände; gegen Wassergefahren, Seenot und Diebe.
Nikolaus gilt also als Helfer in fast allen Schwierigkeiten und Lebenslagen. Ansatzpunkte für das Brauchtum und seine zahlreichen Patronate finden sich in den Legenden. Als Gegenpol zum gütigen Nikolaus, der die Kinder beschenkt, bekam er in vielen Ländern ab dem 17. Jahrhundert Begleiter zur Seite gestellt, der mit Reisigrute, Bocksfuß, Teufelsfratze oder Kettenrasseln die weniger Braven einschüchtern soll:
Knecht Ruprecht in Deutschland
Père Fouettard in Frankreich
Schmutzli in der Schweiz
Krampus in Österreich und Bayern
Housecker in Luxemburg
Zwarte Piet in den Niederlanden
Im 14. Jahrhundert entstand der Brauch des Bischofsspieles in Klosterschulen, wo ein Schüler am Nikolaustag als Bischof fungieren durfte. In der Schule des Klosters Montserrat wird dieser Brauch bis heute gepflegt. Daraus entstand der Brauch, dass der Nikolaus am 6. Dezember Kinder beschenkt. Seit 1555 ist Nikolaus als Gabenbringer für Kinder belegt.
Am 6. Dezember wurde früher traditionell das Gleichnis von den anvertrauten Talenten (=Geld) erzählt: Drei Knechten wurde jeweils die gleiche Summe Geld anvertraut. Jeder musste Rechenschaft ablegen, was er mit dem Geld gemacht hat. Der bekannte Brauch der Befragung der Kinder durch den Nikolaus, ob sie denn auch brav und fromm gewesen seien, geht auf diese Praxis zurück. Ursprünglich war der Nikolaustag - und nicht Weihnachten - der Tag der großen Bescherung mit Geschenken. In einigen Ländern ist er es heute noch.
Martin Luther lehnte diese Legende um Nikolaus in einer Predigt zum Nikolausfest als kindisch 1527 ab. Doch trotz seines Widerstandes ließ Luther Nikolaus als Gabenbringer noch einige Zeit neben dem von ihm bevorzugten Christkind in seiner Familie gewähren. In einer Haushaltsrechnung aus dem Jahr 1535 sind Ausgaben für 135 Nikolausgeschenke an die von Luther und seiner Frau Katharina betreuten Kinder sowie Jahrmarktsgeschenke für das Gesinde aufgeführt. So konsequent, wie Luther den Nikolausbrauch am 6. Dezember bekämpfte, versuchte er, das Beschenken durch das Christkind am 25. Dezember zu beleben, seitdem wurde die Bescherung in vielen - auch in katholischen - Ländern auf Weihnachten verlegt.
Schiffchensetzen nennt man den seit dem 15. Jahrhundert bekannten Brauch, bei dem Papierschiffe gebastelt werden, in die der Nikolaus seine Gaben legen soll. Hintergrund für diesen Brauch dürfte sein Patronat für Schiffer sein. Auch heute noch findet man auf vielen Handelsschiffen ein Bildnis von Nikolaus. Das Nikolausschiffchen wurden später durch Stiefel, Schuhe oder Strümpfe ersetzt, die am Nikolausabend von den Kindern vor die Tür gestellt werden und die über Nacht von ihm mit Süßigkeiten gefüllt werden.
Die frühmittelalterliche Nikolaus-Basilika in Myra, dem heutigen Demre, enthält das leere Grab von Nikolaus. Die früheste Kirche über dem Bischofsgrab in Myra wurde Mitte des 5. Jahrhunderts errichtet, die ältesten Teile des jetzigen Baus stammen aus dem 9. / 10. Jahrhundert. Russlands Zar Alexander I. ließ im Jahr 1853 die Kirche seines Landespatrons teilweise wiederherstellen, nachdem Überschwemmungen und Erdbeben Myra hatten versinken lassen. Der deutsche Archäologe Jürgen Borchardt trug von 1965 bis 1968 durch seine Arbeiten am Ort viel dazu bei, dass die Basilika mit Bodenmosaiken und die restaurierten Fresken wieder freigelegt wurde. Nach fünf Jahren Unterbrechung konnte der griechisch-orthodoxe Patriarch von Konstantinopel am 6. Dezember 2007 dort erstmals wieder einen Gottesdienst zelebrieren.
Sein heiliger Leib wurde im April 1087 von Abenteurern, die in 3 Schiffen anreisten, aus dem Marmorgrab der Nikolaus-Basilika in Myra entführt und nach Bari in Unteritalien gebracht. Dort wurde zu seinen Ehren eine Wallfahrtskirche errichtet, die monumentale Basilika San Nicola, die von Papst Urban II im Jahre 1098 geweiht wurde. Dort liegen die Gebeine bis heute. Der mutmaßliche Ankunftstag der Gebeine in Bari, der 8. Mai, wird jedes Jahr mit einem großen Umzug gefeiert.
Aus seinem Grab in Bari fließt ein wohlriechendes Öl, welches angeblich Kranke heilen soll. Dieses “Manna di San Nicola” wird bis in unsere Zeit jeden Morgen von einem Priester mit dem Schwamm aufgesogen und für die Gläubigen zur Verteilung aufbewahrt.
Nikolaus ist und bleibt der Helfer in allen Nöten! Wer wollte sich nicht an ihn wenden? Nach seinem Tod reißen die Berichte über seine wundersame Hilfe in den verschiedensten Anliegen nicht mehr ab. Bekehrungen von Andersgläubigen, die Umkehr von Sündern von schlechten Wegen, die Wiedererweckung von Toten - alles vermag er bei Gott zu erwirken. Denn das Wunder der Flüssigkeit, die aus dem Gefäß mit seinen Gebeinen tropft, hat sich erneuert.
1090 brachte der Kreuzzugsteilnehmer Aubert de Varangéville aus Bari ein Fingerglied der Segenshand von Nikolaus nach Port, dem heutigen St-Nicolas-de-Port in Lothringen, wo 1093 eine erste Kirche errichtet wurde, die 1193 durch eine größere Kirche ersetzt und ein bedeutendes Wallfahrtsziel wurde.
972 brachte Kaiserin Theophanu anlässlich ihrer Hochzeit mit Kaiser Otto II. Reliquien aus Byzanz mit. Sie befinden sich seit 1058 in der Nikolaus-Kapelle am südlichen Seitenschiff des Domes in Worms. Um 980 entstand in Deutschland die erste Nikolauskirche im Kloster Brauweiler. Vom 11. bis zum 16. Jahrhundert wurden diesseits der Alpen mehr als 2200 Kirchen nach Nikolaus benannt.
Der Name Nikolaus, auch Nicolaus, ist griechischen Ursprungs (griech. Nikolaos, zu griech. nik? => Sieg und laos => Volk, Kriegsvolk).
Was der Nikolaus mit Spekulatius zu tun hat, wird in dem Kapitel "Symbole, Bräuche und Traditionen rund um die Weihnachtszeit" nachzulesen sein.
Bauernregeln
Regnet es an Nikolaus, wird der Winter streng, ein Graus.
Trockener St. Nikolaus, milder Winter rund um's Haus.
Fließt zu Nikolaus noch Birkensaft, dann kriegt der Winter keine Kraft.
8. Dezember
Mariä Empfängnis
Am 8. Dezember, mitten im Advent, feiert die Kirche jedes Jahr das „Hochfest der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau und Gottesmutter Maria“, das verkürzt "Unbefleckte Empfängnis" oder „Mariä Empfängnis“ genannt wird.
Der nicht einfache Name und die große Bedeutung der üblichen Adventsbräuche lassen dieses Fest sehr stark in den Hintergrund treten. Es bekommt daher wenig Beachtung. Auch der Name „Mariä Empfängnis“ ist für manche schwer verständlich. Es geht hier nicht darum, dass Maria Jesus empfangen hat, sondern dass Maria selbst im Schoss Annas empfangen wurde. Marias Eltern, Anna und Joachim konnten lange Zeit keine Kinder bekommen. Joachim ging für 40 Tage in die Wüste, um zu fasten und zu beten, während Anna im Gebet in Jerusalem blieb. Ein Engel Gottes erschien Joachim und teilte ihm mit, dass er und Anna ein Kind erwarten werden. Freudig lief er nach Jerusalem und traf Anna vor dem Tempel, an der "Goldenen Pforte". Beide umarmen sich, dieser Moment wird als "Mariä Empfängnis" bezeichnet. Maria ist also "unbefleckt empfangen" worden und somit frei von jeglichem Makel der Erbsünde.
Da Gott Maria von Anfang an als diejenige auserwählt hatte, die Jesus zum Sohn haben würde, sprach er Maria schon vor ihrer Geburt von aller Erbsünde frei. Das bedeutet, dass Maria nicht in die Schuld Adams und Evas hineingeboren wurde. Maria ist von Gott begnadet worden, daher auch die Anrede im Mariengebet: „Gegrüßt seist du Maria, voll der Gnade...“ Auch die Worte des Erzengels Gabriel zeugen von dieser Gnade im Lukasevangelium: „Sei gegrüßt, du begnadete, der Herr ist mit dir.“
Der Ausdruck „unbefleckt“ hat nichts mit der Sexualität zu tun, sondern dass Maria empfangen worden ist, ohne in die Erbsünde verstrickt zu sein. Manchen bereitet heute auch die Vorstellung von der „Erbsünde“ Schwierigkeiten, nicht zuletzt deswegen, weil unser Wissen in Glaubensfragen in den letzten Jahrzehnten mächtig geschrumpft ist. Die feierliche Definition der „Unbefleckten Empfängnis“ gehört, wie die Gottesmutterschaft und die immerwährende Jungfräulichkeit Mariens, zur christologischen Lehre der Kirche.
Ursprünglich hieß der erstmals im 12. Jahrhundert durch Anselm von Canterbury in England eingeführte Feiertag „Tag der Empfängnis der Allerheiligsten Gottesmutter durch Anna“. Unter Papst Sixtus IV wurde das Fest 1477 im Bistum Rom als Hochfest mit Messe eingeführt und seitdem am 8. Dezember gefeiert. Ein innerhalb der gesamten katholischen Kirche stattfindender Feiertag wurde der 8. Dezember unter der heutigen Bezeichnung „Mariä Empfängnis“ erst im Jahre 1708 unter dem damaligen Papst Clemens XI. Und Papst Pius IX verkündete im Jahre 1854 das "Dogma der ohne Erbsünde geborenen Gottesmutter Maria".
Papst Pius IX.: Zu Ehren der Heiligen und Ungeteilten Dreifaltigkeit zu Schmuck und Zierde der jungfräulichen Gottesmutter zur Erhöhung des katholischen Glaubens und zur Mehrung der christlichen Religion in der Autorität unseres Herrn Jesus Christus der seligen Apostel Petrus und Paulus und der Unseren erklären verkünden und definieren Wir: „Die Lehre, dass die seligste Jungfrau Maria im ersten Augenblick ihrer Empfängnis durch ein einzigartiges Gnadenprivileg des allmächtigen Gottes, im Hinblick auf die Verdienste Jesu Christi, des Erretters des Menschengeschlechtes, von jedem Schaden der Erbsünde unversehrt bewahrt wurde, ist von Gott geoffenbart und darum von allen Gläubigen fest und beständig zu glauben.“
Im engeren Sinn erklärt das Dogma der Unbefleckten Empfängnis, „dass die allerheiligste Jungfrau Maria vom ersten Augenblick ihrer Empfängnis an durch eine einzigartige Gnade und ein einzigartiges Privileg des allmächtigen Gottes und in Anbetracht der Verdienste Jesu Christi von jedem Makel der Erbsünde freigehalten worden ist.“
Dieses Dogma hat sowohl eine
negative
als auch eine
positive
Bedeutung, die sich gegenseitig ergänzen. Die
negative
Bedeutung betont die Freiheit Marias von der Erbsünde dank der vorweggenommenen oder rückwirkenden (hier vorbeugend genannten) Gnade des Erlösungsaktes Christi. Durch das gleiche Vorkommnis weist das Dogma auf die vollkommene Heiligkeit Marias hin. Diese
positive
Bedeutung ist die Folge des Nichtvorhandenseins der Erbsünde. Das Leben Marias wird für immer und aufs Engste mit Gott verbunden und auf diese Weise ist sie die überaus Heilige.
Obwohl es schwer zu erklären ist, die Erbsünde verursacht Unruhe im Denken und in der Handlungsweise besonders im Hinblick auf die Vorrangstellung der Gegenwart Gottes in unserem Leben. Indem sie sie als unbefleckt empfangen erklärt, sieht die Kirche in Maria infolgedessen jemand, der niemals Gott das geringste Liebeszeichen verweigert hat. Das Dogma verkündet, dass vom ersten Augenblick ihres Daseins Maria außergewöhnlich heilig und in beständiger Verbindung mit der heiligmachenden Gnade des Heiligen Geistes war.
Der Gedenktag für Anna und Joachim, den Eltern Marias, ist der 26. Juli
Bauernregel
Zu Mariä Empfängnis Regen, bringt dem Heu keinen Segen.
13. Dezember
Heilige Luciavon Syrakus
Auch um das Leben von Lucia, dessen Todestag der 13. Dezember ist, ranken sich zahlreiche Legenden.
Ihre historische Existenz ist, im Gegensatz zu vielen anderen Heiligen, seit der Entdeckung der Gebeine in der Katakombe San Giovanni in Syrakus gesichert. Syrakus auf Sizilien war zum Zeitpunkt ihrer Geburt ein Zentrum frühchristlichen Glaubens.
Ihr Todestag ist gleichzeitig ihr liturgischer Gedenktag, der in vielen Ländern ausgesprochen populär ist.
Legende
Die heilige Lucia kam zum Ende des 3. Jahrhunderts, vermutlich um 280 n.Chr. in Syrakus, damals eine große und prachtvolle Stadt, zur Welt. Sie stammte aus einer reichen Patrizierfamilie. Der Name des Vaters ist unbekannt, die Mutter hieß Eutychia.
Zum Zeitpunkt ihrer Geburt existierte im römischen Recht ein Dekret, wonach „die Christen nicht gesucht werden dürfen. Wenn sie aber angeklagt werden, sollen sie auch bestraft werden". Kaiser Diokletian sah die Christen anfangs eher wohlwollend an, gab es doch in der eigenen Familie auch welche (Mutter und Tochter). Ab den Jahre 303 änderte sich seine Meinung grundlegend.
Der Vater starb, als Lucia 5 Jahre alt war. So wurde sie fortan liebevoll und behütet von der fürsorglichen Mutter Eutychia allein aufgezogen. Lucia wuchs zu einem lebhaften Mädchen voller Schönheit und Tugend heran. Eutychia sah es mit Wohlgefallen, aber auch mit Herzklopfen.
Die Leute bewunderten sie und die jungen Männer fanden Gefallen an ihr. Die Mutter wünschte sich für ihre Tochter natürlich einen schönen und reichen Mann. Am besten einen Adeligen, der ihr ein angenehmes Leben bieten konnte, sie liebte und ihre herrlichen Tugenden der Bescheidenheit, Nächstenliebe, Intelligenz und Kultur anerkannte.
Lucia hatte aber den großen Wunsch, der Jungfrau Maria ähnlich zu werden und ihr Leben nur Gott zu widmen. Von der Mutter zur Aufrichtigkeit, Nächstenliebe und Wohltätigkeit erzogen, verbrachte sie ihre Zeit mit Gebet, Studium der Religion, Meditation und Hilfe an den Armen. Sie besuchte oft heimlich die nördlich von Syrakus gelegenen Katakomben, stärkte dort ihren Glauben an Jesus und erhob ihren Geist in der Bewunderung des göttlichen Schöpfers.
Niemand, nicht einmal der Mutter, vertraute sie an, dass sie geschworen hatte, ihr Leben niemand anders zu widmen als Gott. Erst recht nicht, als sie von den Plänen der Mutter erfuhr, sie zu verheiraten. Ein junger Adeliger, schön und wohlhabend, bat Eutychia um die Hand von der Tochter. Obwohl er Heide war, kannte die Mutter doch sein Gutmütigkeit und liebes Wesen. Ihn zum Christentum zu bekehren, sollte kein Problem sein. So war er ein Schwiegersohn, wie Eutychia ihn sich wünschte.
Eutychia litt da an einer schweren und unheilbaren Bluterkrankung und sie sorgte sich um die Zukunft der Tochter. Und so war es mehr als verständlich, dass sie ihr einziges Kind gut versorgt wissen wollte, da die Ärzte ihren baldigen Tod prophezeiten.
Lucia machte sich große Sorgen um die Gesundheit der innig geliebten Mutter. Sie überredete die Mutter zu einer Pilgerfahrt nach Catania zum Grab der heiligen Agatha, die den Märtyrertod unter dem Kaiser Decio im Jahr 251 gestorben war. Die Wunder, die an diesem Grab stattfanden, zogen viele aus ganz Sizilien an.
Am Gedenktag der Heiligen, den 5. Februar, erreichten sie das Grab und nahmen auch gleich andächtig an der stattfindenden Messe teil. Zu großen Überraschung der beiden Frauen las der Priester an dem Tag von der Heilung der Blutkranken laut Matthäus:
"....Und siehe, eine Frau, die zwölf Jahre blutflüssig war, trat von hinten heran und rührte die Quaste seines Kleides an; denn sie sprach bei sich selbst: Wenn ich nur sein Kleid anrühre, so werde ich geheilt werden. Jesus aber wandte sich um, und als er sie sah, sprach er: Sei guten Mutes, Tochter; dein Glaube hat dich geheilt. Und die Frau war geheilt von jener Stunde an." (Matthäus IX/20-22)
Die beiden Frauen nahmen es als gutes Vorzeichen und beteten am Grab zur heiligen Agatha voller Hoffnung, dass Gott die Heilung der Mutter erwirken würde. Auch als die Gläubigen nach der Messe die Kirche bereits verlassen hatten, verharrten Mutter und Tochter kniend im Gebet vertieft im Halbdunkel der Kirche am verehrten Grab.
Müde von der Reise schlief Lucia dabei ein. Während sie schlief, erschien ihr die heilige Agatha im Traum, umgeben von Engeln und hellem Licht. Sie sprach lächelnd zu Lucia: „Lucia, meine Schwester und Braut Christie! Warum flehst du um etwas, wenn du es selbst für deine Mutter tun kannst? Eutychia ist geheilt. Dein fester Glaube hat sie gerettet. Es geht ihr gut und das ist dein Verdienst. Aus deinem Herzen hast du einen heiligen Ort für Gott gemacht und deine Seele hast du Gott geschenkt."
Einen Moment später erwachte Lucia und sah ihre Mutter noch immer kniend beten. Sie rief sie leise und erzählte ihr von dem Traum. Voll Freude kniete Eutychia wieder nieder und fühlte die Kraft wiederkommen. Ihr Herz war voller Liebe und Dankbarkeit und fragte nun, was sie in diesem glücklichen Augenblick für Gott tun könnte.
Lucia fühlte, dass sie die Mutter nun in ihrem Lebensplan einweihen konnte. Eutychia war so glücklich über ihre Heilung, dass sie sich über den Entschluss der Tochter nicht beklagte. Lucia überredete die Mutter sogar, dass sie die Mitgift und sämtlichen Besitz verkauft, um die Erlös unter den Armen zu verteilen.
Während sich dies alles zutrug, beschloss Kaiser Diokletian immer strengere Edikte mit immer schwereren Strafen, wenn man denen nicht Folge leisten würde. Die Kontrolleure nahmen ihre Aufgabe sehr ernst und bestraften jeden hart, wenn man sich weigerte, den Götzen öffentlich zu opfern. Überall waren Spione und beim kleinsten Hinweis wurden die Leute als Christen bei den Behörden angezeigt.
Wieder daheim in Syrakus angekommen, hielt sich Eutychia, trotz dieser gefährlichen Atmosphäre, an ihr Versprechen und veräußerte sämtlichen Besitz, um den Erlös an Bedürftige zu verschenken. Der junge Adlige, der um Lucias Hand angehalten hat, wunderte sich darüber und fragte nach. Lucia antwortete ihm mit höflicher Entschlossenheit, dass sie ihn nicht heiraten könnte, weil sie ihr Herz bereits Jesus geschenkt hat. Dabei leuchteten ihre Augen so wunderbar und überzeugend, als wären sie nicht von dieser Welt.
Lucias Gelassenheit und die Unmöglichkeit, seine Wünsche nicht erfüllt zu bekommen, ließ seine Liebe in Wut und Hass umwandeln. Er beschloss die Lage zu klären und wollte nur Rache. Ohne Umwege ging er zu den Behörden und erstattete Anzeige gegen beide Frauen. Das geschah am 13. Dezember 304. Der Statthalter Pascasio handelte ohne Verzögerung und befahl, die junge Christin Lucia vorzuführen.
Das Mädchen trat völlig ruhig und entspannt auf. Sie hatte ja weder etwas zu verlieren, noch zu fürchten. Und sie vertraute darauf, dass Jesus ihr bei der Befragung durch die Richter die richtigen Antworten eingeben würde. Pacasio kannte ihren hohen sozialen Stand und bewunderte Lucia mit ihren hellbraunen Haaren und den schönen Augen. Da diese Verfahren immer vor großen Menschenmassen stattfanden, begann er das Verhör mit großer Ehrfurcht. Viele der Anwesenden wussten von Lucias Wohltätigkeit.
Egal, was Pascasio sagte oder ihr mit Folter antat, er schaffte es nicht, Lucia von ihrem Glauben und der Liebe zu Jesus abzubringen. Im Gegenteil, sie wirkte immer entschlossener, obwohl sie große Angst hatte. Wohlwissend um die qualvollen Strafen des Ediktes, waren ihre letzten Stunden nun gekommen.
Und sie war bereit, die Märtyrerkrone zu empfangen und ihrem himmlischen Bräutigam, Jesus, zu begegnen. Die heilige Agatha war bei ihr, lächelte sie an und lud sie ein. Sie wandte ihre Augen und Seele zum Himmel und sprach ihre letzten prophetischen, unvergesslichen Worte:
„Ich weiß, meine Stunde ist gekommen und ich werde sterben. Aber ich sage dir, die Kirche Gottes wird den Frieden wiederfinden. Alle Herrscher, auch Diokletian und Massimiano, werden vergehen, aber das Christentum wird siegen um sich immer weiter ausbreiten.“