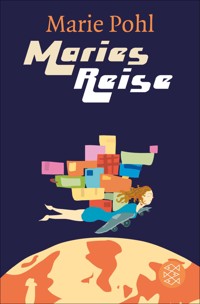
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Maries Reise - Eine unerschrockene Weltreise auf der Suche nach der Generation des neuen Jahrtausends Mit gerade mal zwanzig, zwischen Abitur und Studium, hat Marie Pohl einen Plan: Eine Reise um die Welt zu Menschen ihres Alters, die genau wie sie beginnen, ihr Leben aufzubauen. »Ich suche: Die interessantesten Personen meiner Generation, einer Generation, die genauso am Anfang steht wie dieses Jahrtausend.« Die Stationen ihrer Suche sollen sein: Berlin, Havanna, Buenos Aires, San Francisco, Hanoi, Tiflis, Jerusalem und Helsinki – in jeder Stadt will sie einen Monat bleiben. Ein Verlag zahlt die Flugtickets, der ›stern‹ druckt Fotos von unterwegs. Entstanden ist auf diese Weise ein ebenso kluges und unerschrockenes wie hinreißend charmantes Buch voller Geschichten: »Pohl isst Schlangensuppe in Vietnam und guckt nächtelang den Tangotänzern in Buenos Aires zu, sie findet einen Matrosen, der jedem Schiff den Untergang bringt, und stellt fest, dass im leisen Finnland sogar Besoffene lautlos torkeln« (Berliner Zeitung). In Havanna verfällt sie der süßen karibischen Lethargie und verliebt sich in den schwarzen Musiker Pablo, in Hanoi rast sie mit einem Moped-Rennfahrer durch die Straßen. Besucht in San Francisco einen wortkargen Computermillionär und eine israelische Siedlerin und Soldatin in der Nähe von Ramallah. – Geschichten von Zwanzigjährigen rund um den Globus, die uns etwas über die Welt von morgen verraten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 432
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Marie Pohl
Maries Reise
Über dieses Buch
Mit gerade mal zwanzig, zwischen Abitur und Studium, hat Marie Pohl einen Plan: Eine Reise um die Welt zu Menschen ihres Alters, die genau wie sie beginnen, ihr Leben aufzubauen. »Ich suche: Die interessantesten Personen meiner Generation, einer Generation, die genauso am Anfang steht wie dieses Jahrtausend.« Die Stationen ihrer Suche sollen sein: Berlin, Havanna, Buenos Aires, San Francisco, Hanoi, Tiflis, Jerusalem und Helsinki – in jeder Stadt will sie einen Monat bleiben. Ein Verlag zahlt die Flugtickets, der »stern« druckt Fotos von unterwegs.
Entstanden ist auf diese Weise ein ebenso kluges und unerschrockenes wie hinreißend charmantes Buch voller Geschichten. Inzwischen ist Marie Pohl Schriftstellerin, Journalistin, Schauspielerin und Sängerin und lebt in Berlin und New York. Ihr jüngstes Buch ›Geisterreise‹ führte sie erneut um die ganze Welt. In Havanna verfällt sie der süßen karibischen Lethargie und verliebt sich in den schwarzen Musiker Pablo, in Hanoi rast sie mit einem Moped-Rennfahrer durch die Straßen. Besucht in San Francisco einen wortkargen Computermillionär, der früh genug an AOL verkauft hat, und eine israelische Siedlerin und eine Soldatin in der Nähe von Ramallah. – Geschichten von Zwanzigjährigen, die uns etwas über die Welt von morgen verraten.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Covergestaltung: +malsy, Bremen
Coverabbildung: Max Bode
Erschienen bei FISCHER E-Books
© S.Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2013
Erstveröffentlichung 2002 bei Rogner & Bernhard GmbH & Co. Verlags KG, Hamburg
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-402989-4
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Widmung
Das Exposé
Ich und die Idee
Die Ziele
Das Geld
Der Berlin-Pilot
Gestern ist mir etwas [...]
Der Weg zum Meer
Wahn – Sinn
Martha Ficke
Die letzte Nacht
Havanna
Der Malecón. Die Uferpromenade, [...]
Fruta Bomba I
Mirta
Fruta Bomba II
Romeo y Julieta
Yassel
Mirta
Die Fahrt nach Alamar
Yunior
Fruta Bomba III
Mursoli
Yassel und Yunior und Danae
Fruta Bomba IV
Der Zwischenstopp
Buenos Aires
Ich komme um zwölf [...]
Die Milonga
Sabrina
Der Weinspezialist
La Estrella
Geraldine
In der Küche
Die Kathedrale
Auf dem Friedhof
Boca
San Francisco
In San Francisco suche [...]
Der Millionär
Der HipHopper
Der Insektenforscher
Hanoi
Hai packt die Schlange [...]
Die kleine Katastrophe
Tbilissi
Makka dreht die Musik [...]
Die Gastgebertradition
Sukhos Geschichten
Rati und Lascha
Bei Lelako
Gios Computer
Die Nacht zu meinem Geburtstag
Das Konzert von Joe Zawinul
Auf Georgien!
Die Passkontrolle
Jerusalem
Ich spüre die Stadt [...]
Besuch bei der Armee
Fuad und Auni
Ilan, Etan und Gozal
Meital
Stau
Der graue Tag
Helsinki
Ich laufe eine graue [...]
Hotel Fenno
Anton I
Einige Fakten
Die Köchin Liisa
Am See
Die Krebsbrosche
Anton II
Otto aus Ostrobotnia
Das kleine Wochenende
In der Stadt
Das Krebsdinner
Anton III
Päivikki und ihre Männer
Das Glück des Malers
Anton IV
Bei Stockmann
Anton V
Die Treppe von Finn Air
Die letzte Nacht
End Los
Danksagung
Abbildungsnachweis
Für Oma W. & Für Lucie
Dieses Buch ist eine wahre Geschichte,
so wahr, wie ich sie er- und gefunden habe.
Das Exposé
Frage nie jemanden nach deinem Weg,
denn es könnte sonst sein,
dass du dich nicht verirrst.
RABBI NACHMAN
Ich und die Idee
Ich suche: die interessantesten Personen meiner Generation
In: Berlin, Havanna, Buenos Aires, San Francisco, Hanoi, Jerusalem, Tbilissi, Helsinki
An einem regnerischen Freitag im Juli wurde ich vor zwanzig Jahren in Hamburg geboren. Bis ich dreizehn war, wohnte ich mit meiner Familie in Hamburg, Berlin, Zürich und Köln. Dann zogen wir nach New York.
An einem sonnigen Septembertag 1997 nahm ich mein Abitur und meinen braunen Hut, verabschiedete mich von meiner Mutter, von meinem Vater und von meiner kleinen Schwester und flog nach Madrid. Dort lebte ich anderthalb Jahre, studierte Spanisch an der Universidad de Complutense und arbeitete als Praktikantin bei einer Kinofilmproduktion. Tagsüber kletterte ich Gerüste hoch und bat Bauarbeiter mit all meinem Charme, nur noch einmal, für die letzte Klappe, den Bohrer ruhen zu lassen. Abends las ich Don Quijote oder diskutierte in einer Bar an der Plaza Santa Ana die Ergebnisse von Real Madrid.
An einem bewölkten Oktobertag 1998 landete ich mit einer Iberia-Maschine in Berlin. In meinem Koffer trug ich eine dritte Sprache, ein weiteres Diplom, ein Bündel Erfahrungen und meinen deutschen Pass. Ich wollte wissen, wie es sein würde, nach sieben Jahren wieder in Deutschland zu leben. In Berlin arbeitete ich als Assistentin bei einem Regisseur. Mein erster richtig großer Job. Dort traf ich auch meine erste große Liebe.
Ich wohnte im Prenzlauer Berg. Was meine Mutter wohl gedacht haben muss? Mit dreizehn war sie mit ihrer Familie aus Rumänien in die DDR eingewandert, einen Tag bevor die Mauer gebaut wurde, und musste dort bis zu ihrem 26. Lebensjahr bleiben. Dann wurde sie ausgebürgert. Sie hatte mich bis über den Atlantik nach New York gebracht. Aber kaum war ich ein Jahr aus dem Haus, zog ich in den Osten Berlins und übermalte die DDR-Blumentapeten mit weißer Farbe. Schicksal!
Am 6. Juli 1999 regnete es in Zürich in Strömen. Es war mein zwanzigster Geburtstag. Die große Liebe war in der Nacht zuvor in den See gefallen und ertrunken. Platsch! Meine Wohnung in Berlin hatte ich Ende Juni verlassen und den tollen Job gekündigt. Nun stand ich in diesem warmen Zürcher Regen ohne Freund, ohne Wohnung, ohne Job und ohne feste Zukunftspläne.
Zwanzig Jahre jung und alles vor mir. Entscheidungen treffen: Wie will ich leben, wo will ich leben, was will ich erleben? Der Regen und eine Menge Fragen prasselten auf mich nieder. Was ist das für eine Zeit, dachte ich, diese Anfangs-Aufbau-Zeit?Berlin wird neu aufgebaut, und wir gucken dabei zu. Ich fange an, mein Leben aufzubauen, und ich frage mich: Was bauen die anderen Zwanzigjährigen so? Runde Häuser? Eckige? Schwarze? Weiße oder bunte?
Ich habe mich jetzt entschieden, bevor ich studiere, bevor mich alle mit Sie ansprechen, bevor sich das Fräulein Marie auf seinen auserwählten Weg macht, möchte ich meine Generation in ihrer Anfangs-Aufbau-Zeit finden und porträtieren. Meine Zeit fasziniert mich, und ich will mehr über ihre Menschen erfahren.
Wie Egon Erwin Kisch sagt: »Nichts Sensationelleres gibt es in der Welt als die Zeit, in der man lebt.«
Die Ziele
Ich habe mir natürlich die Städte ausgesucht, die mich am meisten interessieren, von denen ich träume:
Da ich in Berlin lebe, habe ich eine ganz andere Phantasie zu der Stadt als zu den kommenden. Doch Berlin ist groß und vielfältig und ich werde mir auch hier eine Reise ins Unbekannte zusammenstellen.
Den ganzen Herbst möchte ich Interviews machen, um dann darüber zu schreiben, eine Art Pilot für die Reise und Übung für mich. An dem Thema arbeite ich noch. Aber ich werde auf jeden Fall einen oder mehrere Einzelkämpfer suchen. Mit Einzelkämpfer meine ich Persönlichkeiten, die in der ganzen Stadt bei den verschiedensten Cliquen bekannt sind, die überall alleine auftauchen und sich alleine durchs Leben schlagen. Berlin ist ja bekannt für seine skurrilen Typen.
»Wenn wir an den Materialismus geglaubt hätten, wären wir nicht, was wir sind. Wir sind ein besonderes Volk, wir Kubaner«, sagt Ibrahim Ferrer in Wim Wenders’ Film Buena Vista Social Club.
Wenn ich von Havanna träume, dann sehe ich bunte Häuser und die bunten Chevis, sehe die Wellen über die Ufermauer spritzen, höre die zauberhafte Musik und weiß doch nicht, was mir begegnen wird. Denn ich kenne keinen, der nicht in Geld- und Internet-Spinnweben seine Mahlzeit fängt, der ohne all die Dinge lebt, die für uns so wichtig im Leben sind. Ich kenne dieses andere Glück nicht und auch nicht die Diktatur.
Außer mit seiner Musik und seinen Zigarren liegt Kuba angeblich sehr weit vorn in der biochemischen Forschung. Außerhalb der verfallenden Prachtbauten von Havanna sollen sich Fabrikpaläste befinden, in denen man als erstes Land in der Welt die Hepatitis-Impfung entwickelt hat. Während ein Kubaner im Monat nicht mal zwanzig Dollar verdient, investiert Fidel Castro viel Geld in die Forschung. Vielleicht träumt er von einem Impfserum gegen Aids? Gibt es junge Leute, die dort arbeiten? Oder vielleicht welche, die gegen Fidel arbeiten? Und was sagt eine Zigarrendreherin dazu?
Ich suche in Havanna: einen zwanzigjährigen Biochemiestudenten, einen zwanzigjährigen politischen Dissidenten, eine zwanzigjährige Zigarrendreherin.
Wenn ich von Buenos Aires träume, sehe ich wunderschöne Männer, die unglaublich gut küssen können und mit stolzen Frauen Tango tanzen. Ihre Rücken lehnen sich nach Europa und mit ihren Füßen stehen sie in Südamerika. Sie denken europäisch und lieben südamerikanisch. Darauf sind sie stolz und dafür werden sie verachtet. Außenseiter im eigenen Kontinent.
Buenos Aires hat das älteste U-Bahn-System von ganz Südamerika. Ich will einen zwanzigjährigen U-Bahn-Arbeiter finden, der diese Unterwelt in- und auswendig kennt und mir das Paris von Südamerika einmal von unten zeigt.
Auf meiner Reise möchte ich unbedingt auch nach Nordamerika, in die USA. So oft hörte ich Deutsche oder Spanier über die Amis lästern, ein Klischee nach dem anderen wird da immer wieder durchgekaut. Ich selbst habe viel gemeckert, als ich dort lebte. Doch das tut man überall, nicht wahr?
Ich mag an den USA, dass sie mich immer wieder mit etwas völlig Unerwartetem überraschen, ich mag die Einwanderer, die Größe, die extremen Gegensätze.
In San Francisco will ich einen zwanzigjährigen HipHopper suchen und an der Stanford University oder der Berkeley University einen Collegestudenten, der davon besessen ist, amerikanischer Präsident zu werden.
Vietnam und der Vietnam-Krieg waren ein brisantes Thema in meiner Schule in New York. In der zehnten Klasse war ich auf einer amerikanischen High School in Brooklyn, und in diesem Schuljahr lernt ganz Amerika im Geschichtsunterricht: American History!
Ich hatte einen langen, dünnen Lehrer mit einem sehr kleinen Kopf und einer Tätowierung auf dem Arm, einer Schlange, die so aussah wie er. Und dieser Herr erzählte uns von einem amerikanischen Präsidenten nach dem anderen. Wir waren ihm ziemlich egal. Bei den Tests hatte jeder das Lehrbuch unterm Tisch, er saß vorne und schnitt sich die Fingernägel.
Aber als wir zum Thema Vietnam-Krieg kamen, wurde alles anders. Er schritt beim Erzählen durch die Reihen, hielt plötzlich vor deinem Tisch an und schoss mit seinem kleinen Kopf blitzschnell ganz nah an dein Gesicht, schaute dir tief in die Augen und fragte: »Na, und deine Eltern?« Er war ein Widerstandskämpfer gewesen, aber ein heftiger, er verabscheute alle Soldaten. Das sagte er nie so direkt, sondern immer nur durch Anspielungen.
Beim Test lief er ununterbrochen durch das Klassenzimmer, keiner sollte schummeln, alle sollten lernen, dass dieser Krieg eine Schande für das Land gewesen war. Mit seinen eigenartigen Methoden erreichte er immerhin, dass jeder Schüler nach dem Unterricht auf dem Weg zu seinem Spind über den Krieg nachdachte. Und ob es nun an seinen bildhaften Beschreibungen des Dschungels lag, den er nie gesehen hatte, oder an seinen Hymnen auf die tapferen Vietnamesen, weiß ich nicht, aber ich schwor mir, eines Tages nach Vietnam zu fahren.
Es gibt in Hanoi ein Wasserpuppen-Theater, in dem die Geschichte Vietnams erzählt wird. Ich will dieses Theater besuchen und mit einem zwanzigjährigen Puppenspieler sprechen.
Außerdem liebe ich das vietnamesische Essen und suche deshalb einen jungen Meisterkoch.
O Georgien!
Meine besten Freundinnen in New York sind Ketuta und Tatia. Ketuta und Tatia sind die schönsten Mädchen, die ich kenne. Und Georgisch ist die schönste Schrift, die ich je las. Elegant, eigen, fremd und weich. Vielleicht eine Mischung aus Griechisch und Arabisch.
Die Mädchen haben pechschwarzes, glattes Haar, tiefe braune Augen, schneeweiße Haut, schön geformte Nasen, volle Lippen und ausdrucksstarke Gesichter wie Zigeunerinnen. Sie sind von einer gelassen-ruhigen und doch sehr bestimmenden Natur. Vergnügt und kämpferisch. Ihr Land ist Süden. Sie feiern gern, lieben das Essen, das Trinken, das Lachen, die Gesellschaft und den Tanz.
Ketuta und Tatia laden mich seit Jahren ein, ihre Heimat zu besuchen. Ich möchte dort ihre Freunde kennen lernen und den schönsten georgischen Jungen finden.
Jeden Tag steht in der Zeitung etwas über Israel. Ich möchte hinfahren und es sehen, um diese Artikel besser zu verstehen. Und ich möchte die Zwanzigjährigen fragen, wie sie mit diesem Dauerkrieg umgehen und leben. Wen genau ich dort suchen möchte, weiß ich noch nicht.
Helsinki schwappte eher im Nachhinein dazu, wie das PS eines Briefes oder der rote Schal, den man sich kurz vorm Weggehen noch schnell umhängt. Mir fiel plötzlich der Zirkus ein, den ich letzten Sommer auf Sylt gesehen hatte, als ich dort einige Freunde besuchte, die ein internationales Kinderzirkus-Festival veranstalteten. An einem grauen kalten Sylter Sommertag kam der finnische Zirkus. Das ganze Programm war ein Schachspiel und jeder Akt der Kampf zweier Schachfiguren.
Meine Lieblingsszene war die Schlacht der beiden Königinnen, eine Akrobatennummer: Jedes Mädchen hatte einen Strick, der von der Decke des Zeltes in die Manege herabhing. An diesen Seilen tanzten sie, drehten sich, ließen sich an einem Arm oder Bein hängen und kämpften darum, wer sich länger halten konnte und wer sich mehr traute. Die weiße Königin verlor und ließ sich an ihrem Seil langsam hinuntergleiten, während die schwarze Königin noch hoch oben in der Krone des Zeltes hing. Sie hatte das Seil als Schlinge um ihren Kopf gelegt und mit eigenem Anschub drehte sie ihren Körper im Kreis. Den Kopf in der Schlinge, Arme und Beine frei in der Luft, flog sie hoch über uns.
Dieses Mädchen will ich in Helsinki wieder finden. Und ihren Freund, den Zauberer.
Ich möchte in den genannten Orten jeweils einen Monat bleiben, das gibt mir genug Zeit, die Stadt und ihre Menschen kennen zu lernen. Aber wie will ich all diese Leute überhaupt finden?
Ich habe in fast jeder Stadt ein paar Kontakte:
In Havanna werde ich bei einer Frau wohnen, Mirta. Ein Bekannter hat mir von ihr erzählt. Er nennt sie »the golden girl«, weil sie goldblond gefärbte Haare hat. Sie vermietet im Zentrum von Havanna ein kleines Zimmer, für sieben Dollar am Tag.
In Buenos Aires kennt unser Familienfreund und Hausarzt einen Professor, der an der Universität von Buenos Aires Germanistik unterrichtet. Bei ihm werde ich voraussichtlich wohnen können.
In San Francisco habe ich durch New York den Kontakt zu einem verrückten Maler.
In Hanoi kenne ich leider niemanden.
Durch Tbilissi führen mich Ketuta und Tatia.
In Jerusalem lebt die Schwester meiner Großmutter.
Und in Helsinki habe ich einen Namen.
Ich hoffe, dass mir diese Leute helfen können. Und dann hoffe ich natürlich auch auf ein bisschen Glück und Zufall …
Bisher habe ich auf jeder Reise Erfahrungen gemacht, die ich niemals hätte vorhersehen können, und diese Erlebnisse waren meistens viel schöner und tiefer als alles Geplante.
Wenn ich reise, dann habe ich immer ein Ziel, und auf der Suche nach dem Ziel passieren mir Dinge, die mit dem Ziel gar nichts mehr zu tun haben, die aber zum eigentlichen Höhepunkt der Reise werden.
Ich will kurz von einer solchen Erfahrung erzählen:
Einen Sommer bevor ich nach Madrid zog, reiste ich durch Südspanien. Eines Tages entschied ich mich, nach Madrid zu fahren. Ich wollte die Stadt kennen lernen und mir ein Paar rote Schuhe kaufen. Es war August. Glühend heiß. Ich lief die Gran Via hinunter und fand eine Unterkunft in einem billigen Hostal, dessen Name mir aufgefallen war: Hostal Josephina! Die Nacht zu 2500 Peseten. Ich blieb fünf Nächte.
Die Suche nach den roten Schuhen führte mich an kleine, versteckte Plätze, in malerische Cafés, zu einem Kino, das alte Filme von Buñuel spielte, in die ich mich leidenschaftlich verliebte, und schließlich zu einem Laden, wo ich mir bei 40 Grad Hitze einen braunen Wintermantel kaufte. Irgendwann fand ich auch die roten Schuhe, doch ich trage sie viel seltener als den Mantel!
So fuhr ich in roten Schuhen, mit Buñuel im Herzen und dem Wintermantel überm Arm mit einem Nachtbummelzug von Madrid zurück nach Ronda in Südspanien.
Ich bestieg den Zug um Mitternacht. Er war voll. Voll von Männern. Keine einzige Frau weit und breit. Ich wollte mich im Speisewagen verstecken, doch der Schaffner war bissiger als die Passagiere: »Der Speisewagen ist geschlossen, adiós!«
Ängstlich setzte ich mich ins Abteil, in die Männerhöhle, hielt meine Tasche wie ein Baby auf dem Schoß und starrte in die Luft.
Da hüpfte etwas neben dem Fenster hoch, ein kleiner, dicker alter Mann, dem die rechte Hand und der Unterarm fehlten. Er rief in einem breiten, südspanischen, mir kaum verständlichen Dialekt: »Stell doch die Tasche hoch, das ist viel bequemer, glaub mir.«
Mit diesem Satz war das Eis gebrochen, und es wurde die schönste Zugfahrt meines Lebens.
Der hin und her und auf und ab hüpfende Kleine war 77 Jahre alt und Kommunist gewesen. Franco wollte ihn einsperren lassen, doch er war ihm entwischt. In einem kleinen Dorf, wo er heute noch lebt, hatte er sich bis 1975 verstecken können. Spanien verlassen konnte er nicht, er liebte es zu sehr: »In jedem Land gibt es Idioten, und wenn sie nicht abgewählt werden und man sie nicht stürzen kann, dann muss man halt warten, bis sie sterben.«
Auf dem anderen Fensterplatz schlief ein Marokkaner, tief und fest. Die ganzen acht Stunden lang. Neben mir saß ein achtzehnjähriger Junge. Er lehnte seinen Kopf scheu an meine Schulter und schaute mir manchmal tief in die Augen. Sein zukünftiger Schwiegervater saß mir gegenüber. Der hatte mir am Anfang die meiste Angst gemacht. Er war wohl so um die 50, die oberen Knöpfe seines Hemdes hatte er geöffnet und präsentierte das graue schweißnasse Brusthaar, an dem eine goldene Kette klebte. Er las einen Porno, stand ab und zu auf und ging zum Klo.
Diese Gelegenheiten nutzte der Junge, um mit mir zu sprechen. Er erzählte, dass er nach Madrid gefahren war, um von seiner Tante Geld für die Hochzeit zu holen, und dass ihn der schwitzende Señor begleitete, um auf ihn aufzupassen.
Sein Dorf hat 3000 Einwohner, er wird Tischler werden. Und die Liebe? Ja, die Liebe war ein nettes Mädchen.
Dann saß da noch der Kutscher aus Córdoba, der niemals Anzüge trug, auch nicht bei der Beerdigung seines Vaters. Und Drogen verabscheute er auch, denn sein Bruder war an einer Überdosis Heroin gestorben. Er kam gerade aus Barcelona, dort hatte er seine Schwägerin besucht und den kleinen Neffen.
Sie erzählten ihre Geschichten. Wir unterhielten uns über Gott und den Krieg und tranken einen Alkoholmix, der nach Apfelsaft schmeckte. Der Kutscher hatte ihn selbst angerührt und schleppte ihn in einem großen Plastikkübel mit sich.
Als ich kurz vor Ronda aufstand, um meine Tasche herunterzuholen, bemerkten die Männer meine roten Schuhe. Sie gefielen ihnen. Der kleine Alte sprang auf, rüttelte den Schwiegervater an der Schulter und rief: »Sag mal was! Hast du schon mal solche Schuhe gesehen?«
Die ganze Fahrt über hatte er keinen Ton von sich gegeben, nur böse geguckt und in seinen Pornos geblättert. Jetzt streckte er den Kopf ein klein wenig nach vorn, nickte verlegen und lächelte.
Der dicke kleine Alte kam noch ans Fenster, als ich in Ronda ausgestiegen war, und winkte mir nach. Dann verschwand der Zug im klaren Morgenblau.
Zurück zur Reise:
Ich möchte eine Zeit porträtieren, eine Generation, die genauso am Anfang steht wie das nächste Jahrtausend, und ich möchte meine Erlebnisse mit Ihnen teilen.
Das Geld
Ich habe versucht, eine erste Kalkulation zu erstellen, wobei ich hoffe, die Kosten so niedrig wie möglich gehalten zu haben. Es würde mich freuen, wenn Sie sich diese ansehen würden:
Städte:
Pro Tag
Pro Monat
Havanna
50 DM
1500 DM
Buenos Aires
30 DM
900 DM
San Francisco
40 DM
1200 DM
Hanoi
30 DM
900 DM
Jerusalem
40 DM
1200 DM
Tbilissi
20 DM
600 DM
Helsinki
40 DM
1200 DM
Flüge
5000–6000 DM
Extras
2000 DM
Insgesamt Betrag
14500 DM
Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit hoffe, bald von Ihnen zu hören.
Herzliche Grüße, Marie Pohl
Der Berlin-Pilot
Berlin ist eine Durchgangsstation, in der
man aus zwingenden Gründen länger verweilt.
JOSEPH ROTH
Gestern ist mir etwas wirklich Sonderbares passiert, was dazu führte, dass ich mir endlich neue Turnschuhe gekauft habe.
Meine Freundin Oyun und ich laufen den Ku’damm entlang zum Miss-Sixty-Laden, um nach Jeans zu gucken. Da steht plötzlich ein kleiner Mann vor mir.
»Darf ich dir deine Turnschuhe abkaufen?«, fragt er mich. Wie bitte? Oyun und ich kichern. Er bleibt ernst und versichert uns, dass es keine Anmache ist. Er hat eine Wette verloren und muss zur Strafe irgendjemandem die Turnschuhe von den Füßen abkaufen. Er bietet hundert Mark. Hundert Mark! Ich habe die Schuhe in New York gekauft, für 150 Dollar!
Oyun will wissen, warum er ihre nicht schöner findet. Sie sehen ihm zu neu aus. Ich denke, meine Schuhe sind zwei Jahre alt und quietschen, ich brauche sowieso neue und willige ein. Er kann meine Nikes haben, aber nur, wenn er mir jetzt gleich neue Turnschuhe kauft. Damit hat er kein Problem, aber es muss schnell gehen, er hat nicht viel Zeit. Nicht viel Zeit? Ich lächle.
Wir gehen zu Niketown. Der Mann ist Bauingenieur, wie Oyun sagt, »in lockerer Kleidung«, etwa Mitte 30, hat fades, dünnes Haar und ein unauffälliges Gesicht. Unsere erste Station ist die Herrenabteilung der running shoes. Ich finde sofort ein Paar blaue Schuhe, vorne nicht zu klobig, schlicht und durch einen dünnen roten Streifen doch besonders. Es gibt sie nicht in meiner Größe. Wir gehen in die Damen-running-shoes-Abteilung, die Damen- und die Herren-Basketball-Abteilung und in die Kinderabteilung. Ich habe noch immer kein einziges Paar anprobiert. Die wenigen Schuhe, die mir gefallen, sind gerade ausverkauft oder es gibt sie nicht in meiner Größe. Der Bauingenieur wird unruhig. Er bietet an, mir ein Taxi nach Hause und 120 Mark für die Schuhe zu zahlen. Nein, so funktioniert das bei mir nicht.
Oyun führt uns zu einem labyrinthartigen Basar mit vielen kleinen HipHop-Boutiquen. Eine weitere Stunde vergeht. Der Mann sagt, ich bin verwöhnt. Oyun und ich fauchen zurück, ich hätte einfach nur Geschmack.
Endlich finde ich ein Paar gelbe Adidas mit roten und schwarzen Streifen. Sie passen und kosten 99 Mark. Ich bin nicht wirklich überzeugt und drehe mich vor dem Spiegel hin und her, bis ich dem Bauingenieur zunicke. Oyun jubelt. Der Bauingenieur reicht dem Verkäufer einen Hunderter.
»Die kosten hundertfuffzich«, sagt dieser.
Der Bauingenieur versucht sich krampfhaft zu beherrschen: »Wieso? Hier steht doch: Sale 99 Mark.«
»Nee, det sind die mit den orangenen Streifen. Die Gelben sind nich reduziert, die kosten hundertfuffzich.«
Die Orangenen will ich aber nicht. Ich will die Gelben.
»Ich kauf sie für 100 oder gar nicht«, erwidert der Bauingenieur mit sehr lauter Stimme.
Der Verkäufer lacht: »Dann eben nich. Det is doch keen Basar. Det sind hier feste Preise.«
Der Bauingenieur verliert die Beherrschung und explodiert wie ein Vulkan. Der Frust der vergangenen zwei Stunden und vielleicht der seines ganzen Lebens sprudelt aus ihm heraus. Er schleudert die Schuhe durch den kleinen Laden und brüllt: »Dann eben nicht. Dann eben nicht. Dann eben nicht.«
Er schmeißt einen Stapel Pullover zu Boden, springt darauf herum wie Rumpelstilzchen, rast fluchend aus dem Laden und ist wie vom Erdboden verschluckt.
Auf dem Weg zur U-Bahn lauschen Oyun und ich vergnügt dem Gequietsche meiner Turnschuhe. Wie hätte ich sie jemals diesem verrückten Bauingenieur anvertrauen können? Meine armen Schuhe. »Der war krank«, sagt Oyun.
Als ich später wieder allein bin, denke ich über die Schuhe nach, stelle mir die rot-gelben Adidas in allen Perspektiven vor, zu Jeans, zu Röcken, zum Bikini, und am nächsten Tag kaufe ich sie mir. Und weil der Verkäufer die Geschichte mit dem Bauingenieur so lustig findet, gibt er sie mir für 99 Mark. Ha!
Der Weg zum Meer
Zögerlich steige ich die vielen Treppen hinauf. Wie die meisten Berliner, die ich kenne, wohnt mein Exfreund im vierten Stock, Altbau ohne Fahrstuhl. Er hat mich zu seiner Einweihungsparty eingeladen. Was ist los in dieser Stadt, dass die Leute immer umziehen, ausziehen, einziehen? Immer wieder die gleichen Fragen: Weißt du ne Wohnung? Oder weißt du jemand, der ne Wohnung sucht? Oder kannst du mir beim Umziehen helfen? Es ist, als spiegle sich die Unruhe dieser sich selbst noch suchenden Stadt in diesen vielen Umzügen wider. Aber vielleicht fällt nur mir das auf, weil ich ja auch so ein unruhiger Wanderer bin.
Die Renovierung der Wohnung ist noch nicht ganz fertig. Farbeimer stehen in den Ecken. Überall stapeln sich Bretter, Werkzeuge und Umzugskisten. Etwa zwanzig Leute stehen im Wohnzimmer in einem Kreis und klatschen. Sie spielen Versteigerung. Einer der schlauen, sozialen Tricks meines Exfreundes, seine alten Sachen loszuwerden. Ein Junge läuft mit einem großen Hut herum und verteilt das Spielgeld. Im Erker des Zimmers hat der DJ sein Pult aufgebaut. Zu jedem Stück, das versteigert wird, spielt er ein neues Lied und bricht es ab, sobald mein Exfreund den Preis ausruft. Dementsprechend ist die Tanzstimmung etwas »brüchig«.
Ich setze mich auf eine Umzugskiste und sehe in die Menge. Weder Oyun noch Olli sind da, die einzigen Freunde meines Ex, zu denen ich noch Kontakt habe. Oyun muss in der Astro-Bar arbeiten, und Olli liegt mit Grippe im Bett.
Ich weiß gar nicht, warum ich gekommen bin. Ich stecke in einem totalen Gedankensumpf. Aus meiner Suche nach einer Berliner Geschichte ist noch immer nichts geworden, und es ist schon November. Ich habe jeden, der zwanzig Jahre alt war, ob Bauarbeiter, Currywurst-Verkäufer, Lehrling, Student, Zivildienstleistender, Fotograf, Webdesigner, Musiker oder Zeitungsverkäufer nach seiner Geschichte befragt und diese aufgeschrieben. Ich versinke in einem Moor von Schicksalen. Bei mir zu Hause liegen Hunderte Papiere auf dem Schreibtisch, Interviews, Erlebnisse, Dutzende Versionen, zahllose Anfänge. Ich sehe in all den Seiten keinen Sinn. Ich zweifele an meiner Idee und will am liebsten alles hinschmeißen. Mir ist überhaupt nicht nach Feiern zumute. Da schubst mich ein blondes Mädchen fast von der Kiste. »Eh«, schnauze ich sie an. »Pass doch auf.«
»Ich bin Anna«, sagt sie und geht gar nicht auf meine mürrische Bemerkung ein. »Hast du Oyun gesehen?«, fährt sie fort. Ich schüttle den Kopf: »Bist du ne Freundin von ihr?« Sie nickt. Anna kennt Oyun schon seit der zehnten Klasse. Aber sie haben sich lange nicht mehr gesehen. Anna war gerade ein Jahr in Israel.
»Israel?«, frage ich neugierig, »da möchte ich auch gerne hin.« Ich erzähle ihr von meiner Idee, eine Reise zu machen, ein Buch zu schreiben, und von meiner vergeblichen Suche nach einer Berliner Geschichte. Anna hört gespannt zu. Dann sagt sie lachend: »Ich bin 22, leider zwei Jahre zu alt. Aber Ausnahmen bestätigen die Regel.«
Ein Paar Zigaretten später laufe ich mit Anna die Treppen runter. Wir wollen Oyun in der Astro-Bar besuchen. Draußen fällt ein leichter Nieselregen. Es ist mild. Anna lehnt den Kopf nach hinten, hält den Mund zum Himmel und trinkt die Regentropfen. »Ich liebe den Regen«, singt sie, »ich liebe den Herbst. Vom Regen habe ich in Israel immer geträumt. Ich hab gedacht, ich bin ein Mensch, für den muss das ganze Jahr Sommer sein, aber da dreht man ja durch. Ich weiß noch, ich saß in der Agentur, und auf einmal lief ein Tropfen Wasser am Fenster lang, und ich dachte, es regnet. Im August. So unrealistisch. Ich bin echt aufgesprungen, zum Fenster gerannt und dachte, es regnet. Dabei hatte nur jemand seine Blumen gegossen.«
Sie nimmt mich am Arm, läuft die Rosenthaler Straße geradeaus, erzählt von Israel und ihrem Israeli Lev, den sie in Thailand kennen gelernt hat. Die beiden hatten nur einen kleinen Urlaubsflirt am Strand, nichts Ernstes. Dann wurde er in Bangkok mit einem Joint erwischt, kam ins Gefängnis, sie holte ihn innerhalb von 24 Stunden wieder raus und saß auf einmal neben ihm im Flugzeug auf dem Weg nach Tel Aviv. Seine Mutter hat eine Agentur und vermittelte Anna Jobs als Hostess auf Bar Mizwas und Hochzeiten, mit den Gästen tanzen, so ein bisschen animateurmäßig.
Wir kommen zum Hackeschen Markt. Auf dem Platz steht eine Kuh und singt Lieder von Dinah Washington, ein Mädchen in einem schwarz-weiß gefleckten Fellkleid mit einer Kuhmaske und einem roten Tuch um den Hals. Zu ihren Füßen steht der Kassettenrecorder, aus dem es I am mad about the boy scheppert. Ich erinnere mich, dass meine Mutter immer eine Dinah-Washington-Kassette hörte, wenn wir von Hamburg nach Berlin fuhren, um meine Großmutter zu besuchen. Das war noch zu DDR-Zeiten. Ich sehe das lange Fließband wieder vor mir, wo man den Pass drauflegen musste, und die Soldaten in ihren Grenzhäuschen.
Wir fuhren oft nach Berlin, und da meine Eltern hier früher gelebt hatten und die Stadt gut kannten, fühlte ich mich nie wirklich fremd. Heute frage ich mich oft, was bin ich hier? Ich bin keine Berlinerin, aber auch keine Fremde, und auch keine Einwanderin, denn ich werde nicht für immer hier leben. Was bin ich dann? Ich bin total verwirrt.
Anna zieht mich erneut aus meinem Gedankensumpf und zeigt auf die Kuh. Sie hat keine Zuschauer. Wir bleiben einen Augenblick vor ihr stehen. Am Ende des Liedes klatschen wir laut, bis andere Leute kommen und sich ein kleiner Kreis bildet. Als die Kuh also versorgt ist, schlendern wir weiter.
Anna kramt in ihrer Handtasche nach den Zigaretten und erzählt von sich, leicht und unbefangen. Sie ist in Berlin geboren und aufgewachsen. Ihr Vater ist Chefarzt, ihre Mutter Therapeutin. »Die typische Alt-Hippie-Generation, früher ganz wild und heute ganz bürgerlich. Sie haben mich einerseits total locker erzogen, andererseits total behütet. Ich beneidete immer meine Freundinnen, die von großen Dramen zu Hause erzählten. Ich hatte einfach nur eine rosarote Kindheit.«
Mit sechzehn war Anna das Partygirl von Kreuzberg und ging nur noch in die Schule, um im Aufenthaltsraum zu schlafen. In dieser Zeit lernte sie auch Oyun kennen. Aber im Gegensatz zu Oyun, die trotz der vielen Partys immer irgendwie gute Noten schrieb, bekam Anna eines Tages den berüchtigten blauen Brief: Sie schafft das Abitur nicht.
»Das werde ich nie vergessen«, sagt sie und hat endlich die Zigaretten in ihrer Handtasche gefunden, »der Brief schlug wie eine Bombe bei mir zu Hause ein. Mein Vater meinte: ›Pass auf, Anna, dann nehme ich dich halt runter von der Schule. Ich finanziere dir dein Rumschludern nicht. Entweder du gehst arbeiten oder du fängst eine Lehre an.‹
Damit hatte ich nicht gerechnet. Es war irgendwie selbstverständlich, dass ich Abi mache. Ich fing tierisch an zu weinen. Mein Vater stand vom Tisch auf. Meine Mutter auch. Mit ihr habe ich mich zu der Zeit sowieso nicht verstanden, nur mit meinem Vater. Ich bewundere ihn. Er kommt aus einer Oberspießer-Grafen-Schnickschnack-Familie und hat sich davon frei gemacht. Hat rebelliert. Er versteht mich und spürt, wenn es mir schlecht geht, ohne dass ich ihm vorher etwas gesagt habe. Dann diese Reaktion von ihm. Mich einfach stehen lassen. Auf einmal war er voll rigide.
Ich habe heulend meine Koffer gepackt, alles ganz dramatisch, und bin abgehauen. Im Grunde genommen war es total lächerlich, ich bin zu einer Freundin gezogen, die auch noch bei ihren Eltern wohnte. Nach ein paar Tagen rief ich meine Schwester an, weil ich Sachen brauchte, und meinte: Ich klingele und du kommst runter. Ich möchte auf gar keinen Fall die Eltern sehen. Als ich auf sie warte, kommt mein Vater. Steht da, im Regen, und gibt mir eine Tasche mit lauter Sachen und Geld, und sagt, wenn ich das jetzt brauche, Abhauen und Abstand von zu Hause, soll ich das machen, ich soll aber wissen, dass sie mich trotzdem alle lieben, dass man über alles reden und ich jederzeit zurückkommen kann und dass es ihm Leid tut und dass es eine Kurzschlussreaktion war und dass er mich vermisst und dass mich alle vermissen. Und das war schrecklich! Das war so schrecklich! Weil ich natürlich irre stolz war. Ich hab mich zusammengerissen und bin ganz schnell gegangen. Nach ein paar Tagen kam ich kleinlaut wieder an. Das war das Auszugsdrama.«
Inzwischen lehnen wir über die Brüstung der Brücke auf der Friedrichstraße. Die Leuchtbuchstaben des Berliner Ensemble drehen sich im Kreis und spiegeln sich in der Spree wider. Neben dem Theater wohnt der Dichter Thomas Brasch. Sein Licht ist an. Sein Licht ist immer an, als wache er die ganze Nacht über die Stadt.
»Ich sagte meinen Eltern«, fährt Anna fort, »ich möchte es nochmal probieren, und wurde umgeschult. Auf die Waldorfschule. Und das war wieder eine Katastrophe. Ich hab tierisch gelitten unter diesem Waldorfsystem, unter diesem Klassenlehrer, der sich immer tausend Sachen für die Klasse ausgedacht hat, damit sich die Klasse gut versteht. Aber die Leute in der Klasse haben sich nicht gut verstanden. Ich meinte, dass er sich was vormacht, und dann meinte er, ich muss zum Schulpsychologen. Da bin ich abgegangen.
Meine Eltern haben mich machen lassen, haben eingesehen, dass, wenn man mich einengt, sei es in Beziehungen oder überhaupt, wenn ich das Gefühl habe, ich muss in irgendeinem Muster laufen, flipp ich aus. Ja, dann war ich frei. Ich hatte immer viel mit älteren Leuten zu tun gehabt und die studierten alle oder jobbten oder waren so Künstler-Freaks. Das fand ich immer irre toll. Es war Sommer, ich wohnte in einer kleinen Wohnung in Kreuzberg 36, war glücklich und bin nur um die Häuser gezogen. Bis es auf einmal alles keinen Spaß mehr machte, weil mir bewusst wurde, dass ich eigentlich gar nicht weiß, was ich will. Diese Freiheit wurde zu einem schwarzen Loch, in das ich immer tiefer fiel. Unter dir kein Boden. Über dir keine Decke. An den Seiten keine Balustraden. Und aus der Dunkelheit hallte es immer wider: Du kannst jetzt alles machen: Alles. Alles war Nichts.«
Es ist so absurd, denke ich, mit sechzehn will man um jeden Preis unabhängig und erwachsen sein, machen, was man will, und wenn man es dann ist, kann man mit dieser Freiheit gar nichts anfangen, ist gefangen in ihr. Man will kein Kind mehr sein, reißt sich los von zu Hause, nur um dann das zu suchen, was man als Kind ganz einfach war, sich selbst.
Wir laufen zur S-Bahn. Ein paar Straßenzüge vom Bahnhof entfernt beginnt die Geisterstadt, die gläsernen Hochhäuser, die Läden, die nachts alle geschlossen und leer sind, wie wenn du träumst, dass alle Menschen verschwunden sind und nur du ganz allein durch die Stadt wanderst. Ich grusle mich auf leeren Straßen und bin froh, dass wir in die S-Bahn steigen.
»Ein Freund von meinem Vater schlug mir eine Ausbildung als Krankenschwester vor. Der Typ schmückte das total rosig aus. Ich dachte, ich kann ja mal hingehen. Ich sollte zu einem Bewerbungsgespräch. Ich war achtzehn. Mit schwarzen Stiefeln, Minirock und Jeansjacke düste ich da an und ne Nonne macht mir die Tür auf, so ne Franziskanernonne. Ich hab gedacht, mich trifft der Schlag. Ich wusste nicht, dass das ein katholisches Krankenhaus ist. Dann kam das Gespräch, vor einer Garde von drei Ärzten und zwei Nonnen, die mich die ganze Zeit angestarrt haben, als wäre ich eine Außerirdische. Ich dachte, die nehmen mich sowieso nicht, und war deshalb ganz entspannt. Am nächsten Tag kriege ich den Anruf, ich kann im Oktober anfangen. 800 Bewerber auf einen Platz! Da saß ich nun, völlig überrumpelt, in einer Ausbildung als Krankenschwester.
Du kannst dir nicht vorstellen, was du in einem Krankenhaus alles erlebst. Das ist der Hammer. Einfach der Hammer. Einen Tag arbeitest du auf der Krebsstation, mit kleinen Kindern, die dem Tod geweiht sind, und am nächsten Tag in der Geriatrie mit alten Frauen, die nicht mehr wissen, in welcher Zeit sie leben, die wie kleine Kinder sind und nachts nach ihrer Mama rufen. Ich hab mich zum ersten Mal mit dem Tod auseinander gesetzt und eine ganz andere Seite vom Leben kennen gelernt.«
Die S-Bahn rattert am Alex vorbei. Anna unterbricht, kramt nach der Puderdose und tupft sich den Regen von den Wangen. Sie hat ein schönes, klares Gesicht, blaue Augen, rotblondes Haar, die schlanken Beine aneinander gepresst, sitzt sie neben mir wie eine Meerjungfrau. Sie erzählt von einem Aids-Patienten, mit dem sie sich im Krankenhaus angefreundet und den sie bis zum Tod begleitet hat, von den Nonnen, die ihr das Leben zur Hölle machten, weil Anna geschminkt zur Arbeit kam und keine weißen Söckchen trug. »Diese Duckmäusigkeit«, fährt sie leidenschaftlich fort, »diese Hierarchien im Krankenhaus. Wenn der Chefarzt kommt, verstummt alles. Oh, was da abgeht hinter den Kulissen, wie menschenunwürdig das ist. Immer auf diesem Religions-Trip, hinter diesem Schleier, immer dieses ›Liebe deinen Nächsten‹. Was ist das: Liebe deinen Nächsten? Die lieben ja nicht mal sich selbst, wie sollen die ihren Nächsten lieben?«
Warschauer Straße steigen wir aus und laufen über die Warschauer Brücke. Auf der einen Seite liegt Kreuzberg, auf der anderen Friedrichshain, dazwischen liegt die Spree. Es gibt so viele Brücken in Berlin, und endlos lange Straßen, wie Fäden, die die einzelnen Bezirke miteinander verknüpfen. Anna trinkt wieder die Regentropfen. Ihr rotblondes Haar leuchtet in der Dunkelheit.
Keiner glaubte, dass Anna das Examen schaffen würde. Aber sie schaffte es. Dann war es vorbei. Nach drei Jahren. Und das war der schönste Tag ihres Lebens. Als Erstes lief sie mit dem Zeugnis zu ihrem Vater in die Klinik und sagte, man soll ihm Schwester Anna melden. Sie lächelt verlegen und sagt zu mir, eigentlich habe sie das alles nur für ihn gemacht. Dann fuhr sie nach Thailand, traf Lev und ging mit ihm nach Israel.
»Warum bist du wieder nach Berlin zurückgekommen?«, frage ich.
»Ich hatte plötzlich so ein ganz komisches Heimweh. Das war noch nicht mal Heimweh. Ich hatte irgendwie das Gefühl, ich muss wieder nach Berlin. Ich muss gucken, wo ich eigentlich hingehöre. Und ich habe Kreuzberg vermisst. Da fühle ich mich immer so zu Hause, in Kreuzberg 36. In diesem kleinen Kiez, mit den Türken, den vielen Kindern, den jungen Leuten, die alle irgendwie auf der Suche sind. Kreuzberg 36 ist wie ein Dorf. Man kennt sich, man hilft sich gegenseitig, man ist sich nicht egal. Wie zum Beispiel die durchgeknallte Pennerin, die im Waschsalon schläft und jeden Morgen in die Morinna-Bar kommt. Sie isst die Frühstücksreste, räumt dreckige Tassen und Teller weg, und die Bedienung geht sehr herzlich mit ihr um.
Ich hab gemerkt, dass auch ein gewisser Teil von mir hier ist, meine Wurzeln und so, dass ich Berlinerin bin. Aber wenn ich zu lange in Berlin bin, werde ich depressiv. Durch Lev und überhaupt durch das Reisen habe ich angefangen, ernsthaft darüber nachzudenken, wo ich leben will. Es ist zum ersten Mal so, dass ich einen Menschen getroffen habe, mit dem ich meine Zukunft zusammen planen will. Er möchte nicht so gerne in Israel bleiben. Aber ich glaube, Berlin wäre auch nicht das Richtige für ihn. Ich würde gerne mit ihm irgendwo hinziehen. Aber wer weiß, wie lange das hält.«
»Und was machst du jetzt?«, frage ich weiter, »fährst du zurück nach Tel Aviv?«
»Nein. Morgen fliege ich nach Tokio. Für drei Monate. Ein Israeli hat mir dort einen Job als Hostess angeboten. Und danach muss ich erst mal gucken.«
Wir sind in der Astro-Bar angekommen. Es ist noch früh und zum Glück noch nicht so voll. Oyun freut sich und lädt uns zu einem Cocktail ein. Sie macht die besten Cocktails von Berlin. Die Bar ist wie ihr kleines Reich, und sie herrscht wie eine Königin. Während Anna von Israel und Lev erzählt, erinnere ich mich plötzlich, dass ich mit Oyun schon ein paar Mal von Anna gesprochen habe. Durch Anna hat Oyun nämlich ihren Freund Olli kennen gelernt. Anna war mit Olli zusammen, als sie und Oyun durch die Party-Szene in Kreuzberg zogen. Dann machte Anna mit Olli Schluss, kurz darauf wurde er verrückt und kam in die Anstalt. Oyun besuchte ihn dort regelmäßig. Seitdem er draußen ist, sind die beiden ein Paar.
»Und was machst du, wenn du aus Tokio zurückkommst?«, höre ich Oyun Anna fragen.
»Ach, das ist es ja. Ich weiß es nicht.« Anna seufzt. »Ich kann nicht studieren. Das ist nichts für mich, in irgendeinem Unisaal sitzen und theoretisch lernen. Ich muss was machen. Aber was? Ich hab immer gedacht, ich will nie von meinen Problemen wegrennen, aber auf einmal gibt es tausend Wege, und was sollst du machen? Du weißt nicht, welcher richtig und welcher falsch ist. Gar nichts.«
Sie dreht sich zu mir: »Meine Eltern waren anders als ich mit zwanzig, die wussten, was sie wollten, die haben für was gekämpft, die hatten Ideale, die waren politisch aktiv und die haben gegen ihre Eltern rebelliert. Aber ich, ich stehe da und denke nur, wenn ich es schaffe, mit vierzig so zu sein wie mein Vater, der eine Familie ernährt, gebildet ist, einen guten Job hat und das macht, wozu er Lust hat, dann kann ich echt stolz sein. Meine Eltern sind mein Vorbild, versteht ihr, nicht mein Gegenbild. Ich habe überhaupt kein Gegenbild, keine Mauern, gegen die ich ankämpfen muss. Der einzige Kampf, den ich führe, ist der Kampf mit mir selbst, mit meinen Zweifeln, mit den Fragen, auf die ich keine Antwort weiß, oder mit irgendwelchen Typen, in die ich verliebt bin. Und wenn ich mir die Welt angucke, die Nachrichten sehe, dann denke ich, es ist schlimm, was da überall passiert, die Kriege, die Armut. Aber es gibt niemanden, für den ich kämpfen würde. Ich bin nicht für die Amerikaner, aber auch nicht für die, die gegen die Amerikaner sind. Also für wen? Für was? Ich bin ein Mensch, der keine Ideale und keine essenziellen Probleme hat. Ich stehe da und denke, das Einzige, was ich kann und tue, ist Spaß haben, Party machen.«
Oyun schneidet eine Zitrone. Sie hat schweigend zugehört, jetzt hebt sie den Kopf und sagt: »Das ist doch was Schönes, nicht was Schlechtes. Vielleicht sollte das dein Beruf werden: Partygirl. Leute animieren, das kannst du doch.« Anna zuckt mit den Schultern: »Vielleicht hast du Recht.«
Im Gegensatz zu Anna hat Oyun, die auch in Berlin geboren und aufgewachsen ist, deren Muttersprache auch Deutsch ist, keinen deutschen Pass. Ihr Vater kommt aus dem Tschad und ihre Mutter aus der Mongolei. Ihre Eltern lernten sich zu DDR-Zeiten kennen, als beide mit einem Stipendium in Ostberlin studierten. Später siedelten sie nach Westberlin über. Oyun wuchs im Studentenheim auf, denn ihre jungen Eltern konnten sich keine eigene Wohnung leisten. Sie ließen Oyun tun und lassen, was sie wollte. Dann bekam der Vater einen Job in Paris und die Familie zog dahin um. Oyun war achtzehn. Ihre Eltern hatten die ganzen Jahre in Berlin nur ein Studentenvisum gehabt. In Frankreich bewarben sie sich um die französische Staatsbürgerschaft. Oyun vermisste Berlin und ging sofort nach ihrem Abitur nach Deutschland zurück, noch bevor die Eltern die französischen Pässe für die Familie erhalten hatten. In Berlin arbeitete sie als Barfrau. Illegal oder legal war Oyun ganz egal. Aber kaum klingelte die 21 an der Tür, wurde alles kompliziert. Sie wollte anfangen zu studieren, Praktika machen, gemeldet sein, verreisen. Aber sobald Oyun Berlin verlässt, darf sie nicht mehr rein. Und das will sie nicht. Sie liebt Berlin, diese Stadt ist ihr Zuhause, Pass hin oder her, sie ist Berlinerin. Die Behörden lehnten ihre vielen Anträge immer wieder »Ohne Begründung« ab. Dabei hat sie ein Recht darauf, hier zu sein, weil sie in Berlin geboren und zur Schule gegangen ist. Sie hat weder den Tschad noch die Mongolei je gesehen, noch spricht sie deren Sprachen. Sie braucht einen guten Anwalt, aber den kann sie sich nicht leisten. Jetzt muss sie sich entscheiden, entweder sie geht zu ihren Eltern nach Frankreich und wartet, bis man ihr dort die französische Staatsbürgerschaft gibt, oder sie heiratet Olli.
Gegen fünf Uhr verlassen wir die Astro-Bar. Mitten auf der Straße steht eine Frau und streut Haferflocken auf die Kreuzung. Sie erklärt uns, dass heute der 15. November, der Feiertag der griechischen Göttin Hekate ist, die Herrin der drei Wege, die Göttin der Entscheidungen. Man muss ihr Essen schenken, dann bringt sie Glück. Oyun, Anna und ich kaufen eine Tüte M&Ms beim Dönerladen und opfern sie auch Hekate … Oyun fährt mit dem Fahrrad nach Kreuzberg. Anna und ich laufen zur S-Bahn. Wir müssen beide nach Charlottenburg, sie zu ihren Eltern und ich zu meiner Großmutter, wo ich momentan wohne.
Auf der Fahrt erzählt mir Anna eine Geschichte, die ihr Lev einmal in Israel erzählt hat: »Es war einmal ein kleines Mädchen, das von zu Hause wegging, weil es das Meer sehen wollte. Sie kam durch die verschiedensten Dörfer, arbeitete hier und dort, aber besann sich immer wieder des Meeres und zog weiter. Bis sie eines Tages an eine Kreuzung kam, wo es in viele verschiedene Richtungen ging. Sie blieb stehen und wusste nicht, welchen Weg sie wählen sollte. So setzte sie sich unter einen großen Baum und wartete. Reisende kamen vorbei, nahmen sie mit in andere Dörfer, aber immer wieder führte ihr Weg zurück zu dieser Kreuzung. Als sie schon eine alte Frau war, wählte sie, ohne lange zu überlegen, irgendeinen Weg. Sie kam zu einem Berg. Sie war schon sehr alt und kletterte mühsam den Berg hinauf. Es war kalt und windig. Als sie oben an der Spitze angelangt war, sah sie das Meer und die Kreuzung und dass alle Wege zum Meer führten. Der eine Weg war länger, der andere kürzer.
Seitdem denke ich«, sagt Anna und wühlt mal wieder in der Handtasche, »ich muss einfach machen. Einfach einen Weg gehen, und wenn es nicht der richtige war, dann eben nicht. Dann geh ich eben einen anderen. Irgendwann finde ich das Richtige für mich. Irgendwann komme ich ans Meer.«
Die S-Bahn saust am Potsdamer Platz vorbei. Ich gucke aus dem Fenster. Die bunten Kräne reichen dem Himmel die Hand.
Wahn – Sinn
Ich sitze mit Oyuns Freund Olli auf einer Bank im Görlitzer Park. Es ist Ende November, und die Sonne scheint wie im Frühling, einer dieser Traumtage, an denen ich vor Glück die Welt umarmen will. Wenige Meter entfernt von uns füttert ein kleines Kind eine Ziege, die hier auf einem abgezäunten Fleckchen Gras lebt. Meine Eltern haben mir erzählt, dass ich als Kind nicht »Ziege«, sondern »Gieße« sagte und dass ich es unheimlich lustig fand, dass die Gießen gerne Zigaretten essen. Ich lehne den Kopf zurück und genieße die warmen Strahlen. Olli zeichnet mit dem Fuß Muster in den Sand. Er hustet. Er ist noch ein bisschen erkältet. Wir schweigen eine Weile. Dann fängt er an zu erzählen, wie er immer erzählt, in klaren kurzen Sätzen.
»Haut mich neulich so nen Typ
aus meiner Schule inner U-Bahn an.
Wie das denn so gewesen wär mit den Drogen und so.
Und ich so: Was meinst du denn jetzt?
Na, bla bla bla und Klapse und so.
Und ich so: Wer hat dir das denn erzählt?
Er kennt jemand, den Holger kennt.
Das ist auf jeden Fall kein guter Freund, der Holger.
Das ist doch nicht das Erste, was man sagt.
Ach Olli, den kennst de och? Der war inner Klapse.
Das war schon sehr enttäuschend.
Aber damit muss ich anscheinend leben.«
Als ich Olli traf, mochte ich ihn sofort. Er stand bei mir vor der Tür, neben meinem Exfreund, und wollte mir beim Umzug helfen. Wir sahen uns an, und es war eine Verbindung da, so ein Gefühl, man versteht sich, man kennt sich, ohne sich zu kennen, eine Art Seelenverwandtschaft. Ich habe noch nie mit ihm über die Zeit gesprochen, als er verrückt war. Es ist das erste Mal, dass er davon erzählt:
»Ich war 19.
Zwei Mal ein halbes Jahr inner Anstalt.
Ein paar Monate davon waren geschlossen.
Das ist richtig hart, auf jeden Fall.
Davor ist es eigentlich ziemlich lustig.
Nicht in der Klapse, aber verrückt sein.
Wenn du wahnsinnig bist, kannst du fliegen.
Ich denke, das ist auch Zauberei, was da passiert.
Einfach Zauberei.«
Olli hebt den Kopf. Das Kind plärrt, weil die Mutter es von der Ziege wegzerrt. Sie reißt dem Kind das Brot aus der Hand, schmeißt es der verdutzten Ziege hin und schnallt das Kind auf ihrem Fahrrad fest. Das Geschrei tut mir in den Ohren weh. Ich denke, dieses Kind ist genauso brutal wie seine Mutter. Kein Mensch dreht sich um. Olli schüttelt den Kopf und fährt fort:
»Ich hab viele Drogen genommen.
Also relativ viele.
Ab und zu LSD. Viel gekifft. Und mal ne Nase gezogen.
Das ist erst mal ein Zustand,
wo der Geist ein bisschen verrückt ist.
Und abenteuerlustig.
Das vermisse ich heute.
Dass einfach keine Abenteuer mehr passieren.
Dann hab ich irgendwann so nen Typen getroffen.
Anner Ampel.
Ich war aufm Weg zu Anna.
Da dachte ich, ich wär noch mit Anna zusammen.
Für sie war wahrscheinlich klar,
dass wir schon lange nicht mehr zusammen sind.
Egal.
Ich stand anner Ampel. Mit meinem Bike.
So: Ich warte auf Grün.
Der Typ neben mir sah total komisch aus.
Cordhose, Schlips, Vollbart.
Wie Karl Marx mit Turnschuhen.
Und den hab ich gefragt, wie spät es ist.
Einfach nur: What time is it?
Weil es am Potsdamer Platz war
und der halt so ausländisch aussah.
Daraufhin meinte er zu mir,
wieso ich ihm diese Frage stelle,
ob das ein Zufall ist.
Da hab ich gesagt, ich glaub nicht an Zufälle.
So kamen wir ins Gespräch.
Und er war einer,
er war der Meinung,
er ist ne Art Botschafter.
Einer, der für den Staat arbeitet,
aber nicht direkt eingestellt ist.
Sah aus wie’n Penner.
Der war halt komplett irre.
Aber ich hab ihn viele Sachen gefragt.
Und er hat versucht, mir viele Antworten zu geben.
Er meinte, das Wetter wird gelenkt.
Ich bin dann zwei Stunden zu spät gekommen.
Und hab das alles Anna erzählt.
Die hat mich nur angeguckt
und wusste ganz genau, ich bin verrückt.«
Mutter und Kind sind verschwunden. Es ist still. Die Ziege liegt auf ihrem bisschen Gras. Ein paar Leute spielen Frisbee, andere Federball. Aus der Ferne klingen Stimmen und Gitarrenmusik. Ich denke an die große Wiese im Central Park in New York, an die ersten warmen Tage, wenn ich dort die Schule schwänzte. Olli hebt einen Stein auf, der unter der Bank liegt, schaut ihn kurz an und steckt ihn in seine Hosentasche.
»Aber da war ich noch nicht richtig verrückt.
Das kam später.
Meine Eltern waren nach Frankreich gefahren.
Mit Anna war alles vorbei und mir gings beschissen.
Meine Mutter rief an und meinte, komm doch nach.
Ich bin hin und hab mich gleich mit ihr gestritten.
Dann hab ich wieder so nen Typen kennen gelernt.
So nen Kartenleger.
Und mit ihm eine Reise nach Bordeaux gemacht.
Wir gingen in einen Park, um was zu rauchen zu kaufen.
Und dort fanden wir einen Mann,
der uns für eine Nacht ein Hotelzimmer gezahlt hat.
Wir haben dem halt erzählt,
wir sind arme Säcke und wurden ausgeraubt.
Der Mann war Möbelhändler.





























