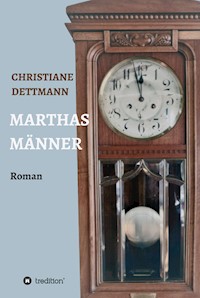
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Jula Borchart hat alles, einen guten Job, eine schöne Wohnung und einen Partner. Ein gutes Leben. Bis sie schwanger wird und auf einmal alleine dasteht. Und während das Kind in ihrem Bauch wächst, erinnert sie sich an die Geschichten, die ihr Großvater ihr erzählt hat, Geschichten über seine Großmutter, die als unverheiratete Frau in Pommern zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein Kind bekam. Wie war das damals, ein Leben als ledige Mutter? Mit der Arbeit, dem Alleinsein und später dann den Kriegen, dem Verlust der Heimat? Und warum hat sie nie geheiratet? Jula beginnt, Marthas Geschichte aufzuschreiben und findet dabei auch Antworten für ihr eigenes Leben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 411
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Christiane Dettmann
Marthas Männer
Roman
© 2020: Christiane Dettmann
Umschlag, Illustration: Jonna Dettmann
Verlag & Druck: tredition GmbH, Halenreihe 40-44, 22359 Hamburg
ISBN
978-3-7482-2013-8 (Paperback)
978-3-7482-2014-5 (Hardcover)
978-3-7482-2015-2 (e-Book)
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Für Papa
Sachsen 1955
Martha
Ich träume. Ich sitze am Fenster und schaue hinaus. In der fremden Wohnung. Alles ist anders hier. Die Menschen. Die Straßen. Hier ist kein Platz zum Atmen.
Ich schaue hinaus und warte. Es ist still in der Wohnung. Zu Hause hatten wir die große Standuhr, die mit ihrem Ticken die Zeit einteilte. Hier ist nichts. Die Zeit steht still. Jetzt höre ich, wie draußen jemand singt. Maikäfer flieg, der Vater ist im Krieg. Ich kenne das Lied. Leise summe ich mit. Ich schaue hinaus, aber es ist niemand da.
Dann schlägt auf einmal die Uhr, die große von zu Hause. Laut hallt es durch die Wohnung, und mir wird kalt. Zwölfmal schlägt sie, und ich weiß. Jetzt ist er tot, mein Gunnar.
Berlin 2015
Jula
Das Foto hing jahrelang bei den Großeltern über dem Klavier. Eigentlich schon immer. Ich weiß noch, wie ich es das erste Mal so richtig anschaute. Da war ich vielleicht fünf Jahre alt und es war kurz vor Weihnachten. Meine Oma hatte auf dem Klavier die kleinen Orchesterengel aus dem Erzgebirge aufgebaut, und ich wollte wissen, ob in diesem Jahr wieder einer dazu gekommen war. Da fiel mein Blick auf das Bild, schwarz-weiß in einem alten braunen Rahmen. Die Frau trug ein hochgeschlossenes Kleid mit Rüschen am Hals, die weißen Haare zu einem Knoten aufgesteckt. Sie schaute sehr ernst, fast ein wenig unfreundlich.
„Wer ist das?“, fragte ich.
„Das?“, erwiderte mein Opa, „das ist meine Großmutter Martha. Martha Borchart.“
„Und warum guckt sie so?“
„Was meinst du, wie guckt sie denn?“
„Ich finde, sie sieht böse aus.“
„Böse, mmh.“ Opa legte den Kopf schief und betrachtete das Bild. „Vielleicht sieht sie so aus, weil sie ganz still sitzen musste. Naja, eigentlich sah sie meistens so aus. Besonders fröhlich war sie wohl nicht. Aber sie konnte toll erzählen.“
Opa konnte auch erzählen. Märchen und Sagen und alle möglichen Geschichten. Von seiner Kindheit und seiner Großmutter Martha. Das mochte ich vielleicht am liebsten. Als ich älter war, so vierzehn, fünfzehn, meinte er, ich hätte Ähnlichkeit mit ihr. Obwohl ich das nicht erkennen konnte. Höchstens vielleicht die hohen Wangenknochen. Und dann hatte sie wohl auch eine Vorliebe für schwarz und lila. Wie ich. Trug immer schwarze, lange Kleider und einen Unterrock in sattem Violett. Und ein Paar Amethystohrringe. Aber die Vorstellung gefiel mir. Dass ich etwas von meiner Ururgroßmutter geerbt hatte. Und wenn es nur eine Vorliebe für bestimmte Farben war. Die Ohrringe hätte ich gerne gehabt. Aber die waren irgendwann verloren gegangen. Wahrscheinlich auf der Flucht. Vielleicht eingetauscht gegen etwas zu essen.
Dann kam eines Tages ein Päckchen von meinen Großeltern. „An Jula Borchart“, stand darauf, in Omas Schrift. Große, energische Buchstaben, die laut über das Papier stampften. Wenn Opa schrieb, sah es immer aus, als würden Spinnenbeine über ein Blatt huschen. Eilig und schwer zu lesen.
In dem Paket lag das Bild in seinem braunen Rahmen. Sorgfältig in Blasenfolie eingepackt. Außerdem noch ein Briefumschlag mit weiteren Fotos. Von Menschen und Landschaften. Einige hatte ich schon mal gesehen, das Hochzeitfoto meiner Urgroßeltern zum Beispiel. Und das Haus, in dem Opa als Kind gewohnt hatte. Marthas Haus. Vor ein paar Jahren war Opa dort gewesen, in seiner alten Heimat, und hatte es fotografiert. So wie es heute aussah. Ein paar alte Briefe waren auch dabei, aber die Schrift war ausgeblichen und fast nicht mehr zu entziffern. Ganz unten lag noch ein Brief. Der war von Opa.
„Liebe Jula“, schrieb er. „Jch schicke dir hier ein paar Dinge, die dich vielleicht interessieren könnten. Du hast ja gerne immer die alten Familiengeschichten gehört. Die Fotos habe ich beschriftet, damit du weißt, wer oder was darauf abgebildet ist. Vielleicht fragst du dich, warum wir dir diese Dinge schicken, allem voran das Bild von Martha. Nun, deine Oma und ich haben uns entschlossen, unser Haus zu verkaufen. Schließlich sind wir ja nicht mehr die Jüngsten, und es ist doch einfach zu groß. Und dann noch der Garten. Es kommt ja auch kaum noch jemand zu Besuch. Die Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen, das kannst du mir glauben. Schließlich geben wir schon wieder ein Stück Heimat auf.
Wir hatten aber Glück und haben ganz in der Nähe ein kleines Reihenhäuschen mit sehr netten Nachbarn gefunden. Jetzt geht es also ans Packen. Und Sortieren. Alles können wir nicht mitnehmen. Wenn du also noch etwas haben möchtest außer der Fotos und Briefe, dann gib uns Bescheid. Wir würden uns sehr freuen, wenn du uns bald einmal wieder besuchen kommst.
Herzliche Grüße, Opa und Oma. “
Der Gedanke machte mich traurig. Dass meine Großeltern ihr Haus aufgeben würden. Seit meinem Umzug nach Berlin war ich nicht mehr dort gewesen. Einmal waren sie hierher nach Berlin gekommen und hatten sich meine Wohnung angeschaut. Das war aber auch schon fast wieder ein dreiviertel Jahr her. Ich würde aber doch gerne das Haus noch einmal sehen. Bevor sie es verkauften. Aber wie sollte das gehen? Die Arbeit im Schichtdienst, da konnte ich gerade nicht frei nehmen. Im Moment fehlten so viele Kollegen. Seufzend legte ich die Fotos und Briefe zurück in den Karton. Nur das Bild von Martha behielt ich in der Hand und drehte es unschlüssig hin und her. Sollte ich es aufhängen? Aber wo? Und was würde Jakob dazu sagen? Er war sehr empfindlich, was die Gestaltung der Wohnung betraf. Ob er sich mit dem Bild meiner Ururgroßmutter anfreunden könnte? Vorerst verstaute ich es auf meinem Schreibtisch unter ein paar Akten. Ich konnte auch später noch darüber nachdenken.
Am nächsten Morgen war ich krank. Irgendetwas mit dem Magen. Also blieb ich zu Hause. Rief nur auf der Arbeit an und sagte, dass ich nicht käme. Stattdessen ging ich zurück ins Bett, mit Wärmflasche und Magentee. Und den Briefen, die Opa mir geschickt hatte. Ich wollte wissen, wer sie geschrieben hatte.
Das Papier war dünn und vergilbt. Sie mussten schon alt sein, diese Briefe. Der Verfasser hatte mit Bleistift geschrieben. In Altdeutscher Schrift. Ich konnte sie nicht lesen. Also stand ich noch mal auf und holte den Laptop. Unter dem Stichwort „Sütterlin“ gab es ein Alphabet, das ich mir ausdruckte. Dann machte ich mich daran, die Briefe zu übersetzen, Buchstabe für Buchstabe. Zuerst die Anrede. Und den Absender. Damit ich überhaupt wusste, wer hier geschrieben hatte.
Es dauerte eine Weile, bis ich es heraus hatte. „Mein Lieber, …“ stand da. Und weiter unten: „…deine Martha.“
Es waren also Briefe von Martha. Liebesbriefe vielleicht. Viel weiter kam ich auch nicht.
Gegen Mittag stand ich auf, weil die Übelkeit verflogen war, und räumte die Wohnung auf. Meinen Kram. Und Jakobs. Das war mittlerweile immer mehr meine Aufgabe. Ohne dass ich sagen konnte, wie es dazu gekommen war. Dabei wohnten wir noch gar nicht so lange zusammen. Erst seit drei Monaten. Vorher hatte er in einer WG gewohnt. Jakob war Fotograf. Er arbeitete für Zeitschriften und machte tolle Bilder. Etliche hingen bei uns an den Wänden. Im Flur, im Schlafzimmer, in der Küche. Kennengelernt hatte ich ihn über eine Kollegin aus der Einrichtung, die ab und zu als Model arbeitete. Sie hatte eine Party gegeben, und da war er gewesen. Jakob. Er hatte mich angeschaut, lange, direkt. Und ich hatte mich in seinem Blick verfangen. Jetzt war er bei mir eingezogen. Und hatte einiges auf den Kopf gestellt. Nicht zuletzt die Wohnungseinrichtung. Er hatte auch Fotos von mir gemacht. Die hingen im Schlafzimmer. Ich erkannte mich darauf kaum wieder.
Wir lebten ziemlich unterschiedliche Leben, Jakob und ich. Er mit seinen Fotos und den Kontakten zur Film- und Modeszene. Und ich mit meinen Behinderten. Aber wir hatten es gut zusammen, wahrscheinlich gerade wegen dieser Unterschiede. Dadurch blieb das Leben spannend.
Später kaufte ich ein, denn am Abend wollte ich kochen. Fenchel-Tomaten-Frittata. Nach dem Vormittag im Bett tat die frische Luft gut. Es roch nach Frühling.
Zu Hause legte ich eine CD auf, dann ging ich an die Arbeit. Schnitt Knoblauch und Gemüse und dünstete es in der Pfanne.
Dann deckte ich den Tisch und stellte extra einen kleinen Primeltopf dazu, den ich gekauft hatte. Rosafarbende Blüten mit einem kleinen, gelben Fleck in der Mitte.
Als Jakob kam, duftete es in der ganzen Wohnung nach Basilikum und Knoblauch. Als wären wir in Italien. Ich stand am Waschbecken und hörte, wie Jakob seine Tasche im Flur abstellte. Wie er ins Bad ging und sich die Hände wusch. Dann kam er in die Küche. Legte seine großen, schönen Hände um meine Taille und küsste meinen Nacken. Es dauerte eine Weile, bis wir zum Essen kamen.
Bei der Frittata erzählte Jakob von seinem Tag. Von der Fotostrecke, die er gerade in Arbeit hatte. Mode für ein großes Magazin.
„Wie ist das eigentlich, hast du an die Telefonnummer gedacht von dem Typen mit dem Loft?“, fragte er. Das war jemand, den ich von der Arbeit kannte. Er wohnte in so einer modernen Dachgeschosswohnung und Jakob hatte sie für den nächsten Auftrag ins Auge gefasst.
„Liegt auf meinem Schreibtisch. Warte, ich geh sie holen.“
Ich musste allerdings eine Weile suchen, weil mein Schreibtisch ziemlich voll und auch nicht besonders ordentlich war. Dabei fiel mir Marthas Bild in die Hände und ich nahm es mit in die Küche.
„Hier, guck mal, das ist meine Ururgroßmutter.“ Jakob schaute auf.
„Wo hast du das denn her?“
„Das haben meine Großeltern mir geschickt, die misten gerade ihre Wohnung aus.“
„Mmh. Und hast du die Telefonnummer gefunden?“ Sonst nichts. Manchmal hatte ich das Gefühl, ich lebte Jakobs Leben, aber nicht meins.
Am nächsten Morgen kehrte die Übelkeit zurück.
„Vielleicht gehst du doch lieber zum Arzt“, meinte Jakob, „am Ende ist das noch ansteckend.“ Er war gerade mitten in einem wichtigen Job und konnte es sich nicht leisten, krank zu werden.
Die Praxis war im Erdgeschoss eines alten Stadthauses. Parkettfußboden, der bei jedem Schritt knarzte, und hohe, weiße Decken mit Stuck. Herrschaftlich. Der Arzt war nicht ganz so herrschaftlich, sondern schon älter, der Rücken ein bisschen krumm, mit ein paar grauen Haarflusen auf dem Kopf. Sein Kittel war knitterig, als hätte er darin geschlafen. Aber sein Blick war klar und blau.
Er fragte nach den Beschwerden, untersuchte mich gründlich und tastete auch den Bauch ab. Schließlich räusperte er sich und strich sich über den spärlichen Haarkranz.
„Wann hatten Sie zum letzten Mal Ihre Monatsblutung?“ Ich sah ihn an. Und zuckte mit den Schultern.
„Das weiß ich gar nicht. Die kommt immer ganz unregelmäßig.“
Er schickte mich auf die Toilette, dann saß ich im Wartezimmer. Mit zittrigen Händen und klopfendem Herzen. Einem Kribbeln im Magen. Das war doch nicht möglich. Ein Kind. Wir hatten doch immer aufgepasst. Oder nicht? Aber es konnte ja auch etwas ganz anderes sein. Die Zeit dehnte sich. Schlich vorbei. Bis endlich die Erlösung kam.
„Frau Borchart? Kommen Sie doch bitte noch einmal mit durch.“
Im Sprechzimmer musste ich meine Hände an der Hose trocknen. Weil sie nass waren vor Aufregung.
Der Arzt sah mich an, ein blauer Blick:
„Frau Borchart, da muss ich wohl gratulieren! Neues Leben ist auf dem Weg!“
Auf dem Weg nach Hause war die Welt ganz neu. Leuchtend. Frisch. Weil ich eine andere war. Den Beweis hielt ich in der Hand. Das erste Foto. Eigentlich nur ein winziger Punkt. Aber doch: ein Kind.
Was würde Jakob dazu sagen?
Zu Hause legte ich das Bild vorsichtig auf den Küchentisch. Saß davor und betrachtete es, lange.
Wir hatten bisher noch nicht über Kinder gesprochen, aber ich hatte mir immer welche gewünscht. Nun konnte ich nur hoffen, dass Jakob es auch so sah. Es sprach ja auch eigentlich nichts dagegen. Ungefähr zwei Jahre waren wir nun schon zusammen, auch wenn wir erst seit kurzem auch wirklich den Alltag teilten. Und das Finanzielle war eigentlich auch kein Problem. Trotzdem, ich wollte es gut vorbereiten. Ihm die Neuigkeit nicht einfach so zwischen Tür und Angel mitteilen. Darum rief ich ihn auch nicht an. Sondern bestellte einen Tisch beim Italiener. Danach schrieb ich ihm eine Nachricht. „Um 19.00 Uhr bei Marcos.“
Der Tag war lang. Und kurz. Ich brannte darauf, es Jakob zu erzählen, und gleichzeitig verging die Zeit, während ich einfach nur dasaß und meinen Gedanken lauschte und der Stille in der Wohnung. Eine Hand auf meinem Bauch.
Dann wurde es endlich Abend. Schon am Nachmittag hatte ich meinen Schrank durchwühlt, einen Rock und das weiße Shirt mit dem bestickten Einsatz rausgesucht. Jetzt trug ich Kajal und Wimperntusche auf und betrachtete mich im Spiegel. Ich wollte schön sein heute. Besonders heute.
Jakob war noch nicht da, als ich das Restaurant an der Ecke betrat. Der Kellner führte mich zu unserem Tisch und brachte mir ein Glas Wasser und etwas Brot.
Dann wartete ich, während ich die anderen Gäste betrachtete. Junge Paare, alte Paare, vielleicht auch einige Geschäftsessen dabei. Schräg gegenüber von meinem Tisch saßen zwei junge Frauen. Die eine war schwanger. Als unsere Blicke sich kreuzten, tauschten wir ein Lächeln. Ein Frauenlächeln.
Dann kam Jakob. Ein bisschen abgehetzt betrat er das Restaurant, unbestritten der schönste Mann von allen. Er begrüßte mich mit einem schnellen Kuss und ließ sich dann mit einem Seufzer auf seinen Stuhl fallen.
„Das ist ja mal ’ne Überraschung“, sagte er, „Gibt es einen Grund?“ Ich lächelte, geheimnisvoll, wie ich hoffte.
„Vielleicht“, erwiderte ich. „Aber lass uns doch erst mal essen.“
Wir bestellten. Scampi und Pizza. Und Weißwein für Jakob. Ich blieb beim Wasser.
„Is ja schön, dass es dir wieder besser geht. Mit deinem Magen, meine ich“, sagte Jakob. „Was hat denn der Arzt gesagt?“ Jetzt war wohl der Moment gekommen.
„Warte, ich zeig’s dir.“ Ich öffnete meine Tasche und holte einen Umschlag heraus.
„Hier“, sagte ich. Verunsichert schaute Jakob mich an.
„Und was soll das jetzt?“
„Mach ihn auf.“
Vorsichtig öffnete Jakob den Umschlag und zog das Bild heraus. Von unserem Kind. Lange saß er da und sah es an. Saß nur und starrte. Schließlich hob er den Kopf.
„Ist das dein Ernst?“ Ich nickte. Verunsichert. Weil ich seine Reaktion nicht deuten konnte. Er freute sich doch wohl und war vielleicht nur etwas überrascht? Wieder schaute Jakob auf das Foto.
„Neunte Woche?“, fragte er.
„Ja, es ist noch ganz frisch. Aber man kann es auf dem Bild schon erkennen.“ Gespannt starrte ich ihn an.
„Jakob?“ Langsam legte er das Bild auf den Tisch und fuhr sich mit der Hand über die Stirn.
„Puh!“, sagte er. Ich lachte.
„Ja, nicht? Ziemlich große Überraschung, oder?“
„Allerdings!“ Er lächelte und strich vorsichtig mit einem Finger über meine Hand. Sah mich an.
„Du kannst es doch aber noch wegmachen lassen, oder?“
An diesem Abend aßen wir keine Scampi. Und keine Pizza. Ich verließ das Restaurant, sobald ich mich von meiner Schockstarre erholt hatte, und lief ziellos durch die Stadt.
Es hatte angefangen zu regnen, aber das merkte ich kaum. Weil ich nur eines denken konnte. Dass Jakob mich verraten hatte. Es war ihm gar nicht in den Sinn gekommen, dass ich das Kind behalten wollte. Das war ihm offensichtlich total egal. Es gab nur ihn und seine Bedürfnisse. Immer wieder nur ihn. Von Anfang an war es so gewesen. Ich hatte das nur noch nie so klar gesehen.
Jakob zog am nächsten Morgen aus. Es machte keinen Sinn mehr.
Ich wollte keine Entschuldigungen, keine Diskussionen, keine Versöhnung. Er hatte mir gezeigt, wie er wirklich war. Ich wollte nur noch, dass er ging.
Die nächste Zeit schlief ich viel. Ich war unendlich müde. Das Kind verbrauchte meine ganze Kraft. Obwohl es nicht größer war als ein Gummibärchen. Der Arzt hatte mich gleich krankgeschrieben und ich hatte nichts dagegen.
Tage vergingen, an denen ich nichts tat. Meistens lag ich im Bett und starrte an die Decke. Und wartete nur, dass die Zeit verging. Manchmal stand ich auf, um mir etwas zu essen zu holen. Gott sei Dank war der Kühlschrank voll. Einmal klingelte das Telefon, aber ich ging nicht ran. Ich wollte mit niemandem sprechen.
Einsam war ich nicht, denn ich hatte ja mein Kind. Das Ultraschallbild hatte ich eingerahmt und auf meinen Nachttisch gestellt, zusammen mit dem Bild von Martha. So hatte ich zwei, mit denen ich reden konnte.
Mir fielen auch die Geschichten wieder ein, die Opa erzählt hatte. Über Martha. Über ihr Leben auf dem kleinen Hof in Pommern. Mit ihrem alten Vater und ohne Mann und Kinder. Und dann, dass sie nie geheiratet hatte.
„Eigentlich hätten wir ja Marten heißen sollen“, hatte Opa gesagt, „aber es hat ja dann keine Hochzeit gegeben.“
Schwanger war sie trotzdem geworden, auch ohne Hochzeit. Wie das wohl gewesen war, damals? Sie hatte ja trotzdem immer arbeiten müssen.
Ich betrachtete ihr Bild und hätte sie gerne befragt. Über das Kinderkriegen. Die Liebe. Das Leben überhaupt.
Schließlich fasste ich einen Entschluss. Stand auf und schaltete den Computer an. Setzte mich davor und begann zu schreiben. Vielleicht war es ja so gewesen…
Pommern 1909
Martha
Mit einem Seufzer stand Martha Borchart vom Melkschemel auf. Reckte sich und rieb sich den schmerzenden Rücken. Im Stall roch es nach warmem Tier und staubigem Stroh.
Martha streckte sich noch einmal, dann schob sie mit beiden Händen die Starke zur Seite. Die Kuh schnob laut und schlug nachlässig mit dem Schwanz. Martha nahm den vollen Eimer mit der schäumenden Milch, hängte den Schemel an den Haken und verließ den Stall. Draußen wurde es langsam hell. Es war ein frischer, klarer Morgen, der schon ganz leicht nach Sommerabschied und Herbstkühle roch. September. In ein paar Wochen würden sie wieder den halben Tag in Dunkelheit und Kälte verbringen. Mit eisigen Händen morgens beim Füttern und Melken. Aber noch war es nicht soweit. Noch war Sommer. Auch wenn die Sonnenblumen schon die schweren Köpfe hängen ließen, und die Hagebutten an den Rosensträuchern sich rot färbten.
In der Küche verströmte der Ofen noch einen kleinen Rest Wärme vom letzten Abend. Martha stellte die Milch in die Speisekammer, dann ging sie zum Tisch und schlug den Kalender auf. Holte einen Stift aus der Schürzentasche und strich einen Tag aus. So. Es war gut zu sehen, dass die Zeit verging.
Die Tage auf dem kleinen Hof waren alle gleich. Sie dauerten von morgens um fünf bis abends um zehn. Im Sommer. Im Winter gingen sie früher zu Bett, um Kerzen zu sparen. Und Petroleum. Jeden Morgen als erstes in den Stall, die Tiere versorgen. Die beiden Pferde, die Kühe und das Schwein. Dann der Haushalt. Kochen, Putzen und die Wäsche.
Die Hühner und der Gemüsegarten. Und dann die Arbeit auf dem Feld. Die machte der Vater. Aber natürlich musste Martha mithelfen. Er war ja nicht mehr der Jüngste. Sie sprachen nicht viel miteinander, der Vater und sie.
Manchmal ging Martha am Samstag zum Tanzen in den Krug. Wenn Gustav keine Lust hatte und Tilly nicht allein gehen wollte.
So war es auf dem Borchart-Hof, seit die Mutter gestorben war. Aber Martha wollte nicht darüber nachdenken. Es nützte ja auch nichts.
Wenn sie aus dem Küchenfenster sah, lag vor ihr der Hofplatz, rechts die Scheune, dahinter der Gemüsegarten. Ein paar Hühner stolzierten herum und scharrten in dem trockenen Sand nach Würmern. Es war bald Mittag, und über dem Hof lag eine schläfrige Ruhe. Martha wärmte Wasser auf dem Herd und goss es dann in die große weiße Emailleschüssel. Die war am Rand schon ein bisschen angeschlagen. Stellte das Geschirr bereit und machte sich an den Abwasch. Die Kartoffelsuppe stand schon auf dem Herd. Draußen hörte sie eine Stimme. Das war die Anna Gehrke, von nebenan. Die redete immer so laut, dass man sie bis Kleinmöllen hören konnte. Vorsichtig schaute Martha aus dem Fenster. Sie wollte nicht, dass die Nachbarin sie sah. Die wurde man sonst nicht wieder los. Ja, da standen sie, die Gehrke und der Vater. Die Frau hielt eine Schüssel im Arm, hatte wohl Eier geholt. Sie redete und redete, während der Vater auf seine Füße schaute. Und die Worte der Nachbarin ohne Widerstand über sich ergehen ließ. Übers Wetter, die Gesundheit und die Familie. Das waren die Themen.
„Ja, meine Astrid, die kriegt ja nu auch ihr drittes. Und so fleißig isse, na, deine ja auch. Da kannste von Glück sagen. Nicht so eine, die den Männern nachläuft, nich. War ja auch nicht so einfach, so ohne Mutter, nur mit 'em Vadder, nich. Aber was soll’s.“ Wohlwollend klopfte sie dem Vater auf die Schulter. „Glück im Unglück, sag ich immer, Glück im Unglück.“ Dann beugte sie sich neugierig vor.
„Und, hat sie denn nu schon was in Aussicht?“ Überrascht schaute der Vater auf.
„Was?“
„Na, 'n Mann, mein ich. Wird ja langsam Zeit. Wie alt isse jetzt? Dreißig? Da muss sie sich aber ranhalten.“ Wieder klopfte sie dem Vater auf die Schulter.
„Na, nichts für ungut. Nu muss ich aber los.“ Sie wandte sich zum Gehen, ließ den Vater auf dem Hofplatz stehen mit den Händen in den Taschen und hochgezogenen Schultern. Martha sah, wie er den Kopf schüttelte. Dann wandte er sich um und ging langsam aufs Haus zu.
Schnell sprang Martha vom Fenster zurück, beugte sich hastig über die Abwaschschüssel. Der Vater sollte nicht wissen, dass sie gelauscht hatte. Sie wollte ihm keinen Kummer machen. Er hatte es ja schwer genug. Aber die Worte der alten Gehrke taten weh, wie Dornenranken auf der bloßen Haut. Sie hätte ja schon gerne geheiratet. Aber wen? Es hatte sie ja nie jemand gewollt. Dazu war der Hof auch zu klein. Und sie hatte auch nie jemanden gefunden, den sie wirklich gewollt hätte. Es wäre ja auch gar nicht gegangen. Denn wer hätte sich um den Vater gekümmert, wenn sie weggezogen wäre? Der Vater hatte sie auf dem Hof gebraucht. Und sie war geblieben. Aber wenn sie ganz ehrlich war, fühlte sie sich mehr und mehr zu dem Leben hier verurteilt. Mit der Arbeit konnte sie die Gedanken auf Abstand halten. Sie wollte sie nicht hören, denn sie nützten nichts. Nicht die von der Schuld und nicht die, die ihr etwas anderes versprachen. Einen Mann, Kinder, etwas Eigenes. Aber sie waren trotzdem da. Immer. Vor allem nachts, wenn sie nicht schlafen konnte.
Ich träume…
Ich bin in der Kirche, vorne, an der ersten Bank. Es ist kalt und düster. Vor dem Altar stehen die Särge. Ein großer und einige kleine. Fünf oder sechs. In dem großen liegt die Mutter. Und in den kleinen ihre Fehlgeburten. Es sind so viele. Der Vater steht daneben und schaut mich an. Ganz streng sieht er aus. Und böse. „Das ist alles deine Schuld“, sagt er.
Obwohl er das noch nie zu mir gesagt hat.
Am Samstag kam Tilly vorbei. Fragte, ob Martha wohl noch ein bisschen Zucker übrig hätte, für den Sonntagskuchen. Aber das war nur ein Vorwand. Mit der Zuckerschüssel in der Hand saß sie auf der alten Bank und sah zu, wie Martha die Hühner fütterte. Warf einen kritischen Blick auf die Fenster und den Gemüsegarten. Ob denn auch alles gut in Schuss war. Tilly wusste gerne Bescheid. Über alles.
„Kommste denn mit heute abend?“, fragte sie. Martha schaute auf.
„Wohin?“
„Na, zum Tanzen. Is doch Samstag heute.“
„Ach nee, ich glaub nich. Hab noch so viel zu tun.“ Tilly sah enttäuscht aus.
„Och, Martha, das sagste immer. Is doch alles in Ordnung hier. Musst dir doch auch mal was gönnen.“
„Aber ich hab doch überhaupt niemanden zum Tanzen.“
„Ach Schnack!“ Tilly schnalzte missbilligend mit der Zunge, „da sind doch wohl genügend flotte Kerle, will ich meinen. Und Gustav kommt diesmal auch mit, hat er gesagt.“
„Ach, ich weiß nich…“
„Nee, also jetzt ist gut. Du kommst mit. Musst doch auch mal raus.“ Tilly stand auf und nahm ihre Zuckerschüssel in den Arm.
„Wir holen dich dann ab.“
Martha stand da und schaute ihrer Cousine hinterher. Manchmal war es, als würde Tilly sie einfach überrollen. Sie musste natürlich mitgehen. Sie konnte auch ‚Nein‘ sagen, wenn Tilly und Gustav vor der Tür ständen. Aber eigentlich hatte sie ja auch Lust. Zumindest ein bisschen. Einmal an gar nichts denken. Nur die Musik hören. Tanzen. Leicht sein.
Und während Martha ihre übliche Runde machte, der Stall, der Garten, das Haus, schlich sich ein Lächeln auf ihr Gesicht. Sie setzte den Suppentopf aufs Feuer und ging in die Kammer. Löste den festgeflochtenen Zopf und begann, ihre Haare auszukämmen. Strähne um Strähne, Strich um Strich. Wie Sonnenstrahlen floss das Haar über ihren Rücken. Lang und dick und glänzend. Ihre Haare waren ihr ganzer Stolz. Auch wenn sie das nie gesagt hätte. Es war ja sonst nichts Besonderes an ihr. Ein breites, gutmütiges Gesicht, eine kräftige Gestalt. Rote Wangen hatte sie, immerhin. Nach dem Bürsten flocht sie die Haare zu einem dicken Zopf, den sie sich wie eine Krone um den Kopf legte. Jetzt konnte sie zum Tanzen gehen.
Der Dorfkrug war bereits gut gefüllt, als Martha mit Tilly und Gustav den Saal betrat. Die mitreißenden Klänge von Akkordeon und Geige schlugen ihnen entgegen. Dazu ein lautes, rhythmisches Stampfen auf den alten Holzdielen. Es wurde schon getanzt. Die Luft roch nach Schweiß und dem Essen, das in der Küche auf dem Herd stand. Kartoffelsuppe, falls jemand Hunger bekam. Tilly packte ihren Mann bei der Hand und zog ihn auf die Tanzfläche. Martha schob sich zwischen den Zuschauern an der Wand entlang, bis sie einen leeren Platz gefunden hatte. Dort blieb sie stehen und schaute sich um. So gut besucht wie heute war das Tanzvergnügen nicht immer. Es sah so aus, als wären nur die Alten und die Kinder zu Hause geblieben. Dicht an dicht standen die Leute um die Tanzfläche herum, auf der sich die Tanzenden fast auf die Füße traten. Ein ständiges Kommen und Gehen. Kaum verließ ein Paar die Tanzfläche, verschwitzt und außer Atem mit hochroten Gesichtern, schon sprang das nächste herbei und stürzte sich ins Vergnügen. Martha sah viele Frauen, mit denen sie zur Schule gegangen war. Ein paar schon etwas breiter um die Hüften vom Kinderkriegen. Aber alle mit einem Mann an der Hand. Die Burschen rissen sich um die jungen Mädchen, die verschämt kicherten, wenn jemand sie zum Tanzen holte, und laut auf quiekten, wenn der Tänzer kräftig zupackte. Zu Martha kam niemand. Nur Gustav bat sie um einen Tanz. Da hatte Martha schon fast keine Lust mehr. Aber sie ging mit. Er war ja doch ein Netter. Gutmütig und großzügig, ganz anders als seine laute, herrschsüchtige Frau.
Die Musiker spielten eine Polka, aber Martha tanzte steif und unbeholfen. Die Musik erreichte sie nicht.
Nach dem Tanz schlich sie sich davon. Sie wollte nicht, dass irgendjemand sie aufhielt. Aber sie hätte nicht schleichen brauchen, sie war ja doch unsichtbar.
Zu Hause setzte sie sich an den Küchentisch und starrte vor sich hin. Versuchte, die Enttäuschung hinunterzuschlucken. Aber das war schwer. Dann stand sie auf und holte Eimer und Feudel und die Scheuerseife aus der Kammer. Und fing an, die Küche zu putzen. Vielleicht konnte sie dadurch wieder sichtbar werden. Sie hörte den Vater nicht, der kam und stumm in der Tür stand. Und wieder ging, ohne etwas zu sagen.
Am nächsten Morgen war alles wie immer. Die Tiere, der Garten, der Haushalt. Martha hatte gerade das Wasser für das dreckige Geschirr gewärmt, als der Vater über den sandigen Hofplatz geschlurft kam. Um diese Zeit gönnte er sich immer seinen Vormittagskaffee. Muckefuck nur, aber immerhin. Eilig trocknete Martha sich die Hände ab und lief zum Herd hinüber. Der Abwasch musste warten. Vorsichtig nahm sie die heiße Kanne vom Feuer und goss den Kaffee in den blauen Becher. Schon ging die Tür und der Vater kam herein. Schwerfällig ließ er sich am blankgescheuerten Küchentisch nieder. Der alte Stuhl ächzte leise. Mit zitteriger Hand nahm der Alte die Tasse und trank die ersten Schlucke. Leise schlürfend. Martha ging zurück zur Waschschüssel. Das Geschirr klapperte aneinander. Aus der Stube war das Ticken der Uhr zu hören. Die Stille zwischen ihnen füllte das ganze Haus. Auf einmal räusperte sich der Vater. Ein lautes, kratzendes Geräusch.
„Ich hab mit Karl Marten gesprochen, weißt schon, drüben in Kleinmöllen. Seine Frau ist krank und er braucht jemand für den Haushalt. Kannst bei ihm in Stellung gehen. Am besten gleich die nächste Woche.“ Er nahm noch einen Schluck aus der Tasse, dann schob er den Stuhl zurück, stützte die Hände schwer auf die Tischplatte und erhob sich mit einem Seufzer. Zeit, wieder an die Arbeit zu gehen. An der Tür blieb er kurz stehen und nickte mit dem Kopf.
„Ja, so.“ Mehr gab es nicht zu sagen.
Die Tür fiel ins Schloss, und Martha stand eine Weile einfach da und sah vor sich hin. In der Abwaschschüssel wurde das Wasser kalt, während die Worte des Vaters durch die Küche schwebten. Wie kleine Sonnenstrahlen, die wärmten. In Stellung gehen. Wie das klang! Nach etwas Neuem, Aufregendem. Endlich mal raus und weg von dem immer Gleichen hier auf dem Hof.
Martha war schon einmal in Stellung gewesen. Mit 16, bei der Lehrerfamilie. Als Haushaltshilfe. Da hatte die Mutter noch gelebt. Und die Welt war frisch und neu und voller Versprechungen gewesen. Leicht war es gewesen, ganz leicht. Wie gut es ihr gefallen hatte, die Stellung, die Lehrersfrau, die Arbeit. Aber als die Mutter starb, war Schluss damit gewesen. Und jetzt sollte sie nach Kleinmöllen, auf den Marten-Hof. Der war um einiges größer als der eigene. Wie man hörte, hatte der alte Marten gut gewirtschaftet. Da konnten sie sich wohl eine Magd leisten.
Martha spürte eine stille warme Freude in sich. Diese Freude trug sie durch die nächsten Tage.
Ich träume…
Ich komme zum Marten-Hof und stehe in der Tür. Aber sie lassen mich nicht herein. Schauen mich nur an von oben bis unten und schütteln mit dem Kopf. Einer nach dem anderen.
Dass es nur nicht so wird.
Der Morgen von Marthas erstem Arbeitstag auf dem Marten-Hof war ganz golden. Über den Wiesen und Feldern lagen dünne Nebelschleier, die einen sonnigen Tag versprachen, und die Hecken hingen voller zarter Spitzendeckchen. Spinnenweben. Altweibersommer. Wie gut, dass die Ernte eingebracht war. Zumindest zum größten Teil. Nur die Kartoffeln und die Rüben fehlten noch, aber das würde schon gehen, irgendwie. Noch früher als sonst war sie heute aufgestanden, hatte die Kühe gemolken, Finnöt und die Starke, die Hühner und Gänse gefüttert und dem Vater das Essen bereitet.
Jetzt war sie auf dem Weg nach Kleinmöllen. Am Fichtebarg vorbei und hoch zur Straße. Überall auf den kleinen Hofstellen war man schon wach. Rauch stieg aus den Schornsteinen, Kühe muhten und Hühner gackerten schläfrig. Morgengeräusche. Auch bei Gustav und Tilly war schon Licht hinter dem Fenster. Wahrscheinlich stand Tilly bereit, um einen Blick auf die neue Magd zu erhaschen. Dann konnte sie hinterher brühwarm überall zu erzählen, dass „die arme Martha ja ziemlich blass ausgesehen hätte, naja, die Aufregung. Aber ob sie das denn auch schaffen würde mit der ganzen Arbeit, zu Hause und auf dem Marten-Hof, und dann auch noch die kranke Frau…“. Denn dass Martha in Stellung ging, hatte sich bereits herumgesprochen. Nicht nur in der Barning, sondern bestimmt auch in Kleinmöllen, vielleicht sogar in Bauernhufen und Sorenbohm. Sowas ging immer ganz schnell.
Martha streckte den Rücken und hob den Kopf. Sie wusste, dass die Leute tratschten, aber sie wollte sich nicht den Tag verderben lassen. Trotzdem nagte es. Als ob sie nichts Besseres hätten, worüber sie sich unterhalten konnten. Martha wanderte weiter, und mit jedem Schritt wuchs die kleine, flatternde Unruhe, die sich in ihrem Magen eingenistet hatte. Seit dem letzten Traum. Sie hatte das Glücksgefühl der letzten Tage verdrängt. Martha versuchte, sie nicht zu beachten. Unangenehme Gedanken von sich weg zu schieben, das konnte Martha gut. Darin hatte sie Übung. Jahrelang. Man musste nur an etwas anderes denken. An das Wetter zum Beispiel. Oder die Landschaft, die wohl nirgendwo so schön war wie gerade hier. Unverfängliche Gedanken. Man konnte die Hagebutten betrachten, die sich schon rot färbten, oder die Sonnenblumen drüben am Zaun bei Strehlows. Das half.
Der Weg von der Barning nach Kleinmöllen war nicht sehr weit. Wenn man zügig ging, konnte man in einer halben Stunde dort sein. Martha wollte an ihrem ersten Tag auf keinen Fall zu spät kommen. Doch als sie den Marten-Hof erreichte, war niemand zu sehen. Schliefen die Leute etwa noch? Vorsichtig klopfte sie an die Hintertür, erst leise, dann lauter. Wartete und lauschte. Es dauerte eine ganze Weile, bis sich endlich etwas regte. Erst war ein Poltern zu hören, dann öffnete sich die Tür einen Spalt breit. Ein noch vom Schlaf verknittertes Gesicht lugte heraus. Die blonden Haare ganz zerzaust. Ein Junge, nein, ein Mann. Einer der Marten-Söhne vermutlich, Leo, der Jüngere. Missmutig blinzelte er ins Helle.
„Ja?“ Marthas Hals war trocken, als sie zum Sprechen ansetzte. Aber sie wollte sich nicht entmutigen lassen.
„Ich bin Martha Borchardt, drüben aus der Barning. Die neue Magd.“ Das fügte sie noch hinzu, denn ihren Namen schien der junge Marten nicht einordnen zu können.
„Die neue Magd…“, wiederholte er und musterte sie von oben bis unten. Wie in ihrem Traum. Unverschämt fand Martha das, aber sie konnte nicht verhindern, dass sie rot wurde unter seinem dreisten Blick.
„Ist der Vater da?“, fragte sie mit fester Stimme.
„Nee, der is in Kolberg, kommt erst morgen zurück. Aber sie kann schon reinkommen. Arbeit gibt’s auch ohne ihn.“ Mit diesen Worten öffnete er die Tür. Zögernd trat Martha ein.
Wenn man, wie sie, das Haus durch die Hintertür betrat, kam man erst durch einen kleinen Flur und von dort in die Küche. Ein großer heller Raum mit dem eisernen Küchenherd und einem langen Holztisch an der einen Wand. Durch die Fenster schien die Morgensonne, auf den Staub auf den Regalen und die Spinnenweben in den Ecken und über dem Herd. Und auf das dreckige Geschirr, das sich neben dem Abwaschplatz türmte. Dreckverkrustet. Der alte Marten und seine Söhne waren wohl nicht dazu gekommen. Martha sah das. Und der junge Marten sah, dass sie es sah. Nachlässig zuckte er mit den Achseln.
„Is viel Arbeit, hab‘ ich ja gesagt.“ Dann kramte er unter der Bank einen alten Pullover hervor und zog ihn sich über den Kopf.
„Ich muss los“, sagte er, „bin am Nachmittag wieder da. Georg kommt früher, gegen Mittag. Dass sie dann was gekocht hat.“ Er wandte sich zur Tür.
„Und die Mutter?“, rief Martha ihm noch hinterher. Er winkte nachlässig mit der Hand.
„Die schläft jetzt. Stör sie mal nicht.“ Dann klappte die Tür.
Martha stand eine ganze Weile einfach nur da, mitten im Raum, und sah sich um. Das war nun nicht so ein Empfang gewesen, wie sie ihn sich gewünscht hätte. Aber es nützte wohl nichts, sich darüber zu grämen. Martha seufzte tief, dann stellte sie ihren Korb auf die Bank, band sich die Schürze um und begann mit der Arbeit. Und da sie Martha war, tat sie das gründlich. Sie putzte das ganze Haus. Holte die Spinnweben von der Decke und aus allen Winkeln. Putzte die Fenster und wischte die Fensterbänke. Staubte die Möbel ab und scheuerte außerdem die Fußböden. Überlegte kurz, ob sie wohl einfach die Schlafkammern betreten durfte, entschied sich dafür und lüftete die Betten. Nur das Zimmer, in dem die Kranke schlief, betrat sie nicht. Es war auch das einzige, dessen Tür verschlossen war. Und da sie nicht nur gründlich, sondern auch flink war und ihr die Arbeit schnell und leicht von der Hand ging, war sie noch vor dem Mittag fertig. Mit den Haaren voller Staub und einer tiefen Befriedigung im Herzen.
In der Speisekammer fand sie noch Kartoffeln von der vergangenen Ernte. Die letzten, ganz offensichtlich. Etwas schrumpelig schon und mit Keimen. Aber für ein paar Plinsen würden sie noch reichen.
Martha heizte den Ofen an und schälte die Kartoffeln. Rieb sie und gab Eier und Salz dazu. Dann buk sie die Plinsen in der Pfanne, ganz dünn und knusprig, und deckte den Tisch. Für eine Person. Danach gab es erst mal nichts mehr zu tun. Ein merkwürdiges Gefühl. Martha setzte sich auf die Bank und lauschte den Geräuschen des Hauses. Es war still, und die Stille hatte etwas behagliches, war nicht vorwurfsvoll wie zu Hause. Martha konnte einfach hier sitzen und nichts tun, und es fühlte sich gut und richtig an. Kein Drang, sofort aufzuspringen und die nächste Arbeit in Angriff zu nehmen. Merkwürdig, in der Tat, ungewohnt und fremd.
Da ging die Tür. Fast erschrocken fuhr Martha zusammen. Schnell sprang sie auf und lief zum Herd, um die letzten Plinsen zu wenden. Vielleicht sollte sie doch nicht so einfach auf der Bank sitzen. Im Flur war ein Poltern zu hören, als ob jemand schwere Stiefel auszog. Das musste Georg Marten sein, der ältere Sohn. Martha kannte ihn nur flüchtig, früher war er immer einer von den Jungen gewesen, die ihr und Tilly Schimpfwörter nachgerufen hatten, wenn sie in Kleinmöllen beim Einkaufen gewesen waren. Jetzt kam er in die Küche und war ein stattlicher junger Mann. Groß und blond mit einem freundlichen, offenen Gesicht. Ein Mensch, der strahlte. Er hatte kräftige, warme Hände, die ihre nahmen und sich bedankten, dass sie gekommen war, um zu helfen. Er setzte sich an den blankgescheuerten Holztisch und sah sich um. Sah ihre Arbeit, und seine Augen leuchteten. Sagte, es sei schwer gewesen in der letzten Zeit. Aber heute sei es wieder richtig behaglich. Wie früher. Das hätten sie wohl nicht geschafft, er und Leo und der Vater. Da bräuchte es wohl eine Frau. Und wie gut es roch! Martha hörte zu und nickte und lächelte. Füllte den Teller mit Plinsen und stellte ihn auf den Tisch. Erstaunt sah er sie an. Ob sie denn nicht essen wollte? Also nahm sie noch einen Teller, füllte ihn und setzte sich an den Tisch. Aß und hörte zu, während Georg Marten erzählte. Von dem Hof und den Tieren. Leo sollte bald nach Kolberg, zu einem Maurer. Mit zwanzig wollte er mal ein bisschen hinaus. In der letzten Zeit hätte er sich ja um die Mutter gekümmert und den Haushalt. Als Martha fragte, was denn das nun eigentlich wäre für eine Krankheit und was sie selber tun könnte, um zu helfen, zuckte er mit den Achseln.
„Is halt so ein Husten. Der sitzt fest, schon seit Wochen. Ordentlich dünn ist sie geworden. Viel machen kann man da nicht. Ruhe, vor allem. Und keine Aufregung.“ Dann lächelte er, als wolle er die schweren Gedanken verscheuchen. Ob sie denn nicht mal etwas erzählen wolle von ihrem Hof in der Barning? Martha zuckte mit den Schultern. Was gab es da schon groß zu erzählen? Ein paar Felder, die Tiere, der Vater, das Haus. Mehr war es nicht. Sie konnte nichts über sich selber erzählen, schon gar nicht einem Fremden, einfach so. Dass er das konnte! Überhaupt, dass er so viel redete, das kannte sie sonst nur von Tilly. Und die sprach nicht über sich, immer nur über andere. Aber sie hörte ihm gerne zu.
Nach dem Essen sagte Georg, dass sie vielleicht jetzt einmal nach der Mutter schauen sollten. Ob sie schon wach wäre. Martha nickte.
Schon vor einiger Zeit war der alte Marten aus dem gemeinsamen Schlafzimmer in eine kleine Kammer umgezogen, er wollte seine Frau nicht stören. Die lag alleine in dem breiten Ehebett und sah klein und verloren darin aus. Ein schmales Gesicht, straffe Haut über eingefallenen Wangen. Und dunkle Schatten unter den Augen. Wie ein Vogel, dachte Martha, der aus dem Nest gefallen ist. Aber als sie jetzt lächelte, war es ein bisschen so, als würde die Sonne aufgehen.
„Georg!“, sagte sie. „Und das wird wohl die Martha sein, wie schön!“ Dann musste sie husten, und der Husten packte ihren kleinen, dünnen Körper und schüttelte ihn durch. Keuchend holte sie anschließend Luft und wischte sich die Tränen aus den Augen. Hob die Schultern und sagte entschuldigend:
„Ja, so ist das.“ Georg setzte sich neben sie und nahm ihre Hand. Und sprach von Wickeln und Umschlägen und Dampfbädern. Und Martha nickte wieder. Das würde sie schon schaffen. Das klang nicht so schwer. Dann halfen Georg und Martha der Frau aus dem Bett und setzten sie in den Lehnstuhl am Fenster, mit einer warmen Decke über den Knien.
„Hier kannste ein bisschen hinausschauen“, sagte Georg und küsste seine Mutter auf die Wange, „und was essen kannste dann auch. Die Martha hat Plinsen gemacht.“
Wieder in der Küche zeigte Georg Martha noch ein Flasche mit dem Hustensaft.
„Den nimmt sie vor dem Schlafengehen.“ Prüfend hielt er sie gegen das Licht.
„Is nicht mehr viel drin. Der Doktor sagt, eigentlich müsste sie weg, in die Berge. Aber das geht ja wohl nicht.“ Er zuckte mit den Schultern.
„Is auf jeden Fall gut, dass sie jetzt da ist. Dann macht sich die Mutter nicht so viele Gedanken.“
In diesem Augenblick ging die Haustür und Leo Marten betrat die Küche. Missmutig runzelte er die Stirn, als er die beiden in der Küche so vertraut beieinander stehen sah.
„Ist noch was zu essen da?“, grummelte er und setzte sich ohne einen Gruß an den Tisch. Georg zog mit einer entschuldigenden Geste die Schultern hoch.
Als Martha sich später auf den Weg nach Hause machte, fing Georg sie auf dem Hofplatz noch einmal ab. Es sei wegen Leo, sagte er. Der sei eigentlich nicht so. Aber sie müsste das auch verstehen. Bisher hätte er sich um die Mutter gekümmert. Und nun sei sie gekommen, und das wäre, als sei er nicht mehr gut genug. Dabei wollte der Vater doch nur, dass Leo endlich mit der neuen Stelle anfing. Martha hörte ihm zu und nickte. Ja, das verstand sie.
Dann ging sie nach Hause. Das war der erste Tag.
Am nächsten Tag kam Karl Marten nach Hause.
Martha kochte Apfelmus. Gleich am Morgen hatte Georg ihr drei große Säcke voller Äpfel in die Küche geschleppt, die bereits ein paar Tage in der Scheune gestanden hatten und dringend verarbeitet werden mussten. Martha schälte Äpfel, entkernte und schnitt heraus, stundenlang, bis die Küche und das Haus voll waren vom Wasserdampf und einem behaglichen Duft nach frisch gekochtem Apfelmus. Martha war so sehr in ihre Arbeit vertief, dass sie den Mann erst bemerkte, als er schon in der Küche stand. Erschrocken fuhr sie zusammen.
„Ja?“, fragte sie, und ob sie ihm helfen könnte. Da lachte der Mann und erwiderte, dass sie das schon täte. Und Martha ging auf, dass dies wohl Karl Marten sein müsste. Sie wurde rot im Gesicht, so unangenehm war es ihr, und am liebsten hätte sie sich im Wasserdampf unsichtbar gemacht, doch das ging nicht, denn jetzt streckte ihr der Bauer die Hand hin.
„Karl Marten“, sagte er, „willkommen auf dem Marten-Hof. Und vielen Dank auch, dass sie uns helfen will.“ Martha wollte ihre Hand gerne wegziehen, doch er hielt sie fest und sah ihr lächelnd ins Gesicht. Warm und fest fühlte sich seine Hand an. Und ein bisschen rau. Dann ließ er sie los und sagte, er wollte nicht weiter stören, sie habe ja zu tun, so wie es aussähe. Außerdem wollte er jetzt auch mal nach der Frau sehen. Verstohlen sah Martha ihm nach, als er die Küche verließ. Und dachte, dass sie gar nicht gewusst hatte, dass er noch so jung aussah, mit dem hellblonden Haar, in dem man die weißen Strähnen erst auf den zweiten Blick sah, und dem braungebrannten Gesicht. Aber sie hatte ihn auch immer nur aus der Ferne gesehen, wenn überhaupt. Mit einer Leichtigkeit im Herzen, von der sie gar nicht sagen konnte, woher sie kam, machte sich Martha wieder an die Arbeit. Und während sie das Apfelmus rührte und in die Gläser füllte, begann sie zu singen. Ohne es zu merken. Das war die Freude, die hinaus wollte. Aber oben im Zimmer saß die Frau. Die hörte den Gesang. Und roch den vertrauten süß-herben Duft, der aus der Küche kam. Sie schloss die Augen und lächelte, während der Mann ihr über die Stirn strich.
Ich träume…
Ich stehe auf einer Lichtung und die Sonne scheint auf mich herab. Nur auf mich, drum herum ist es dunkel. Am Rand der Lichtung stehen Menschen, sie flüstern und tuscheln und zeigen auf mich. Ich kann nicht verstehen, was sie sagen, aber ich glaube, sie sind neidisch. Ich drehe mich auf der Lichtung im Kreis, ganz langsam. Und die Sonne wärmt mich.
Auf einmal war das Leben schön. Gleich wenn Martha morgens aufstand, hatte sie ein warmes Gefühl in der Brust, ein Kribbeln im Magen, das sich als Lächeln auf ihrem Gesicht zeigte. Immer öfter sang sie bei der Arbeit, was erstaunlich war, denn sie hatte sonst nie gesungen. Jetzt aber kramte sie all die alten Lieder, die sie in der Schule oder von ihrer Mutter gelernt hatte, wieder aus den hintersten Winkeln ihres Gedächtnisses hervor.
Und dabei arbeitete sie doch mehr als zuvor. Stand früher auf und war den ganzen Tag auf den Beinen. Und musste auch abends noch, wenn sie nach Hause kam, die Tiere versorgen und Putzen und das Essen für den nächsten Tag vorbereiten.
Es lag wohl daran, dass es nun jemanden gab, der ihr die Arbeit dankte.
Bestimmt war der Vater auch froh darüber, dass er sie hatte auf seinem Hof, dass sie all die Arbeit tat, die er nicht schaffte, dass sie sich um ihn kümmerte. Aber er hatte es nie gesagt und sagte es auch jetzt nicht. Auf dem Borchardt-Hof sprach man über so etwas nicht. Gefühle! Oder wie es einem ging, ob man glücklich war, das war doch wohl nichts, worüber man sich unterhalten konnte. Vielleicht wenn einen mal das Zipperlein plagte, dann ja. Aber ansonsten hielt man sich an handfeste Dinge. Das Wetter, die Tiere, die Arbeit. Auch auf dem Marten-Hof saß man nicht ständig beim Kaffeeklatsch und erzählte sich gegenseitig seine Befindlichkeiten, natürlich nicht! Doch wenn Martha dort zu ihrer Arbeit kam, waren da drei Menschen, die sich freuten, dass es sie gab. Drei nur. Denn Leo blieb eifersüchtig und missmutig Martha gegenüber. Gott sei Dank war er kaum da, eigentlich nur am Wochenende, und da blieb wiederum Martha zu Hause in der Barning. So liefen sie sich selten über den Weg.
Morgens war es jetzt immer schon dunkel, wenn sie aufstand und die Tiere versorgte. Selber frühstücken, dafür fehlte ihr meist die Zeit. Das tat sie später auf dem Marten-Hof, zusammen mit der Frau. Die freute sich, wenn Martha sich zu ihr setzte, ihr half beim Essen und selber auch eine Butterstulle aß.
„Ach, das ist doch schön, dass sie da ist“, sagte sie dann, „da bin ich nicht immer so allein. Das Mannsvolk ist ja man nur unterwegs.“ Sie erzählte auch von früher, als sie noch auf dem Hof der Eltern gewohnt, und Karl Marten um sie geworben hatte.
„Eigentlich sollte er nur meinem Vater aushelfen. Uns fehlte ja ein Knecht zu der Zeit. Na, und da kam halt der Karl. So ein fescher Mann. Meine Schwester und ich mussten den Männern immer das Essen aufs Feld bringen. Die Lise war auch in ihn verliebt. Meine Schwester. Aber er wollte lieber mich. Da war ich ja auch noch nich so dünne.“ Sie lachte, und daraus wurde ein Husten, das dauerte eine Weile. Danach lag sie erschöpft in den Kissen und wollte lieber, dass Martha etwas erzählte. Von der Mutter und dem Leben mit dem Vater so alleine auf dem Hof, und Martha kamen Gedanken, die sie noch nie gedacht hatte, dass sie auch weggehen könnte aus der Barning, zum Beispiel.
Mit Georg war es leicht. Von Anfang an. So leicht, dass Tilly bei einem sonntäglichen Treffen mit Martha mutmaßte, dass sie vielleicht die nächste Frau Marten werden wollte.
„Das ist doch ein schmucker Mann. Das wär doch was. Und er mag dich doch, oder?“
„Ja, schon. Aber doch nicht so. Und er ist doch auch jünger als ich.“ Tilly schnalzte mit der Zunge.
„Das ist doch nicht schlimm. Ich würd mich da ein bisschen ranhalten. Ist doch auch praktisch, dass die Höfe nicht so weit auseinander liegen. Da könnt ihr gut beide bewirtschaften.“
Aber Martha schüttelte nur den Kopf. Denn so war es eben nicht. Georg war einfach freundlich. Und fröhlich. Ein freundlicher, fröhlicher Mensch. Und aufmerksam. Es war leicht, mit ihm zu reden, denn er stellte keine Forderungen. Mehr gab es nicht zwischen ihnen, auch wenn er im Vorbeigehen öfter mal eine Hand auf Marthas Schulter legte. Das hatte nichts zu bedeuten. Schließlich hatte er ein Mädchen in Köslin, das er heiraten wollte.
Und Karl Marten? Von dem sah Martha nach der ersten Begegnung nicht viel. Wenn sie kam, war er meist schon aus dem Haus. Bei den Tieren oder auf dem Feld. Und wenn er sich einen Vormittagskaffee holte, war sie dann bei der Frau. Nur beim Mittagessen trafen sie sich. Das aßen sie zu dritt, Georg, Martha und Karl Marten. Bisher war Essen kochen immer ebenso eine Pflicht für Martha gewesen wie die Hühner zu füttern





























