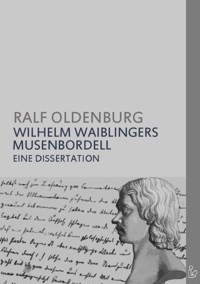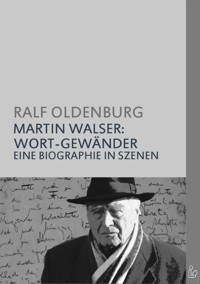
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Der öffentliche Autor Martin Walser! Eine Provokation? Nein, eine längst überfällige Tatsache. Sich medienwirksam intellektuell und sprach-artistisch ins Rampenlicht zu manövrieren, ist für Martin Walser ein Leichtes. Kaum einer wie er schaltet sich in Diskurse ein, ja, stößt öffentliche Debatten sogar gezielt an. Dabei tritt er betont als Intellektueller auf und weniger als Dichter im eigentlichen Sinn. Er sieht sich als Mensch, sozusagen als die Marilyn Monroe unter Deutschlands Schriftstellern. An der Schönheit kann es nicht liegen, auch wenn der Meister vom Bodensee noch immer eine imposante Erscheinung ist. Nein, kein Autor ist – bis heute – bildmedial präsenter als Walser. Die Öffentlichkeit hat der Streitbare wahrlich nie gescheut. Und darin gleicht er jener Hollywood-Ikone.
»Es sollte überdies darauf hingewiesen werden, dass Oldenburgs Text nicht als ganz und gar zuverlässige Quelle für Doktorarbeiten oder gar für studentische Essays geeignet ist, aber schließlich gibt es - so heißt es zumindest – ein Leben außerhalb der Universitäts-Gärten...«
(Stuart Parkes, gfl-Journal, 2003.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
RALF OLDENBURG
Martin Walser -
Wort-Gewänder
Eine Biographie in Szenen
Romankiosk Sachbuch
Der Romankiosk
Inhaltsverzeichnis
Das Buch
Vorwort von Carolin John-Wenndorf
Martin Walser. Wort-Gewänder. Eine Biographie in Szenen
1. »Bei meiner Geburt starben drei Mütter« – Walsers (Text-) Leben und Lebenstext
2. Die Kindheit in Wasserburg, »seinem Dublin, dem Nabel seiner Welt« (1927 – 1938)
3. »Ich habe meine Jugend in dem mittelalterlich bewahrten Glaubensgebäude verbracht.«
4. »Auf einem Floß aus Sätzen« oder das Durchlaufen von Sprachen (1938 – 1946)
5. »Der Auszug aus Wasserburg war ein Aufbruch in die Welt.« - Reporter, Regisseur und Hörspielautor (1946 – 1957)
6. »Schreiben ist: die Wahrheit proben«
7. »Ich bin voller politischer Geräusche, die in mich hineingestrahlt werden und mich provozieren.« (1958 – 1964)
8. »Ich bin immer sprachlich aufgelegt.«
9. »Jeder Mensch ist ein Schriftsteller. Nur viele haben es nicht nötig, es auszuüben.« (1964 – 1972)
10. »Ich bringe nicht zusammen dieses kapitalistische Amerika und das konkrete Amerika, das ich erfuhr.« (1973 – 1983)
11. »Meine Muse ist der Mangel.«
12. »Ich schreibe immer denselben Roman weiter, mit einer anderen Tonart.« (1984 – 1990)
13. »Nie böllern aus mir die Schlagwörter so unbremsbar heraus wie beim Deutschland-Gespräch.«
14. »Mit seinem Gewissen ist jeder allein.« (1991-2003)
15. »Was auch geschehen mag: sich nicht aus seinem Ich vertreiben lassen.«
16. »Der Schmerz verdient ein Denkmal aus Speiseeis.« (2003-2019)
Das Buch
Der öffentliche Autor Martin Walser! Eine Provokation? Nein, eine längst überfällige Tatsache. Sich medienwirksam intellektuell und sprach-artistisch ins Rampenlicht zu manövrieren, ist für Martin Walser ein Leichtes. Kaum einer wie er schaltet sich in Diskurse ein, ja, stößt öffentliche Debatten sogar gezielt an. Dabei tritt er betont als Intellektueller auf und weniger als Dichter im eigentlichen Sinn. Er sieht sich als Mensch, sozusagen als die Marilyn Monroe unter Deutschlands Schriftstellern. An der Schönheit kann es nicht liegen, auch wenn der Meister vom Bodensee noch immer eine imposante Erscheinung ist. Nein, kein Autor ist – bis heute – bildmedial präsenter als Walser. Die Öffentlichkeit hat der Streitbare wahrlich nie gescheut. Und darin gleicht er jener Hollywood-Ikone.
»Es sollte überdies darauf hingewiesen werden, dass Oldenburgs Text nicht als ganz und gar zuverlässige Quelle für Doktorarbeiten oder gar für studentische Essays geeignet ist, aber schließlich gibt es - so heißt es zumindest – ein Leben außerhalb der Universitäts-Gärten...«
(Stuart Parkes, gfl-Journal, 2003.)
Vorwort von Carolin John-Wenndorf
Ein Hut, darunter buschige Augenbrauen und wasserburgblaue Augen. Über seiner linken Schulter liegt lässig ein Trenchcoat. Warum über der linken Schulter? »Das war auf einem einzigen Foto!«, ruft Martin Walser entrüstet. »Nichts was mir wichtig ist, ist rechts oder links.«1 , »Ich habe in mir für mehr als eine Meinung Platz.«2 Das macht sein Verhältnis zur Öffentlichkeit mitunter prekär. Zu gerne möchte man ihn in eine Schublade zwängen, in die linke oder die rechte. Doch aus jeder Schublade lugt etwas heraus, das nicht hineinpassen will. Rechts ein roter Schal, links ein schwarzer Hut. Doch auch wenn Martin Walser befürchten muss, missverstanden zu werden, gibt er seit seinen literarischen Anfängen bemerkenswerter Bereitwilligkeit Auskunft. In Radiosendungen und Fernsehshows, in öffentlichen Briefen, seinen publizierten Tagebüchern, in Interviews, Essays und Reden. Er spricht über die Liebe (»Dass Liebe Liebe ist, ist sicher. Sie ist zusammengesetzt aus den Anlässen, die sie enthält und ehrt.«3 ) und ihr Gegenteil, fast, (»Ich komme nicht dazu, an meinen Tod zu denken. Immer ist etwas.«4 ). Oftmals ironisch (»Meine letzte Straftat? Nachprüfendes Anschauen der Videokassette mit der Paulskirchen-Veranstaltung. Dabei Frank Schirrmacher ziemlich gut gefunden.«5 ), nicht selten poetisch (»Ich liege auf der grünen Lippe des Sees.«6 ), immer aber emotional (»Mir tut die Commerzbank leid, bei der ich mein Konto gekündigt habe.«7 ), auch selbstkritisch (»Ich bin uncharakteristisch.«8 ) und voll Hoffnung (»Droben bleiben, das wär’s.«9 ). Entstanden ist so eine glanzvolle öffentliche Autorfigur, deren Facetten – je nach Blickwinkel – changieren. Eine Figur, über die Klaus-Michael-Bogdal die Vermutung anstellt, dass sie »das fehlende Werk, das ‚im Gedächtnis bleibt‘, [...] durch die kontinuierlichen, Person, Werk und öffentliche Repräsentativität verbindenden Selbstinszenierungen substituiert.«10
Die Strategien der Sichtbarkeit, die Martin Walser in der Öffentlichkeit anwendet, sind vielseitig. Die betonte Haltung der ‚Political Incorrectness‘, die ihn seine Paulskirchenrede gegenüber Ignatz Bubis mit den Worten verteidigen lässt: »Ich habe nur gesagt, wie es mir geht.«11 , ist verbunden mit stilisiert bescheidener ‚Authentizität‘ (»Ich leiste keinen Beitrag, ich teile Schwierigkeiten mit.«12 ). Diese wird verstärkt durch die Inszenierungsstrategie des öffentlichen ‚Geständnisses‘, das als einzigen Maßstab des Schriftstellers Gewissen kennt und das Martin Walser in seinem Aufsatz Über freie und unfreie Rede expliziert hat: »Ein Ergebnis der Gewissensbildung ist, daß ich das, was in meinem Gewissen stattfindet, nicht veröffentlichen kann. Ich kann sagen, mein Gewissen ist nicht vorzeigbar.«13 Wer sein Gewissen für nicht vorzeigbar hält und es dennoch tut, kann sich eines sicher sein: des gesteigerten Interesses, nicht selten verbunden mit einem wirkmächtigen Skandal.14 Scheint ihn auch sein Geständnis im ersten Moment auf dem literarischen Feld zu demontieren, so beschert es ihm zugleich die größtmögliche mediale Aufmerksamkeit. So ist es nicht weiter verwunderlich, dass Martin Walser der erste deutsche Autor ist, dem schon zu Lebzeiten ein Denkmal gesetzt wurde. Das ist selbst Goethe nicht geglückt. Das ‚Reiterstandbild‘ Martin Walsers des Bildhauers Peter Lenk wurde 1999 in Überlingen am Bodensee, dem Wohnort Walsers, aufgestellt. Es zeigt den »Appointed Cowboy of Texas«15, wie Martin Walser sich selbst bezeichnet, nachdem er in Texas einen imposanten Sturz vom Pferd unverletzt überstanden hat, was den ihn begleitenden Texaner dazu ermunterte, ihm diesen Titel huldvoll zurufend zu verleihen. Die Skulptur Walsers inszeniert jedoch keinen dynamischen Cowboy auf dem Rücken des Pegasus, sondern einen älteren Herrn auf dem Buckel eines Esels, was Martin Walser empörte. Und war auch die Pose ‚hoch zu Ross‘ seit der Antike der Verewigung von Feldherren vorbehalten, so wird diese durch einen weiteren Stilbruch ironisch gewendet, indem dem Reiter Schlittschuhe unter die Füße geschnallt werden, die ihn den mythologisch aufgeladenen Ritt über den Bodensee, auch wenn eisige Zeiten anbrechen sollten, unbeschadet über die Eisschicht gleitend überstehen lassen.16Erfahrungen des Misslingens und der verfehlten Repräsentation seiner selbst kommen vor. Gelegentlich sind sie Walser physisch derart unerträglich, dass er drohte, auszuwandern.17 Doch Walser bleibt. Und lädt zu weiterer Beschäftigung mit seiner Person und seinem Werk ein.
Über sich selbst schreibt Walser: »Ich bin ein angebundenes Tier, das so tut, als möchte es frei sein, während es mit Genuss die Gefangenenkost frisst.«18 Die Zufriedenheit des an seine eigene Subjektivität gefesselten Schriftstellers mag an Ilse Aichingers Erzählung Der Gefesselte19 erinnern. So wie der Gefesselte in Aichingers Erzählung trotz seiner eingeschränkten Freiheit, ganz ohne Waffen, nur mit seinen bloßen Händen einen Wolf töten kann, so agiert auch Walser besonders sprachmächtig, mit Genuss, aus seiner Gefangenheit und Befangenheit heraus. Die Unsicherheit, die der Gefesselte bei Aichinger durch das Zerschneiden der Fessel erfährt, kennt und benennt auch Walser. Sie macht sich dann besonders eindrücklich bemerkbar, wenn er außerhalb seiner Fessel schriftstellerischer Subjektivität allgemeingültige Standpunkte beziehen soll. Bereits früh, in seinem 1963 veröffentlichten Essay Freiübungen formulierte Martin Walser in Anlehnung an den Chandos-Brief Hugo von Hofmannsthals, dem die Worte wie Pilze im Mund zerfallen, sein vorrangig seiner Innerlichkeit verschriebenes lebens- und sprachästhetisches Selbstverständnis, das ins Wanken gerät, sobald sich theoretische Reflexionen einschalten. Bei Walser heißt es: »Theorien sind zu haben. Es zerfällt mir etwas im Mund. Schmeckt nach Wörtern. Gibt es einen, der sich nicht belagert mit brutaler Aufmerksamkeit?«20 Sobald seine Emotionen durch den intellektuellen, aus eigenen Vernunftkategorien gebauten Filter brutaler Selbstaufmerksamkeit rieseln, erstarrt der intuitiv agierende Schriftsteller in unsicherer Pose. »Erfinde also einen Fluchtweg unter allem durch. Für Dich selbst unauffindbar. Das wäre paradiesisch. – Das wird nicht der Fall sein. Du wirst irgendetwas piepsen, weil Du gefunden werden willst. Für die nächste Runde. Da tritt auf ein Mund voller Wörter.«21 Der Wunsch, sich selbst zu finden, auch gefunden zu werden, lässt den Schriftsteller entfesselt auftreten, als »Akrobat«, wie es im nächsten Satz seiner Freiübungen heißt; ein Akrobat, der »eine fast lebensfähige Kehrseite« zu zeigen vermag, »blind vor Sicherheit« kämpft er, ganz ohne Fesseln und wehrt sich, einzig, um gesehen zu werden.22 Aber: »Wer sich verteidigt, verheddert sich leicht. Er widerspricht sich. Ist unsicher. Eigentlich zweifelt er an der Möglichkeit, sich erfolgreich zu wehren. Und dieser Zweifel bestimmt seinen Stil. Er flüchtet von einer Behauptung zur nächsten und wird auch noch aus der letzten Behauptung vertrieben. Darüber verliert er sein Gesicht [...]. Dadurch ist er genötigt, immer neue Gesichter auszuprobieren«23 , in der Manege, die sich Öffentlichkeit nennt. Das, was ihn literarisch am Leben hält (»Es geht nicht um einzelne Sätze, sondern um Atmosphärisches, das noch im Prozess ist.«24), irritiert seine Selbstbehauptung im öffentlichen Raum. Walser kennt die Gefahr der Öffentlichkeit: »In Wirklichkeit ist kein Mensch so, wie er vor dem Mikrofon ist. In der Physik heißt es: Wenn der Schwerpunkt über die Unterstützungsfläche hinausgeht, dann kippt es. So gekippt komme ich mir da öfter vor.«25 Nur die Sprache fängt ihn auf. »Schreibend kann man fast alles ertragen.«26
Wer ist nun Martin Walser, diese schillernde öffentlich Figur, die nicht nur zwischen den Zeilen seiner Bücher lebt, sondern auch auf der öffentlichen Bühne des Kultur- und Literaturbetriebs? Martin Walser ist »ein Wind- und Wortmacher«27 , »ein Showmaster und in der Tat ein begnadeter Unterhaltungskünstler«28, meinte Marcel Reich-Ranicki. Ein »naives Genie«29 und eine Art »Eddie Irvine des Literaturbetriebs«30 schrieb Klaus-Michael Bogdal, die Worte Reich-Ranickis im Kopf (»Seit ich mich mit Walsers Büchern beschäftige, kann ich den Verdacht nicht loswerden, er schreibe immer ein wenig unter seinem Niveau.«31 ). Ein »großer Kormoran«, illustriert Fritz J. Raddatz in seinem satirisch-tierischen Bestiarium, »ein hochtalentierter Taucher und Fischer auf großen Seen, dessen langer Hals ihn zu schnellen Wendemanövern im Wasser befähigt.« Und ergänzt »Im Unterschied zu anderen Tauchvögeln lassen Kormorane Wasser in ihr Federkleid eindringen, [...] um nicht an die Oberfläche zu steigen, muss der Vogel daher stets eifrig mit den Füßen paddeln.«32 Ob Showmaster, Genie oder Kormoran, evolutionsbiologisch hat Martin Walser Glück. Neben seinem Talent sind seine große Gestalt und seine wilden Augenbrauen wie gemacht für die öffentliche Bühne: »In Studios und Vorlesesälen kommt immer so starkes Licht von oben«, weiß Walser aus Erfahrung. »Ohne starke Brauen bist du geblendet. Was mir da wächst, ist mein Beitrag zur Evolution.«33Wie Martin Walser wurde, was er ist, zeichnet Ralf Oldenburg in der vorliegenden Biographie auf einzigartige Weise nach.
In seinem Buch »Der Unglücksglückliche« nähert sich der promovierte und vielfach für sein literarisches Schreiben ausgezeichnete Wissenschaftler und Pädagoge Ralf Oldenburg auf einfühlsame, anspruchsvolle und unterhaltsame Weise dem Leben, Werk und Wirken Martin Walsers. Dabei ordnet und sortiert Ralf Oldenburg das gelebte Leben Walsers nicht wie so oft im Genre der Biographie üblich in strukturierte Happen nüchternen Wissens, sondern widmet sich dem Leben Martin Walsers spielerisch, erzählend, literarisch. Eingebettet sind die biographischen Fakten in eine fiktionale Rahmenhandlung: Ein junger Erzähler ist Gast im Theater, in dem Schauspieler ein Stück über das Leben Martin Walsers proben. Der Regisseur winkt den jungen Mann zu sich heran und lädt ihn ein, sich hinter den Kulissen umzusehen. Dort, in der Requisite entdeckt der junge Erzähler, zwischen Topfhüten, Strapsen und Jazz-Platten, alte Schwarz-Weiß-Fotografien von der ‚Bahnhofsrestauration‘, in der Martin Walser groß geworden ist. Er findet Briefe, Zeitungsausschnitte und Tagebücher Walsers. Und er kommt mit den Darstellern des Stückes ins Gespräch. Mit der ‚Mutter‘, die die Augusta Walser mimt und sich in der Garderobe auf ihren Auftritt vorbereitet, und dem ‚Vater‘, der erzählt, während er in die Schuhe schlüpft, dass er diesen Schöngeist spielt, diesen Träumer, der lieber Lehrer geworden wäre, als Gastwirt. Der junge Erzähler sammelt die Gespräche, die Gedanken, Gefühle und fliegenden Blätter und verstaut sie in seinem Notizbuch mit dem Ziel, am Ende des Tages einen Essay über Martin Walser schreiben zu können. In seinem Notizbuch bewahrt er das nachprüfbare biographische Wissen auf: Briefauszüge, Tagebucheinträge, Fotographien, Zitate und Interviewsequenzen. Das Innenleben seines Notizbuches bildet somit die von realen Lebensdokumenten getragene Binnenhandlung der Biographie: chronologisch sortiert und als Zitat-Collage faktischer Dokumente, meist unkommentiert und nur mit einem kurzen Hinweis versehen, hintereinander dargeboten. Als sein Notizbüchlein fast vollständig gefüllt ist, steht plötzlich der Großschriftsteller Martin Walser persönlich am Bühnenrand, der sich ein Bild davon machen möchte, wie sein Leben inszeniert wird. Der junge Erzähler und der Schriftsteller kommen ins Gespräch. »Nichts macht so frei wie die Sprache der Literatur«, wird Martin Walser sagen und die Vorlage dafür geben, was das Buch »Der Unglücksglückliche« von Ralf Oldenburg, in dem der Satz gedruckt steht, so besonders macht. Es ist der sprachlich feine Zugang zum Leben. Und die Weiterentwicklung des biographischen Genres.
Ralf Oldenburg entwickelt das biographische Genre weiter, indem er liebevoll lebendig erzählend und ebenso exakt und akribisch die literarische Biographie, die Romanbiographie inauguriert. Anders als in biographischen Romanen, die durchgehend fiktionalisieren, verschränkt die Romanbiographie narrative und objektive Elemente miteinander, wobei die objektiven stets als solche erkennbar bleiben. Die Rahmenhandlung ist Fiktion, die Binnenhandlung bleibt von Überformungen unberührt und damit wissenschaftlich nachprüfbar. Durch diese neue Struktur innerhalb des Biographie-Genres wird es möglich, ein Schriftstellerleben nahezu distanzlos, einerseits sprachspielerisch und andererseits mit dem nötigen wissenschaftlichen Abstand darzustellen und nachzuerleben.
Entstanden ist die Biographie aus zahlreichen Gesprächen, die Ralf Oldenburg mit Martin Walser während seiner intensiven Forschungsarbeit geführt hat. Der Binnenteil der Biographie basiert auf Zitaten aus über 400 Interviews Martin Walsers. Ergänzt werden die O-Töne durch Zitate, Kritiken und Repliken, öffentliche Briefe, Tagebücher, Reden, Essays, archivierte Auftritte und öffentliche Einlassungen, die Martin Walser seit den 1950er-Jahren auf der Bühne der Öffentlichkeit kundgetan hat und die Ralf Oldenburg aus den Archiven gehoben sowie aus über 35.000 durchforschten Internetseiten herausgefiltert hat. Nicht nur für seine wissenschaftliche Tätigkeit, auch für sein literarisches Schreiben wurde Ralf Oldenburg mehrfach ausgezeichnet. Während einer Lesung in Frankfurt begeisterte Ralf Oldenburg mit seinem Werk bereits Hellmuth Karasek, der ihn prompt für das Friedrich-Hölderlin-Stipendium der Stadt Bad Homburg vorschlug, wo Ralf Oldenburg seine Forschung, gleich zweimal stipendial gefördert, fortsetzen durfte und sein Wissen über das Leben und Werk Martin Walsers produktiv vertiefte.
Indem Ralf Oldenburg didaktisch klug seinen jungen Erzähler sich behutsam und staunend den Lebensdokumenten des Großschriftstellers Martin Walser nähern lässt, öffnet er dem Leser die Tür zu einer vorsichtig neugierigen und empathischen Rezeptionshaltung, die dazu ermuntert, den jungen Erzähler auf seiner Spurensuche zu begleiten. Schrittweise chronologisch entblättert sich dem Leser so das Leben Martin Walsers. Durch das Beobachten, das genaue Hinschauen und Sammeln von Informationen gelingt es dem jungen Erzähler, das nötige Wissen und die (literarische) Kompetenz zu erlangen, einen Essay über Martin Walser zu verfassen. Diesen Weg könnten auch Schülerinnen und Schüler gehen. Für den Unterricht, aber auch für das Studium ist die literarische Biographie ein idealer, weil leichtfüßiger und auch in Auszügen zu rezipierender Schlüsseltext. Vielgestaltige Zugänge sind, je nach Text- und Analyse-Kompetenz, denkbar, beginnend damit, über die literarische Biographie einen ersten Zugang zu literarischen Texten und zum Werk Martin Walsers zu finden sowie, im Binnenteil, Textsorten (Brief, Tagebuch, Notiz) sprachlich zu unterscheiden und zu analysieren. Ergänzend bietet sich ein produktionsorientierter Ansatz an, durch den die Lernenden ihr erworbenes Textsortenwissen kreativ, schreibend festigen. Für die Oberstufe ist, neben einem sprachlichen und narratologischen Zugang auch eine streng aspektorientierte und konkret biographische Beschäftigung möglich, innerhalb derer sich die Lernenden mit Martin Walser als bedeutendem Autor der Gegenwart und seinem Werk in Grundzügen auseinandersetzen, Zusammenhänge zwischen Literatur, Politik und Zeitgeschehen erkennen, eine kritische Haltung einzunehmen üben und diese argumentativ zu begründen lernen. Ethische Fragen über seelische Zerrissenheit, den Wert des Schreibens und das Wesen der Künstlerexistenz lassen sich ebenso anschließen wie Diskussionen über den Literaturbetrieb und die Literaturkritik. Inspiriert ist Ralf Oldenburgs Romanbiographie »Der Unglücksglückliche« von dem Theaterstück »Sechs Personen suchen einen Autor« des Nobelpreisträgers Luigi Pirandello, woraus sich weitere Anknüpfungspunkte ergeben. Dem interessierten Leser entfaltet sich in der Romanbiographie »Der Unglücksglückliche« ein historisches Panorama, aus dem der Porträtierte Martin Walser zwischen den Zeilen lebendig hervor blinzelt. Und was würde wohl Martin Walser dazu sagen? »Wer wird schon wissen wollen, wer ich war?«, fragt er. »Was hätte ich davon und was er...?«34 – Verbundenheit.
Martin Walser. Wort-Gewänder. Eine Biographie in Szenen
Wie nähert man sich einem Menschen, den man persönlich nicht kennt und einer Zeit, die man selbst nicht miterlebt hat? Man inszeniert. Ein Leben auf einer Bühne, öffentlich bewundert und kritisch hinterfragt. Bereits ein kurzer Blick durch den mit dürren Worten – Novemberrevolution, Nationalversammlung, Inflation, Weltwirtschaftskrise – getünchten Vorhang macht eines sehr schnell deutlich: hier wird fieberhaft an einer Epoche gearbeitet. Einer deutschen Epoche. Dem Auge des jungen Betrachters bietet sich, kaum hat er das Bühnenbild betreten, eine Welt im Aufbruch an, eine deutsche Welt, die vergessen zu haben scheint, dass sie vor nicht einmal zehn Jahren an allen Fronten kapituliert hatte. Und Siegesboten kommen herab: Die Schlacht / Ist unser! Lebe droben, o Vaterland, / Und zähle nicht die Toten! Dir ist, / Liebes! Nicht Einer zu viel gefallen. Und dennoch wurde und wird viel gezählt: 8,7 Millionen Tote, oft noch bis zuletzt mit Hölderlin und Patriotismus im Gepäck, darunter 71 Gefallene aus Wasserburg und Umgebung. Geblieben sind Gedenktage, bei denen die Pfarrer kaum noch zu diesem Thema sprechen, sondern lieber – wie gewöhnlich – ihre Sonntagsepisteln auslegen.
So auch an diesem 24. März 1927. »Der Herr Dr. Walser verspätet sich. Er wird aber gewiss noch kommen.« Eine Stimme aus dem Off. Der junge Mann lächelt, weiß, wie doppeldeutig diese Aussage nur ihm in seinem Gedankenablauf jetzt erscheinen muss, während sie allen anderen lediglich als bloße Mitteilung dient. Erleichterung mischt sich darunter, hat er plötzlich doch noch Zeit, sich auf das Interview vorzubereiten. Gelassen lässt er sich auf einen Stuhl fallen und beobachtet das hektische Treiben. Ein Arbeiter schnauzt ihn an: »Setz‘ deinen fetten Hintern in Bewegung und pack‘ gefälligst mit an!« Auf die Frage, worum es hier denn genau gehe, bekommt er, von zwei mächtigen Armen bereits vorwärtsgetrieben, die kurze Antwort: »Walser improvisieren.« Stolpernden Schrittes platzt er nun vollends hinein in ein Leben, das er persönlich nicht kennt und eine Zeit, die er selber nicht miterlebt hat. Ein deutsches Leben, das ihn eigentlich nie interessiert hat, das ihm zwar aus Funk und Fernsehen hinreichend geläufig erscheint, so glaubt er, das er nun für diese neue Auftragsarbeit weiter entblättern soll, öffentlich bekannt und kritisch hinterfragt – so sein Chef bei der Verabschiedung. Seither ist er mit seinen Gedanken ganz woanders. Ihn drücken Geldsorgen, und so macht er halt diesen für ihn undankbaren Job. Er werde sich die Finger an Walser verbrennen, hieß es im engsten Familienkreis; er habe bislang nicht einen einzigen Buchstaben aus dem literarischen Werk Walsers gelesen und werde daher den Autor zwangsläufig missverstehen, sprach es in der Verwandtschaft und schließlich gäbe es immer Gruppen, die ihm das Wort im Mund verdrehen würden, um Äußerungen so zu verstehen, wie es denen in den Kram passe, flüsterte es hinter vorgehaltener Hand dem Verwirrten fortan entgegen.
Missmutig, die Hände als stillen Protest aufreizend in die Hüften gestemmt, betrachtet er das Bühnenbild: alles für ihn in loser Unordnung vereint. Hier ein gelb-bräunliches Charleston-Kleid, dort Werner Grauls »Metropolis«-Plakat, daneben Schwarz-Weiß-Fotografien an Stellwänden, unter anderem Reichsaußenminister Gustav Stresemann spricht vor dem Völkerbund, ein Porträt des »Sieges von Tannenberg«, Reichspräsident Paul von Hindenburg, ein Foto der jungen, androgyn wirkenden Marlene Dietrich von Arthur Benda sowie der nur mit einem Bananenröckchen bekleideten Revuetänzerin Josephine Baker und schließlich eine Karikatur, auf der sich eine junge Frau mit einer Art Nudelholz die überflüssigen Fettpolster wegzudrücken versucht. »Die neue, moderne Abnehm-Methode Mensendieck« steht darunter.
Er entdeckt Requisiten: Topfhüte, Strapse, Armbanduhren, einen Stresemann-Anzug, Trenchcoat und Trainingsanzug, alles fein säuberlich beschriftet. Er glaubt, Musik zu hören: Ragtime, Jazz, Blues, Tango, Foxtrott, die Comedian Harmonists, er kennt den Film von Vilsmaier, fühlt sich plötzlich im Streit der Parteien und Ideen als der einzig wahre Unterlegene, findet beim Sechstagerennen sich erhitzt vor und errötet sogar beim Anblick von gezügelter Nacktheit angesichts einer verkrampft für die Kamera posierenden Bogenschützin, in Anlehnung an deren mythologische Vorfahrin.
Er taumelt ob der schwülen Atmosphäre der Vergnügungslokale, inklusive Prostitution und Rauschgifthandel, der Champagnerdroge der Reichen, und kann gerade noch rechtzeitig vor dem Sturz bewahrt werden. »Fühlen Sie sich nicht wohl?« Ein junger, roter Mund haucht ihm unvermittelt wieder Leben ein. »Doch, doch, geht schon. Danke.« »Fühlen Sie sich in der Lage, das »Lindauer Tagblatt« vom 24. März 1927 direkt neben das Sternzeichen zu hängen? Mir ist das Zeugs hier alles zu schwer.« Er nickt. Die junge Frau überreicht ihm die überdimensional großen Zeitungsdruckbögen und tippelt leichtfüßig davon. An zugewiesener Arbeitsstätte, dem Treffen unter den Sternen, angekommen und wieder einigermaßen Herr der Lage, lesen seine Lippen halblaut: Widder (21. März bis 20. April): Feuerzeichen, durch Mars und Pluto beherrscht, viel Kraft, Energie und Mut, instinktiv, dynamisch, handelt manchmal unüberlegt, was zu folgenschweren Fehlern führen kann, Berufe, die sich am meisten für den Widder eignen, sind Designer, Vertreter, Schriftsteller, Anwalt, Politiker und Schauspieler, und all die Berufe, die ein großes Maß an Verantwortung und ein außergewöhnliches Leben voraussetzen, Ordnung ist nicht seine Stärke, weder Zuhause noch auf der Arbeit, das Faszinierende an diesem Zeichen ist seine Unberechenbarkeit, die sich sowohl durch Aggressivität als auch durch rührende Schwäche äußern kann. Den Walsern allgemein wird ein großes Beharrungsvermögen nachgesagt und eine mehr als nur rührende Traditionspflege.
Alles Blödsinn, denkt der junge Mann und beginnt, die riesigen Kopien der Zeitung vor sich auszurollen, gleichsam zu entblättern; er überfliegt die Daten:
Lindauer Tagblatt – Generalanzeiger für das bayerische Bodenseegebiet und Allgäu – Amtsblatt für die Stadt Lindau. Bekanntmachungsorgan der staatlichen Behörden des Amtsgerichts Lindau sowie der Gemeinden Bodolz, Nonnenhorn, Oberreitnau, Wasserburg und Weißensberg. Beilagen: »Die illustrierte Beilage« (wöchentlich), »Bodensee-Heimatschau« (14-tägig), »Die deutsche Glocke« und »Die Jugendführung« (monatlich). Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Lindau, Geschäftsstelle: Lindau, Reichsplatz D 99. Druck und Verlag: Dr. Karl Höhn, Lindau (Bodensee). Er hält inne: Wasserburg am Bodensee. Gedanken fluten sein Hirn, verwässerte Bilder steigen wie Luftblasen auf und treten ihm unangenehm flimmernd vor die Augen: eine Jugenderinnerung. Warum aber erst jetzt?
Er war damals 15 Jahre alt gewesen, als er mit seinen Eltern diese malerisch auf einer schmalen, weit in den Bodensee vorgeschobene Halbinsel besichtigen musste: die spätmittelalterliche Pfarrkirche St. Georg an der Südspitze mit ihrer zinnenbekrönten Friedhofsummauerung und den restlichen Wehrmauern am See, die Fugger-Gedenksäule, die Katholische Kapelle Hl. Kreuz, unmittelbar südlich der Straße nah Friedrichshafen gelegen, das Museum im Malhaus mit Gerichtssaal und Gefängniszellen als mahnende Erinnerung an die Wasserburger Hexenprozesse, das ehemalige Schloss, dazu nicht enden wollende Spaziergänge am Seeufer, Kämpfe durch nahe gelegene Naturschutzgebiete, Wälder und Obstanlagen, dazwischen vorbeigrüßende Ausflugsdampfer ins benachbarte Österreich, in die Schweiz, nach Liechtenstein und ins Allgäu und ständige Konfrontationen mit Obstschnaps und Bodenseewein.
Überall mithingeschleppt. Nirgends heimisch geworden. Nutzlose Daten gefressen. 7,5 km westlich von Lindau gelegen, 400 m über Meereshöhe, 634 ha Fläche, 3000 Einwohner, 1700 Fremdenbetten. Allein, weil der Vater ein derartiger Geschichtsnarr ist, musste 1984 die 1200-Jahrfeier Wasserburgs ja unbedingt vor Ort begangen werden! Dieser Heile-Welt-Verfechter! Dieser Möchtegern-Bayer! Und über einen gebürtigen Wasserburger muss ich jetzt auch noch schreiben. Doch weiter im Text, ja nicht einschüchtern lassen. Das Lindauer Tagblatt erscheint werktäglich. Derzeitiger monatlicher Bezugspreis 3,20 Mark frei ins Haus; abgeholt bei der Hauptgeschäftsstelle 2,10 Mark; durch die Post monatlicher Postlistenpreis. Einzelnummer: 10 Pfennig. Verantwortlich für Geschäftsleitung: Otto Zittlau, für Schriftleitung: Ernst Drißner, für Anzeigen: Kurt Mayer, sämtlich in Lindau. Donnerstag, 24. März 1927. Nr. 68, Jahrgang 74.
Der junge Student kann es sich nicht erklären, warum er mit einem Mal diesem gedruckten Mikrokosmos seine ganze Aufmerksamkeit schenkt. Er, der für Geschichte und Geschichten nie etwas übrig hatte, der im Abitur Geschichte als Leistungskurs nehmen musste, um dem gehassten Mathematikunterricht in der Oberstufe zu entgehen. Das geringere Übel wählend, und immer war alles bei ihm eine Sache der geregelten Entscheidung und genormten Abwägung gewesen. Was war hier los? Warum interessiert er sich plötzlich, die Seiten hastig nach dem Lokalteil der Zeitung durchblätternd, ohne auch nur eine Notiz von den innen- und außenpolitischen Themen zu nehmen, für die Beethoven-Feier bei Fräulein Johanna Stettner vom gestrigen Mittwochabend, bei der Fräulein Marie und Lisbeth Gloggengießer, Lieselotte Spitzner, Heinz Wierer, Fräulein Meng, Hans Hundhammer, Fräulein Graßmann, Fräulein Maja Ritter und Fräulein Giesel Kühlwein die reifen Früchte fleißigsten und hingebenden Studiums dargebracht hatten? Für den heftigen Weststurm, der in der vergangenen Nacht zwischen drei und vier Uhr über das Bodenseegebiet hinweggefegt war, dabei Fensterscheiben zerschlagen und Ziegelplatten von Hausdächern geschleudert hatte, ohne jedoch Störungen im Telefonverkehr und in der Stromversorgung zu verursachen? Für den bekannten Bolivienforscher Dr. Theodor Herzog, der für den 30. März zu seinem Vortrag mit Lichtbildern über »Bergfahrten in Südamerika« in den Bahnhof-Terrassensaal eingeladen hatte? Für die Lindauer Filmschau, die stolz den technisch vollendetsten und wunderbarsten Film ankündigte, der je gezeigt wurde – »Der Dieb von Bagdad« mit Douglas Fairbanks in der Hauptrolle und mit verstärktem Orchester unter der Leitung von Kapellmeister Offenwanger? Für den Wetterbericht: Mittlere Tagestemperatur: plus zwei Grad, 100 Zentimeter Schneehöhe, Nordhänge Pulver. Und für Damenhüte in großer Auswahl, Münchener Schlüterbrot, Autofahrschule und Reparaturwerkstatt Biedermann, Henko-Wasch- und Bleich-Soda, Malzkaffee, Hammelfleisch, Lungenwürste und Franz Achtstätters Maler- und Tüncher-Arbeiten? »Der Büffel-Beize Eigenschaft sind Spiegelglanz und Farbenkraft.«
Den zarten Anflug eines Lächelns unterbricht der harte Blick eines Arbeiters, abwechselnd auf nackte Leinwand und dem Boden entrollte Zeitung gerichtet. Im selben Augenblick ergreifen ihn gleich mehrere Theatermenschen, und deren ausgestreckten Armen folgend, verlässt der junge Mann die Bühne, um immerhin noch in Rufweite davor Platz zu finden. Den Anweisungen aus dem Off, das »Lindauer Tagblatt« um Himmelswillen nun doch endlich zu befestigen, um das erste Bild des Werkes in dessen Vollständigkeit inszenatorisch wirken lassen zu können, wird sofort Folge geleistet. Der Bühnenraum wird abgedunkelt, und nach einer Weile beginnt mit dem fast schon in die Welt hinausgerufenen Wort »Biografie«, dem ersten Schrei eines eben erst entbundenen Säuglings ebenbürtig, ein deutsches Leben öffentlich zu atmen, zu strampeln.
1. »Bei meiner Geburt starben drei Mütter« –
Walsers (Text-) Leben und Lebenstext
Aus dem Notizbuch des jungen Mannes:
Wahrscheinlich war inzwischen dem Regisseur aufgefallen, dass da jemand auf der Bühne herumgesprungen war, der offensichtlich dort nicht hingehörte, und ebenso wahrscheinlich musste er wohl meinen unrühmlichen Abgang mitbekommen haben – jedenfalls kam dieser und setzte sich zu mir. Obwohl ich wenig Zeit habe, sagte er, möchte ich doch wissen, was Sie hier wollen. Ich antwortete ihm, dass ich ein Interview mit Herrn Dr. Walser führen solle; ich sprach von der Auftragsarbeit, den Bedenken und Zweifeln und auch davon, dass der Schriftsteller von meinem Chef darüber informiert worden sei und dass er nach einigem Zögern seine Einwilligung dazu gegeben habe. Ich solle mich hier ja pünktlich an diesem Probenvormittag einfinden; der Rest werde sich dann schon ergeben, wurde mir gesagt.
Der Regisseur hatte mir zugesichert: »Ich werde mit Ihnen 25 Stunden im Leben Martin Walsers verbringen. Sie werden auf diesem Rundgang Menschen kennenlernen, junge und alte, reale und fiktive Personen, Sie werden auf eine kapriziöse Fährtensuche geschickt, werden mit allerlei Dokumenten aus Zeitungen, Zeitschriften, Augenzeugenberichten, Büchern und Internet konfrontiert, die in ein neues Gewand gekleidet und zu Gutachten, Tagebuch- und Notizeintragungen, Spielszenen und Briefen umfunktioniert wurden.« Er versprach mir, solange Walser noch durch Abwesenheit glänze, könne ich darüber hinaus auch die Schauspieler hinter der Bühne befragen, aber nur unter der Bedingung, dass der Spielbetrieb nicht gestört werde. Ich war froh, zur Abwechslung endlich mal etwas Sinnvolles zu tun und nahm das Angebot dankend an. Ich sprach zuerst mit den Eltern, oder genauer, den Darstellern der Eltern Walsers, die sich gerade in der Garderobe auf ihren Auftritt vorbereiteten. Ich erfuhr, dass ich – eher unfreiwillig – in eine sogenannte Durchlaufprobe geplatzt war, in der die Darsteller mit dem chronologischen Gesamtablauf des Geschehens vertraut gemacht, der künstlerische Standard des Probenprozesses ermittelt und die Bühnentauglichkeit der nachempfundenen Lebens-Bilder getestet werden sollten.
Der Regisseur hat uns allen als Einstimmung auf unsere Rollen eigens noch Infomaterial zum Studium mitgegeben, meinte der »Vater«, nachdem er mein Interesse für die an einer großen Pinnwand befestigten SW-Fotos und Texte bemerkt hatte. Eine Fotografie, betitelt »Bahnhof Mitten (seit 1926 Wasserburg) bei der Eröffnung am 30. September 1899«, zeigte als Staffage mehrere Personen, die Hände teils in den Taschen vergrabend, teils locker herabhängend, teils den eigenen Nachwuchs an der Schulter haltend, in die Kamera blicken. Darunter stand: Für Wasserburg war die Anbindung an die Bodenseegürtelbahn 1899 für den Fremdenverkehr entscheidend. Bereits 1847 waren Friedrichshafen und 1854 Lindau an das Eisenbahnnetz angeschlossen worden. 1925 wurde die 1911/12 mit elektrischem Licht versehene Dorfstraße geteert und auf den Salondampfern der Bodenseeflotte endlich der Viehtransport eingestellt, 1926 entstand die erste Fremdenstatistik:
8.435 Übernachtungen. Die Entwicklung von Wasserflugzeugen am Bodensee durch die Firma Dornier führte dazu, dass bereits 1927 ein Landeplatz dafür eingerichtet wurde, so dass Wasserburg endgültig direktes Reiseziel wurde.
Daneben hing ein Foto »Bahnhofsrestauration«. Auch hier menschliches Inszenesetzen: ein von zwei Jungen gezogener 4-rädriger Karren an der Eingangstür, dahinter eine Bedienstete in bescheidener Geste, um die Ecke ein Gast, der vor der massiven Kulisse des Hauses demonstrativ frühstückt und im Vordergrund zwei – man möchte schon beinahe sagen – Hauptpersonen, ein Mann mit dichtem Schnauzbart und Stehhaaren sowie eine Frau im dunklen Samtkleid. Ich notierte in meinen Schreibblock: 1901 eröffnete Josef Walser die Bahnhofsrestauration mit Zimmern zum Bahnhof als Attraktion. Zu diesem Ereignis spielte der Wasserburger Musikverein. Ich stockte. Da war sie: die erste, persönlich spürbare Anbindung zur Gegenwart. Der alte Mann auf dem Foto – vielleicht Walsers Großvater? Die Frau in gebührendem Abstand daneben – die Großmutter? Wer waren die Kinder auf bzw. vor dem Wagen? Wohlmöglich der Schriftsteller selbst? Und wer waren der rätselhafte Tourist vor dem Haus und all die anderen Personen? Ich habe später von dem jungen Regisseur erfahren, als ich ihn auf eben diese Fotografie hin ansprach, dass es tatsächlich Martin Walsers Großeltern im Bildvordergrund waren: Josef Walser, geboren am 14. Oktober 1861 in Hengnau, verstorben in Wasserburg am Bodensee, den 12. Februar 1935; Franziska Walser, geb. Strohmaier, 16. Mai 1866 bis 13. August 1917.
Ich war fasziniert, war ergriffen von der Macht dieser nur wenigen Worte. Dagegen betrachtete ich die anderen Fotos doch eher mit nur mäßigem Interesse, denn mit Hingabe. Sie berührten mich einfach nicht, weder das erste Familienstrandbad von 1922, der Besuch des Königs Karl Gustav von Schweden im Gasthof Reutenen 1929, noch die erste, ausschließlich auf Wasserburg bezogene Werbung aus dem Jahr 1912 mit dem Titel »Wasserburg am Bodensee, das deutsche Chillon«; oder das Entschlossenheit und Stärke demonstrierende Gruppenfoto der Freiwilligen Feuerwehr Wasserburg , datiert auf den 9. Mai 1926, bei deren 50. Gründungsfest im Saal des Hotels Krone. Ich dachte plötzlich an meine eigenen Großeltern, die ich über alles liebe. Mir ist es gottseidank erlaubt gewesen, sie beide länger genießen zu dürfen. Meine Oma lebt noch, mein Opa verstarb mit 91 Jahren im vergangenen Sommer. Ein Schicksalsschlag für meine Oma. Für uns alle. Wenn ich daran denke, dass Martin Walser seine Oma nie kennengelernt hat und mit seinem Opa auch nur für kurze Zeit zusammensein konnte, erfüllt es mich mit einem Male mit großer Traurigkeit. Er hätte sicherlich gerne mehr von seinen Großeltern gehabt, hätte sicherlich gerne an der linken Hand des Großvaters öfter noch die nähere und weitere Umgebung erkundet, hätte sicherlich gerne auf diesen Spaziergängen aus dem großväterlichen Mund noch öfter den Satz gehört, der zwischen 1930 und 1934 stereotyp murmelnd wiederholt wurde: »Wenn i bloß ge Amerika wär.« Sein irrealer Wunsch lebt im Enkel fort; er wird ihn für sich Jahrzehnte später als Gastdozent an verschiedenen amerikanischen Universitäten realisieren.
Der »Mutter« war meine plötzliche Gefühlsregung nicht entgangen. Auch wir Schauspieler brauchen den Zugang zu einer Rolle, entweder durch uns selbst oder mit Hilfe des Regisseurs, meinte sie und fügte hinzu: Nehmen Sie mich zum Beispiel. Ich spiele die Augusta Walser, die Mutter eines bedeutenden deutschen Gegenwartsschriftstellers und zugleich eines der zurzeit umstrittensten. Man sagt doch immer den Müttern gerne nach, sie hätten ihre Söhne verpfuscht, hätten sie falsch erzogen, wenn sie anders werden als erwartet. Ich selbst habe keine Kinder. Ich würde auch keine in diese schreckliche Welt setzen wollen. Von daher halte ich mich nur ans Drehbuch, übe die Rolle so ein, egal, ob dahinter eine noch lebende oder bereits verstorbene Person steht, egal, ob historisch oder fiktiv. Es interessiert mich diese Frau nicht, die ich spielen soll. Selbst, wenn ich die Möglichkeit bekäme, sie kennenzulernen, ich würde es ablehnen, da sie mich sicherlich manipulieren würde. Es wird ja auch nichts Dokumentarisches daraus, kann es ja auch gar nicht. Die echte Augusta, geb. Schmid, wurde am 8. Juli 1900 in Kümmertsweiler geboren. Sie starb am 13. April 1967 in Wasserburg am Bodensee. In ihrer Familie, die aus 15 Köpfen bestand, gab es eine radikal zu nennende Empfindlichkeit gegen Abhängigkeit und Beleidigung. In einer dörflichen Gemeinschaft wie Wasserburg, wo ihr Mann sich und seine Familie in immer größere finanzielle Verstrickungen brachte und wo er ein eher belächelter Mensch war, musste sie sich oft zutiefst gekränkt gefühlt haben. Sie musste eine Glaubenskraft gehabt haben, wie ich sie noch nie bei irgendjemandem erlebt habe. Zwei Schwestern der Mutter waren ins Kloster gegangen, und ein Bruder von ihr war in der Klosterschule. Die ersten Geschichten, die man dem jungen Walser vorgelesen hat, waren von Absalom, Susanne, Abraham und Isaak. Dem Einfluss solch einer glaubensstarken Mutter, deren Lieblingslektüre die Heiligenlegenden waren, konnte sich sicherlich der junge Martin nicht entziehen. Unser Regisseur meint, ich solle die Frau als das starke Geschlecht spielen, viel stärker als ihr Ehemann, der, halb aus Krankheit, halb aus anderer Ungeeignetheit, immer wieder durch Katastrophen produzierende Ideen Geschäft und Familie aufs Spiel setzt. Immer wieder musste sie für seine Schulden aufkommen, musste alleine den Laden schmeißen. Den Ausdruck von familiärer Zärtlichkeit gab es nicht. Null intime Atmosphäre, würde ich sagen. Weder so noch so. Weder Sprache noch Gestik. Man fasste sich nicht an. Erziehungsbemühungen ausgesprochener Art hat der junge Walser vonseiten seiner Mutter wohl nie viel erlebt. Aber die Angst der Mutter vor dem Jenseits, vor der Ewigkeit ohne Wiederbegegnung, wenn man sich nicht so verhielt, wie die Kirche es forderte, hinterließen in dem Jungen tiefe Spuren. Diese Angst wurde aktualisiert durch die Dominanz des düsteren Beichtstuhls in der dämmrigen St.-Georgs-Kirche an der Südspitze Wasserburgs. Schreckliche Ansprachen innerhalb und außerhalb des Beichtstuhls gingen auf den Knaben wohl in dieser Zeit verheerend nieder. Dennoch ein unendlich wichtiger Kindheitsraum, zu dem der Ministrantendienst genauso gehörte wie die prachtvolle Langeweile der Hochämter und das erste zaghafte Hinüberblinzeln zu den Mädchenbänken. Gleichzeitig war da aber immer die ständige Furcht vor Konkurs gegenwärtig, vor der öffentlichen Versteigerung der Gastwirtschaft, die noch geschürt wurde durch eine konkurrierende Holz- und Kohlenhandlung vor Ort. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Angst der Mutter in dem Jungen eine Art Sicherheitswahn erzeugte, der sich dahingehend ausgewirkt haben mochte, dass er seit seiner Jugend immer vom Bestreben nach wirtschaftlich-finanzieller Absicherung geleitet wurde. Das waren die Auswirkungen der zwanziger, dreißiger Jahre und der kleinbürgerlichen Not.
Als Schauspielerin könnte ich mir durchaus vorstellen, dass man als Mutter in diesen Verhältnissen nicht Jahrzehntelang immer nur stark sein konnte. Ich denke, die mentale Stärke zog sie allein aus dem katholischen Glauben. Ich fürchte nur, auf andere hat dieser Zwang eher als Angst-Religion und in deren Entwicklung deformierend gewirkt. Gerade weil sie so intensiv religiös war, musste man das Gefühl haben, dass die Religion ihr keine Sekunde lang irgendeine Ruhe gebracht hat. Seine Mutter habe ihn und seine zwei Brüder vollkommen in ihre Angstwelt eingeschlossen, sagt Walser, es gab keinen Bereich, der davon nicht durchdrungen gewesen sei, vom Essen über das Geld, die Krankheit, den Tod, alles. Die Gotteserfahrungen waren zu dieser Zeit alle angstbesetzt. Jene bäuerlich-religiöse Erziehung hat aus Martin – nach eigenem Selbstverständnis – einen katholischen Krüppel gemacht, der bis heute nicht imstande ist zu glauben, der in seiner Schreckhaftigkeit verkrümmt bleibt. Es waren traumatische Erinnerungen. Zu seiner Mutter hatte Martin nicht das recherchierende oder kritisch sich erkundende Verhältnis, das andere intellektuelle Söhne mit ihren Müttern pflegten. Er hat ihr nie Fragen über ihr Tun in der Nazizeit gestellt, denn ihre Vergangenheit hatte er geteilt, und was er nicht wusste, ließ keine Lücken im Bild. Dass seine Mutter früher als Weihnachten 1932/33 in die NSDAP eingetreten war, hat Martin erst viele Jahre nach dem Krieg erfahren. Irgend jemand hatte ihr die Sorge genommen, es könne das eine Partei von Gottlosen sein, und Hitler nähme die Vorsehung ernst, den Herrgott. Also trat sie bei, damit die Fahne der NSDAP neben den anderen Vereinsfahnen im Nebenzimmer stehe und auch dieser Verein seine Versammlungen in der Walser'schen Wirtschaft abhalte und die Zwangsversteigerung um einige Bestellungen hinausgezögert sei.
Mit der Schreiberei ihres Sohnes konnte sie zeitlebens nicht viel anfangen. Einfach keinen Zugang dazu herstellen können. Das änderte daran auch wenig, als ihr Martin 1957 einen 10.000 Mark-Scheck – auf diese Summe belief sich der Hermann-Hesse-Preis – mit den Worten überreichte: um dir, liebe Mutter, zu vermitteln, dass Schriftstellerei auch etwas ist. Das änderte sich erst wirklich, als ein Geistlicher mit dem Fahrrad aus Regensburg nach Wasserburg kam, um Martin zu besuchen. Da er nicht im Haus war, vertraute der Geistliche seiner Mutter an, wie wichtig »Ehen in Philippsburg« für ihn sei. Dadurch bekam dieses Buch eine Legitimität. Der Geistliche hat Martin praktisch vor allen möglichen Verdächten bewahrt. Dafür handelte er sich alle möglichen anderen Verdächte ein – als könne es nicht ungestraft bleiben, dass man sich von der Welt, aus der man kommt, nicht lossagt, wenn man ein Intellektueller wird, dass man sich eine Kindheit, die man als schön in Erinnerung hat, nicht zurichten lassen will.
Mit einer beinahe schon entschuldigenden Handbewegung, die auszudrücken schien, dass die Schauspielerin bereits viel tiefer in ihrer Rolle der Walser-Mutter steckte als ihr sicherlich lieb sein konnte, fuhr sie – nachdem sie kurz durchgeatmet hatte – verlegen fort: unser Regisseur verlangt, dass ich während der ganzen Aufführung kein Hochdeutsch sprechen darf. Nur Kümmertsweilerdeutsch. Habe dafür extra einen Sprachtrainer bekommen. Der Regisseur meint, ich soll mir folgendes Szenario vorstellen: Wasserburg liegt eingebettet zwischen eiszeitlichen Endmoränen und Drumlins, den Hügelherden, dem Hinterland, das für Martin immer auch Kindheitsland heißt, aus dem die Mutter an den See kommt und mit ihr die Sprache, der heimische Dialekt, in dem und mit dem der Junge groß wird, und dem See, dem Freund, an dem, in dem und auf dem er einen beträchtlichen Teil seiner Freizeit verbringt: mit Baden, Schwimmen, Fischen, Floßfahrten, Ufererkundungen, Schlittschuhlaufen. Eigenart und Schönheit des Sees werden entdeckt, empfunden, später artikuliert. Walsers Mutter sagt wohl in ihrem Leben nie einen einzigen hochdeutschen Satz oder benutzt hochdeutsche Wörter. Sie spricht das Hochdeutsche wohl immer in einem gequälten Alemannisch aus, in dessen herausringender Tonfolge keine Wörter mehr zu unterscheiden sind.
Der »Vater«, eingekleidet in eine lange, zweifach geknöpfte, grün-weiß gesprenkelte Jacke, darunter ein smaragdgrünes Hemd mit Kragen, hatte sich in der Zwischenzeit umständlich die roten Strümpfe angezogen und war anschließend lautlos in die Schuhe geschlüpft. So geht sein Geist in der ganzen Welt spazieren, grinste er, das Gesicht mir halb zugedreht – der richtigste Vater, den man haben konnte. Die Sorgen, die meine Kollegin hier hat, habe ich gottseidank nicht. Das Königlich-Bayerische Realschuldeutsch ist mir bestens bekannt. Ich spiele diesen Schöngeist, diesen Träumer, der lieber Lehrer geworden wäre anstatt Gastwirt und Kohlenhändler, nur, um dadurch dem Publikum bekannter und interessanter zu werden. Als Sprungbrett für weitere Rollen – Sie verstehen?
Er schüttelte den Kopf: Ich verstehe diesen Kerl nicht, sagte er. Schon sein Alter baut und verkauft, obwohl er weder Baumeister noch Gastronom gelernt hat, insgesamt sechs Gaststätten, und zwar vorzügliche Bahnhofsgaststätten, da zu der Zeit die Bodenseegürtelbahn entsteht. Er überlässt seinem Sohn die Bahnhofsrestauration in Wasserburg, obwohl er doch bestimmt von Anfang an genau weiß, dass der nicht dazu in der Lage ist. Erstens, weil Gastwirtschaften im Dorf schon übermäßig besetzt sind, zweitens kennt er seinen Sohn und dessen Anlagen doch sicherlich ganz genau, und drittens war ihm doch hoffentlich klar, dass sein weltfremder Filius als Nicht-Wasserburger – er wurde, glaube ich, wie auch sein alter Herr in Hengnau, ca. 2 km von Wasserburg entfernt, geboren – nur schwer, wenn überhaupt, die Cliquenbildung in dieser kleinen Stadt aufsprengen und Gäste für sein Lokal abgreifen würde. Und das alles noch in dieser Zeit!
Ich spiele den Martin, den Vater, der am 8. Mai 1890 in Hengnau auf die Welt gekommen war. Damals wurde oft den Kindern der Name des Vaters gegeben, damit später, wenn der Jugendliche seinen Beruf ergriff, sich nichts an Äußerlichkeiten wie Briefkopf, Visitenkarte und so weiter änderte, Sie verstehen? Alles lief durch den Filius genauso weiter, wie durch den Vater schon zuvor. Man musste sich nicht umgewöhnen, fast nichts neu lernen. Alles blieb bekannt. Die Familie blieb den Leuten bis aufs Innerste bekannt. Das habe ich zumindest so gelesen. Es fällt mir sehr schwer, mich in diese Rolle eines Familienvaters einzufinden, der sich vor der Realität in immer kleinere Geschäfte flüchten wollte, etwa als Vertreter für Uhren, weil er ursprünglich eine Kaufmannschaft in Lausanne gelernt hatte, als Literat, Anthroposophie und anderem esoterischen Schnickschnack verdorben; oder als Klavierspieler, wozu er zweifelsohne das meiste Talent besaß. Leider habe ich nur einen relativ kurzen Bühnenauftritt. Im Alter von erst 49 Jahren lässt mich der Regisseur am 3. Januar 1938 an den Folgen einer Stoffwechselerkrankung in Wasserburg am Bodensee sterben: ich bin zuckerkrank. Mit dieser familiären Katastrophe habe ich mich in der Vorbereitung auf meine Vaterrolle sehr intensiv auseinandergesetzt. Sie reizt jeden Schauspieler, denn, überlegen Sie doch mal: ich hinterlasse drei Söhne, darunter einen knapp 11-Jährigen, Martin, der es vielleicht sogar eher verstanden hätte, wenn seine Mutter ihm gesagt hätte: Dein Vater hat uns wegen einer Geliebten verlassen, und nicht, weil es allein Gottes Wille war. Er wird es mir vielleicht sein Leben lang vorwerfen, dass ich weggestorben bin und seine Mama, seine Brüder und ihn einfach so zurückgelassen habe, dass er es irgendwann als rücksichtslosen Fluchtversuch von mir werten könnte, der am Ende doch noch in Erfüllung gegangen ist, dass er mit dem acht Jahre jüngeren Bruder Karl Anselm, geboren am 16. November 1935, später das ganze Kohlengeschäft ohne Angestellte – lediglich mit einem Kriegsgefangenen – betreiben muss, eine Kindheit und Jugend in den Fesseln von seelischer Qual und nicht enden wollender körperlicher Arbeit, und dass er von Anfang an erlebt, wie Frauen die Sache retten.
Ich habe gelesen, dass Walser, nachdem sein zwei Jahre älterer Bruder Josef schon eingezogen war, das Geschäft mit Abrechnungen, Zuteilungsscheinen, mit der ganzen Bewirtschaftungs-Bürokratie neben der Schule erledigte, was zur Folge hatte, dass er an 36 Tagen im Jahr in der Schule fehlte, so dass sich seine Mutter vom Direktor der Oberschule in Lindau schließlich die Frage gefallen lassen musste, ob sie ihren Bauernbuben als Oberschüler wolle oder in ihm nur den Kohlenarbeiter erkenne, der pro Jahr zig Waggons Kohlen auslade und in die Keller und auf die Dachböden der Witwen und Bäckereien schleppe? Sie solle sich für Eines ganz schnell entscheiden. Das war für den jungen Walser ein Klassenerlebnis. Und seiner Mutter wurde angeraten, sich für das letztere bei ihrem Sohn stark zu machen, da – nach dem Tod von Josef – alle Geschäfte entsprechend auf ihn überzugehen hätten. Also stand eigentlich fest: Martin soll Gastwirt und Kohlenhändler werden. Sein Bruder Karl Anselm wurde später Hotelier.
Was die Tanten Anna und Sophie wohl zu allem zu sagen hatten, die immer zum Familienbild gehörten? Wie von weit her vibrierte eine dumpfe Stimme zu uns herauf: Alle Menschen sind am 24. März 1927 in Wasserburg am Bodensee geboren. Das ist länger her als die Jahreszahlenrechnung vermuten lässt. Alle Menschen wollen offenbar zurück zu ihrem 24. März, oder sie wollen wenigstens jetzt nicht mehr weiter. Sie möchten endlich bremsen. Und eine im Mundwinkel tanzende Zigarette schien uns allen sagen zu wollen: Er ist angekommen.
2. Die Kindheit in Wasserburg, »seinem Dublin, dem Nabel
seiner Welt« (1927 – 1938)
Aus einem Gutachten seiner Zeit:
Als Martin 1927 das Licht der Welt erblickte, wuchs er in eine Welt hinein, an deren Bedingungen und Strukturen er nicht mitgewirkt hatte, für die auch seine Eltern nicht verantwortlich waren. Die Diskrepanz zwischen dem, was das Kind einsehen konnte, und der Katastrophe, die sich in seiner Umgebung vorbereitete, war besonders groß. Walsers Vorschulphase fiel in die politisch und wirtschaftlich instabilen Endjahre der Weimarer Republik, in denen Nazi-Anhänger der ersten Stunde aus kindlicher Perspektive als halbstarke Heldenfiguren und große Vereinfacher im Gedächtnis Spuren hinterließen. Das geistige Rüstzeug, das die Eltern ihrem Sohn mitgaben, war gering für eine Zeit zusammenstürzender Ordnungen und einer barbarischen Gegenordnung. Beide waren nicht in der Lage, den von der Epoche verfügten kapitalistischen Konkurrenzkampf zu bestehen. Zurechtzukommen und das beste aus der Situation zu machen, waren die Lebensmaximen der Eltern. Sie trafen keine besonders mutige Entscheidung zum Widerstand oder Exil. Beide wollten nur, dass aus dem Jungen etwas Besseres werde, und so legten sie großen Wert auf eine sorgfältige Bildung.
Für den kleinen Martin waren die mütterliche und väterliche Welt streng voneinander getrennt. Zum Reich der Mutter gehörten die Küche der Restauration, der Hausflur vor den Gästezimmern und die weiblichen Angestellten. Sie sorgten sich um sein leibliches Wohl, sie sozialisierten den Jungen, schickten ihn zum Friseur, brachten ihm bei, wie man sich erfolgreich gegenüber der Konkurrenz der anderen Wasserburger Gastwirtschaften behauptete. Die Welt der Mutter bestand aus Pragmatismus, so lange wie möglich einen normalen Alltag aufrechtzuerhalten.