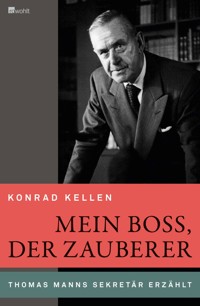
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Konrad Kellen, Sohn des Fabrikanten Ludwig Katzenellenbogen, ging Anfang 1933 in die Emigration. Nach Aufenthalten in Frankreich, Jugoslawien und Holland wanderte er im Herbst 1935 nach New York aus, wo er sich mit kleinen Jobs durchschlug. 1940 übersiedelte er nach Los Angeles. Von 1941 bis 1943 war er dort der persönliche Sekretär von Thomas Mann in Pacific Palisades. Er tippte dessen Briefe, Reden und Manuskripte, darunter den Roman «Joseph der Ernährer», und wurde einer der engsten Vertrauten des Schriftstellers. Seine Aufzeichnungen spiegeln ein abenteuerliches Emigrantenleben, mit vielen unfreiwilligen Brüchen und Neuanfängen. Im Mittelpunkt stehen die Erinnerungen an Thomas Mann: eine einzigartige Nahaufnahme des «Zauberers», geschrieben aus der täglichen Nähe der gemeinsamen Arbeit. Ergänzt wird Kellens Autobiographie durch Texte, in denen die Herausgeber Kellens Lebensweg sowie seine Familiengeschichte schildern und über die Entstehung des Buches berichten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 338
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Konrad Kellen
Mein Boss, der Zauberer
Thomas Manns Sekretär erzählt
Über dieses Buch
Konrad Kellen, Sohn des Fabrikanten Ludwig Katzenellenbogen, ging Anfang 1933 in die Emigration. Nach Aufenthalten in Frankreich, Jugoslawien und Holland wanderte er im Herbst 1935 nach New York aus, wo er sich mit kleinen Jobs durchschlug. 1940 übersiedelte er nach Los Angeles. Von 1941 bis 1943 war er dort der persönliche Sekretär von Thomas Mann in Pacific Palisades. Er tippte dessen Briefe, Reden und Manuskripte, darunter den Roman «Joseph der Ernährer», und wurde einer der engsten Vertrauten des Schriftstellers.
Seine Aufzeichnungen spiegeln ein abenteuerliches Emigrantenleben, mit vielen unfreiwilligen Brüchen und Neuanfängen. Im Mittelpunkt stehen die Erinnerungen an Thomas Mann: eine einzigartige Nahaufnahme des «Zauberers», geschrieben aus der täglichen Nähe der gemeinsamen Arbeit.
Ergänzt wird Kellens Autobiographie durch Texte, in denen die Herausgeber Kellens Lebensweg sowie seine Familiengeschichte schildern und über die Entstehung des Buches berichten.
Impressum
Rowohlt Digitalbuch, veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, September 2011
Copyright © 2011 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Lektorat Sabine Buck und Uwe Naumann
Umschlaggestaltung: Anzinger | Wüschner | Rasp, München
(Umschlagabbildungen: Christa Zinner)
ISBN Buchausgabe 978-3-498-03537-2 (1. Auflage 2011)
ISBN Digitalbuch 978-3-644-01431-2
www.rowohlt-digitalbuch.de
Die Seitenzahlen im Namensverzeichnis beziehen sich auf die Printausgabe.
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Widmung
Teil 1 KONRAD KELLEN
Als sich Deutschland veränderte
Herkunft
Zwischenstationen
Begegnungen mit Thomas Mann in New York
Vom Freund des Hauses zum Sekretär des Zauberers
Die Atmosphäre bei den Manns
Die Arbeit mit Thomas Mann in Pacific Palisades
Thomas Manns Verhältnis zu Amerika
Gespräche über Deutschland
Mein letzter Besuch bei Thomas Mann in der Schweiz
Thomas Mann als Schriftsteller
Erinnerungen an Albert Einstein
Als amerikanischer Soldat in Europa
Eindrücke eines Besatzungsoffiziers
Wie ich Chagall nach Amerika brachte
Leben in Los Angeles
Nachdenken über den Fall Stella (Rezension)
Über das Reden auf dem Golfplatz (Essay)
Teil 2 ÜBER KONRAD KELLEN
Manfred Flügge: Konrad Kellen und die Familie Mann
Die Familie Katzenellenbogen
Der Wirtschaftsskandal um Ludwig Katzenellenbogen
Unruhige Zeiten in Paris
Konrad Kellens Freundschaft zu Klaus Mann
Emigration nach Amerika
Ankunft in Kalifornien
Im Dienst von Thomas Mann
Im Dienst der USA
Konrad Kellens Rückkehr nach Kalifornien
Erinnerungen an Konrad Kellen
Christian Ter-Nedden: Sekretär des Sekretärs
Meine Arbeit mit Konrad Kellen
Zur Entstehung dieses Buches
Literaturhinweise
Veröffentlichungen von Konrad Kellen
Weitere Literatur
Bildnachweise
Danksagung
Namensverzeichnis
TAFELABBILDUNGEN
Für Patricia
Teil 1KONRAD KELLEN
Erinnerungen
Als sich Deutschland veränderte
Wann immer ich erzählt habe, dass ich im März 1933 aus Deutschland emigriert bin, wurde ich gefragt: «Warum denn schon so früh?» Ja, wie lange hätte ich denn warten sollen? Hatte ich nicht dieses eine Mal wenigstens recht gehabt? Andere aus meiner Familie haben zu lange gewartet, zu lange auf Deutschland vertraut. Mein Grund war einfach: Ich hielt es dort nicht mehr aus. Man musste kein Prophet oder ein besonders politischer Kopf sein, um das kommende Unheil zu ahnen.
Zwei Jahre irrte ich durch Europa. 1935 kam ich in New York an. Ein neues Leben sollte beginnen. Aber meinen Familiennamen «Katzenellenbogen» konnten sie in New York nicht aussprechen. Sich umzubenennen war in den USA durchaus üblich, oft auch ratsam. Ich verkürzte meinen Namen auf «Bogen». Das war auch nicht viel besser. Als ich 1943 in die amerikanische Armee aufgenommen wurde, veränderte ich meinen Namen in «Kellen», und dabei ist es geblieben. Das klingt auf Deutsch und auf Englisch gut, klar, einfach.
Gut, klar und einfach war bis dahin wenig in meinem Leben, zu Hause nicht, in Berlin nicht, in Deutschland nicht, in Paris nicht, in New York auch nicht. Ich hatte mit Börsenmaklern zu tun und lernte echte Gangster kennen. Beides war nicht meine Welt. Erst die Begegnung mit Thomas Mann hat mein Leben verändert, hat mich auf eine andere Ebene gebracht statt auf die schiefe Bahn. Zwei Jahre habe ich für ihn gearbeitet. Der Zauberer war mein Boss und auch mein Retter. Aber dann kamen die Armee, der Krieg, die Rückkehr nach Europa als amerikanischer Soldat. Und ich musste erneut Erfahrungen mit meinen einstigen Landsleuten machen. Versöhnt mit ihnen haben mich diese Erfahrungen nicht.
Ich bin kein gebildeter Mann. Zwar habe ich im Laufe meines langen und verworrenen Lebens viel gelesen, habe Französisch, Englisch und sogar Latein und Griechisch gelernt. Aber ich bin kein gebildeter Mann in dem Sinne, dass ich aus dem Stegreif die wesentlichen Ähnlichkeiten oder Unterschiede zwischen Hölderlin und Kleist, Heine und Eichendorff oder Schiller und Gott weiß wem aufzählen könnte. Ich bin der deutschen Sprache außerordentlich hold, nicht aber den Deutschen. Was sie mir und meiner Familie angetan haben, vielleicht auch der Krieg, in welchem ich schließlich unter höchster Gefahr gegen die Deutschen kämpfen musste, haben mich Deutschland für immer entfremdet. Die einzige Brücke zu einem «anderen» Deutschland war für mich Thomas Mann.
Thomas Mann war ein äußerst vielseitiger und deshalb irritierender Mensch. Auch wer ihn näher kannte, ihn mehr als einmal erlebt hatte, vermochte ihn kaum zu beschreiben. Und so wird sein wahres Wesen oft falsch verstanden – natürlich auch zuweilen von mir. Aber immerhin, der beinahe tägliche Umgang mit ihm als Sekretär in Los Angeles und spätere Zusammenkünfte in der Schweiz ließen mich ihn vielleicht nicht besser, aber eben anders verstehen als Menschen, die nur seine Bücher gelesen oder gesellschaftlich mit ihm verkehrt haben.
Drei seiner Eigenschaften will ich besonders hervorheben: erstens seinen tiefen, unveränderlichen Humanismus; dann seinen einzigartigen, eigentlich undeutschen und allumfassenden Sinn für Humor (den auch viele seiner Biographen nicht begriffen haben); und schließlich seine abgrundtiefe Verachtung für den Nazismus und dessen verschiedene Träger. Mann war der einzige ehemalige Deutsche, den ich persönlich kannte, der weder Jude noch Kommunist war und doch die Nazis und den Nazismus aus ganzem Herzen verachtet hat.
Er unterschied nicht zwischen «Deutschen» und «Nazis», zwischen gutem und bösem Deutschland, sondern bestand immer darauf, dass es nur ein Deutschland mit seinen verschiedenen Seiten gebe. Und so unterscheide auch ich nicht zwischen diesen und jenen Deutschen und würde sie am liebsten die «Deutschnazis» oder die «Nazideutschen» nennen. Das mag manche verletzen, aber ich habe in meiner Zeit meine besonderen Erfahrungen mit ihnen machen müssen.
Mir wird unwohl, wenn ich Bücher von Historikern über jene Zeit lese. Mir kommt es manchmal vor wie hölzernes Geplapper. Ich finde nicht das wieder, was ich erlebt habe. Man muss doch das Kind beim Namen nennen, und der Name war: Die Nazideutschen haben nach 1933 ihr wahres Wesen gezeigt – als ideologisch berauschte Quartalssäufer.
Meine Mutter besaß eine große Gemäldesammlung mit Bildern von Monet, Manet, Renoir, Cézanne und Liebermann. Mein Vater führte die Brauerei Schultheiß-Patzenhofer und einige andere Firmen. Durch die Weltwirtschaftskrise und einen Finanzskandal verloren meine bereits geschiedenen Eltern den Großteil ihres Vermögens. Was wir noch übrig hatten, erlaubte mir immerhin, ein Jurastudium zu beginnen. Damals waren die Lehren von Sigmund Freud dabei, Allgemeingut zu werden, und ich hatte den Plan, auf ihrer Basis als Strafverteidiger zu arbeiten.
Also schrieb ich mich im Frühjahr 1932 an der Universität in Heidelberg als Student der Rechte ein. Mein zweites Semester verbrachte ich in der herrlichen Stadt München, aber noch bevor es vorüber war, brach am 30. Januar 1933 unter dem Jubel der Männer und auch der Frauen Adolf Hitler über Deutschland herein. Sein Name ist mir so zuwider, dass ich ihn nur ungern ausspreche oder vollständig hinschreibe.
Obgleich ich noch jung und politisch unerfahren war, hatte ich das Ableben der von rechts wie links verachteten deutschen Demokratie durchaus erwartet. Andererseits war die totale «Machtergreifung» Hitlers doch ein unerwarteter Schock für mich. Viele «Nichtarier», zu denen auch ich zählte, blieben in Deutschland, weil sie glaubten, die Herrschaft des «Führers» sei nur ein kurzer Spuk. Die allermeisten von ihnen wurden im Laufe der Jahre von den Schergen Hitlers grausam vernichtet. Aber es lief mir kalt den Rücken herunter, als diese Kreatur ihre Antrittsrede in die Welt hinausspie. Schon seit zehn Jahren hatte er die deutschen Massen ermächtigt – ja angefeuert –, Erniedrigung, Mord und Folter jeder Art an Millionen von unschuldigen Menschen zu begehen – IM NAMEN DES DEUTSCHEN VOLKES!!! Und nochmals: IM NAMEN DES DEUTSCHEN VOLKES!!! Und zum dritten Mal: IMNAMEN DES DEUTSCHEN VOLKES!!! So tobte er mit teils brüllender, teils fistelnder Stimme in die Volksmassen hinein. Und ich hatte eine Eingebung. Ich verstand sofort, dass die Masse der Deutschen, ob Hinz oder Kunz, reich oder arm, gebildet oder nicht, diesem Un-Menschen auf Gedeih und Verderb treu bleiben und in seinem Namen einzeln und im Kollektiv Verbrechen begehen würde, wie die Welt sie noch nicht gesehen hatte. Von Beginn der deutschen Geistesseuche an hatte ich nämlich – ich gestehe es – eine Todesangst vor meinen deutschen Mitbürgern, die lauthals sangen: «Wenn’s Judenblut vom Messer spritzt!»
Die Augen geöffnet hat mir eine Ehrenfeier in der Universität München zum Jahrestag der Schlacht bei Langemark. Bei jener Schlacht im Jahre 1914, zu Beginn des Ersten Weltkriegs, hatten deutsche Generäle, noch unter dem Kommando des Kaisers, Bataillone von Fünfzehn- bis Siebzehnjährigen in das feindliche Sperrfeuer getrieben, wo zig Tausende von alliierten Maschinengewehren niedergemäht wurden. Am Ende der Schlacht waren die deutschen Einheiten zurückgeworfen worden bis zum Ende der Gefechtslinie, von der sie gekommen waren. Nichts hatten sie mit ihrem jungen Blut erkauft. Auf der jährlichen patriotischen Feier zur Erinnerung an dieses sinnlose Gemetzel hielt der Rektor der Münchner Universität, an der ich Jura studierte, eine Rede. Er behauptete, diese jungen Männer seien nicht umsonst gefallen, sondern sie hätten dem Vaterland einen großen Dienst erwiesen. Daraufhin brach unter den Studenten und Professoren gewaltiger Applaus los. Es wurde «Sieg Heil!» gerufen, jenes abstoßende Wort, das mir noch jahrelang hässlich in den Ohren klang.
Bei einem Auftritt Hitlers auf dem Odeonsplatz in München kam mir in der brüllenden, drängelnden Menge zum ersten Mal der Gedanke, ich müsse dieser Meute und meinem Land entfliehen und mich retten – ein erschütternder, damals einfach verrückter Gedanke für einen harmlosen Jurastudenten von gerade 19 Jahren. Aufgrund meiner «Abstammung», um die ich mich nie gekümmert hatte, musste ich damit rechnen, eingesperrt und totgeschlagen zu werden wie ein räudiger Hund.
Aber wohin floh damals der Mensch, der von der kreischenden Masse gewaltsam «entdeutscht» und vogelfrei gemacht wurde? Jeder Einzelne von den Tausenden auf dem Odeonsplatz hasste mich, den angehenden Jurastudenten, mit wild loderndem, tödlichem Hass, als hätte ich – vor ihren Augen – Christus oder den «Führer» oder ihr Kind erdrosselt – ich, der schüchterne und einsame Student.
Hinzu kam natürlich, dass die Zeit damals eine ganz andere war. Heutzutage wandern die Leute aus oder ein, und es verwundert uns nicht. Aber damals! Vor der mörderischen Meute meiner Mitbürger fliehen und in die Fremde auswandern zu müssen, mir dort ein Leben zu schaffen, so schwierig dies auch sein würde! Das war ein erschreckender Gedanke. Ein Sprung ins Ungewisse.
Viel ist über die Verbrechen und die Grausamkeiten der Nazideutschen gesagt worden, aber wenig über ihren Wahnsinn. Natürlich waren sie grausam und mörderisch; das ist einfach gesagt und stimmt. Aber waren sie nicht auch, was ja etwas anderes ist, schlicht wahnsinnig, diese Fäuste schüttelnden Männer und teils kreischenden, teils selig hingerissenen Weiber, die dem «Führer» zujubelten, der in seinem Mercedes stehend an ihnen vorbeifuhr. Und all das gegen mich und «meinen Glauben», den ich nicht einmal hatte. Unweit von mir sah ich einen Mann reglos – nicht brüllend oder klatschend – in der Menge stehen, also vermutlich ein Jude. Ein Jude! Ein Juuude! Auf dem Odeonsplatz! Mitten in München! Eine Frau ging auf ihn zu und spuckte ihm ins Gesicht. Er wischte sich ab und ging still davon.
Vor diesem entfesselten Wahnsinn also floh ich sogleich und schlug mich recht und schlecht durch in verschiedener Herren Länder, bis ich endlich nach Amerika kam. Nicht bevor der «Führer» sich eine Kugel in den Schädel geschossen hatte, betrat ich wieder deutschen Boden – dieses Mal als amerikanischer Besatzungsoffizier mit der Aufgabe, bei der Bereinigung der verseuchten deutschen Presse mitzuwirken.
Ich hasse die Deutschen nicht, aber nach Hitler sind sie mir so fremd geworden wie unbekannte Stämme auf fernen Kontinenten. Ich wurde als junger Mann «entdeutscht» und muss im Rückblick sagen, dass mir die Deutschen einen Dienst erwiesen haben, als sie mich zwangen, Amerikaner zu werden.
Herkunft
Noch unter Kaiser Wilhelm II. wurde ich am 14. Dezember 1913 in Berlin geboren. Meine Eltern waren jüdischer Herkunft, aber zum Christentum übergetreten. Und so wurde ich in der protestantischen Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche getauft und mit 14 Jahren eingesegnet. Ich lebte mit meinen Eltern teils in unserem prächtigen Haus in der Bendlerstraße Nummer 40 am Berliner Tiergarten, teils auf unserem Rittergut mit dem schönen Namen Freienhagen nördlich von Oranienburg, zu welchem ein Dorf gleichen Namens gehörte.
Das Rittergut Freienhagen lag etwa eine Autostunde von Berlin entfernt. Meine Eltern hatten es 1913 gekauft. Es kam mir riesengroß vor mit seinen Wäldern, Feldern, Wiesen, Treibhäusern, Stallungen und Taubenschlägen. (Aber als ich es nach 1990 ein einziges Mal wiedersah, kam es mir sehr geschrumpft vor. Oder war die Welt kleiner geworden?) Jedenfalls war es so groß, dass wir mehrere Bedienstete brauchten.
Herr Pelz war der Imker, doch er kümmerte sich auch um die Hühner. Herr Tuberke fütterte die Tauben. Auf den Wiesen standen unsere Kälber. Wir aßen unser eigenes Kalbfleisch, von dem Schlachter Stöpel besorgt, und es schmeckte köstlich. Des Abends half ich, unsere Kühe von der Weide in den Hof zu treiben. Zur Erntezeit kamen junge Mädchen und Männer aus dem fernen, geheimnisvollen Polen und arbeiteten für uns «im Akkord», wie es hieß. In Freienhagen besaßen wir auch riesige Tulpenfelder, von denen wir hin und wieder Blumen an Händler in Berlin verkauften.
Nach Ansicht meiner Mutter aß ich zu wenig und wurde von ihr wiederholt gerügt. Ich war ein großes und schmächtiges Kind, aber ich war nicht unsportlich. Ich konnte sogar reiten und besaß mein eigenes Pferd, einen Apfelschimmel namens Puppe. Im Winter kam das Pferd nach Berlin und wurde im Tattersall untergebracht, bei uns in der Bendlerstraße. Wir besaßen auch zwei Lipizzaner, die vormals zum kaiserlichen Marstall gehörten. Vor dem Pferdestall am Eingang des Gutes wachte ein riesiger Löwe aus Bronze, gegossen vom berühmten Bildhauer August Gaul. Ein Löwe von Gaul, direkt bei den Rössern … Nach dem Krieg war dieses bronzene Raubtier verschwunden. Der Künstler Gaul wurde übrigens vom Galeristen Paul Cassirer vertreten, für den mein Vater zum Schicksal wurde, weil er sich in dessen Frau Tilla Durieux verliebte.
Der Kutscher auf unserem Gut hieß Reinhold und lebte mit einer Frau Heim in «wilder Ehe». Er brachte mir das Reiten bei und sogar das Überspringen von Hindernissen. Gemeinsam streiften wir zu Pferd durch die umliegenden Wälder. Bald konnte ich eine vierspännige Kutsche lenken oder einen Pferdeschlitten. Reinhold vertrat in allen Lagen den Grundsatz: Niemals umkehren. Daran habe ich mich stets gehalten, insbesondere nach 1933.
Zudem war ich gut Freund mit unserem Hausmeister Oertel, der neben vielen anderen wichtigen Aufgaben auch die Aufsicht über unseren Weinkeller hatte. Mit unserem Förster ging ich zuweilen, wenn es meine gestrenge Mutter erlaubte, an lauen Abenden auf die Wildschweinjagd, was mir weniger gut bekam, denn es war kalt in der Morgenfrühe. Die aufsteigenden Nebel wirkten bedrückend auf meine schon damals melancholische Natur; zudem sah man nur selten ein Wildschwein und erledigte noch seltener eins.
Ich wurde kein passionierter Jäger, anders als die Söhne der meisten deutschen Gutsbesitzer. Das Töten von Tieren bereitete mir Unbehagen. Vom Direktor des Gymnasiums in Berlin, der ein Bekannter meines Vaters war und mir privat Latein-Nachhilfe gab, wurde ich gefragt, ob ich schon meinen ersten Rehbock geschossen hätte. Ich verneinte und fügte hinzu, dass ich wenig Lust hätte, einem unschuldigen Tier von weitem eins auf den schönen Pelz zu brennen, sie täten mir leid. Da sprang der kleine, rundliche Kerl aus seinem Sessel hoch, schlug entsetzt die fetten Hände zusammen und rief: «Was! Du! Ein deutscher Mann!» Ich war da übrigens gerade zehn.
Drei Chauffeure arbeiteten für meine Eltern; der ranghöchste von ihnen hieß Max Lehmann, mit dessen Sohn, ebenfalls Max geheißen – ein blonder, blauäugiger Junge – ich mich gut verstand. Er tat sich nicht dicke, sondern war freundschaftlich und gefällig zu mir, obwohl ich ihm körperlich unterlegen war. Viel später ging der starke, aber sanfte und gutwillige Maxe zu den Fliegern und ist im großen Hitlerkrieg gegen die Welt für immer und ewig im russischen Eis verschollen. Wie gern würde ich noch einmal mit Maxe durch unsere Wälder streifen, Pfifferlinge und Steinpilze sammeln und Erlebnisse austauschen …
Vater Lehmann ließ mich sogar auf Waldwegen unseren Mercedes fahren, da war ich 13, aber schon groß genug, um über das Lenkrad hinausschauen zu können. Dergleichen hätte meine Mutter nie gestattet. Ihre etwas herrische Attitüde, ihre Art, jeden zu gängeln und alles zu verbieten, mag sie von ihrer eigenen Mutter geerbt haben, Frau Geheimrat Elise Marcuse. Auch an sexuelle Aufklärung durch sie war nicht zu denken. Das übernahmen wohlwollende Hausangestellte, mehr durch Taten als durch Worte.
Mein Vater Ludwig Katzenellenbogen stammte aus Krotoschin, einer Stadt bei Posen. Er war kurzbeinig, wirkte etwas gedrungen, hatte aber ein großes, offenes Gesicht und eine breite Stirn. Sein eigener Vater besaß eine Schnapsfabrik. Ludwig wollte gerne Jura studieren, musste aber in die väterliche Firma eintreten. In dieser Branche war er sehr erfolgreich. Bald zog er nach Berlin, wo er seine Frau kennenlernte, die Arzttochter Estella Marcuse. Er wurde Generaldirektor verschiedener Firmen, so auch der Brauerei Schultheiß-Patzenhofer. 1925 konnte ein Haus in der Bendlerstraße gekauft werden. In derselben Straße lag das Reichswehrministerium, an dem ich als Kind an der Hand meiner Gouvernante vorbeispazierte und die Ehrenwache bewunderte.
Unsere Villa war fürstlich eingerichtet, die Wände waren mit Seidenstoffen aus Frankreich in verschiedenen Farben verkleidet. Es hingen dort Gemälde von Monet, Manet, van Gogh, Cézanne und Menzel; es gab sogar eine Madonna von Rubens. Max Liebermann hat schöne Porträts von meinem Vater und von meiner Mutter gemalt. Antike Möbel oder neue Möbel aus feinen Hölzern zierten die Räume, dazu Porzellan aus China oder Meißen. Meine Mutter war eine große Sammlerin mit gutem Geschmack. Sie liebte ihre Kunstobjekte mehr als ihre Kinder, von denen ich das älteste war. Nach mir kamen zwei Schwestern, Leonie im Jahr 1918 und Estella im Jahr 1921. Dass sie einmal Galeristin in Los Angeles werden sollte, hat meine Mutter sicher nicht geahnt.
Zum Luxus des Hauses gehörten ein Wintergarten mit Marmor und seltenen Pflanzen, außerdem mehrere komfortable Badezimmer mit Handtuchwärmern. Die Küche lag unter dem Dach, damit die Gerüche oben blieben. Nur das Schwimmbad im Keller wurde nie zu Ende gebaut. Denn während das Familienpalais entstand, zerbrach die Familie.
Weshalb mir meine Mutter den Vornamen Konrad gab, der bis dahin in der Familie nicht üblich war, weiß ich nicht. In meiner Kinderzeit führte der Name zu Hänseleien, denn kaum jemand konnte widerstehen, die bekannten Verse aus dem «Struwwelpeter» zu zitieren: «Konrad, sprach die Frau Mama, ich geh aus und du bleibst da …» Es ist deshalb sogar zu Prügeleien gekommen.
Eingeschult wurde ich 1920 in der Privatschule von Fräulein Lenze. Sie befand sich in der Keithstraße, in einer Wohnung in der vierten Etage. Zur Schule begleitete mich jeden Morgen unsere Gouvernante Agnes Kühn, die mich auch abholte. Das war ein weiterer Grund für die Mitschüler, mich zu hänseln. Später schickte man mich auf das Mommsengymnasium, an dem es mit unserem Turnlehrer Hartmann einen ausgemachten Frühnazi gab. Wurde ich bis dahin wegen meines Vornamens gehänselt, so nun wegen meines Nachnamens. Die Namen waren mein Stigma, was eine gewisse Vereinsamung bewirkte. Das änderte sich erst, als ich auf das Französische Gymnasium geschickt wurde.
In meiner Familie waren alle christlich getauft; eine Synagoge habe ich nie betreten. Außerdem haben wir jedes Jahr Weihnachten gefeiert. Aber das war den Nazis gleichgültig. Mir war schon als Knabe der Irrsinn des Nazismus von Anfang an klar, obgleich ich das noch nicht in Worte kleiden konnte. Da war zunächst einmal der Judenhass. Das war es aber keineswegs allein. Es gab einen wilden, leidenschaftlichen, frei schwebenden, frei schwelenden Hass in der deutschen Welt. Dieser Hass einte unter Hitler die verschiedensten Elemente des Volkes.
Der Hass war die nie versiegende Quelle der Begeisterung des deutschen intellektuellen Lumpenproletariats, dem auch die gesamte Oberschicht angehörte. Mit Politik hatte die Nazischande überhaupt nichts zu tun! Wer die Nazis nicht von Anfang an verabscheute, war ein Unmensch, und basta! Ein Nazi zu sein war kein Denkfehler, sondern ein Charakterdefekt. Andererseits vertrauten viele Gefährdete auf den deutschen Rechtsstaat, und nur wenige hielten die Deutschen für ein Volk, das zu allem fähig ist.
Sehr früh lernte ich sogenannte Prominente kennen: Albert Einstein, die junge Marlene Dietrich, Tilla Durieux und auch den Boxer Max Schmeling. 1938 sah ich in New York seinen Kampf gegen Joe Louis, der 90 Sekunden dauerte. Ich glaube nicht, dass Schmeling ein Nazi war, auch wenn er sich von ihnen benutzen ließ. Der Bildhauer Professor Friedrich kam oft zu Besuch, er wurde von meiner Mutter gefördert.
Zu den Freunden des Hauses gehörte der Rennfahrer Rudolf Caracciola. Er galt als rasanter Starter mit kühlen Nerven, Geduld und Mut, aber er war nicht tollkühn. So lehnte er es ab, einen wahnsinnigen Geschwindigkeitsrekord zu fahren. Dank seiner «Seehundsaugen» galt er als guter Fahrer im Regen. Caracciola leitete die Generalvertretung von Mercedes am Kurfürstendamm. Für wichtige Kunden, wie meinen Vater, testete er deren Autos bei Problemen höchstpersönlich auf der Avus. Mein Vater besaß einen knallroten Mercedes 24/100/140K mit schwarzem Dach. Caracciola kam mit seinem Rennwagen zu uns, denn damals war es noch erlaubt, diese auf den Straßen zu benutzen. Es war ein offener Wagen, der 28/120/200 SS.
Mein Vater und sein Chauffeur Lehmann fuhren zur Avus, Caracciola folgte ihnen im Rennwagen: mit mir als Beifahrer. Auf der Rennstrecke fuhr er dann mit meinem Vater und dem Chauffeur einige Runden, während ich allein auf den Rennwagen aufpassen sollte. Ich war 15, setzte mich hinter das Lenkrad aus poliertem Holz. Da der Zündschlüssel noch steckte, ließ ich den Motor an. Aber gerade in dem Moment kamen die anderen zurück. Statt mich zu beschimpfen, wie ich erwartete, fragte Caracciola: «Willst du ihn mal fahren?» Dann setzte er sich neben mich und sagte: «Also los!»
Der Wagen war schwer zu bedienen – eine harte Kupplung, eine Kugelschaltung –, aber alles klappte problemlos. «Er hat Talent», sagte Caracciola zu meinem Vater, «ich könnte ihn schulen.» Mein Vater konnte sich seinen Sohn nicht als Rennfahrer vorstellen. Chauffeur großer Autos zu sein war damals ein Traumberuf, doch für die Kinder reicher Leute kam das nicht in Frage.
Meine Mutter fuhr ein tiefblaues Mercedes Coupé. Das Auto war eine Maßanfertigung, wie auch alle unsere Hemden, Kleider und Schuhe sowie die speziellen dreiteiligen Schuhleisten. Wir waren Kunden bei Wilhelm Breitsprecher, einst Kaiserlicher Hofschuhmacher.
Als ich 12 war, kam einmal Marlene Dietrich zum Mittagessen ins Haus, zusammen mit dem Regisseur Victor Barnowsky, bei dem sie debütierte, und mit ihrer Kollegin Sybille Fleming. Marlene hatte damals dunkles Haar, gab sich ausgesprochen munter. Später in Amerika sah ich sie noch zweimal wieder.
Mein Vater war Mitglied im «Land- und Golfclub Berlin-Wannsee»; eine Zeitlang war er dort sogar Vizepräsident. Über ihn habe ich auch zu diesem Sport gefunden, den ich später in Amerika weiter betrieb. Ich spielte gar nicht schlecht, durfte sogar zur Berliner Juniorenmeisterschaft antreten. Präsident des Golfclubs war Herbert M. Gutmann, Direktor der Dresdner Bank. Mein Vater hatte sich direkt am Berliner Club-Gelände einen Bungalow bauen lassen, um dort manchmal zu übernachten.
Mitglied im Club war auch der älteste Sohn des Kaisers, Prinz Wilhelm von Preußen. Der Prinz hatte ein Verhältnis mit der Frau des Bankiers Dr. Schwarz, einer Jüdin mit echt Berliner Schnauze, die ihn stets mit «Majestät» anredete. Wiederholt habe ich mit dem Prinzen Golf gespielt und jedes Mal gewonnen. Der liebste Mensch auf dem Golfplatz war mein Caddie, ein Mädchen namens Erna, mein erster Schwarm. Auf diesem Golfplatz geschah es auch, dass Herbert Gutmann Anfang 1931 meinem Vater zuflüsterte, dass die Darmstädter Bank Pleite gemacht habe. Das war der Anfang der großen Krise, die auch meinen Vater schwer treffen sollte.
Ich kannte das Reichsein, die Privilegien, aber auch die Nachteile meiner Familiensituation; doch dann lernte ich den plötzlichen Verlust von allem kennen. Ich selbst wurde später nie vermögend. Als ich mit 19 Jahren auswanderte, war ich vorbereitet auf ein abenteuerliches Leben unter wechselnden Umständen.
1931 wurde meinem Vater übel mitgespielt. Intrigen eines deutschvölkischen Bankiers kosteten ihn sämtliche Posten in Aufsichtsräten und schließlich sein Vermögen. Man machte ihm den Prozess wegen Konkursverschleppung und Ähnlichem. Das war ein Riesenskandal, der in der Presse ausgeschlachtet wurde, insbesondere in der Nazi-Presse. Er wurde verurteilt, auch wenn man ihm wenig nachweisen konnte, und saß drei Monate im Gefängnis. Als er wieder herauskam, war er ein gebrochener Mann.
Er hatte alle Villen verloren, das Rittergut Freienhagen, seine Autos und seinen guten Ruf. Er lebte nun mit der Schauspielerin Tilla Durieux zusammen, deretwegen er sich von meiner Mutter scheiden ließ. Die Schauspielerin, die ihn erst ein Jahr zuvor geheiratet hatte, musste sich nun um ihn kümmern.
Ich hatte 1932 das Abitur gemacht und im Sommersemester in Heidelberg mit dem Jurastudium begonnen. Dafür reichten die Ersparnisse meiner Mutter noch. Zum Wintersemester 1932/33 wechselte ich nach München. Dort erlebte ich den 30. Januar 1933.
Ich fuhr zu Skiferien nach Österreich, kam noch einmal in meine Bude in der Ohmstraße zurück. Nach einigen unliebsamen Begegnungen beschloss ich, mit dem Zug nach Paris zu fahren. Ich hatte eben erst meinen 20. Geburtstag erlebt (aber nicht gefeiert). Während an jenem ersten Tag meines Exils teils nüchterne, teils besoffene «Heil Hitler»-Rufe durch Münchens Straßen schallten, ging ich zu Fuß und mutterseelenallein zum Hauptbahnhof. Ich bestieg den nächsten Nachtzug nach Paris und nahm Platz auf einer Holzbank in der dritten Klasse. In Paris kannte ich keine Menschenseele. Ich hatte weder Geld noch einen Namen, noch irgendeinen Status vorzuweisen. Als Absolvent des Französischen Gymnasiums waren meine Sprachkenntnisse allerdings gut genug. Während ich die Nöte eines Emigranten kennenlernte, tobte in Deutschland der Veitstanz einer ganzen Nation.
Zwischenstationen
Ich verließ das rasend gewordene Deutschland am 12. März 1933. Einen guten Monat zuvor hatten die Deutschen die «Machtergreifung» der Massenmörder und -quäler als «Volkserhebung» und Neubeginn des Paradieses auf Erden gefeiert, unter ihrem «Führer» mit der feschen Haarlocke, der sich überschlagenden Stimme und den relativ kurzen Beinen, der vom bestechlichen Greis Hindenburg «böhmischer Gefreiter» genannt wurde, bevor er ihn zum Reichskanzler erhob.
Mit den erlaubten zweihundert Mark in der Tasche reiste ich nach Frankreich. Ich besaß kein Diplom, und meine zwei mageren Semester Studium der deutschen Jurisprudenz waren im Ausland keinen Pfifferling wert. Meine Eltern und meine wenigen deutschen Freunde hatten meine «wilde Abreise» nicht gebilligt und meinten: «Du bist verrückt! Der Hitler bleibt doch nicht am Ruder! Was kann der schon anders machen als die anderen? Die Deutschen lassen den doch nichts machen, was nicht legal ist! Und die Welt schon gar nicht! In spätestens drei Monaten ist der doch fertig! Du wirfst ja Dein Leben weg!»
So sprachen sie und viele andere in ihrem besorgten Unverstand und mussten, wie mein armer Vater, später auf schreckliche Weise für ihre Unkenntnis des deutschen Volkes büßen. Gerade mein Vater hatte sich immer als loyaler deutscher Bürger gesehen, zumal er getauft war.
Wie viele andere Emigranten lebte ich in Frankreich, weil ich nur da geduldet wurde, nicht weil ich es mir so ausgesucht hatte. Wir deutschen Flüchtlinge waren nicht willkommen, wurden als lästige Fremde angesehen und als «sales boches» beschimpft. (Die Haltung der Amerikaner uns gegenüber, die ich später erlebte, war ganz anders, Fremden gegenüber viel offener.) Zeitweise lebte ich auch in Amsterdam. Ich konnte mich mit kleinen Jobs und ein bisschen Geld von meiner Familie über Wasser halten.
In Paris arbeitete ich bei einer Vermögensberatung. Ein Kollege dort hieß Franz Pieck. Er hatte einen grausamen Mund, eine niedrige Stirn, eine scharf gebogene Adlernase. Sein starker Bartwuchs ließ ihn immer unrasiert aussehen, im Gesicht wirkte er dunkel. Pieck war Spezialist für Gold. Devisen, Häuser, Geldanlagen hielt er für faulen Zauber. Er glaubte nur an Gold. Für Ökonomen ist Gold eine irrationale Sache, und so glauben sie nicht daran. Es bringt keine Zinsen. Franz Pieck glaubte, dass man sich allein auf das Irrationale verlassen könne. Als er 1939 nach Amerika ging, nahm er sein ganzes Vermögen in Gold mit. Er starb als steinreicher Mann.
Ein anderer Kollege in Paris war Richard Lewinsohn, der bis 1933 Journalist bei der Berliner Weltbühne und bei der Vossischen Zeitung gewesen war. Von Beruf war er Arzt, er schrieb Gedichte, aber auch Studien zu ökonomischen Fragen sowie Porträts von Industriellen. Im Pariser Exil schrieb er unter dem Pseudonym Campanella in der Emigranten-Presse sowie in französischen Zeitungen.
Lewinsohn hatte einen dicken Bauch und trug ungebügelte Hosen. Er war ein sanfter Mann. Ich musste für ihn den Verlauf der Kurse für Gold, Silber und Kupfer aufzeichnen und in einer Kurve graphisch darstellen. Als ich die Firma 1935 verließ, um in die USA zu gehen, gab mir Lewinsohn die Hand und schaute mich lange und mitleidig an, als bezweifele er, dass ein so schmächtiger Jüngling im rauen Amerika seinen Weg machen würde.
1939 sperrten die Franzosen Lewinsohn ein, wie fast alle Emigranten, doch 1940 konnte er nach Brasilien fliehen. Dort wurde er Wirtschaftsberater der Regierung und Dozent für Ökonomie an der Universität von Rio. Nach 1952 lebte er in Paris, verfasste noch viele Veröffentlichungen. Er starb auf einer Reise in Madrid.
In Paris lernte ich im Februar 1934 Klaus Mann und dessen Pariser Freundeskreis kennen, darunter die Kinder von Thea Sternheim, Klaus und Dorothea, genannt Mopsa. Zuweilen besuchte ich Klaus Mann und seine Schwester Erika in Südfrankreich, wo man eine Menge deutscher Emigranten antreffen konnte.
Die Ausgewanderten glaubten mehrheitlich, Hitler würde sich nicht mehr lange halten können. Viele saßen in Cafés herum und warteten darauf, wie sich die Lage entwickelte. Ich erinnere mich an ein Zusammentreffen mit Klaus Mann und Jean Cocteau, der mit seinem Liebhaber gekommen war. Übrigens war Cocteau nur bedingt gegen die Nazideutschen, da er seine Drogen aus deutschen Quellen bezog und nicht von seinem Nachschub abgeschnitten werden wollte. Cocteau wirkte sehr klug und direkt. Er nahm an, dass ich eine Beziehung mit Klaus hätte, was nicht der Fall war. Obwohl wir in dieser Zeit eng miteinander befreundet waren, pflegte Klaus seine Freundschaften und sein Liebesleben diskret auseinanderzuhalten, so wie er auch seine Drogensucht zu einem hohen Grad vor anderen versteckt hielt.
Im Sommer 1934 verschlechterte sich meine Lage in Paris. An eine reguläre Arbeitserlaubnis war nicht zu denken, meine Finanzreserven schwanden. Ich hatte keine Aussicht auf eine Karriere oder einen festen Wohnsitz. Deshalb beschloss ich, nach Jugoslawien zu gehen, wohin mein Vater mit seiner zweiten Frau Tilla Durieux geflüchtet war. Sein Vermögen hatte er größtenteils verloren. Um Geld in neue Geschäfte investieren zu können, mussten Tilla und er Kunstwerke verkaufen, in der Schweiz oder in Paris, so etwa ein Porträt Tillas, das Renoir gemalt hatte. Heute befindet sich dieses Gemälde im New Yorker MOMA. Andere Stücke aus der Sammlung meiner Eltern befinden sich immer noch in Jugoslawien.
Mein Vater hatte in Ljubljana eine Fabrik gegründet, in der Motoren von Lieferwagen von Benzin auf Holzverbrennung umgebaut wurden. Aber das erwies sich bald als Fehlinvestition. Mit einer Hotelgründung hatte mein Vater später etwas mehr Glück. Aber meine Zukunft lag nicht auf dem alten Kontinent.
Bevor ich mich zur Überfahrt nach Amerika entschloss, bin ich Anfang 1935 noch einmal nach Berlin zurückgekehrt. Mein deutscher Pass war noch gültig. Ich ging zuerst nach München, von wo mich der Kunsthändler Böhler, bei dem meine Eltern gute Kunden gewesen waren, im Auto nach Berlin mitnahm, wenn auch nur widerwillig. Unterwegs hatten wir eine Autopanne. Beim Reifenwechsel half uns ein Passant, der sich mit «Heil Hitler!» verabschiedete. Ich war verwirrt, wusste nicht, wie ich mich verhalten sollte, wollte weder auffallen noch den Gruß erwidern. Der Helfer ging wütend davon. Die Szene ist mir lange im Gedächtnis geblieben, wie ein böser Traum.
Ich blieb zwei Tage in Berlin. Meine Mutter und meine beiden Schwestern wohnten in einer bescheidenen Wohnung. Sie hatten nur wenig Geld, konnten mir aber etwas leihen, damit ich die Überfahrt bezahlen konnte. Auch sie dachten schon an Auswanderung.
Einmal rief ich bei der Familie eines Bekannten an, ein schwuler deutscher junger Mann namens Horst Prüfmann, der im Zuge des sogenannten Röhm-Putsches 1934 ermordet wurde. Seine Mutter meldete sich am Telefon, reagierte aber verlegen auf meinen Namen und wollte nichts weiter sagen.
Mit dem Zug fuhr ich in Richtung Holland. In Amsterdam wohnte ein Freund von mir in der Keizersgracht 9. Dort könnte ich unterkommen, dachte ich, und mich im Hafen um ein Schiffsbillett nach New York kümmern. An der Grenze aber ließen mich die holländischen Zöllner nicht einreisen, weil ich keine Einladung vorweisen konnte. Man schickte mich zurück, das hätte unangenehme Folgen haben können.
Dem deutschen Bahnhofsvorsteher gegenüber, der sich über meine schnelle Rückkehr wunderte, sagte ich: «Eine Schweinerei, sie haben mich nicht reingelassen! Das hätte bei uns in Deutschland nie passieren können!» Er gab mir lauthals recht und lud mich zu einem Schnaps ein. Mit dem nächsten Zug klappte dann aber die Einreise in das vorerst noch sichere Nachbarland.
Von Holland aus machte ich einen Abstecher nach Paris und Nizza, doch im Herbst 1935 gelang es mir, die Einwanderung in die Vereinigten Staaten von Amerika zu bewerkstelligen. Ich fuhr auf dem holländischen Dampfer Statendam, der später im Weltkrieg durch Torpedos versenkt wurde, über das große Meer in das mir völlig unbekannte New York. In der Mitte des Ozeans erfasste uns ein Sturm, der fast zwei Tage andauerte und unseren Riesendampfer auf hoher See umherschleuderte wie einen Spielball. Als der Sturm sich gelegt hatte und die See glatt wie ein Riesenspiegel dalag, erschienen die eleganten Herrschaften aus der ersten Klasse (zu denen auch ich gehörte) zu den Mahlzeiten im Speisesaal, wo von eiligen Kellnern riesige Portionen serviert wurden. Da ich nicht an der Seekrankheit gelitten hatte, sprach ich den einladenden holländischen Spezialitäten kräftig zu.
Auf dem Schiff machte ich bald die Bekanntschaft einer amerikanischen Familie. Der Vater – ein Mann mittleren Alters – lud mich zu einem Genever ein und stellte mich seiner Frau und seinen drei Töchtern vor. Alle schienen, wie auch er selbst, erstaunlich guter Laune zu sein. Den Grund für die gute Laune erfuhr ich erst später: der Vater, ein bedeutender Rechtsanwalt, hatte kurz zuvor einen Strafprozess verloren, der ihn trotzdem reich gemacht hatte. Er hatte den berüchtigten Gangster Al Capone verteidigt. Mit seiner Frau und seinen drei attraktiven Töchtern hatte er eine Reise nach Europa unternommen, wo sich die jungen Damen, besonders in Paris, königlich amüsiert hatten. Vielleicht hielt er es für ratsam, nach dem Prozess eine Weile anderswo unterzutauchen.
Während der restlichen Tage der Reise verbrachte ich viel Zeit mit dieser Familie, die sich über mich und mein recht schwaches und holpriges Englisch amüsierte. Außerdem war ich damals ein recht gutaussehender junger Mann, sodass die Eltern in mir wohl einen möglichen europäischen Schwiegersohn sahen. Es war damals nicht ungewöhnlich, dass reiche Amerikaner nach Europa fuhren, um dort Männer für ihre Töchter zu finden. Junge, gutaussehende Passagiere in der ersten Klasse auf den Überseeschiffen wurden von manchen Amerikanern als Mitglieder des europäischen Adels angesehen. Mit der jüngsten und schönsten der drei Anwaltstöchter kam es zu einem bescheidenen Flirt. Am Ende der Reise stand ich gut genug mit der Familie, um ihr einen Heiratsantrag zu machen – aber dieser Plan zerschlug sich, wie so viele in meinem wunderlichen Leben.
Als ich auf Ellis Island ankam, fragte mich der bärbeißige Grenzbeamte, ob ich Geld dabeihätte. Ich sagte wahrheitsgemäß: «300 Dollar.» Da brüllte der Beamte los: «Don’t you lie to me!» Sie Lügner! Sie sind viel zu jung für so viel Geld! Und der ganze Saal bebte unter seinem Brüllen. Aber ich hatte die Wahrheit gesagt. Allerdings hatte ich keineswegs das Gefühl, vor allem in der ersten Zeit in New York, zu viel Geld zu haben.
In New York lernte ich dann eine Familie mit Namen Fronknecht kennen, die schon vor längerer Zeit aus Deutschland ausgewandert war und nun an der 5th Avenue lebte. Auf der Madison Avenue hatte ich einen ehemaligen Mitstudenten getroffen, der mich zum Sechstagerennen im Sportpalast mitnahm. Dort stellte er mich zwei jungen Damen vor, den Töchtern jener Familie Fronknecht. Eine von ihnen wollte mich unbedingt heiraten, und so kam ich in Kontakt mit der High Society, während ich andererseits von kärglichen Jobs leben musste. Auf diese Weise lernte ich Amerika von beiden Seiten kennen. Die Fronknechts verschafften mir das Affidavit, das nötig war, um ein «Visitor’s permit» zu erhalten, als Voraussetzung für einen längeren Aufenthalt im Lande. In Paris wäre es leichter gewesen, eines zu erhalten.
Damit die unbefristete Aufenthaltsgenehmigung gültig wurde, musste ich das Land noch einmal verlassen. Ich reiste also über die kanadische Grenze, aber auch dieses Mal wurde ich wegen meiner Bargeldbestände befragt. Ich hätte hundert Dollar bei mir, sagte ich und musste sie vorzeigen. Doch besaß ich fast 200 Dollar, mehr, als ich selbst gedacht hatte. Für ein paar Tage blieb ich in Montreal, wo ich niemanden kannte, bis ich auf dem dortigen US-Konsulat meine offizielle Einwanderungserlaubnis erhielt. Mit meinen Englischkenntnissen war es noch nicht sehr weit her. Immerhin hatte ich inzwischen einen anerkannten Status.
Begegnungen mit Thomas Mann in New York
In New York schlug ich mich zuerst auf kleinen Pöstchen durch. So war ich Aktienhändler bei dem später sehr berühmten Wirtschaftswissenschaftler und Börsianer Benjamin Graham an der Wall Street. Wir hatten eine gute Beziehung zueinander und schätzten gegenseitige Offenheit, aber meine Bemühungen, mir an der Wall Street ein Riesenvermögen zu verdienen oder mir wenigstens ein erträgliches Leben zurechtzuschustern, waren nicht von Erfolg gekrönt.
Die wenigsten Leute konnten sich meinen Namen merken, aber wenn sie es schafften, riefen sie gerne: «Katzenellenbogen, how are you?» New York war ein schweres Pflaster – besonders zu jener Zeit, als die Große Depression zwar am Abklingen, aber noch keineswegs vorüber war.
Ein für mich damals unerwarteter Aspekt der Emigration war es, dass Leute aller Art durch die Flucht vor den Nazis durcheinandergeschüttelt wurden. In New York begegnete ich einem bekannten deutschen Kommunisten.
«Nanu», fragte ich einfältig, «wieso sind Sie denn hier in Amerika und nicht in Moskau?»
«Moskau?», antwortete er, «als Kommunist kann man doch in Moskau nicht leben!» Und so war er nach Amerika gegangen, wie so viele.
Ich traf in New York manche Bekannte wieder, wie den aus Wien stammenden Feuilletonisten Anton Kuh, den ich schon in Paris gesehen hatte, aber auch den Regisseur Eric Charell, der ein bekannter Mann in Berlin gewesen war, wo er das Weiße Rössl inszeniert hatte. Es wurde einer der größten Theatererfolge der Weimarer Zeit. Nun versuchte er sich als Regisseur in New York und in Hollywood.
Im Jahre 1938 ging ich mit meinem Freund Jerry Speyer im Central Park spazieren. (Sechs Jahre später nahmen wir beide als amerikanische Soldaten an der Normandielandung teil.) Ich lernte ihn nicht in Deutschland, sondern erst in New York kennen und schätzen. Er hatte genau wie ich Deutschland Anfang 1933 verlassen. Jerry war der Neffe des damals sehr bekannten und ebenfalls 1933 emigrierten Autors Wilhelm Speyer [1887–1952], der den Roman Der Kampf der Tertia geschrieben hatte und mit den Manns gut bekannt war, sodass sie auch seinen Neffen willkommen hießen. Jerry sagte zu mir: «Ich gehe heute Nachmittag ins Hotel Bedford, um Erika Mann zu besuchen. Wollen Sie nicht mitkommen? Vielleicht ist der Vater ja auch da, dessen Bücher gefallen Ihnen doch so sehr!» (Damals siezten sich junge Leute noch.)
Thomas Manns Bücher und Novellen hatte ich in Deutschland als Gymnasiast mit großem Genuss gelesen, denn sie hatten mich stärker angesprochen, beeindruckt, belehrt und amüsiert als all die anderen Bücher, die ich, wie viele Jugendliche aus der deutschen Oberschicht, ebenfalls gelesen hatte. Thomas Manns Werke – besonders die Novelle Tonio Kröger und der Roman Der Zauberberg





























