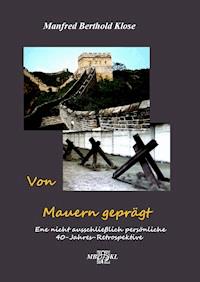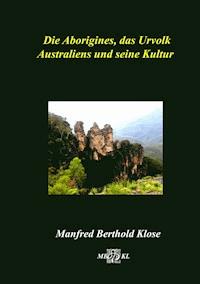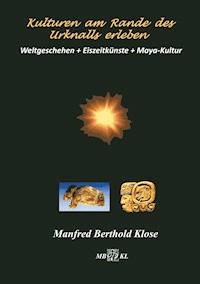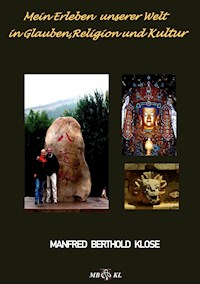
8,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Autor wurde bei vielen privaten und dienstlichen Aufenthalten und Kontakten im Ausland häufig mit Fragen zum Leben des Menschen und der ihn umgebenden Welt konfrontiert: Seit wann gab es diese Umwelt, Himmel und Erde sowie das Leben auf unserem Planeten? Die ersten Antworten dazu waren: Durch die göttliche Schöpfung entstand diese Welt in sieben Tagen. So auch die ersten Gedanken dazu in meinen jungen Jahren, einem Mythos gleich. Aber bereits in diesen Jahren beschäftigten mich exakte Beobachtungen der Umwelt, etwa von planetarischen Nebeln oder Sternen. Diese Erkenntnisse waren mir in Glaubensfragen nicht hinderlich, stärkten mich auch in der mir vertrauten Glaubenslehre. Das im Gegensatz zur Auffassung, die von Soziologen der Säkularisierungstheorie vertreten wurde, wonach im 20. Jahrhundert in modernen Gesellschaften der religiöse Glauben immer schwächer werde, an kulturellem und politischem Gewicht verliere und sich verweltliche. - In den letzten 30 Jahren zeigte sich aber etwas anderes. Der Glauben bestimmt noch immer das Leben der meisten Menschen auf unserem Planeten. Vor allem auch aus demografischen Gründen nimmt seine Faszinationskraft sogar zu. Und das ist auch verbunden mit einem anwachsenden schnelleren religiösen Wandel. Die Universalität der Religion spielt da eine ganz wichtige Rolle als Basisfunktion der verschiedenen Kulturen in unserer bekannten Welt, aber auch in der moralischen Orientierung ganz allgemein. Das Zölibat - wie ich es schon in meiner Jugendzeit kritisiert habe - und auch die Missbräuche in der Katholischen Kirche sind davon betroffen und waren ein wichtiges Thema beim Zusammentreffen der Vorsitzenden der Bischofskonferenzen im Februar 2019 in Rom und der dabei getroffenen Analyse von Papst Benedikt XVI.. Das waren auch die Gründe für den von mir an den Papst Franziskus gerichteten Brief zur Erneuerung der katholischen Kirche, nachdem ich aufgrund dessen Äußerungen während seines Besuchs im asiatischen Raum an den von ihm dabei mehrfach geäußerten positiven Beitrag der Menschen dieser Länder, den Rom auch unterstützen wollte, geglaubt hatte. In Rom angekommen, nahm aber Franziskus deutlich Abstand von seinen vorangegangenen optimistisch geklungenen Äußerungen. Der vom Papst mir durch seinen Nuntius Paolo Borgia zugesandte Antwortbrief könnte aber vielleicht doch ein positives Zeichen zum Anbeginn der Bemühungen im Hinblick auf die erforderlichen Erneuerungen in der katholischen Kirche sein.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 118
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Das Urknallphänomen - seine Interpretation und Relation in verschiedenen Glaubensgemeinschaften und Religionen
Vom Sternenstaub zur Entstehung des Lebens
Kosmische Evolution, Naturwissenschaft, Schöpfungsglaube und Christianisierung
Christlicher Schöpfungsglaube
Göttliche Offenbarung und Religion
Christentum und Glauben in Deutschland und der Welt
Zitate aus den verschiedenen Evangelien
Die Heilige Schrift in verschiedenen Religionen unseres Planeten und wie sie der Autor in seinem Zuhause erlebte
Christentum, Römisch-Katholische Kirche und Reformation
Derzeitige Ausbreitung des Christentums
Glauben, Offenbarung und Religionsfreiheit in verschiedenen Regionen unseres Planeten
Buddhismus und Lebensrad
Buddhistisches Tibet, Lhasa „Ort der Götter“ und Sera-Kloster
Das Zusammenfinden der Menschen in Glauben, Religion und Kultur
Kosmische Voraussetzungen von Religion
Menschliche Vorfahren-Population
Erste menschliche Aktivitäten: Figürliche Bearbeitungen, Fels- und Höhlenbemalungen, Schmuck-Anfertigungen
Das Urvolk der Aborigines in Glauben, Religion und Kultur
Der Uluru
Das alternative China in-Glauben, Religion und Kultur
Fengdu - die Geisterstadt oder der „Eingang zum Hades“
Die Halle Höchster Harmonie
Huashan und Geisterwesen
Geisterlicht und Schöpfung in der Quarantäne
Vergleichende Momente der Maya-Kultur
Quellenverzeichnis
Nachbetrachtung
Danksagung
Vorwort
Seit Menschengedenken beschäftigt man sich mit Fragen nach dem Anfang und dem Ende der Welt. Es sind Fragen wie etwa: Wann entstand unsere Welt? Wann entstanden Himmel und Erde, Sonne, Mond und die Gestirne? Gibt es ein zeitliches Ende für unsere Welt? Wo ist ihr räumlicher Anfang und wo das Ende? Gibt es überhaupt diesen räumlichen und zeitlichen Anfang und ihr Ende? Wie und wann entstand irdisches Leben, vor allem der Mensch mit seiner Kultur?
Welche Nachweise gibt es dafür? - Es sind Themen, mit denen sich die Menschen schon seit Jahrhunderten beschäftigten und womit sie sich vielleicht auch noch eine unbestimmte Zeit beschäftigen werden. Natürlich beschäftigten sie auch mich, den Autor. Das bereits schon in sehr jungen Jahren ebenso auch noch heute. Trotz all dieser Fragen, hatte ich in meinen jungen Jahren, auch in der Zeit als Ministrant, vor allem auch die These der Bibel im Gedächtnis, wonach die Welt in sieben Tagen entstanden sein soll. Dem stand gegenüber die widersprüchliche Aussage der Naturwissenschaft, die ich ja sehr schätzte, daß viereinhalb Milliarden Jahre zwischen der Entstehung der Erde und dem Aufkommen der ersten Menschen lagen. Natürlich war mir bereits schon damals klar, daß es in der Zeit, als die Bibel geschrieben wurde, keine derartig präzisen Daten über unsere Welt gab, wie diese hunderte Jahre später in der Naturwissenschaft Normalität waren.
Die Entstehung unserer Welt und des Lebens wird oft mit dem Begriff Urknall verknüpft. Der schöpferische Mensch und seine Kulturleistungen werden häufig damit in Verbindung gebracht. Und das wird dadurch begründet, daß es so etwas wie eine geistige Explosion in seiner Vorstellungswelt gegeben haben muss. Auf diese Weise wird auch unseres Lebens erklärt, in verschiedenen Ländern und Kontinenten.
Das Urknallphänomen - seine Interpretation und Relation in verschiedenen Glaubensgemeinschaften und Religionen
Als Urknall wird in der Kosmologie der Beginn des Universums, also der Anfang der Entstehung von Materie, Raum und Zeit bezeichnet.
Nach dem kosmologischen Standardmodell ereignete sich der Urknall vor etwa 13,8 Milliarden Jahren. Die verschiedenen Urknall-Theorien beschreiben nicht den Urknall selbst, sondern vor allem das frühe Universum in seiner zeitlichen Entwicklung nach dem Urknall. Mit Urknall wird dabei keine Explosion in einem bestehenden Raum, sondern das gemeinsame Entstehen von Materie, Raum und Zeit aus einer ersten Singularität [1] verstanden. Diese Singularität ergibt sich formal, indem man die Entwicklung des expandierenden Universums zeitlich rückwärts bis zu dem Zeitpunkt betrachtet, an dem die Materie- und Energiedichte unendlich ist. Es resultiert dann ein Zustand unendlicher Dichte und Hitze, die sogenannte Singularität, wie man das in der Physik und Astronomie bezeichnet. Die Gravitation ist dabei so stark, daß die Krümmung der Raum-Zeit divergiert und ihre Metrik ebenso.- Es wird angenommen, daß die Singularität die Grenzen der allgemeinen Relativitätstheorie aufzeigt und zur Beschreibung ein anderes Modell, etwa die Quantengravitation, verwendet werden müsste. Als eine Lösung der Gleichungen der Allgemeinen Relativitätstheorie beschreibt eine derartige Singularität einen Punkt oder ein sogenanntes Schwarzes Loch, in dem die Raum-Zeit nicht mehr definiert ist: Eine unendlich hohe Masse und ein unendlich starkes Gravitationsfeld sind dort miteinander vereint.
„Big Bang“ - Urknall Alfred Pastewka/ Science Photo Library via Getty Images 639549057
Die Urknall-Theorien behandeln die Entwicklung des Universums [2] von einem Zeitpunkt mehr als eine sogenannte Planck-Zeit (etwa 10−43 Sekunden) nach dem Urknall bis etwa 300.000 bis 400.000 Jahre später, als sich stabile Atome bilden konnten und das Universum durchsichtig wurde. - Von der Schöpfung erfuhr der Mensch vor allem dadurch, daß ihn die ihn umgebende Welt zum Leben befähigte. Und in der Schöpfungstheorie wird formuliert: Das Auffinden geeigneter Nahrung und die Erfüllung der Lebensbedürfnisse im Lebensumfeld waren nur durch einen liebenden Schöpfer erklärbar. Symbol und sichtbares Zeichen für göttliche Ordnung waren die Abläufe am Himmel, mit Tag und Nacht sowie den Jahreszeiten, die für den Menschen, wie gemacht, empfunden wurden.
Die auf den Menschen ausgerichtete Schöpfung, auch als klassisches anthropisches Prinzip bezeichnet, war die entscheidende religiöse Grunderfahrung aller Kulturen [3, 4]. Für einen auf Evolution basierenden Glauben an die Schöpfung wird dabei als ausreichend der Glauben an ein starkes Religionsprinzip für den gesamten Kosmos angenommen. Dieses Prinzip geht davon aus, daß das Potential für die Religion in den Naturgesetzen und kosmischen Variablen bereits mit Beginn des Universums enthalten ist. Und deshalb sagt es das Auftreten von Religion nach einer ausreichenden Zeit an Evolution voraus, obwohl die Entwicklung auf chaotischen und zufälligen Prozessen basiert. Zwar wurde das durch menschliche Eigenleistungen, wie den Bau von Häusern, Städten und resultierenden Gesellschaftsordnungen, in den Hintergrund gedrängt, durch Naturkatastrophen, Krankheiten und Tod aber immer wieder mit göttlicher Macht verknüpft.
Eine Abkehr von dieser Gottesvorstellung entstand erst, als die Naturwissenschaft mit der Evolutionstheorie eine zuvor nicht denkbare, andere Erklärung für die Schöpfung lieferte: Nicht die den Menschen umgebende Welt wurde vom Schöpfer auf die Bedürfnisse des Menschen zugeschnitten, sondern im Rahmen der Evolution wurde der Mensch den Bedingungen der Umwelt angepasst. Und das wirft die Frage auf: Sind damit etwa alle Formen von Religion nur ein Produkt dieser anthropozentrischen Wunschvorstellungen, die nur ausgehend vom Menschen zu verstehen sind?
Dazu Stephan Hawking, [5] Atheist und Astrophysiker, auf Lebenszeit Mitglied der Päpstlichen Akademie der Wissenschaften und Mitbegründer der Theorie der Schwarzen Löcher: „Die Schöpfung ist nicht auf die Intervention eines übernatürlichen Wesens oder Gottes angewiesen, sondern nur auf die Physik als gesetzgebendes Organ. So ist auch die reale Vielfalt der Universen eine Folge der physikalischen Gesetze.“
Vom Sternenstaub zur Entstehung des Lebens
Seit der Entstehung des Weltalls vor fast 14 Milliarden Jahren sind unzählige Sterne erloschen oder explodiert. Sie lieferten den Grundstoff für unseren Planeten und das Leben auf ihm. Und nachhaltig dabei vor allem das Enden der Sterne vor etwa 13,4 Milliarden Jahren im sogenannten Supernova, wobei Reste der Sterne mit interstellarem Gas und Sternenstaub wechselwirkten, sich vermischten und im Weltraum bewegten. Schließlich entstanden aus ihnen auch wieder Sterne, Monde und Planeten. Die Milchstraße und Galaxien wie auch die Sonne waren davon auch betroffen. Mit den vorhandenen vulkanisierten Gasen konnte eine Atmosphäre mit Kohlendioxid, Stickstoff und Wasserdampf entstehen. Mit der Abkühlung der Gestirne bildete sich Wasser, das sich in den Senken ihrer Oberflächen ansammelte. Es entstanden so Seen und Meere und auch die Erde und mit ihr viele Kontinente.
Vor ca. 2,5 Milliarden Jahren vollzog sich der wohl bedeutendste Moment in der Weltgeschichte: Es begann das Leben auf der Erde mit Pflanzen und Tieren. Die Photosynthese war die Voraussetzung für das Entstehen einer mit Sauerstoff geladenen Atmosphäre, was die Entwicklung von Lebewesen ermöglichte, das Leben des Menschen auf der Erde eingeschlossen. Eine Besonderheit dabei: In der erdgeschichtlichen Kambrium-Formation traten besondere Tierformen auf, vor allem hartschalige Tiere, aber auch solche, wie wir sie heute noch antreffen können. Gegenwärtig beträgt der Sauerstoffanteil etwa ein Fünftel unserer Lufthülle. Es gilt als ziemlich sicher, daß es ohne Sauerstoff kein höheres Leben auf der Erde geben würde.
Bildung von Sternen-Staub aus dem Zentrum der Milchstraße nach deren Wechselwirkung mit den Galaxien. Er scheint sich auch als „As-Fontaine“ ins All zu bewegen. Foto Chris Butler
Kosmische Evolution, Naturwissenschaft, Schöpfungsglaube und Christianisierung
Notwendig für die Existenz des Menschen war die Bildung des mit geeigneten Eigenschaften ausgerüsteten Planeten Erde und die spezifischen Bedingungen, bei denen erstmals komplexe Moleküle des Lebens entstehen konnten. Diese auch als Flaschenhälse der Evolution bezeichneten Schritte galten als neue Formen der Entwicklung unter bis dahin nicht relevanten Gesetzmäßigkeiten, wie zum Beispiel in der Biologie nach dem ersten Auftreten von Leben.
Obwohl das Urknallmodell nur auf wenigen Indizien aufbaut ist, ist es unter Naturwissenschaftlern heute zumindest im Grundsatz kaum umstritten. Auch viele christliche Theologen konnten sich überraschend schnell mit diesem Modell anfreunden. Grund dafür dürfte sein, dass der Kosmos aufgrund dieses Modells einen Anfang und vielleicht auch ein Ende hat. Die Naturwissenschaften stoßen damit an Grenzen der Erkenntnis, deren Überschreitung man allein dem Glauben überlassen muss.
Andererseits bringt das Urknallmodell und die folgende kosmische Evolution für den Schöpfungsglauben eine Reihe von Schwierigkeiten. Dazu gehört vor allem, daß der Kosmos auf der Basis von konstant angenommenen Naturgesetzen funktioniert. Einmal initiiert und angestoßen, läuft dabei alles ohne Hilfe und Korrekturen eines Schöpfers weiter. Und das würde eher dem philosophischen Modell des Deismus entsprechen, der sich so diesbezüglich jedoch vom Gottesglauben nicht nur des Christentums unterscheidet und bei dem immer von einem zugunsten des Menschen in die Geschichte eingreifenden Gott ausgegangen wird. Man muss sich auch darüber Klarheit verschaffen, daß die Naturgesetze in einem modernen Schöpfungsglauben nicht eine Konkurrenz zu göttlichem Handeln darstellen, sondern den ursprünglichsten Teil. Eine besondere kosmische Dimension steckt im strukturell nötigen Informationsdefizit des Glaubens. Wäre uns der Schöpfer bekannt, gäbe es nichts zu glauben. So ist aber die Einschätzung der Schöpfung, der Mitgeschöpfe und auch der eigenen Taten freier und mehr von Verantwortung geprägt. Und dabei ist das Religionsprinzip eng mit dem Glauben an Gott verbunden. Der Glaube an einen Gott oder an mehrere Götter gibt den Menschen auch die Kraft den Lebenssinn zu erkennen und sich im Lebensalltag danach zu richten, was sich dann auch in der jeweiligen Religion niederschlägt. Eine typische Frage in Rahmen eines Religionsprinzips wäre: Wie muss ein Kosmos aussehen und angelegt sein, daß die Existenz des Schöpfers für entstehende Geschöpfe nicht beweisbar bleibt? Einige Konsequenzen folgten, etwa daß der Anfang des Kosmos keine eindeutig auf den Schöpfer zurückführbare Eigenarten besitzt und es keine später beweisbaren, direkten Eingriffe des Schöpfers in den kosmischen Evolutionsprozess erfolgen dürfen. Alles, was entsteht, muss sich auf naturgesetzlicher Basis bilden. Naturwissenschaftliche Erkenntnisse müssen immer auch areligiöse Erklärungsmuster zulassen, wie zum Beispiel die sogenannte Vielweltentheorie. Deren quantenmechanische Interpretation sagt aus, daß alle möglichen unterschiedlichen Vergangenheiten des Universums tatsächlich existieren. Und zu jedem Zeitpunkt teilt sich das Universum in eine Vielzahl von Existenzen auf, in denen jeder mögliche Ausgang jedes Quantenprozesses stattfindet. In der modernen Physik wird das etwas anders und einfacher ausgedrückt: Unser Universum wurde möglicherweise zusammen mit einer unendlichen Anzahl von anderen Universen geboren. Der uns bekannte Kosmos ist demnach nur ein sehr geringfügiger Teil eines viel größeren Multiversums, das aus vielen Parallelwelten besteht. Denkbar ist auch, daß eine Schöpfung, in der selbstverantwortliche Geschöpfe entstehen sollen, gar nicht ohne vergleichbare Größe und Komplexität des Kosmos sowie Dauer und Zufälligkeit eines Evolutionsprozesses, wie der, der unser Universum geformt hat, auskommen kann. Religion ist ein auf die Personen, die auf der Erde leben, ausgerichtetes Phänomen. Die Basis der personalen Struktur des Menschen ist ein mit der Evolution individuell im Großhirn ausgebildeter innerer Kosmos aus gespeicherten Bildern und von unabhängig ablaufenden Gedankenmustern.
Christlicher Schöpfungsglaube
Ich befasste mich gerade mit dem Schöpfungsglauben und der damit in der Theologie des Alten Testaments häufig gestellten Frage: Wie ist es möglich, daß ein gerechter Gott es duldet, daß guten Menschen etwas Böses widerfahren kann. Und das ist auch für viele Menschen, vor allem des Abendlandes, eine klassische Frage der christlichen Theologie nach der diesbezüglichen Rechtfertigung Gottes, eine Frage, die sich besonders auch auftut, wenn man vielleicht die Schrecken des Holocausts erlebte oder anderweitig vor Augen hat.
Just in diesem Moment erhielt ich von einem Kollegen der Naturwissenschaft einen aktuellen Hinweis zu diesem Thema, das auch den religionstheoretisch bedeutenden Begriff der Unendlichkeit einschließt und das nicht nur in der Naturwissenschaft, sondern auch in der Philosophie und Theologie, also interdisziplinär ist [6]. Der Hinweis beinhaltet ein Paper über das Religionsprinzip des Kosmos - die Evolutionstheorie und das Handeln Gottes. Inhalte dieses Artikels sind beispielsweise die „Bewegungsparadoxien des Zenon von Elea“ und Kants „Erste Antimonie“ in seiner „Kritik der reinen Vernunft“. Zenon beschäftigte sich in Thesen und Antithesen mit dem Verhältnis von Raum, Zeit und Bewegung, wobei es in seinen Paradoxien auch um die Frage geht, ob die Welt in diskrete Einheiten zerlegbar ist. Die Annahme der Teilbarkeit führt zu dem Problem, daß entweder alles unendlich teilbar ist oder ob es letzte Elementarquanten von Raum und Zeit geben muss. Die Paradoxien konnten für Messungen in der Quantenwelt an der Ludwig-Maximilians-Universität München 1994 bestätigt werden. Das andere Phänomen des Papers, Kants Erkenntniskritik, ist das eindrucksvolle Modell methodischen Vorgehens in der Philosophie mit einem positiven Begriff von Metaphysik, dessen Bedeutung sich vor allem in der Ethik zeigt. Für die Erkenntnis der Welt, wie für die Selbsterkenntnis des Menschen, bleibt dabei die sinnliche Erfahrung unentbehrlich. Unter dem Einfluss von Kants „Kritik der reinen Vernunft“ setzten sich zunehmend Betrachtungsweisen durch, die zwischen den naturwissenschaftlichen, philosophischen und theologischen Denkhorizonten und den damit jeweils verbundenen Kompetenzen unterscheiden. Es wurde deutlich, was die Naturwissenschaften exakt erkennen können, wo die philosophische Reflexion ihren Ort hat, wo die Spekulation anfängt und was Gegenstand des Glaubens ist. Das Realitätsfeld der Naturwissenschaft ist so aufgebaut, daß sich hier die Gottesfrage weder wissenschaftlich stellen, noch wissenschaftlich beantworten lässt. Das eröffnet der Theologie die Möglichkeit, die freie Entwicklung der Naturwissenschaft und der damit verbundenen Erkenntnisfortschritte bewusst zu bejahen. Der Schöpfungsglauben erhebt dabei aber auch den Anspruch auf die Deutung unserer Wirklichkeit. Als Physiker ist mir da natürlich immer bewusst, daß der Schöpfungsglauben mit der menschlichen Lebenswelt, die beide zu dieser Wirklichkeit gehören, unvermeidlich auch auf kosmologische Dimensionen stößt, wo er auch einen Anfang von Raum und Zeit lehrt.