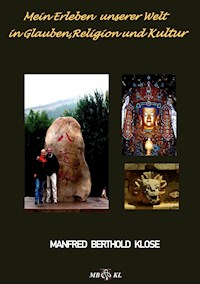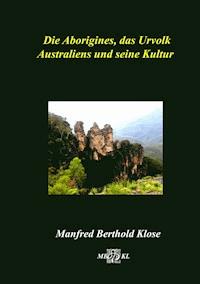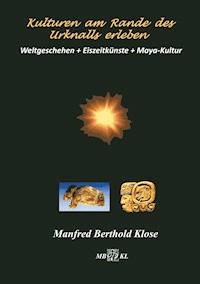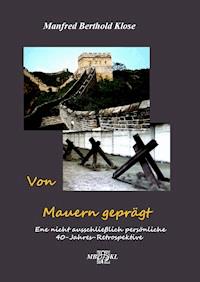
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
In einer mehr als 40-jährigen Retrospektive wird das Leben des in der Nachkriegszeit im Osten Deutschlands aufgewachsenen und später mit seiner Familie dort lebenden Autors aufgezeigt. Leistungsorientiertes Streben mit christlicher Erziehung, Toleranz und Respekt dem Nächsten gegenüber waren dabei wichtige Attribute. Durch Erfolge in Schule, Beruf und Sport für viele im Blickfeld stehend. Intrigante Ränkespiele und Maßregelungen von umgebenden Partei-Karrieristen und SED-Potentaten standen dem häufig entgegen. Oft war es mehr als nur Alltags-Tristesse. Aber letztlich war es doch für den Autor und seine Familie mit der schmerzlichen Erkenntnis verbunden, dass es für sie in diesem Land DDR keine Zukunft gibt. Der Verbleib der Ehefrau bei einem Verwandten-Besuch im westlichen Teil Deutschlands war nur der Folgeschritt, eine Entscheidung, die in gleicher Weise vom Autor getragen wurde. Darüber sowie über die folgenden Probleme und Bemühungen zur Zusammenführung der Familie wird im zentralen Teil des Buches berichtet. Begegnungen an der Berliner Mauer mit Freunden und der zwischenzeitliche Besuch des Autors mit seiner Tochter bei Bekannten in seiner Ursprungsheimat Hindenburg und im nahegelegenen KZ Auschwitz standen fragwürdige Treffen mit den DDR-Ausreise-Anwälten Vogel und Schnur sowie Vertretern der Kirche gegenüber. Die Lesung des Autors zum 50. Jahrestag des Baus der Berliner Mauer in der Polizeihistorischen Sammlung in Berlin beleuchtete das. Dazu die eindringliche Mahnung "Wider das Vergessen" des dabei auch zugegen gewesenen, ehemals beim Mauerfall amtierenden Polizeipräsidenten von Berlin.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 176
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Autor
wurde in Hindenburg in Oberschlesien geboren, wuchs in Thüringen auf, wo er Schule und Studium absolvierte. Als Physiker arbeitete er auf dem Gebiet der Molekül- und Festkörperphysik an Akademie-Einrichtungen der ehemaligen DDR und zeitweilig am Vereinigten Institut für Kernforschung in Dubna bei Moskau. Nach seiner Ausreise war er ca. 20 Jahre am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt auf dem Gebiet der Laserentwicklung und -anwendung für Hochtechnologie und Luftfahrtsicherheit tätig. Das führte ihn zu Vorträgen und Dienstaufenthalten nach Frankreich, den USA, Japan und Australien.
Bei seinem Hobby, weltweit dem Marathon-Lauf nachgehend, verband er die sportliche Aktivität mit der Auseinandersetzung der Kultur des jeweils besuchten Landes. Peru und Inka-Kultur, Mittelamerika und Maya-Kultur sowie Reich der Mitte und buddhistischer Mythos waren dabei dominant.
In Dankbarkeit gewidmet
meiner Frau, die in der Zeit der Antragsstellung zur Ausreise getrennt von ihrer Familie war und alles gab, um mit dieser möglichst bald wieder zusammen zu sein, meiner Tochter und meinem Sohn, die sich dabei auch ganz tapfer verhielten,
Freunden und Bekannten, die uns in dieser für uns schweren Zeit halfen und begleiteten.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Ein nicht ganz normaler Tagesbeginn: Joggen mit Rückerinnerungen
1945 - die Flucht aus Oberschlesien und die Zeit des Neubeginns in Thüringen
Die erste Begegnung mit meinem aus der Kriegsgefangenschaft zurückgekehrten Vater
Die Anfangsjahre und Schulzeit in der neuen Heimat
Mein erster Verwandten-Besuch und die Radtour im westlichen Teil Deutschlands
Die zweite Verwandten-Besuchsreise kurz vor dem Berliner Mauer-Bau
Job-Erlebnisse im Betrieb der „Fast“-Tante
Mauer-Assoziationen beim Joggen: Berliner Mauer und Große Mauer
Die wichtigen Berufsjahre der ersten Dekade und der längerfristige SU-Aufenthalt
Meine Eindrücke während des längerfristigen Aufenthalts am VIK Dubna bei Moskau
Der Verwandten-Besuch meiner Frau, der Ausreise-Antrag und die Zeit kurz davor und danach
Stasi-kontrollierte persönliche Briefe und die Schreiben an den Staatsratsvorsitzenden der DDR
Die persönlichen Unterlagen meiner Frau und ihr sogenanntes staatliches Eigentum
Aktionen der Verzweiflung und Briefe, die Hoffnungen schüren
Die Besuche und Gespräche beim Generalvikar des Bistums Dresden-Meißen und bei den Ausreise-Anwälten Schnur und Vogel
Die unerwartete Hilfe von Bekannten
Die vorerst letzten Reise nach Prag und Kattowitz
Meine Auschwitz-Wahrnehmung
Der Bescheid der genehmigten Ausreise
Die letzten Aktivitäten vor der Ausreise
Der Tag der Ausreise
Das Auffanglager Gießen und der Neustart im „Westen“
Wie wir in unserem neuen Zuhause den Mauerfall erleben
Die Touren zu den nächsten Verwandten und Bekannten unmittelbar nach der Wende
Die China-Reise und der Große Mauer Marathon
Quellenverzeichnis
Vorwort
Es geht auf und ab auf bekannter historischer Strecke, oft auch als Weltwunder bezeichnet. Holprig, aus felsigem Gestein, schlängelt sie sich meist steil und Kilometer entlang dahin. Manchmal muss da auch eine Leiter helfen, um einem den notwendigen Halt zu geben. Vor mir ist die Große Mauer. Für den Lauf hier oben im bergigen Massiv habe ich längere Zeit trainiert. „One World One Dream“, das olympische Motto aus jüngster Zeit, hat mich nicht nur gedanklich begleitet, sondern auch oft zusätzlich stimuliert. Es ist auch hier entlang der Strecke an den Berghängen zu lesen.
Jetzt, nach einigen Stunden Laufen, fühle ich mich in einer Art Trance-Zustand. Und ich habe auch Glück. Das Wetter meint es an diesem September-Tag sehr gut mit uns, die wir diesen Bergrücken bewältigen wollen. Noch gestern war das nicht so. Da regnete es heftig. Die Strecke war da kaum passierbar. Jetzt Sonnenschein und ein traumhafter Blick in die Ferne. Ich habe mittlerweile gelernt, da meinen Gedanken freien Lauf zu lassen. Nun kann ich träumen von der Verbotenen Stadt, den heiligen Stätten Huashan und Lhasa. Und ich habe da auch inzwischen einen geschärften Blick für die dort anstehenden Probleme. Ich bin schweißtriefend, ab und an begegnet mich auf diesem Pfad ein streifender lächelnder Blick eines Mitstreiters, der aufrütteln und Mut machen soll: „Du schaffst es.“
Vergleiche aus der Vergangenheit und auch vorausgegangenen Läufen drängen sich auf. Träume aus Jugendzeit und Studium, auch solche aus dem Berufsleben werden wach, auch Erinnerungen, ausgelöst durch die selbst erlebten Niederschlagungen des 17. Juni 1953 oder des Prager Frühlings 15 Jahre später. Der Mauer-Bau 1961 mit den zahlreichen menschlichen Tragödien und Negativ-Eindrücken reiht sich da ein. Die sich anschließende Zeit, ein ähnliches holpriges Auf und Ab, häufig für mich auf schmalem Pfad wie eine Gratwanderung. Freunde und Bekannte geben oftmals Unterstützung und Halt wie diese Leitern auf der Strecke, an den Wach- oder Feuertürmen.
Dienstliche Aufenthalte in Prag und Moskau sowie private Besuche in der ursprünglichen Heimat - einschließlich im KZ Auschwitz – schärfen meinen Blick zusätzlich für die jeweilige Situation. Es ist der Blick eines durch die Mauern Geprägten, mit einem Ausdruck von Mut und Hoffnung, wissend: Mauern, welcher Art sie auch immer sind und wo sie auch immer stehen mögen, sie können überwunden werden.
Ein nicht ganz normaler Tagesbeginn: Joggen mit Rückerinnerungen
Ein kühler Morgen ist heute. Ich bin unterwegs auf meiner Fitness-Lauf-Hausstrecke, meist Waldweg, beginnend nur wenige Meter von meiner Wohnung entfernt. Der Tag ist gerade erst angebrochen. Es ist noch dämmrig, der Himmel leicht bedeckt. Ich habe den Schlaf noch in den Augen. Meine Vorbereitung für den Marathon auf der Großen Mauer hat begonnen. Ich habe im Moment einen höllischen Respekt vor den dabei auftretenden Schwierigkeiten, vor den 18.000 Stufen unterschiedlicher Höhe und Breite und den 1.600 Höhenmetern, die zu absolvieren sind - und das bei möglicherweise Regen oder auch Temperaturen von etwa 30°C.
Der heutige nahezu 10 km lange Weg ist leicht vereist und Schnee-bedeckt, ebenso wie die etwa 200 Stufen der Weinbergstaffel in seinem mittleren Abschnitt und die ca. 80 Stufen zur Karlshöhe am Umkehrpunkt dieser Laufstrecke. Ich muss höllisch aufpassen, damit ich nicht stürze.
Kurz zuvor noch ein Telefongespräch mit meiner „großen“, nicht ganz vier Jahre älteren Schwester. Sie erinnert mich daran, dass heute am 21. Januar vor 43 Jahren „unsere Flucht“ von Hindenburg /Oberschlesien aus begann.
1945 - die Flucht aus Oberschlesien und die Zeit des Neubeginns in Thüringen
Es war Krieg, und die Bewohner Hindenburgs, mussten diese meine Geburtsstadt, am Morgen des 21. Januars 1945 verlassen, die dort noch lebenden Männer mussten zum Volkssturm, die verbleibenden Frauen und Kinder sollten sich 10 Uhr morgens am Stadt-Bahnhof treffen. Nur ein vorübergehendes Verlassen des Heimatortes sollte es sein, einige Wochen vielleicht, nicht mehr. Der Vater, der zuvor kurzzeitig zum Fronturlaub nach Hause gekommen war, gab uns noch auf den Weg, alle wichtigen Papiere an uns zu nehmen und möglichst immer zusammen zu bleiben. Egal, was passiert. Dazu und für alle Fälle noch die Adresse von Onkel P., einer der insgesamt neun Geschwister meines Vaters, der in Adorf im Vogtland lebte, als eventuelle Zufluchtsstätte.
Nur mit dem Notwendigsten ausgestattet und in einer Art Güterwagen auf engstem Raum untergebracht, ging es die folgenden 5 Tage und 5 Nächte westwärts. Nur der Umstand, dass unsere Mutter einer Mitreisenden, die die Strapazen der langen Fahrt nicht mehr aushalten konnte, helfen wollte, veranlasste uns, in Bautzen auszusteigen, um etwas später weiter nach Nossen „transportiert“ zu werden. Wir erfuhren, dass der von uns verlassene Zug kurze Zeit später von Tieffliegern bombardiert worden ist. Und nur wenige Tage darauf, am 13. Februar, sahen wir von hier aus dann den von Phosphorbomben rot leuchteten Himmel des nur wenige 10 km entfernten Dresdens.
Während die meisten Flüchtlinge aus Oberschlesien - und so auch unsere Verwandten - weiter westlich befördert wurden, sind wir schließlich über Adorf im Vogtland nach Schwarza in Thüringen umgeleitet worden. Keiner hatte zu diesem Zeitpunkt geglaubt, dass wir hier lange bleiben würden, schon gar nicht, dass hier unsere neue Heimat - für 30 Jahre und mehr - sein sollte. Und auch keiner der Ortseingesessenen glaubte, dass wir, die „armen Luder“ aus den oberschlesischen Ostgebieten, uns hier irgendwie durchbeißen würden und das auch könnten. Glücklicherweise bestätigten auch hier, wie so oft im Leben, Ausnahmen die Regel.
Unsere Mutter konnte, dank ihrer Schneiderkünste, vor allem bei und für Bauern arbeiten und so Brot und Milch heranschaffen. Dadurch war es möglich, dass ich, der nachts des Öfteren vor Hunger nicht schlafen konnte, dann wenigstens eine Scheibe Brot bekommen konnte. Und das geschah dann meist unter der Bettdecke, wo das Brot bereits unmerklich aufbewahrt war und um sicher zu sein, dass es die Geschwister nicht bemerken konnten.
Wir wohnten da - zumindest die ersten Jahre - in einem einzigen großen Raum eines älteren Zweifamilienhauses, parterre und nasskalt, mit einem Kamin, der eigentlich gar nicht geheizt werden konnte. Die Milch für meine gerade nicht einmal ein Jahr alte Schwester, konnte so nur an der Deckenlampe ein wenig aufgewärmt werden.
Ich sehe heute noch ihre erwartungsvollen Augen, wenn Mutti mit der Milchflasche sich ihr näherte. Was war da schon mein Hunger dagegen. Ich konnte mir ja wenigstens nächtliche schlaflose Stunden damit vertreiben, dass ich dann in den an meinem Bett angrenzenden Wandputz aus meist nassen krümeligen Sand und Kalk mit meinen Fingern Löcher bohrte und dieser sich dann in meinem Schlafgemach verschiedenen Orts wiederfand.
Meine drei Jahre jüngere geliebte kleine Schwester - ich sehe sie noch heute, wie ein Engel, oft strahlend, in ihrem kleinen Bettchen liegend - konnte aber diese harte Zeit, in der es keine weitere Hilfe gab, nicht überstehen. Es gab keinen Arzt oder eine Möglichkeit einer medizinischen Betreuung, und sie starb noch vor ihrem ersten Geburtstag an Lungenentzündung und körperlicher Schwäche.
Bei diesem Rückblick habe ich vor mir auch das Bild, das sich tief in meiner Erinnerung eingegraben hatte. Es war einige Jahre später, im Jahre 1949. Straßen-Fußball war wie so oft angesagt. Der machte uns viel Spaß. Außer einem Ball - gleich welcher Art, aus Gummi oder Igelit - war da nichts weiter nötig. Die Bordsteinkante war die natürliche Begrenzung. Aber außer dem Ball hatte es uns an diesem Tag vor allem ein Baum vor dem Hause, nicht einmal 50 m von dem unsrigen entfernt, angetan. Seine Zweige - voll beladen mit kräftigen Herzkirschen - hingen teilweise geradezu aufreizend über den Gartenzaun des Hauses, einer kleinen Villa ähnelnd. Und Appetit und Hunger nach dem Spiel pochten auf ihr Recht, und ich kletterte auf den Zaun und bediente mich so viel und so gut ich es nur konnte. Die verbotenen Früchte waren Labsal für den leeren Magen. Der Besitzer sah diesen Akt vom Parterre-Fenster aus, aber nicht gerade mit Freuden und deutete an, uns zu verscheuchen und die Polizei zu alarmieren. Und schleunigst und auch ängstlich machte ich mich sodann auf den Weg nach Hause.
Die erste Begegnung mit meinem aus der Kriegsgefangenschaft zurückgekehrten Vater
Gerade war ich zu Hause angekommen, stand noch vor der Eingangstür. Just, in diesem Moment hörte ich eindringliche Rufe hinter mir. Es war die Stimme eines hageren Mannes. Ich drehte mich um und sah ihn, am Gartentor stehend, nur drei Meter hinter mir, in uniformähnlicher graugrüner Kleidung. Ich erschrak und hatte Angst, denn ich vermutete, jemanden von der Polizei bereits im Nacken zu haben. Ich hörte ihn, meinen Namen rufend, und ich brauchte noch etwas Zeit, um das richtig zu erfassen.
Es war mein aus russischer Gefangenschaft zurückgekehrter Vater. So richtig wahrgenommen hatte ich das aber erst nach seinem Eintreten in unsere Wohnung. Mutti hatte ja lange auf diesen Tag gewartet. Nun war er Wirklichkeit geworden. Sie umsorgte ihn. Ein gutes Essen war zunächst das Wichtigste. Dazu gehörten auch die von mir tags zuvor mühevoll gesammelten Blaubeeren. Ich selbst hatte davon noch keine einzige angerührt, wollte sie ja verkaufen, ein Liter für eine Mark, und jede Beere war deshalb für mich kostbar. 350 Mark sollten es am Ende werden. Der Preis für ein einfaches Fahrrad, natürlich ohne Gangschaltung.
Nun war aber von den gesammelten Beeren nicht mehr viel übrig geblieben. Ich hatte zwar mitgefühlt mit meinem Vater, und glaubte dabei, dass er wohl viel Schlimmes erlebt haben musste. Trotzdem aber schmeckte mir gar nicht so recht, dass in wenigen Minuten mein Tagesverdienst verschwunden war. Über das Schlimme, das ich vermutete, habe ich auch später nie etwas erfahren können. Und da ging es mir so wie vielen anderen meinesgleichen. Ihre Väter, die ich kannte und die aus russischer Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt waren, waren von dieser Zeit psychisch derart gekennzeichnet, dass sie darüber nicht sprechen wollten und das vielleicht auch gar nicht konnten.
Die Anfangsjahre und Schulzeit in der neuen Heimat
Die Anfangsjahre in dem durch seine Zellwolle-Produktion bekannten Schwarza und später auch im vor allem durch Schiller bekannten benachbarten Rudolstadt waren nicht ganz einfach.
Der Vater, Lehrer von Beruf, jetzt als Chemiefacharbeiter in der Konditionierung des Zellwolle-Betriebs und die Mutter im gleichen Betrieb als Schneiderin tätig, verdienten nicht gerade viel. Das Geld reichte gerade dafür, uns drei Kinder zu ernähren und die notwendigen Dinge für den Haushalt zu kaufen. Kindergeld gab es damals nicht. Möbel, Schuhe oder Kleidung zu kaufen, war fast undenkbar. Letzteres hat dann unsere Mutter aus Stoffen, die sie billig einkaufte oder geschenkt bekam, geschneidert. Ob es Hosen, Jacken, Kleider oder Mäntel waren, alles war wunderschön und passend gemacht und sah dann auch wunderbar aus. Selbst die Unterwäsche für uns Kinder hat sie genäht, und zwar aus Stoffen, die aus der sogenannten Abteilung „Tragversuche“ des Betriebs billig erworben werden konnten. Noch als Student habe ich so meine Unterwäsche bezogen. In meiner gesamten Grundschulzeit hatte ich da wohl nur ein Paar Schuhe und einen Anzug, Sachen, auf die lange gespart wurde und die anlässlich meiner 1. Heiligen Kommunion schließlich gekauft worden. Und das änderte sich in den folgenden Jahren kaum. Dabei empfand ich nie etwas zu vermissen. Anderes war mir viel wichtiger: Sich mit Freunden zu treffen, mit Freunden zusammen zu sein, etwas Vernünftiges zu tun.
Zu Hause hatten wir natürlich keinen Fernseher, TV gab es ja damals noch nicht, und als Radio hatten wir auch nur einen kleinen Volksempfänger, der aber für alles Wesentliche, vor allem Musik und die Nachrichten, ausreichte. Deshalb war es etwas Besonderes, wenn man ins Kino gehen konnte. Das Geld dafür - 50 Pfennig, das war auch mein wöchentliches Taschengeld - bekam ich, wenn ich meine wöchentliche Pflicht, das Straßenkehren, erledigt hatte, dazu gehörte auch das Reinigen der Gehwege im angrenzenden Garten.
Das Kino im Ort war so ein begehrenswerter Ort für mich. Ich traf mich dort mit Freunden, mit denen ich am Wochenende, anfangs am Samstagnachmittag, später am Sonntag, unmittelbar nachdem ich zusammen mit ihnen zuvor in der Fußballmannschaft der dortigen Betriebssportgemeinschaft gekickt hatte.
Das Kino war auch für viele andere ein beliebtes Ziel, so auch für die Eltern, meine Eltern, die dort gern einmal in 14 Tagen oder im Monat eine interessante Abendvorstellung erleben wollten.
Ich lernte es, mit dem Wenigen, was ich hatte, optimal umzugehen, trieb viel Sport, zeichnete zusammen mit anderen in einem Schulzirkel, sang gelegentlich im Schulchor und las viel. Meist dabei ein bestimmtes Ziel vor Augen, ein Ziel, etwas Besonderes zu erreichen. Mein positives Umfeld spielte da eine nicht unwesentliche Rolle.
Möglicherweise war da auch die vor allem durch meinen Vater bestimmte christliche Erziehung vorteilhaft. Sie war von einer sehr leistungsorientierten und kritischen Denkweise begleitet. Da gab es keine langen Diskussionen. Das, was mein Vater wollte, mussten wir Kinder ihm von den Augen ablesen. Ich habe mich dabei oft, richtiger gesagt, eigentlich immer, hinterfragt, und das geschah dann auch ganz spontan: “Ist das so auch wirklich alles richtig?“ Heute würde man sicherlich manches nicht gut heißen. Erstaunlicherweise aber entwickelt sich trotz alledem und parallel dazu, fast unbemerkt, eine selbstkritische Vorgehensweise in meiner Bewertung, zu dem, was ich tat. Und, obgleich es wie ein Widerspruch zum Vorhergenannten anmutet, bildete sich so bei mir ein starkes Selbstbewusstsein aus. Die Folge davon war meine kritische Haltung beispielsweise zu den nur „Ja-Sagern“, die, wie fast alle meine Mitschüler, Mitglied der Pionierorganisation waren. In diese Organisation einzutreten, war aber so für mich indiskutabel. Die meisten waren ja dort auch nur Mitglied, weil es der allgemeine Trend war.
Und Gleiches galt natürlich auch hinsichtlich der damals „ins Leben gerufenen“ Jugendweihe. Ich stand ihr mit Distanz gegenüber, trotz der Tatsache, dass sie nach und nach zu einer kaum wegzudenkenden Veranstaltung wurde, ja eigentlich fast zu einem Fest für die jeweilige ganze Familie.
Ein bisschen war ich da wohl auch stolz auf meinen eigenen, meist von der Masse etwas abweichenden Standpunkt. Die strenge christliche Erziehung spielte sicherlich auch da eine nicht unwesentliche Rolle. Heute muss ich aber korrekterweise hinzufügen: Meine Emotionalität überwog dabei in meiner Verhaltensweise doch häufig die Rationalität. Nur mein Stolz verhinderte oft das auch nach außen kundzutun.
Später - mit dem Erleben des Arbeiteraufstands am 17. Juni 1953 in der damaligen DDR und mit dem Verfolgen der Revolution in Ungarn 1956 - vor allem aber mit dem Berliner Mauer-Bau, wich einstige Emotionalität dem klaren bewussten Standpunkt. Und die an mich - insbesondere nach dem Studium - mehrmals empfohlene und herangetragene und gewünschte Partei-Mitgliedschaft kam da meinerseits überhaupt nicht in Frage. Das, im Gegensatz zu vielen anderen Kollegen meines Umfelds, die in dem DDR-Machtapparat nicht ausgegrenzt sein wollten und die um ihre Karriere besorgt waren.
Vielleicht war das aber gerade der Grund, weshalb ich von vielen geschätzt wurde, was damals aber meist nicht ausgesprochen wurde und weshalb ich so einen sehr intakten Freundeskreis um mich herum hatte. Jeder von ihm schätzte den anderen und wusste, dass er sich auf ihn 100%ig verlassen konnte. So war dieser vertraute Kreis gleichzeitig Schutz und gab mir persönlich auch die Lockerheit, die ich brauchte. So jedenfalls meine heutige Sicht.
Vor allem: Kein Pionier, aber Ministrant in der katholischen Kirche zu sein, all das passte nicht so recht in die Vorstellungswelt einer sozialistischen Bildung und Erziehung. Und trotz der Tatsache, dass ich - wie mir aus Lehrer-Kreisen später mitgeteilt wurde - einen Zeugnisspiegel mit nur einer Zwei als schlechtester Note in den 8 Jahren Grundschule wie kein anderer vor und nach mir in dieser Region besaß, wurde durch die zuständigen Verantwortlichen der Volksbildung des Kreises Rudolstadt eine Entscheidung getroffen, wonach für mich der Besuch der damaligen Oberschule, dem heutigen Gymnasium, nicht möglich sein sollte. Nur dem folgenden geschlossenen Protest der gesamten Schwarzaer Lehrerschaft und der Verpflichtung meines Vaters, wieder als Lehrer tätig zu sein, war es zu verdanken, dass dieser Beschluss revidiert wurde.
Zu dieser Situation trug ich aber möglicherweise auch etwas selbst bei. Fast regelmäßig arbeitete ich recht engagiert während der Schulferien in der Betriebsschlosserei des benachbarten Betriebs Zellwolle. Hier hatte ich vor allem Motoren zu säubern, und baute sie danach mit den seit Jahren dort tätigen Kollegen auch wieder in die jeweiligen Maschinenaggregate ein. Ich verdiente so etwas Geld, um mir dann den einen oder anderer Wunsch erfüllen zu können.
Vielleicht hatte ich auch einmal gesagt, dass mir diese Arbeit als Betriebsschlosser Spaß macht und ich mir so einen Beruf auch vorstellen könnte. Offenbar stand so etwas im Raum und vielleicht haben das andere zu hören bekommen. Für manche in der Volksbildung war das dann natürlich auch willkommen bei ihrer Propaganda hinsichtlich einer unmittelbaren Berufsausbildung nach der Grundschulzeit in einem örtlichen Betrieb und damit Grund und Rechtfertigung für die genannte Ablehnung. Ich selbst konnte das allerdings nicht fassen, denn ich konnte mich nicht erinnern, dass ich mich irgendwann einmal in dieser Richtung beworben hätte. Die Oberschule nicht besuchen zu können, war für mich jedenfalls nicht vorstellbar.
In die folgende Oberschulzeit fielen auch die gemeinsamen Ernteeinsätze der Schüler in den Sommerferien, an die man sich noch heute bei gelegentlichen Treffen gern erinnert, aber auch meine Reise der „besonderen Art“ im Sommer 1957 in den westlichen Teil der Bundesrepublik Deutschland. Von den Behörden wurde von Reisen dieser Art abgeraten. Grund dafür war vor allem die sogenannte schädliche Propaganda des dortigen Kaiser-Ministeri ums. Es würde mit der Vergabe von Gutscheinen vor allem für einen Verbleib der Jugendlichen im westlichen Teil Deutschlands werben. So die gängige Begründung. In der Tat konnten von den Besuchern aus der DDR solche Gutscheine - 100 Stück im Werte von je 50 Pfennig - erworben werden, um damit bei Touren die Übernachtungen und das Essen in Jugendherbergen bezahlen zu können.
Mein erster Verwandten-Besuch und die Radtour im westlichen Teil Deutschlands
Der Tag der Abreise dieser „Reise der besonderen Art“ war langersehnt. Ich war bislang noch nie verreist, weder mit meinen Eltern oder meinen Geschwistern, noch allein, weder in Form einer Urlaubsreise, noch anderweitig. Umso mehr war ich deshalb nun gespannt auf all das, was mich bei dieser Reise erwartet. Es sollte zur Familie meines Onkels Jorg ins Ruhrgebiet gehen, einem der sechs Geschwister meiner Mutter.
Dieser Onkel machte nach seinem Ausscheiden aus der russischen Gefangenschaft kurzzeitig bei uns in Schwarza einen Zwischenaufenthalt, um von hier aus dann nach einer Woche die Weiterreise zu seiner Familie ins Ruhrgebiet anzutreten und um dann dort, wie die Jahre zuvor in Oberschlesien, untertage im Steinkohlenbergbau zu arbeiten.
Ich erinnere mich wie er begeistert war, wenn er mit mir zusammen die künstliche Leberwurst aß, die einzige Wurst, die wir uns damals kaufen konnten. Und sie schmeckte uns natürlich vorzüglich. An andere Wurst und vielleicht sogar Fleisch oder ähnliches war ja gar nicht zu denken.