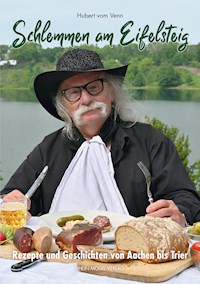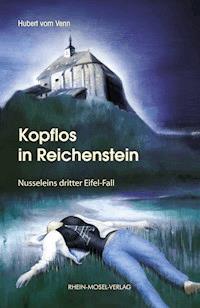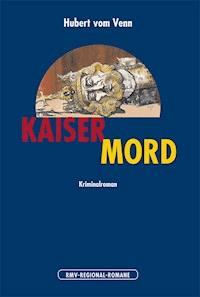Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Rhein-Mosel-Vlg
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Warum muß man eigentlich in Düsseldorf leben, zumal die Altersversorgung gesichert ist? Also machten sich die Protagonisten auf in die Provence, um sich dort ein Haus zu kaufen. Doch sie kamen nicht weit, da sie sich in ein Eifler Bauernhaus verliebten. Nach einem ersten Jahr zieht man Bilanz - über ein ganz eigenes Völkchen, über Sitten und Unsitten, über Essen und Trinken, über Gott und die Welt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 216
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© 2001 eBook-Ausgabe 2011RHEIN-MOSEL-VERLAGBrandenburg 17, D-56856 Zell/Mosel Tel. 06542/5151, Fax 06542/61158 Alle Rechte vorbehalten ISBN: 978-3-89801-793-0 Umschlagaquarell: Alfred Holler Mit freundlicher Genehmigung der Kunstsammlung der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens
Hubert vom Venn
Mein Jahr in der Eifel
Rhein-Mosel-Verlag
– Für Ena und Katharina –
Roetgen/La Grande Motte im Sommer 2001
EINFÜHRUNG
Der Rhein hatte seine Schuldigkeit getan.
Unsere Tochter Katharina war aus dem Haus, hatte – obwohl sie Psychologin ist – einen Banker namens Sascha geheiratet und meine Frau und mich mit Sandra und Caroline zu Großeltern gemacht. Lebens-, Rentenversicherungen und Sparverträge hatten darüber hinaus ihren Job getan.
Was sollten wir da noch in Düsseldorf?
Mein Frau erwischte mich mit einem überraschend geschossenen »Ein Haus in der Provence kaufen« auf dem falschen Fuß – einfach so in den Tag hinein gesprochen. Der Grund für ihren Entschluss lag auf der Nachttisch-Kommode: Irgend ein Engländer hatte taschenbuchgenau die pastisgeschwängerten Vorteile des Lebens in Frankreichs Süden geschildert: Essen, Trinken, unzuverlässige Handwerker.
Da halfen auch meine Vorurteile gegen englische Autoren nicht. Ich rief meiner Frau die Aussteigerbibel ›Leben auf dem Lande‹ in Erinnerung – eine bunte Schwarte, die in den siebziger Jahren in keiner Wohngemeinschaft fehlen durfte. Das Buch war, wie einige Aufs-Land-Übersiedler schnell feststellten, allerdings nur für ein Landleben unter der Leselampe geeignet.
Das Kapitel ›So halte ich eine Kuh auf 32 Quadratmetern‹ hatte damals dafür gesorgt, dass die Kuh unserer Freunde fast in der eigenen Jauche ertrunken wäre. Auch die übrigen Tipps waren meist nur für Papiertiger, pardon: Papierlandwirte nützlich.
Meine Frau ging darüber hinweg. Ich nicht:
»Denk an die Hitze, in jedem Warenhaus kann man keine fünf Sekunden stehen, weil immer einer ›Pardon‹ sagt und einen zur Seite schiebt. Und dann liegen überall in der schönsten Natur ›Vittel‹-Flaschen rum, und ein Duft von Melone-im-Mülleimer begleitet einen dauernd.«
Ich glaube, ich habe gegen die Wand geredet.
Wenig später hatte meine Frau – ich kann das ja nicht – mit einem Internet-Routenplaner den Weg via Eifel und Saarland in die Provence gesucht und gefunden: Düsseldorf – Aix-en-Provence.
Und ich? Ich hatte einfach keine Termine mehr, die ich vorschieben konnte, zumal die Koffer zwei Stunden später gepackt waren.
»Lass uns doch direkt auf die Autobahn gehen und nicht durch diese Eifel schleichen.«
Meine Frau winkte ab. Eine Freundin in Prüm, »seit Jahren nicht gesehen, viele gemeinsame Erinnerungen«, wollte sie kurz ansteuern:
»Wenn wir sowieso schon in der Nähe sind.«
Wieder halfen meine Einwände nicht:
»Bei Prüm und Provence kann man nicht unbedingt von Nähe sprechen. Nach Prüm können wir doch später auch mal so fahren.«
»Du bist einfach nicht flexibel!«
Wir sollten Prüm nie erreichen.
Der Grund lag kurz hinter Monschau. Der Routenplaner hatte bei seiner Planung Düsseldorf, Prüm, Montelimar und Aix-en-Provence kurz hinter Monschau eine Abkürzung über Belgien ausgemacht.
Der Weg führte über Kalterherberg, ein Ort, den ich damals durch Rekord-Minustemperaturen aus dem Wetterbericht kannte. An einem Junimorgen hatte Kachelmann stolz von Bodenfrost im Morgengrauen berichtet.
Meine Frau verliebte sich in das Grauen – genauer: in eine belgienumzingelte Enklave. Uns traf nämlich der Nationalschlag, als wir hinter der Grenze belgische Schilder ausmachten, dann aber bei einem Blick in eine Seitenstraße das dottergelbe deutsche Ortsschild ›Monschau – Stadtteil Leyhof‹ sahen. Diese Grenzverwirrung wollte meine Frau sich ansehen.
In Leyhof waren die Menschen offensichtlich international gestimmt – auf jeden Fall verkündete das Schild vor einem Fachwerk-Bauernhof ›A vendre – Zu verkaufen‹. Auskunft über das Gemäuer versprach das Schild in einem belgischen Lebensmittelgeschäft, gleich um die Ecke.
Johanna war das Geschäft!
Sie war Chefin, Verkäuferin, Lagerbeauftragte und örtliche Anlaufstelle für Informationssuchende aus beiden Ländern, wo die Grenze verrückt spielte. Als Belgierin las sie die lokale belgische und eine lokale deutsche Zeitung – ihr Informationsvorsprung war dadurch immens.
Sie schloss ihren Laden einfach ab: ›Bin gleich wieder zurück‹ verkündete eine Pappe einsprachig.
Meine Frau und ich verliebten uns gleichzeitig in ein Eifeler Bauernhaus, das Johanna uns mit maklerfreiem Unterton anpries. Bis auf ein paar Schönheitsoperationen war das Haus bezugsfertig, uns drohten also nur wenige Handwerker.
Johanna, die wir noch lieben lernen sollten, machte uns schnell klar, dass sie mit dem Haus »nix zu tun« habe. Sie hatte nur vom Besitzer, einem Zahnarzt aus Köln, der nach nur einem Jahr eifelmüde geworden war, die Schlüssel bekommen:
»Die Eifel war nix für den, aber sonst ist er ganz nett.«
Die Provence und die Freundin in Prüm mussten warten. Sie warten übrigens heute noch.
Nach einem Telefonat mit dem eifelmüden Zahnarzt aus Köln rückte dieser schon zwei Stunden später im Zweisitzer an. Wir wurden uns schnell preis- und notariatseinig, und vier Wochen später gehörte uns kein Haus im sonnigen Süden, sondern ein Eifelhaus im Ortsteil eines Dorfs, das das Kalte schon im Namen führt.
Nachdem wir Düsseldorf aufgelöst hatten, zogen wir Anfang Dezember in Leyhof ein.
Von Johanna wussten wir, dass wir keine Chance hatten, wenigstens was unsere historische Einordnung ins Dorfleben betraf. Natürlich, erklärte sie mir, sei es möglich, dass ich »da drüben in Deutschland«, zu dem unsere Insel in Belgien immerhin gehört, Bürgermeister oder Abgeordneter werden könnte. Ja, man würde mich vielleicht sogar auch Schützenkönig werden lassen – trotzdem würde ich auch nach vierzig Jahren noch »ne Frömme«, ein Fremder, sein.
Meine Frau druckte kleine Zettel und steckte sie in einem Radius von zwei Kilometern in belgische und deutsche Briefkästen.
Viele kamen, häuften Geschenke zum Einzug an, erklärten uns frank und frei, dass die Zeiten sich geändert, man sich an die Neubürger schon lange gewöhnt habe und betonten, dass wir die ersten seien, die sich direkt ›vorgestellt‹ hätten.
Das klang nach einem Punktsieg, das ließ auf Zukunft hoffen. Von der Provence sprach keiner – besser: meine Frau – mehr. Als ich die Bücher einräumte, bemerkte ich, ohne es lauthals rauszuschreien, dass die Bücher dieses Engländers offensichtlich in der Kiste gewesen sind, die wir beim Wegzug dem Düsseldorfer Kindergarten für den nächsten Flohmarkt geschenkt hatten.
Es war Winter, es war Nebel, es war kalt, es war Eifel – schlimmer hätte es nicht kommen können. Doch meine Frau und ich lieben es.
JANUAR
Den ersten Silvesterabend, so hatte ich es mir erträumt, wollte ich mit meiner Frau alleine vor dem offenen Kamin oder auf der Ofenbank des Kachelofens verbringen. Immerhin konnten wir uns zum ersten Male im Leben an solchen Einrichtungen erfreuen.
Ich hätte dann die Dramen des vergangenen Jahre noch einmal Revue passieren lassen: Umzug, Nebenkiefernhöhlenentzündung, Marmeladenbrot auf die falsche Seite gefallen und Schwiegermutter bei bester Gesundheit.
Doch schon auf den Wetterbericht konnte ich mich nicht verlassen. Den blauen, niederschlagsfreien Sonnentag in der Eifel habe ich in Form von acht Zentimeter Neuschnee mit einem Handfeger vom Wagen gekehrt. Als meine Frau mich mit »Du hast ja schöne rote Wangen« nach dreißig Jahren Ehe immer noch erröten ließ, wollte ich schnell ablenken und schimpfte nicht gerade mit einer intellektuellen Bemerkung über das Wetter:
»Ich glaube, dass die Wetterbeobachter in Paris waren, den Himmel nicht sahen, weil sie in einer bestreikten Metro festsaßen, dann endlich rauskamen und logen: Metro-logen deshalb.«
Meine Frau schaute, als hätte sie in einen faulen Apfel gebissen. Dabei sprach sie ein paar verhängnisvolle Sätze:
»Es haben sich eben ein paar Freunde aus Düsseldorf angesagt!«
Ich schwieg, da ich mich nicht auch im neuen Haus Misanthrop schimpfen lassen wollte
Der ›Sportjahresrückblick‹ im Fernsehen war nicht drin, weil der angekündigte Besuch von Menschen, die ich gerne hinter mir lassen wollte, genauso viel Stress wie in Düsseldorf machte. Als mich in der Badewanne der Karpfen mit seinen rehbraunen Augen anguckte, brachte ich es nicht übers Herz, ihm eins mit dem Nudelholz überzuziehen. Essen könnte ich so ein Tier sowieso nicht. Immerhin hatten wir uns, als ich die Werbezeitung eines belgischen Verlages auf dem Klo las, richtig angefreundet. Ich holte also heimlich den Putzeimer und brachte den Karpfen runter zur Rur.
Meine Frau regte sich zwar furchtbar über die Fischstäbchen auf, die ich noch schnell bei Johanna gekauft hatte. Aber ich fand, dass diese gute Tat in Sachen himmlischen Sünden-Nachlass mindestens bis Karsamstag reichen müsste. Ostern wollte ich nämlich die Kaninchen laufen lassen, die meine Frau bis dahin mit Sicherheit anschaffen würde.
Zuletzt bereitete ich das Bleigießen vor. Ich sage zwar immer »Nur ein Klumpen Schrott!«, aber meine Frau erkennt immer die seltsamsten Dinge:
»Das geht mir jetzt aber nahe. Da ist tatsächlich Uranus mit Venusbeschattung.«
Ich gucke dann immer blöde und denke:
»Nur ein Haufen Schrott«.
In unserem letztes Düsseldorf-Jahr hatte Katharina meinen Wagen zu Schrott gefahren – es scheint also doch was dran zu sein …
Als aus Richtung Düsseldorf noch nicht die drohenden Geräusche nahender Kreativ-Direktoren, Boulevard-Journalisten, Lehrer nebst ihren wahlweise männlichen oder weiblichen Partnern zu hören waren, stöhnte ich in unsere Eifeler Ruhe:
»Weißt du, was ich mir einmal zu Silvester wünsche: ›Dinner for one‹ – nur so.«
Meine Frau schüttelte den Kopf:
»Das kann du doch heute x-mal im Fernsehen haben?«
Von wegen! Acht Düsseldorfer, drei fremde Kinder, Katharina und dieser Sascha mit Sandra und Caroline, (m)eine Schwiegermutter, meine Frau und ich fielen mir zu unserem ersten Silvester in der Eifel auf die Nerven.
Kurzum: Es handelte sich um ein Dinner for 18 …
Fast hätte im Vorfeld der Silvesterplanung meine höfliche Frage »Muss deine Mutter unbedingt auch noch kommen?« zu einem ersten Streit im neuen Haus geführt.
Meine Frau wollte nämlich, dass wir sogar zu Silvester wieder das Geschenke-Füllhorn öffneten.
»Was schenken wir eigentlich meiner Mutter zu Neujahr?«, rief diese Mutter Theresa der Geschenkartikel, als ich gerade in unserer Sickergrube achtzehn Flaschen Waldbeer-, Kirsch-, Stachelbeer- und Blumenkohl-Aufgesetzten entsorgte, die die Verwandtschaft (meist von ihrer Seite) mir geschenkt hatte.
»Deiner Mutter zu Neujahr, deiner Mutter zu Neujahr«, polterte ich gleich los:
»Das sind noch rund drei Tage. Wer weiß, ob die dann überhaupt noch lebt!«
Eine Stunde hat meine Frau nicht mit mir gesprochen. Ich habe dann in der Küche zu einem großen Vortrag über die Geschenk-Unsitten angehoben, der von meiner Frau mehrmals mit einem Fingertocken an die Stirn gestört wurde.
»Sei doch mal ehrlich! Das ganze Geschenktheater wird doch gewaltig übertrieben. Früher gab es Geschenke zu Weihnachten, ein paar Süßigkeiten zu Nikolaus und Ostern, einen Weckmann zu St. Martin – Geburtstag, Namenstag und Feierabend. Und wenn man das frühe Glück einer evangelischen Geburt hatte, noch nicht einmal etwas zum Namenstag. Und heute? Schon zu St. Martin müssen die ersten Gänse ihr junges, polnisches Leben lassen, zu Nikolaus und Ostern nehmen die Geschenke schon Heiligabend-Charakter an und Weihnachten selbst fährt man mit einem Tieflader voller Verpacktem vor. Doch damit nicht genug! Kein Mensch wusste vor dreißig Jahren, dass man sich zu so ’was wie Hochzeitstag auch noch beschenken muss, und ahnte vor zwanzig Jahren auch nicht, dass es einen Valentinstag gibt. Bis heute ist mir nicht klar, was ein Münchener Komiker mit dem Verliebtsein zu tun hat … Neu in der Reihe der Tage, zu denen man anderen Leuten sein Geld hinterher schmeißen muss, ist seit diesem Jahr der Halloween-Tag, an dem Nachbarn und – !!!natürlich!!! – Verwandte einem die Kellerbar leersaufen. Den ›Heute-kommt-der-Primeur-Tag‹ feiern wir ja schon seit einigen Jahren. Demnächst – da bin ich mir ganz sicher – wird bei uns das Geschenkbedürfnis auch zu Pfingsten (Schokoladen-Ochsen), Sommer- und Winterzeit-Beginn (Uhren der Firma Quatsch), Himmelfahrt (Modelle der Raumstation MIR) und Totensonntag (kleine Plastiksärge mit dem Aufdruck ›Ein langes Leben wünscht …‹) von pfiffigen Trend-Erfindern angeboten. Und dann erst einmal die Heim(be)leuchtungen an den Häusern! Diese bleiben ab sofort das ganze Jahr hängen und können nahtlos für Weihnachten, Silvester, Karneval, Ostern, Pfingsten, Grillfeste, Herbstbeginn und dann wieder Weihnachten vielseitig und energielutschend eingesetzt werden. Aber, was rede ich hier, wo ich doch in den nächsten Tagen jede Minute zur Vorbereitung der Silvesterfeier brauche.«
Ich glaube, es handelte sich um eine der längsten Rede meines Lebens, doch statt tosend Beifall zu spenden, sagte meine Frau nur:
»Manchmal hast du sie nicht alle!«
Ganz wütend habe ich darauf in das Marzipanschweinchen mit dem Schornsteinfeger gebissen, dass meine Schwiegermutter mir schon Weihnachten geschickt hatte. Der Geschmack hätte mich fast umgebracht – Richtung altes Nierenfett und frittierte Seife.
Da sah ich in der Schnauze des Schweins einen Zettel:
»Ein Frohes Jahr 1957«.
Bis zum Silvestertag grummelte ich mich so durch, dann nahte der Tag der vielen Besuche. Vorsorglich hatten wir in den umliegenden Gasthäusern einige Zimmer angemietet, da unser Haus lediglich über ein Gästezimmer verfügte. Und das hatte natürlich meine Schwiegermutter für sich angemeldet.
Und dann kamen sie!!!
Wenn Menschen aus Düsseldorf kommen, sind darunter natürlich auch immer ein paar Werber, die sich Art-Direktoren nennen. Den alten Witz, dass dies ›so eine Art Direktor‹ bedeute, bringen diese Menschen bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit an.
Unser Freund Dieter Schmelzer war von dieser Sorte. Er arbeitete bei ›Heidkopf und Springer‹ und mußte sich dort den ganzen Tag mit Katzenpisse beschäftigen. Sein berufliches Feld war nämlich eine Firma, die Katzenstreu herstellt. Ohne je einer Katze im privaten Bereich begegnet zu sein, hatte Dieter eine Katzen-Allergie bekommen. Er traf als erster bei uns ein – diesmal in Begleitung einer unbekannten Schönen, die sich Angie nannte. Wir erfuhren später, dass die Dame eine TV-Berühmtheit sei. In einem Werbespot für Katzennahrung legte sie einem schnurrenden Kater Grünzeug auf das Edelfutter.
Draußen hatte es ungefähr drei Millimeter geschneit und Dieter tat sofort, als müsste ich nach wenigen Tagen Eifel bereits ein Fachmann für Wintersport sein.
Nach einer ersten stürmischen Begrüßung – ich hasse es übrigens, wenn mich Männer küssen – verschwanden die Frauen im Haus. Dieter zog mich zur Seite und verfiel in eine Geheimnishaltung. Ich nahm an, dass er mir seine neue Aktfoto-Sammlung zeigen wollte.
Dem war nicht so. Dieter erklärte mir »Wenn wir schon einmal hier sind …«, dass er an unsere drohende Silvesterfeier »noch ein paar Tage dranhängen« werde, um in Sachen Wintersport tätig zu werden. Als er mir erklärte, dass er die Nächte nicht bei uns, sondern in einem Hotel hinter München verbringen werde, war ich direkt erleichtert. Ich fragte mich lediglich, ohne dies aber auszusprechen, wie er die Eifel und die Alpen in Verbindung brachte.
Dieter näselte die ganze Zeit, als wolle er bereits genossenen Nudelsalat durch Reden in die Nase befördert.
Langer Rede-Unsinn: Mein Freund betrieb mit dem Wort ›Wintersport‹ so ein Angeber-Verhalten, dass mir bereits zu unserer Düsseldorfer Zeit gehörig auf die Nerven gegangen war.
Warum, frage ich mich, wird um so etwas wie Bergrunterrutschen solch ein Aufstand gemacht, der sich neben Kleidung und Aprés-Drumherum vor allen Dingen auch in der Sprache entlarvt:
»Wir werden diesmal bei St. Johann-in-den-Seilen auf der Nässelalm in der bekannten Neunspitzerzinnen-Hütte mit Blick auf das Löffler-Joch in 1647 Meter Höhe wohnen.«
Nach diesem Satz schaute Dieter von Welt mich so glücklich wie ein Bürgermeister an, der gerade erfahren hat, dass sein Rathaus in den Farben seiner Partei gestrichen wird.
Als jemand, der schon Sommerurlaub als Belästigung empfindet, schaute ich betreten auf meine skischuhfreie Zone – mir durchaus der Tatsache bewusst, nicht mitreden zu können.
Ich schwieg also, da mich der Nobelschnee-Hobel auch noch zu seinem Wagen zerrte, um die erst vor wenigen Tagen erworbene Ski-Garderobe in unserer Einfahrt auszubreiten. Er begann mit dem Fußwerkzeug.
Dies hatte mit jenen Skischuhen, die man noch in den sechziger Jahren auf dem Lande zum kombinierten Kirch-, Schul- oder eben Skigang benutzen konnte, überhaupt nichts mehr zu tun. Sollte es sich bei den Schuhen, fragte ich zögernd, auch um ein Nebenprodukt aus der Raumfahrt handeln?
Quasi die Teflon-Pfanne für die Füße?
Dieter klärte mich auf:
»Nein, wenn man mit diesen Schuhen – übrigens die absolute Neuheit auf der diesjährigen ›Inter-Matsch‹ in Genf! – stürzt, so schießt in Sekundenschnelle aus den Schuhen ein Airbag in Form einer Tragbare, auf dem die Bergwacht den Schwerverletzten dann ins Tal transportieren kann.«
Und dann führte er mir den Skianzug mit doppelter Action-Noppen-Rippung vor, der von der kubanischen Damennationalmannschaft im Superski vier Wochen unter Dauerbelastung im Windkanal bei VW in Wolfsburg getestet worden sei. Der Test zog zwar den völligen Ausfall jenes Damenteams bei der Weltmeisterschaft wegen Kollektiv-Lungenentzündung nach sich, aber der Anzug hatte seinen Test bestanden.
Als besonderen Modegag habe Karl Lagerfeld – so versicherte Dieter – den Skianzug zu einem Formel-1-Anzug um-designed, doch dies sei nur rein äußerlich. Innerlich sei statt feuerfester Asbest-Doppelripp-Feinripp-Unterwäsche eine neu entwickelte Faser namens ›Pups 2000‹ eingewebt worden, die die eigenen Körperausdünstungen in Wärme umwandeln würde. Der Anzug, das vergaß er mir natürlich auch nicht zu berichten, sei unter dem Namen ›Schummel-Schummi-Alpin‹ nur in den ersten Sportgeschäften zu haben.
»Und was machst du mit der Schweißerbrille?«, wollte ich wissen, doch da erntete ich nur ein mitleidiges Kopfschütteln:
»Das ist eine Sonnenschutzfaktor-16-Brille mit integrierter Herpes-Abwehrsonde gegen Schneebrand.«
Der Helm war natürlich auch vom Feinsten: Knapp über der Stirn befand sich eine Sensor-Öffnung, die nicht nur die vor dem Skifahrer liegende Schneehöhe errechnet, sondern dem Fahrer über eingebaute Kopfhörer auch den möglichen Damen-Aprés-Ski-Abschlepp-Faktor in der nächstliegenden Hütte mitteilt.
»Alles vom Feinsten«, schloss Dieter seine Modenschau, »da bin ich bestens gerüstet für meinen Ski-Urlaub!« – wobei er das letzte Wort wieder wie Nudelsalat in der Nase aussprach.
»Und wo sind deine Skier?«, fragte ich zaghaft, da ich schon wieder einen Unkenntnis-Rüffler erwartete. Vielleicht fährt der Wintersportler von Welt heute schon ohne Skier den Berg runter …
Da schlug sich Dieter vor die Stirn:
»Skier? Ich wusste doch, dass ich etwas vergessen habe …«
Wir gingen ins Haus, in unser neues Haus, in das in den nächsten Stunden noch mehr Menschen einfielen, die bisher meine Freunde waren, mir aber unter der klaren Eifelsonne am kalten Winterhimmel völlig fremd, ja sogar unsympathisch vorkamen. Sieht man einmal von meiner Frau, Katharina ohne Sascha und Sandra und Caroline ab …
Ich merkte, nach nur knapp drei Wochen Eifel gehörte ich nicht mehr zu Düsseldorf.
Man erspare mir die Schilderung des Silvesterabends.
Am ersten Januar waren bis zum frühen Abend alle mit der Drohung »Wir kommen bald wieder zu euch in die herrliche Eifel« abgefahren. Und als sogar meine Schwiegermutter einen Tag später starke Bedürfnisse nach ihrem Damenkränzchen in Düsseldorf verspürte, legte selbst meine Frau ihr keine Bleib-doch-noch-was-Bitten in den Weg.
Ich fuhr also meine Schwiegermutter gutgelaunt zum Aachener Bahnhof. Wenn’s nach mir gegangen wäre, hätte ich ihr aber auch den Bahnbus ab Kalterherberg zugemutet.
Und dann hatte uns der Eifeler Alltag wieder. Und dieser Alltag begann – warum sollte es uns besser gehen als den Menschen in der Provence – mit Handwerkern.
Ich hatte eine Kleinigkeit zu reparieren. Nein, nein, das Klo war nicht verstopft. In unserem Eifler Kriechkeller musste vielmehr etwas an den Rohren gedichtet werden. Da alle deutschen und belgischen Schwarzarbeiter, die die gute Johanna kannte, ausgebucht waren, zog ich andere Seiten auf, gelbe Seiten.
‹Sanitärtechnik Gebrüder Mertens‹, die ich in Kalterherberg anrief, waren nicht ausgebucht:
»Kein Problem, ab 10 Uhr kommt morgen einer vorbei.«
Wir sollten die Eifler Pünktlichkeit sehr bald kennenlernen.
Am nächsten Morgen schellte es um Viertel nach 7, und ich schnellte aus dem Bett hoch:
»Morgen Meister, da sind wir!«, begrüßte mich eine Viertel Fußballmannschaft, die an meinem Morgenmantel rauf und runter guckte, was mich nervös machte.
Mein Hinweis auf den zu frühen Termin tat Wolfgang Mertens, zweiter Chef und Kapitän der Mannschaft, ab:
»Ach, was mein Bruder Berthold sagt, da müssen Sie nix drum geben. Aber keine Sorgen, um uns brauchen Sie sich nicht kümmern. Alles fest im Griff, alles im grünen Bereich.«
Ich griff im Badezimmer gerade zum Nassrasierer, da schellte es schon wieder. Ich zog schnell wieder den Morgenmantel an, und rannte zur Tür:
»Ihre …« – in dem Wort lag ein Vorwurf – »… Tür ist zugefallen. Wir hatten was im Auto vergessen.«
Dann guckte Wolfgang Mertens wieder an meinem Morgenrock runter, was mich noch etwas nervöser machte.
Kaum war ich wieder im Bad, da hörte ich die Stimme von Wolfgang Mertens:
»Nur ganz kurz! Haben Sie einen Aufnehmer – oder eine Frau, da ist eine Kleinigkeit wegzuwischen?«
Mit der Kleinigkeit wurden früher Schwimmbäder gefüllt …
Meine Frau entschied aus dem Bett, dass wir einen Aufnehmer hatten.
»Das macht unser Lehrling gerne weg, obwohl das nicht meine Arbeit ist!«, drohte Wolfgang Mertens und guckte nur noch an meinem Morgenrock runter – nicht mehr rauf.
Meine Nervosität blieb.
»Das Bad können wir jetzt mal ne Zeit nicht benutzen!«, schob der Eifler Handwerker nach.
»Wir – wieso wir?«, schoss es mir durch den Kopf, »wollen die Handwerker jetzt sogar noch bei uns baden?«
Also verzog ich mich im Morgenmantel in die Küche. Genau 35 Sekunden!!!
»Haben Sie mal heißes Wasser, damit wir uns einen Caro-Kaffee für unsere Frühstückspause in Ihrem kalten Keller aufbrühen können?«
Höflich wie ich bin, lud ich die Viertel Fußballmannschaft in die Küche ein und machte Kaffee – drei Mann und ein Vizechef guckten an meinem Morgenmantel runter.
»Es ist so«, sagte der Meister des Rohrverlegens nach der Pause, »das können wir so nicht machen. Da müssen wir erst einen Zwickelbiegerrohrspanner bestellen. Das kann dauern, der kommt nämlich von früher drüben. Wir haben Ihnen aber einen Eimer unter das Rohr gestellt.«
Darauf verabschiedeten sich alle, liefen mit nassen Schuhen über den Teppichboden, bemerkten dies aber:
»Das ist doch jetzt kein Problem. Sie haben ja einen Aufnehmer oder eine Frau?«
An der Tür guckten noch alle einmal an meinem Morgenrock runter und gingen, bis auf Wolfgang Mertens, den ich höflich zurückhielt:
»Warum, warum können Sie nix machen?«, entfuhr es mir.
»Ihr Morgenrock!, Meister, Ihr Morgenrock«, sagte der, »damit kann ich meine Leute nicht motivieren.«
»Was hat das mit meinem Morgenrock zu tun?«, schrie ich nun schon fast.
Die Antwort war knapp:
»Keine Taschen, kein Trinkgeld!«
Als ich meiner Frau die Geschichte erzählte, winkte sie nur ab:
»Ich glaube, du übertreibst schon wieder. Johanna hat mir erzählt, dass Eifeler Handwerker höfliche Menschen sind!«
Doch auch sie sollte nur zwei Tage später diese eigene, diese typische Eifler Art der Höflichkeit kennenlernen.
»Morgen Meister«, grüßte ganz höflich ein Mensch im weißem Blaumann, als er mich um sieben Uhr aus dem Bett klingelte, »da sind wir, die Anstreicher, Firma ›Franz Roder & Schwippschwager‹ aus Mützenich. Wir sollen die Fenster streichen.«
Ich erinnerte mich dunkel an einen Auftrag an die damalige Firma ›Josef Roder & Neffe‹, den ich noch aus Düsseldorf erteilt hatte. In der Zwischenzeit hatte wohl ein Franz das Erbe angetreten. Oder hatte es sogar eine feindliche Übernahme gegeben? Eine Frage, die mir nie beantwortet wurde, die mich aber auch schon sehr bald nicht mehr interessierte.
Mit einem kritischen, wohlbekannten Blick auf meinen Morgenrock (!!!) wurde Franz Roder noch freundlicher:
»Ach, Meister, Ihr schlaft noch? Legt euch ruhig noch mal hin. Kein Problem. Da fangen wir draußen mit dem Streichen an.«
Unhöflich wie ich zu so früher Tageszeit nun einmal bin, unterstellte ich dem braven Malermeister, dass er »Um die Zeit noch mit dem dicken Arsch im Bett« gedacht haben könnte. Dabei murmelte dieser nur fast unhörbar beim Weggehen:
»Morgenrock ohne Taschen – ohne Taschen …«
Eifler Handwerker sind höfliche Menschen. Zehn nach sieben schellte es wieder, diesmal schlug ich mir vor Schreck den Kopf am Ehebett-Bild ›Der Engel des Herrn geht hinter Kindern über eine wackelige Brücke‹ blutig. Das Bild hatte ich mir erst eine Woche vorher auf einem Flohmarkt in Eupen gekauft und gegen den ausdrücklichen Protest meiner Frau aufgehängt.
»Tschuldigung Meister«, sagte Franz Roder – ganz höflich – »kann ich mal in der Firma anrufen, meine Frau muss mir nämlich noch einen Eimer ultrahitzeabweisendes giftfreies Deckweiß bringen, das hat der Lehrjunge nicht eingeladen. Das ist doch bestimmt auch in Ihrem Sinne, das giftfreie.«
Es war in meinem Sinne. Die Farbtritte auf unserem falschen Perser waren dagegen nicht im Sinne meiner Frau. Ich legte mich nach einer Teppich-Sonderbehandlung mit Waschbenzin dann noch einmal hin. Um zehn nach acht schellte es wieder, diesmal schlug meine Frau gegen ›Der Engel des Herrn geht hinter Kindern über eine wackelige Brücke‹. Zur Tür musste ich aber.
»Tschuldigung Meister«, sagte der Maler – ganz höflich:
»Ich dachte mir, dass Ihr um diese Zeit nicht mehr schlaft, wir müssen nämlich auf meine Frau mit dem ultrahitzeabweisenden giftfreien Deckweiß warten, und da ziehen ich und der Lehrjunge die Frühstückspause vor. Habt Ihr, nur wenn es euch nichts ausmacht, ’was heißes Wasser. Ich trinke nämlich nur Tee, müssen Sie wissen. Die Galle!«
Eifler Handwerker sind höfliche Menschen!
Erst um zwanzig vor neun schellte es wieder. Da meine Frau und ich nicht mehr ins Bett gegangen waren, schlug keiner gegen ›Der Engel des Herrn geht hinter Kindern über eine wackelige Brücke‹.
»Tschuldigung Meister«, sagte Franz Roder ganz höflich:
»Wir fangen jetzt an. Könnt Ihr die Fenster nur einen Spalt, damit es euch nicht zieht, aufmachen, damit wir die Fenster nicht verkleben. Das ist nur in eurem Sinne.«
Eifler Handwerker sind schon höfliche Menschen!
Und so machte es mir auch kaum etwas aus, als ich mir gerade die Unterhose anzog, dass der Maler auf einer Leiter durchs Schlafzimmerfenster guckte:
»Tschuldigung Meister«, sagte dieser. Ganz höflich, versteht sich:
»Ihr seit es ja nur, und nicht eure Frau. Wir Mannsleute sehen ja alle gleich aus. Ihr habt bloß mehr Bauch, aber dafür seht Ihr für euer Alter noch ganz jung aus.«
Handwerker sind eben höfliche Menschen und so knallte ich erst wieder bei meinem Mittagsschlaf gegen ›Der Engel des Herrn geht hinter Kindern über eine wackelige Brücke‹, als es schellte:
»Tschuldigung Meister«, sagte Franz – ganz höflich:
»Habt Ihr mal den Schlüssel von eurer Garage, da kommen wir nämlich nicht rein. Da müssen wir bis morgen unsere Sachen unterstellen. Aber nur, wenn es euch nicht stört, Meister.«
»Neiiiiiiin«, schrie ich: »Neiiiiiiin«.
»Manchmal bist du ein richtig unhöflicher Mensch«, sagte meine Frau später zu mir.
Franz Roder störte in den nächsten Tagen kaum noch und da ich mir in der Eifel nicht gleich den Ruf eines unhöflichen Städters einhandeln wollte, suchte ich bis zum Ende der Arbeiten mehrmals das Gespräch mit dem Anstreicher. Er wurde mir von Stunde zu Stunde sympathischer.
Bei einem gemischten Tee und Kaffee, ließ ich mir von Franz Roder eine Einführung die die Mentalität des Eifler Arbeitslebens geben.
Der Malermeister hatte mir schon längst meinen Ausfall verziehen und führte mich zunächst in den Arbeitsmorgen ein:
»Sie müssen wissen, wir Eifler stehen nicht mit den Hühnern auf, nein, der Eifler steht auf und weckt die Hühner, ehe er sie melkt – also nicht die Hühner, sondern die Kühe. Was ich Ihnen damit sagen will: Wir Menschen am Venn arbeiten nicht nur viel, wir arbeitet auch gerne.«
Ich war beeindruckt, zumal Franz Roder mich weiter in die Arbeitsfreudigkeit seiner Mitmenschen einführte.