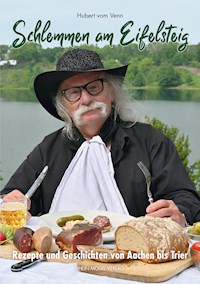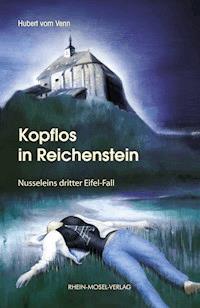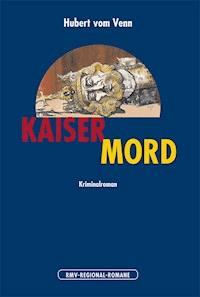Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Rhein-Mosel-Vlg
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
'Zugegeben: Mit einer Kugel im Kopf geht man schon lange nicht mehr nach Hause. Aber dann auch noch in einem Altbier-Gärbottich entsorgt zu werden und somit Düsseldorf – ja, dieses Düsseldorf – als Sterbeort in die endgültige Vita geklatscht zu bekommen, ist für einen Rheinländer schon ein verdammt schlimmes Ende. Ja, ja, klar sind Düsseldorfer auch Rheinländer. Aber eben, nun ja, wie soll ich sagen, em., – auf jeden Fall von der falschen Uferseite des Flusses. Natürlich hätte diese Geschichte in einem fernen, grauenhaften Land mit einem grauenhaften Vorfall, dessen grauenhafte Spur dann in unsere Breiten führt, beginnen können. Doch sind wir einmal ehrlich: Was könnte grauenhafter als Düsseldorf sein? Und daher beginnt all das, von dem nun zu berichten ist, zunächst in der Eifel. Wobei – dieser Nachsatz sei für Ortsunkundige noch erlaubt – die Eifel nichts, aber auch gar nichts mit Düsseldorf zu tun hat.'
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 279
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Ena – für Rat und Tat
© 2004 2. Auflage/Neuauflage 2009 eBook-Ausgabe 2011RHEIN-MOSEL-VERLAGBrandenburg 17, D-56856 Zell/Mosel Tel. 06542/5151, Fax 06542/61158 Alle Rechte vorbehalten ISBN: 978-3-89801-786-2 Korrektur: Thomas Stephan
Hubert vom Venn
Wer stirbt schon gern in Düsseldorf?
Nusseleins erster Fall
– Ein satirischer Polit-Krimi –
Geschrieben in Roetgen, La Grande Motte, Neuharlingersiel und Mühevollerkleinarbeit
RHEIN-MOSEL-VERLAG
Mein Dank gilt einigen, natürlich ungenannten Informanten, die mir – wissentlich und unwissentlich – über die Tätigkeit von Geheimdiensten, US-Besatzern, Journalisten, Politikern sowie den Militärs in der Eifel berichtet haben. Mein Dank gilt schreibenden, mitteilenden und mitteilungsbedürftigen Menschen, deren Originalzitate ich – meistens satirisch – verfremdet habe.
***
Inhalt
1. Das erste Buch Charly2. Tod im Gärbottich3. Welt-Sheriffs in der Eifel4. B-Hunter5. Der Separatisten-Aufstand6. Ende einer Idee7. Der Schlapphut8. Das Ende vom LiedEpilog
***
PrologZugegeben: Mit einer Kugel im Kopf geht man schon lange nicht mehr nach Hause. Aber dann auch noch in einem Altbier-Gärbottich entsorgt zu werden und somit Düsseldorf – ja, dieses Düsseldorf – als Sterbeort in die endgültige Vita geklatscht zu bekommen, ist für einen Rheinländer schon ein verdammt schlimmes Ende.
Ja, ja, klar sind Düsseldorfer auch Rheinländer. Aber eben, nun ja, wie soll ich sagen, em …, – auf jeden Fall von der falschen Uferseite des Flusses.
Natürlich hätte diese Geschichte in einem fernen, grauenhaften Land mit einem grauenhaften Vorfall, dessen grauenhafte Spur dann in unsere Breiten führt, beginnen können. Doch sind wir einmal ehrlich:
Was könnte grauenhafter als Düsseldorf sein?
Und daher beginnt all das, von dem nun zu berichten ist, zunächst in der Eifel. Wobei – dieser Nachsatz sei für Ortsunkundige noch erlaubt – die Eifel nichts, aber auch gar nichts mit Düsseldorf zu tun hat.
1. Das erste Buch Charly
Es gibt Tage, an denen lässt Charly Nusselein Herrn Schlüter einen guten Mann sein.
Man muss in diesem Zusammenhang allerdings wissen, dass Charly Nusselein überzeugter Atheist ist, sich selbst aber, falls er doch einmal betet, einen eigenen Gott namens »Herr Schlüter« geschaffen hat.
Und Charly Nusselein betet oft …
… meistens, wenn er Angst hat.
Und Charly Nusselein hat oft Angst!
Angst, die in seinem aufreibenden Job an der Tagesordnung ist. Die Formulierung »aufreibend« stammte übrigens von ihm selbst – andere Menschen hätten dieses Wort – wenigstens in Verbindung mit Charly Nusselein – nie ausgesprochen.
Charly Nusselein, der eigentlich Karl-Heinz heißt, ist Lokaljournalist bei einem bunt aufgemachten Anzeigenblatt. Seit sechs Jahren. Vorher hatte er, aus Prüm stammend (»Genau wie Erich Maas, der mal bei Bayern spielte.«), in Berlin in einer Kneipe namens »Brot & Rosen« am Prenzlauer Berg als eingeschriebener Student gekellnert. Seine Mutter nannte das stolz »Unser Karli studiert auf Volksschullehrer und so was wie Kunst – es kann aber auch Turnen sein«. Als Charly Nusselein nach zehn Jahren endgültig das Studium schmiss, kehrte er in die Eifel zurück. Zunächst jobbte er zwei Jahre als Fahrer bei UPS in Wittlich, ehe er vor sechs Jahren dann Reporter bei dem Anzeigenblatt in Monschau wurde:
»Ich konnte einfach die braune Uniform von UPS nicht mehr ertragen. Ideologisch gesehen, versteht sich.«
Einige Eifeler nennen das Blatt, das monatlich erscheint, »Die Eifel-Bravo«, weil man in erster Linie ein jüngeres Publikum »so bis 49« ansprechen will. »Man« ist übrigens Alex Kufka, Verleger, Chefredakteur, Anzeigenverkäufer und sogar Bote in einer Person. Letzteres allerdings nur in seinem Wohnviertel. Kufka hat eine recht gewöhnungsbedürftige Angewohnheit. Er trägt fast immer einen Luftpolster-Umschlag bei sich und zerknackt bei Gesprächen die kleinen Kammern. »Handfürze mit Musik« nennt Nusselein das.
Das Blatt heißt übrigens »Der Hammer«, ein Name, der – zumindest in der Eifel – recht gewöhnungsbedürftig war und es eigentlich immer noch ist. Karl-Heinz Nusselein, den alle nur Charly nennen, ist seit seiner Rückkehr in die Eifel »so um die 30 rum«. Er lebt seit fünf Jahren in einem Wohnwagen auf seinem eigenen Grundstück in Ruitzhof.
Ruitzhof ist übrigens eine von Belgien umzingelte deutsche Enklave unweit von Kalterherberg. Und Kalterherberg ist wiederum ein Monschauer Stadtteil.
Stadtteil, na ja …
Eher ein Eifeldorf, ein typisches Eifeldorf, wie es sein muss: Fachwerkhäuser, hohe Hecken, Menschen, die sich nicht verbiegen lassen und früher, also bis kurz nach der Wiedervereinigung, jedem aus einem anderen Dorf eins kräftig aufs Maul hauten, der eine dorfeigene Maid länger als drei Sekunden anstarrte. Auch die angehimmelte Maid, die der Kalterherberger dann allerdings »e fies Wiev« nannte, wurde, sofern sie dem Werben des Ortsfremden nachgegeben hatte, in der Johannisnacht abgestraft: Zu ihrem Haus legten die Burschen ab der Kirche eine Spur aus Sägemehl, damit jeder hergelaufene Nicht-Kalterherberger den Weg zu der Unmoralischen auch sicher finden konnte. Aber dieser Service ist – wie gesagt – lange, lange her. Der letzte Fall liegt immerhin schon sieben Jahre zurück.
Zurück zu Charly Nusselein!
Seinen Wohnwagen nennt dieser »meinen alten Zirkuswagen«.
Richtig wäre allerdings »alter Bauwagen«, da Charly das nachträglich bunt bemalte Gefährt vor Jahren von einer Baufirma gekauft hat. Und zwar von der in Insolvenz geratenen Schleidener »Hoch- und Tief«, deren Besitzer zu sehr in die Breite gegangen war. Will sagen: Für Wein, Weib und Gesang hatte der gute Mann mit dem Firmenvermögen hoch gepokert und war tief gefallen – »Hoch und Tief« – wie der Firmenname schon sagte. Und der Mann gehörte noch nicht einmal der dritten Generation an, die bekanntlich alles in den Sand setzt.
Übrigens: Seit Charly Nusselein in dem Zirkuswagen, der ein Bauwagen ist, lebt, will das Bauamt der Stadt Monschau, zu der die deutsche Insel-Enklave Ruitzhof gehört, den recht proper hergerichteten bunten Bauwagen zwar nicht zum Teufel, aber zum nächsten Schrottplatz schicken. Doch dafür müssten die beamteten Abrissbirnen über belgisches Gebiet anrücken – und das ist auch in einem sich umarmenden Europa immer noch mit gewissen kleindiplomatischen Nasenrümpfen verbunden.
Man stelle sich nur einmal vor: Der Bürgermeister aus dem belgischen Bütgenbach kommt nach Monschau und übergibt seinem deutschen Amtskollegen eine Protestnote. Ein Skandal wäre das, unvorstellbar – mit Schlagzeilen links und rechts der Grenze, im »Grenz Echo« und in der Aachener Zeitung, die der Verleger übrig gelassen hat.
Und so lässt es sich für Charly Nusselein, der immer diese altmodischen blauen John-Wayne-Hemden und Jeans trägt, prächtig in Ruitzhof leben. Nusseleins Mutter nennt die Jeans übrigens immer noch Texashosen.
Ach ja, Nusselein lebt nicht allein.
Der wahre Herrscher im Bauwagen ist nämlich Incitatus, also »Heißsporn«, der einst – dies nur als Hinweis für Nicht-Kleinlatinumer (und wer ist das schon) – nach dem Pferd von Caligula benannt wurde.
Und Caligula, das erzählt Nusselein gerne, »hatte einen totalen Ratsch am Kappes«. Nusselein liebt Menschen, die einen Ratsch am Kappes haben oder hatten: Ludwig II, Ozzy Osbourne, Karl Valentin, Helge Schneider. Seine Lieblingsband – und Nusselein hat alle Platten aus den sechziger und siebziger Jahren – ist immer noch Insterburg & Co. Er kann alle Songs auswendig, sogar die eigenen Textveränderungen: »Ich liebte ein Mädchen in Steckenborn, die liebte ich ganz toll von hinten und von vorn.«
Nun ja, das Versmaß ist noch nie Charlys Stärke gewesen, aber was braucht man als rasender Lokaljournalist schon Versmaß.
Charly Nusselein behauptet übrigens steif und fest, dass sein Kater Incitatus jeden Abend mittels einer eigens angefertigten Vorrichtung eine Tabakspfeife schmaucht. Dies erscheint aber umso unwahrscheinlicher, da Incitatus ein äußerst träger Kater ist, der mit seinem Namensgeber Heißsporn so viel zu tun hat wie der Pulitzer-Preis mit Charly Nusselein.
Verweisen wir also die Pfeife samt Haltevorrichtung in den Bereich der vielen Nusselein-Legenden, zumal die Geschichte über einen Pfeife rauchenden Kater nun wirklich keinem Menschen wehtut.
Na ja, von einigen radikalen Tierschützern vielleicht einmal abgesehen.
Nusselein arbeitet, wie gesagt, seit der Gründung vor sechs Jahren bei dem kostenlosen Eifel-Magazin »Der Hammer«, einer Publikation, der in den letzten Jahren doch immer wieder die eine oder andere – nennen wir es ruhig so – journalistische Sensation von lokalpolitischem Eifeler Weltinteresse zwischen Schleiden und den südlichen Aachener Stadtteilen geglückt ist. Denn auch dort, wo Aachen schon Eifel ist, landet »Der Hammer« in jedem Briefkasten.
Da war zum Beispiel die Sache mit den unternehmerisch-politischen Machen- und Klüngelschaften von diesem – wie hieß der noch? – Dings aus Simmerath oder die Serie über das angeblich nicht reine Trinkwasser aus der Perlbach-Talsperre.
Diese Artikel, beide mit der Autorenzeile »Von unserem Redakteur Charly Nusselein« versehen, hatten nicht nur bewirkt, dass der Dings nicht mehr im Simmerather Gemeinderat sitzt und dass das RWE eine ganze Anzeigenseite im »Hammer« stornierte, sondern auch, dass viele selbsternannte Eifeler Alternative den Aufkleber »Keine Werbesendungen in meinen Briefkasten« heimlich mit einem Kartoffelmesser weggekratzt haben.
Denn den »Hammer« wollten in der Nordeifel und den südlichen Aachener Stadtteilen alle lesen, auch zu dem hohen Preis, dass die Briefkästen nun mit kostenloser Werbung voll gestopft werden dürfen. Immerhin sind hin und wieder bei den Werbestopfaktionen auch kostenlose Waschmittelpröbchen dabei – und die kann nicht nur der Eifeler Alternative gut gebrauchen.
Die meisten Politiker können, mal mehr, mal weniger – das hängt mit der aktuellen (Selbst)-Betroffenheit zusammen – Charly Nusselein nicht leiden. Aber dies nur am Rande.
Ganz im Gegensatz zu den Kollegen der fusionierten Nordeifeler Tageszeitung. Sie zollen ihm, glaubt dieser wenigstens, den nötigen Respekt, auch wenn er ihnen – wie gelesen – schon so manche Story »vorgesetzt« hat.
Ja, ja, es waren nur zwei Storys – doch das ist auf sechs Jahre gesehen in der Nordeifel eine fette Ausbeute.
Nusselein gibt sich immer recht bescheiden, auf jeden Fall tut er so. Jedem Kollegen- oder Leserlob begegnet er mit dem herunterspielenden Satz: »Das war doch nichts. Ich bin vielmehr der Meinung, dass Schleiden zerstört werden muss, wie Cato, der alte Sack, immer sagte.«
Woher Nusselein diesen Satz hat, ist nicht überliefert, da er nur über einen Asterix-Lateinschatz verfügt. Erschwerend kommt noch hinzu, dass Nusselein kaum Asterix gelesen hat, dafür aber alle Krimi- und Detektiv-Geschichten, die ihm in die Finger gekommen sind. Schade nur, dass die katholische Pfarrbibliothek in Kalterherberg keine »Jerry-Cotton«-Heftchen hat.
In diesem Zusammenhang: So eine richtige, also so eine richtige Krimigeschichte hatte Nusselein noch nie im »Hammer« platzieren können.
Nein, Charly Nusselein träumte vielmehr davon, einmal selbst einen echten Kriminalfall aufzuklären und dann das gelöste Verbrechen der Kripo zu präsentieren. Unter Mord sollte aber nichts laufen – träumte wenigstens Charly Nusselein in seinem Wagen, der kein Zirkuswagen ist, in Ruitzhof.
Kurzum: Ob Nusseleins wüstenrot-freie Wohnstätte nun ein Bau- oder Zirkuswagen ist, und ob Incitatus wirklich die eine oder andere Pfeife raucht, soll uns nun nicht mehr interessieren. Denn Nusseleins Stunde – oder besser: Mord – sollte kommen, in die Historie der späteren ungeschriebenen Nusselein-Enzyklopädie gerne als »Äh, mein erster, richtiger Fall« eingehend.
* * *
Alles begann an einem ganz normalen Wahlabend, oder besser gesagt: an einem Landtagswahl-Abend. Da die Eifel ein getrenntes Land ist – fast wie früher die DDR, allerdings mit Buchenhecken statt einer Mauer – muss noch erwähnt werden, dass die Wahl nur im nordrhein-westfälischen Teil der Eifel stattfand. In NRW regiert mit Nils Steenken von der SPD ein Ministerpräsident, der vor Jahren als Staatssekretär aus Kiel nach Düsseldorf geholt worden war und sich langsam bis zum Ministerpräsidenten hochgedien(er)t hatte. Ein Fischkopf also und nicht etwa ein Rheinländer oder – meinetwegen auch – ein Westfale. Man stelle sich nur einmal vor, in Bayern würde ein Sachse Ministerpräsident – unmöglich: »Nü, liepe Payern, mochen Se mol das linke Ohr frei …«
Um die kosmopolitische Bedeutung der Landtagswahl zu verdeutlichen, begann Nusseleins erster richtiger Fall nicht etwa in Monschau, sondern vielmehr im urbanen Aachen, genauer gesagt in einer Grundschule der eben erwähnten südlichen Stadtteile, die zur Eifel gehören. Wer es genau wissen will: in Walheim. Völlig unberührt lässt uns dabei die Frage, ob Aachens Zentrum zur Eifel gehört oder nicht. Wir diskutieren diese Frage ja auch nicht in Sachen Trier – oder …????
Um aber in Gedanken ganz nahe bei Charly Nusselein zu sein, muss noch erwähnt werden, dass Herr Schlüter an diesem Wahltag nicht alle Parteien mit idealem Wetter bedacht hatte.
Es war nämlich der Wahlabend der langen Gesichter.
Ernst-Wilhelm Noppeney, in die Jahre gekommener Ex-Bürgermeister, CDU, der schon lange von Aachen geschluckten ehemaligen selbständigen Gemeinde Walheim & Kornelimünster, traute so einer modernen Errungenschaft, wie es eine Digital-Uhr nun mal ist, immer noch nicht. Daher hatte er als zuverlässigen Vertreter der offiziellen Zeit ein Billig-Transistorradio mitgebracht, das er als kostenlose Zugabe bei seiner letzten Bestellung von einem Großversandhaus für Kleinartikel bekommen hatte.
Auf den Vertreter der offiziellen Zeit war Verlass – immerhin stand hinter dem kleinen Radio das zweite Programm des Westdeutschen Rundfunks mit geballter Kraft und Pünktlichkeit:
»18 Uhr, WDR II – das Nachrichten-Magazin. In diesem Augenblick schließen überall im Lande die Wahllokale …«
Weiter kam der Sprecher nicht, da Ernst-Wilhelm Noppeney mit einem schnellen Dreh das kleine Gerät zum Schweigen gebracht hatte. Er schloss den obersten Knopf seiner Jacke, stellte sich gut sichtbar in den zum Wahllokal umfunktionierten Raum der Grundschulklasse und verkündete mit sicherer Stimme:
»Em, ja. So. Auch unser Wahllokal ist hiermit geschlossen. Wir können mit der Auszählung beginnen.«
Auch Günther Lehnen hatte den Zenit seiner kommunalpolitischen Karriere schon lange überschritten. Doch als ehemaliger SPD-Fraktionsvorsitzender der gleichen ehemaligen Gemeinde sah er in Noppeney immer noch einen ungeliebten Gegenspieler, und so wunderte es keinen im Wahlvorstand, dass er sich sofort zu Wort meldete:
»Dazu gehört aber auch, dass die Tür zum Wahllokal geschlossen wird.«
Werner Tholen, der als Ex-FDP-Gemeinderat der Ex-Gemeinde weder den Vertreter der CDU noch den der SPD jemals in sein gelb-blaues Herz geschlossen hatte, war sich nicht sicher, ob das kommunale Wahlgesetz etwas zum »Schließen von Türen der Wahllokale nach Wahlschluss« sagt und knallte zum Zeichen seiner liberalen Unabhängigkeit die Tür einfach zu.
Rums!!!!
Die Wahlurne wurde geöffnet, die zu Schriftführern bestimmten bartlosen Vertreter zweier politischer Jugend-Organisationen starrten gebannt auf ihre Zählblätter und auf eine mit Taschenmesser in die Schulbank geritzte Bemerkung, mit der wohl ein frühreifer Viertklässler seine Kritik am Schulsystem zum Ausdruck bringen wollte:
»RIP – Hier starp ein Schenie aus Langeweile! Es lebe PISSA!«
Die Auszählung begann mit den in der Ex-Gemeinde gewohnten Stimmanteilen: »Vier CDU, zwei SPD, eine FDP und eine grüne Stimme!«
»Die würde ich am liebsten fallen lassen«, dachte Ernst-Wilhelm Noppeney, von dem man erzählte, dass er sich früher seine Mehrheiten immer gestrickt hatte.
Doch dann stockte der Zähler, schaute ungläubig seine Mitzähler mit den anderen Parteibüchern an:
»Neun Stimmen F.R.!«
Kein Zweifel – selbst die geübten Wahlzettel-Blicke von Ernst-Wilhelm Noppeney und Günther Lehnen konnten einen Irrtum ausschließen:
»Eindeutig F.R.!«, verkündeten beide in ungewohnter Eintracht, wobei nur am Rande vermerkt werden musste, dass beide Herren trotz ihres Alters diese weit reichende Feststellung noch ohne Lesebrille treffen konnten – quasi aus einer fielmannfreien Zone auf die Wahlzettel starrten.
Werner Tholen dagegen, erst 67, stammelte betroffen:
»Das ist doch nicht zu fassen! Wir Liberalen sollten doch die Überraschung dieser Landtagswahlen werden! Dafür haben wir doch so manche Mark und unseren Spitzenkandidaten springen lassen!«
* * *
Der Ausruf des Erstaunens entfuhr an diesem Abend noch so manchem in Nordrhein-Westfalen – in erster Linie allerdings im Rheinland.
Hatte doch die unter »ferner liefen« eingestufte Winz-Gruppierung »Freies Rheinland« (F.R.) auf Anhieb sensationelle 19,6 Prozent der Stimmen im größten Bundesland der Republik verbuchen können, einige Direktmandate gewonnen und dies mit einem Wahlkampf, der sich auf recht hilflos formulierte Werbeschriften mit Kurz-Statements, Infostände unter Sonnenschirmen lokaler Bierverleger in Fußgängerzonen sowie Kinder-Belustigungen durch angeheiratete Separatisten-Frauen auf Spielplätzen beschränkt hatte.
Selbst im Münster- und Sauerland, wo die Partei überhaupt nicht angetreten war, rief das Ergebnis baffes Erstauen hervor, und so mancher Schweinezüchter in den unendlichen Weiten des Münsterlandes und Ostwestfalens schaute neidvoll gen Rhein, trank einen zweiten Steinhäger, klopfte sich auf die Schenkel und meinte zu Familie sowie Gesinde:
»Jau, jau, jau – das hätten wir auch haben können. Freies Westfalen, das hätt’ doch was. Jau, jau, jau!«
Im dritten Fernsehprogramm spielten Ergebnisse aus »Dülmen 1« und »Gütersloh 3« an diesem Abend nur eine untergeordnete Rolle – mit Spannung wurden dagegen die Schlussergebnisse aus Moers, Duisburg, Düsseldorf, Heinsberg, dem Oberbergischen Land, Düren, Köln, Aachen und der Eifel erwartet – um nur einige rheinische Hochburgen zu nennen.
Und die ließen keinen Zweifel: Im neuen Landtag von Nordrhein-Westfalen würde das Rheinland von zahlreichen Abgeordneten der Rheinland-Separatisten vertreten werden, selbst Ministerpräsident Nils Steenken hatte seinen sicheren Wahlkreis »Bonn 1«, in dem die SPD das Nordlicht eingenistet hatte, mit Pauken und Trompeten verloren. Da Steenken im unsicheren Gefühl eines Sieges auf Absicherung durch die SPD-Landesliste bestanden hatte, gehörte er nur noch mit einem Reservelisten-Makel dem neuen Landtag in Düsseldorf an.
Der Ministerpräsident hatte seine persönliche Niederlage bereits im Foyer des Düsseldorfer Landtags um 18.57 Uhr – also rechtzeitig zu den ZDF-»heute«-Nachrichten mit Petra Gerster – eingestanden. Allerdings nahm er dabei schon wieder seinen nordischen Klaus-Störtebeker-Blick an:
»Nun gut, die Bürger meines Wahlkreises haben mir diesmal nicht ihr Vertrauen geschenkt. Das liegt sicher an dem Überraschungserfolg einer lokalen Splitter-Gruppierung von Chaoten. Die Hauptsache ist aber, dass wir Sozialdemokraten landesweit wieder die Nummer Eins sind. Ich gehe davon aus, dass ich weiterhin Ministerpräsident dieses Landes bleiben werde.«
Dann dankte er noch den SPD-Wählern und allen Plakatklebern »draußen im Lande«. Aber das wurde vom ZDF schon nicht mehr gesendet.
Zu diesem Zeitpunkt lagen die öffentlich-rechtlichen Hochrechnungen von ARD und ZDF bis auf wenige Stellen hinter dem Komma dicht beieinander.
Menschen, deren Wichtigkeit sich hinter Kameras abspielt, wuselten durch den Landtag, um wenigstens einen F.R.-Vertreter vor die Aufnahmegeräte ihrer öffentlich-rechtlichen oder privaten Medienanstalt zu zerren. Hatte man doch in einer von den Demoskopen aus Noelle, Allensbach und Neumann abgesicherten Überheblichkeit die Kleinpartei unter »Gar nix« noch weit hinter der PDS einkalkuliert.
Endlich, die »Tagesschau« rückte schon gefährlich näher, konnte ein freier Mitarbeiter des Düsseldorfer WDR-Hörfunkstudios den F.R.-Spitzenkandidaten Ludwig Förster in der Düsseldorfer Kneipe »Op de Eck« am Grabbeplatz ausfindig machen, wo dieser nicht nur ausgiebig seinen Sieg im eigenen Wahlkreis »Aachen III – Euskirchen I« feierte, sondern auch mit baffem Erstaunen so manch ungeliebtes Altbier auf das immer konkreter werdende Endergebnis hob.
Ludwig Förster enttäuschte wenig später in der »Tagesschau« all die, die sich unter dem Chef der F.R.-Partei einen tümelnden Blut- und Heimaterde-Fanatiker im Trachtenjanker vorgestellt hatten. Der Buchhändler aus Monschau erklärte vielmehr in kurzen, wenn auch noch recht unsicher wirkenden Zügen seine Vorstellungen von einem Westfalen-Lippe-freien Bundesland: Pappnasenfreie Kultur und rheinischer Freigeist, der selbst in den zwanziger Jahren des vorigen Jahrhunderts bei einem gewissen Herrn Adenauer aus Köln auszumachen gewesen sei. Seine Ausführungen beendete er:
»Vom Rheinland ist, soviel ich weiß, nie ein Krieg ausgegangen, von Berlin immer wieder – zuletzt sogar im Kosovo. Nun ja, ich gebe zu, dass die ersten Entscheidungen sicher noch in Bonn gefallen sind. Und zu Afghanistan werde ich später noch etwas sagen.«
Die beiden letzten Sätze fielen in der Ausstrahlung allerdings der Schere zum Opfer.
Mehr war an diesem Abend in Sachen politischer Standortbestimmung nicht zu erfahren – zumal man für die Düsseldorfer Runde, die natürlich eine Berliner Runde war, keinen Vertreter der rheinischen Separatisten eingeladen hatte.
Der weitere Fernsehabend zog sich dahin mit Bafferstaunt-Kommentaren, Kopfschüttel-Statements von Nicht-NRWlern und Teufel-an-den-Landtag-Gemale von Noch-Nordrhein-Westfalen.
Neben der Politik gab es an diesem Abend noch die Meldung, dass der Papst das Geheimnis von Fatima gelüftet hatte.
Das Attentat auf ihn selbst sei das große, erschreckende Geheimnis gewesen.
»Mehr nicht?«, formulierte ein öffentlich-rechtlicher Nachrichtensprecher recht salopp – aber darüber konnte sich an diesem Abend kein Rundfunkrat aufregen – zumal »Bayer Leverkusen« an diesem Tag noch Deutscher Meister hätte werden können … es aber dann doch nicht wurde.
Aber das sind völlig andere Geschichten – im wahrsten Sinne des Wortes: Geschichte eben.
Als sich die ARD gründlich über die übrigen, recht unbedeutenden Ereignisse des Tages ausgemeldet hatte, ging man gegen 23.10 Uhr zur verlängerten Tagesthemen-Ordnung über und verkündete das vorerst amtliche Wahlergebnis:
Die F.R.ler hatten auf Anhieb 19,6 Prozent der Stimmen geholt und zogen mit 48 Abgeordneten in den Landtag ein. Die SPD erhielt glatte 33 Prozent bei 78 Abgeordneten, die CDU 27,2 und 64 MdLer, die Grünen 7,1 Prozent und 17 Sitze und die FDP 9,8 Prozent und 24 Sitze für das Düsseldorfer Parlament. Damals war auch noch der Fallschirmspringer mit dem harten Aufschlag dabei.
Unter normalen Wahl-Umständen wäre das FDP-Ergebnis die Sensation des Abends gewesen – doch nach dem »Freies-Rheinland«-Erfolg interessierten sich nur noch die Liberalen selbst für ihre Zahlen und riefen ihren Stolz laut, aber unerhört in die nordrhein-westfälische Parteienlandschaft hinaus.
Das WDR-Fernsehen entließ seine Zuschauer genau um 0.03 Uhr mit einem süffisanten »Nun koaliert mal schön« in die dunkle Nacht. Da fielen auf dem Sportkanal bereits die ersten Hüllen einer Stripperin in einer schlecht aufgeräumten Turnhalle, die sehr stark an eine Gesamtschule erinnerte. Die Turnhalle … nicht die Stripperin.
* * *
Ludwig Förster war der Mann des Montags – wenn auch noch nicht in der Fakten-Fakten-Fakten-Postille des angedickten Chefredakteurs. Bereits ab 7.30 Uhr – also zur besten Prime-Zeit – stand der Buchhändler aus Monschau aspiringestärkt Radio-Morgensendungen aus sieben Bundesländern, darunter sogar »Bayern I« mit der »Schon-wieder-dreißig-Tote«-Verkehrsfunkfanfare, wenig Rede und mehr Antwort. Kurz vor 9 Uhr meldete sich das Düsseldorfer Regionalbüro des »Spiegel« vom Karlplatz.
Bis Mittag kam der Überraschungssieger auf dreiundzwanzig Interviews.
Ministerpräsident Nils Steenken war bereits mit der ersten Lufthansa-Maschine um 6.50 Uhr aus Düsseldorf nach Berlin-Tegel geflogen, um intern beim Thing seines SPD-Parteivorstandes das Wahlergebnis zu beweinen. Wolfgang »Saddam« Thierse drückte ihn nach der Sitzung in seinen Fusselbart:
»Nils, das Ergebnis hat nichts mit dir zu tun. Das war der Zeitgeist.«
Nach draußen, gerne auch »vor der Presse« genannt, jubelte Nils Steenken anschließend verhalten, während Regierungssprecher Béla Anda wie immer schwieg. Dann holte nicht etwa Max, sondern Nils den Schieber raus, den Rechenschieber:
»Während SPD und Grüne auf 95 Sitze kommen, können CDU und FDP 88 Abgeordnete hinter sich bringen. Da alle Parteien bereits vor der Wahl klare Aussagen zur Partnerschaft getroffen haben, ist im Augenblick keine neue Regierungskoalition zu sehen. Zumal sich diese Koalition auch auf Bundesebe…«
An dieser Stelle unterbrach ihn unser aller Bundeskanzler:
»Ich sag mal so. Im Augenblick.«
Leicht irritiert fuhr Nils Steenken fort:
»Ja, ja, natürlich. Die Frage ist also: Wie verhalten sich die ›Rheinländer‹?«
»Sind das nicht alles Faschos?«, warf ein Journalist der »Lausitzer Rundschau« ein – ein Bild, das er an diesem Tag nicht allein malte und am Abend schon wieder revidieren musste.
An diesem Wahlmontag hielten nämlich zunächst noch alle »die Rheinländer« für einen erzkonservativen Ableger eines Heimattümel-Vereins mit roten Wandersocken und gefleckten, grauen Luis-Trenker-Hütchen. In der Berliner SPD-Parteizentrale an der Wilhelmstraße glaubte man fest, dass sich Ludwig Förster mit seinen 48 Sitzen auf die Seite des konservativen Lagers schlagen würde.
Davon ging man – ohne ein Gespräch geführt zu haben – auch in der Berliner Zentrale der CDU im Klingelhöfer Dreieck aus.
Deren Spitzenkandidat Bernd Balkenhol, der eher durch den Wahlkampf gefettnäpfchent war, seinen Wahlkreis »Brilon I« im Sauerland aber mit satten 62,3 Prozent gewonnen hatte, sah sich schon als kommender Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Dies verkündete er intern auch vollmundig seinem eigenen Parteivolk:
»Diese Rheinländer sind doch nur ein schlechter Eifelverein, woll, die werden doch niemals mit den Sozis ins Boot springen, woll. Nein, nein, mit deren 48 Sitzen kommen wir auf eine satte Mehrheit von 136 Stimmen, woll.«
Angela Merkel nickte zustimmend. Dabei spannte sich ihr roter Blazer, den sie wieder einmal zwei Nummern zu klein gekauft hatte.
Gegen Mittag riefen alle Parteien in Berlin zum Presse-Verlautbaren – lediglich die F.R. hatte mit der Preußensgloria-Stadt nichts am Hut und veranstaltete ihr Meeting im Bonner »Pantheon-Theater« – einem Kabarett wohlgemerkt.
Und während die SPD lamentierte, die Grünen sich vom Wähler beleidigt fühlten, die CDU Siegerlaune zeigte und die FDP sich weiterhin selbst feierte, konnte Ludwig Förster den Journalisten in Bonn nur »Mit uns hat noch keiner über eine Koalition gesprochen« in die Blöcke und Mikrofone diktieren.
Danach erklärten die neuen Rheinländer erstmalig ihr politisches Konzept – mehr als ein grober Abriss lag allerdings auch intern nicht vor.
»Ohne eine einzige politische Aussage sind wir wie die Jungfrauen zu Mandaten gekommen«, übte Ludwig Förster internen Selbstspott.
Als das Winz-Programm, das Platz auf einer halben DIN-A4-Seite hatte, am Abend durch die Medien ging, wurde CDU-Spitzenmann Bernd Balkenhol, inzwischen wieder in Düsseldorf gelandet, merklich leiser:
Da war nichts von Blut und Boden zu hören, da schwang keiner den Wanderstock zu Heimatliedern oder stimmte Haselnuss-Hymnen als Parteisong an. Den ersten Eindruck, den man von »den Rheinländern«, wie die Partei am ersten Tag nach dem Wahlerfolg noch genannt wurde, haben konnte, war der einer recht aufgeschlossenen Sponti-Gruppierung. Fern jeder Ach-hätten-wir-doch-nur-noch-unser-Bonn-Nostalgie.
Ludwig Förster erklärte, dass »auseinander wachsen muss, was nie zusammen gehört hat«. Er orakelte von einem Rheinland als eigenes Bundesland – ähnlich dem Saarland:
»Die Selbständigkeit des Rheinlands ist eine Frage der Ehre. Uns treibt keine nationale Romantik oder Abneigung gegen Westfalen und den Berlin-Zentralismus. Wir Rheinländer haben fast eine eigene Sprache, eine eigene Kultur und eine eigenen Geschichte. Der Luxemburger steht uns doch näher als der Münsterländer. Wir sind nie gefragt worden, ob wir Mitglied in dem Kunstgebilde NRW werden wollten und haben das auch nie akzeptiert. Bedenken Sie, seit 1969 sind weltweit 43 neue Mikrostaaten entstanden. Wir wollen nur ein selbständiges Bundesland werden und nicht etwa der 44. Staat.«
Dann schob er allerdings noch ein »Wenigstens jetzt noch nicht« hinterher. Aber dieses Trapsen der Eifeler Nachtigall hatte offensichtlich niemand gehört.
Ludwig Förster betonte, dass von den Unterstellungen, er wollte sich sofort von der Bundesrepublik trennen und sogar Ostbelgien »heim ins Reich« holen, nur »spinnerte Nazis träumen«:
»Ich hörte heute sogar schon von Spinnern, die deutliche Parallelen zur Anbindung Ostbelgiens an das Deutsche Reich in den 20er und 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts sehen wollen. Da ist aber überhaupt nichts dran!«
Zum Abschluss sagte er einen Satz, der Nils Steenken wie auch Bernd Balkenhol in seltener Einheit gleichzeitig schlucken ließ.
»Wir sind als Mehrheitsbeschaffer nur für den zu haben, der unsere Vorstellungen von einem selbständigen Rheinland mit auf die Schiene bringt. Wir wissen, dass wir dieses Ziel so schnell wie möglich erreichen wollen.«
Bernd Balkenhol polemisierte darauf in der »Aktuellen Stunde«, dass man mit ihm keinen »Rheinischen Karnevalsstaat, woll, mit einem Prinz an der Spitze und einer Alaaf-Hymne, woll« verwirklichen werde.
Nils Steenken hielt sich dagegen zurück. Er sprach in der »Tagesschau« nur von »Wir werden das Gespräch mit allen Parteien im neuen Landtag suchen.«
Dann schob er allerdings nach:
»Man sollte aber auch immer im Hinterkopf haben, dass wir in einem Zeitalter der Globalisierung und Integration leben. Da sind Abspaltungen eigentlich nicht die richtige Antwort auf die brennenden Fragen der Zeit.«
Dabei ahnte er, dass harte Tage auf ihn zukommen würden. Ein einsamer Ministerpräsident sang am Abend auf der Rückbank seines Dienstwagens ein einsames Lied:
»Wo de Nordseewellen trecken an de Strand, wor de geelen Blöme bleuhn int gröne Land, wor de Möwen schrieen gell int Stormgebrus.«
In die letzte Zeile stimmte dann auch Heiko Ennen, Nils Steenkens Fahrer aus Aurich, ein. Zusammen sangen sie auf der Fahrt durch das hell erleuchtete Düsseldorf den Refrain:
»Dor is mine Heimat, dor bün ick to Hus. Dor is mine Heimat, dor bün ick to Hus.«
* * *
Ludwig Förster traf sich erstmalig am Dienstag nach der Wahl mit seinen Abgeordneten in Düsseldorf. Der Buchhändler aus der Eifel kannte seinen bunt zusammengewürfelten Haufen auch nur flüchtig – immerhin hatte noch vor Monaten niemand an eine neue Partei – geschweige denn an ein freies Rheinland gedacht.
Na ja, zumindest hatte keiner diese Idee öffentlich zu propagieren gewagt.
Die Palette der Freies-Rheinland-Politiker war groß: Da saß der Bonner Abgeordnete Edward Hanfland, der nicht nur so hieß, sondern auch so aussah – E-Technikerhemd, graue Strickweste mit abgenutztem, jetzt allerdings verwaistem Buttonbereich, Cordhose, Samenstau und natürlich Socken und Sandalen. Da gab es aber auch Susanne Adrian, eine jugendlich wirkende Realschullehrerin aus Mönchengladbach, die H&M-stilsicher zur ersten Sitzung nach Düsseldorf gekommen war. Vertreten waren aber auch die Ganghofers, die Bömmelchen an den Schuhen trugen und krachledern auftraten. Bereits nach der ersten Sitzung bildeten diese um den Uerdinger Abgeordneten Johann Leisten den »Krefelder Kreis« – nicht unbedingt eine Ansammlung, die sich Ludwig Förster als zukünftige politische Weggefährten gewünscht hatte.
In bester Breiumdenbart-Politik hatten derweil SPD und CDU dafür gesorgt, dass den beiden neuen Parteien im Landtag – dazu gehörte nach vierjähriger Abwesenheit auch die FDP – unbürokratisch Fraktionsräume zur Verfügung gestellt wurden. Immerhin sollten zukünftige Verhandlungen in Sachen Machtbeschaffung nicht an so etwas profanem wie ein paar Zimmern scheitern. Das sah die FDP auch so und okkupierte mit dem Ausfuhr »Erster!« die besseren Räume für sich.
* * *
Blick zurück im Zorn.
Vor einem Jahr saß Ludwig Förster noch für die Grünen im Monschauer Stadtrat.
Seine dortigen vier Fraktions-Mitstreiter waren nicht unbedingt sein Fall gewesen: Fundis mit einer politischen Ideologie, die darauf schließen ließ, dass man die Fraktion irgendwann Ende der sechziger Jahre getötet, eingefroren und erst kurz vor der Kommunalwahl wieder zum Leben erweckt hatte.
Der Schlimmste in der Fraktion der Grünen in Monschau war aber Jürgen Lauscher, der immer schwarz-grau längsgestreifte Jeans trug.
Natürlich drehte dieser – immerhin lebten die Lauschers auf ihrem Bauernhof in Rohren gesund – seine »Drum«-Zigaretten selbst und aß auch nur Yoghurt aus eigener Herstellung. Ihm war klar, dass auch ein Öko-Raucher einmal zu einer großen politischen Belastung der Partei werden könnte und so verkündete er, dass er bald im »Kollektiv mit Gleichgesinnten« das Rauchen einstellen werde. Mit dem Gesetzentwurf »Von der Zigarette zur Yogurette!« für den Landesparteitag scheiterte er aber im Ortsverband kläglich. Kurzum: Es gab nichts, was Lauscher nicht politisch begründen musste – vom Nussaufstrich auf seinem Backautomaten-Brot bis zur Ablehnung von Kapkirschen, da »die Setzlinge immerhin noch in der Vor-Mandela-Zeit von Farbigen unter Zwang gepflanzt worden sind«.
Von den Mitgliedern der grünen Ortsgruppe wagte es allerdings niemand, ein einfaches Eifeler »Du hast se doch nicht alle!« in Richtung des grünen Fraktions- und Parteichefs zu schmettern.
Auch Ludwig Förster hatte sich anfangs zurückgehalten und so verteidigten immer mehr Monschauer Grüne den Zeitgeist mit uralten 68er Argumenten.
Die Lauscher-Sandale nebst grauer Wollsocke als Sinnbild wurde für die gesamte Fraktion zur Bremse. Wo Medienschaffende und -geschaffte eine Schere im Kopf haben, hatten die Monschauer Grünen eine ideologische Sandale. Lauscher Sandale. Inklusive grauer Wollsocke – versteht sich …
Ludwig Förster machte sich erstmalig politisch verdächtig, als er beiläufig erzählte, dass er seine Tochter Hanna im katholischen Kindergarten Monschau anmelden wollte. Lauschers Ehefrau Heidi Pötter-Lauscher, Lehrerin an der Grundschule in Mützenich, schaute nach dieser Mitteilung den Buchhändler an, als habe dieser mit einer christdemokratischen Jung-Funktionärin auf einem Fahrradstreifen im Kat-losen Wagen aus Stuttgart geknutscht.
»Was«, schrie sie, »in so einen Kindergarten willst du deine Hanne schicken!«
Ihr hennagefärbtes Haar wirbelte ein verächtliches »Nein, unser Rüdiger-Fabian wird nur einen alternativen Kindergarten besuchen.«
Ludwig Förster dachte:
»Gott-sei-Dank hat sie nicht autonom-alternativ-biologisch-vegetarischen gesagt.«
Doch grünes Szene-Schlechtgewissen schüttelte Ludwig Förster damals noch nicht locker ab und so konnte er nur verdattert antworten:
»Ja, öh, das ist so, weißt du …«
Da Ludwig Förster Frauen immer ausreden ließ, stoppte er seinen Argumentationsfluss erst, als Heidi Pötter-Lauscher Anstalten machte, sich auf ihrem Flokati vor Gram zu wälzen:
»Da kann doch wohl nur unser selbstverwalteter Kinderladen ›Scheckigbunte Rappelkiste Mützenich‹ in Frage kommen«, rief sie entgeistert aus.
Das bessere Argument war nicht unbedingt bei dem Buchhändler. Mit einem sprachunsicheren »Ja, öh, das ist so, weißt du …« konnte er erklären, dass ihm in der »Scheckigbunten Rappelkiste Mützenich« ein Platz für seine Tochter parallel zu deren Pubertätsbeginn versprochen worden sei. Er verkniff sich – nachdem seine ideologische Sandale im Kopf einmal kurz aufgetippt hatte – dass ihn bei einem Besuch des Kinderladens ein von der Galerie (unbehandeltes Holz) auf Holz-Spielzeug (bis dahin unbehandelt) pieselnder Dreijähriger leicht verstört hatte.
»Und Waldorf-Roetgen?«
Ludwig Förster verschwieg sandalengetreten, dass ihm bis dahin nur »Waldorf-Astoria New York« ein Begriff gewesen sei, und konnte seinen Kopf mit dem Hinweis auf die gen Roetgen fahrenden Kat-losen Eltern-Auto-Karawanen gerade noch aus der Schlinge ziehen.
Ludwig Förster hatte seine Hanne dann im katholischen Kindergarten »Zum unschuldigen Lämmchen« in Monschau angemeldet und wen traf er da?
Heidi Pötter-Lauscher mit Rüdiger-Fabian:
»Ja, em, öh, das ist so, weißt du …«, stotterte sie, »neue gesellschaftliche Verän…, eben die, vor allem im Osten.«
»Lass nur«, sagte Förster und hob dabei die Hand wie der alte Mao auf dem langen Marsch durch die Institutionen.
Seit diesem Zeitpunkt kauften die Lauschers ihre esoterischen Bücher nicht mehr in Försters Buchladen »Lesezeichen« an der Monschauer Laufenstraße.
Zur entscheidenden Partei-Krise kam es aber, als einige gemeine Mitglieder – darunter auch Ludwig Förster – Joschka Fischer nach Monschau einladen wollten. Bei der Parteiversammlung, die wegen der Mitgliederzahl von zwölf in der privaten Wohnung der Lauschers in Rohren stattfinden konnte, wälzten sich gleich mehrere Frauen in fundamentalistischer Einheit auf dem Flokati, als die Rede auf den grünen Außenminister kam:
»Dieses frauenfressende Monster mit seinen immer jünger werdenden Dingern.«
Zerstritten – und mit einem Abstimmungsergebnis von 9 zu 3 gegen den Außenminister – ging man auseinander. Ab diesem Zeitpunkt fiel es schwer, so etwas wie Einklang in der Monschauer Partei der Grünen zu demonstrieren.
Partei-Chef »Streifenjeans« Lauscher wurde in den folgenden Monaten in seiner Argumentation immer extremer. Im Rat der Stadt, wo selbst wohlgesonnene Sozialdemokraten bald nur noch mit dem Kopf schütteln konnten, diskutierte er seine Partei ins absolute Abseits.
In allen Parteigremien – von der Kreisversammlung Aachen bis zum NRW-Landesparteitag – erntete er nur noch Hohn und Spott und als er in einem Interview mit der »Aachener Zeitung« einen Farbbeutel-Anschlag auf Joschka Fischer nachträglich begrüßte und zu einer Wiederholung aufforderte, war es Ludwig Förster zuviel: Er verließ die grüne Partei, die er vor Jahren auf Ortsebene mitgegründet hatte und blieb als fraktionsloses Mitglied im Stadtrat.
Zwei weitere Fraktionsmitglieder traten wenige Monate später geschlossen zur PDS über – aber dies war dann nur noch eine Eintags-Lachnummer für einige lokale Zeitungen.
Jürgen Lauscher blieb somit als einziger Grüner zurück und fiel nur noch durch die Angewohnheit auf, im Stadtrat rohe Möhren zu mümmeln.
Ludwig Förster spielte lange mit dem Gedanken, der Politik endgültig den Rücken zu kehren, bis er in der Zeitschrift »Neues Rheinland«, die früher jedem Stadtratsmitglied kostenlos ins Fach gelegt wurde, einen Kommentar von Chefredakteur Jakobi las: »Rheinland«-Schilder fürs Auto seien aufgetaucht. Die Rede war sogar – wenn auch leicht satirisch gefärbt – von einem eigenen Rheinland:
Westfalenfreie Zone also.
Ludwig Förster ließ diese Idee nicht mehr los.
Er wälzte Bücher wie »Revolverrepublik Rheinland« über den Separatismus am Rhein, studierte Veröffentlichungen über die Geschichte des Rheinlands und stieß sogar auf Separatisten in der braven Eifel. Im Internet fand er: