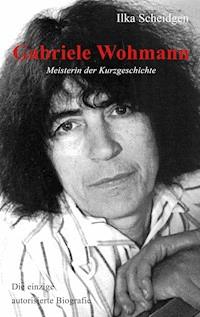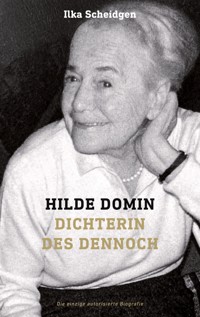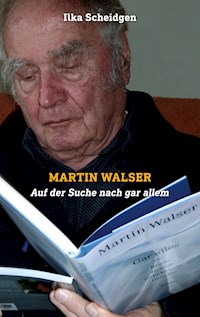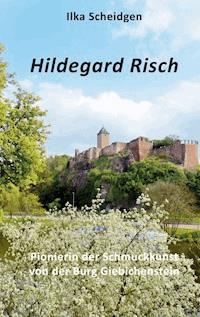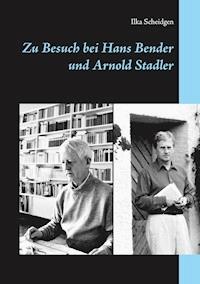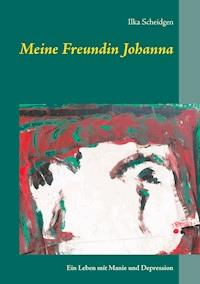
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
lka Scheidgen zeigt auch in diesem Buch, wie einfühlsam sie einschneidende Ereignisse literarisch zu verarbeiten im Stande ist. Es handelt sich um einen Roman, der Mut macht und einen Beitrag zum Verständnis und Erkennen dieser nicht leicht fassbaren Krankheit liefert. Den wechselvollen Wegen in dieser Lebensbeschreibung zu folgen, liest sich sehr spannend. Erzählt wird von den Jugend- und Studienjahren, dem Elternhaus, der Ehe. Die Bearbeitung der Familiengeschichte in einer Psychoanalyse ermöglicht Johanna langfristig die Gestaltung eines Lebens, das zwar durch große Verluste gekennzeichnet ist, aber schließlich doch aus dem Wechselbad von Manie und Depression hinführt zu einem Alltag, mit dem sie durchaus zufrieden ist. Es ist zudem ein inhaltlich dichtes und literarisch überzeugendes Buch über eine lebenslange Freundschaft: "Vielleicht ist der Grund, weshalb ich diese Geschichte aufschreiben will, der Versuch zu verstehen, warum die Welt ist, wie sie ist. Warum der eine Mensch krank wird und der andere nicht. Warum ein Mensch, den man liebt, verrückt wird.“ Was dem Text darüber hinaus Tiefe verleiht: Das Leben von Johanna spiegelt - von der Krankheit abgesehen - typische Generationsmuster wider: die Dominanz des Vaters, die Unterordnung der Mutter, die Flucht in die Ehe. Das sind biografische Erfahrungen, die viele Frauen teilen. "llka Scheidgen ist mit 'Meine Freundin Johanna' ein Roman gelungen, der sich mit einem komplizierten und in der Gesellschaft leider immer noch tabuisierten Krankheitsbild auf spannende Weise auseinandersetzt. Der aufklärt, ohne zu verurteilen. Erinnert, ohne zu beschönigen. Es wäre viel, wenn durch die stilistische Bandbreite dieser Annäherung Fernstehenden wie Betroffenen ein verständiger Zugang zu dem ermöglicht werden könnte, was Johanna leiden macht. So unerklärlich es auch sein mag. Auf diesen Seiten des Lebens." Die Tagespost "Der Text ist ein eindrückliches Erlebnis einer irrealen Welt, die auch das Elend der Psychiatrie in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg widerspiegelt." Ärzte-Zeitung "Ilka Scheidgen ist es gelungen, fernab von populärer Betroffenheitsliteratur die ergreifende Geschichte einer Frau nachzuerzählen, deren Leben zwar nicht der Normalität entspricht, deren Existenz diese Normalität aber ebenso in Frage stellt." Kölner Stadt-Anzeiger "Johanna", Ihren Roman, riskiere ich, ein 'Hauptwerk' zu nennen. Hans Bender, langjähriger Herausgeber der Literaturzeitschrift 'Akzente'
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 397
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch: „Ich sitze vor Bergen von Material. Tagebücher, Briefe, Notizzettel, fachmedizinische Gutachten, Fachbücher über Schizophrenie und über die manische Depression, die bespielten Kassetten mit unseren Gesprächen. Ab jetzt, wo ich wirklich angefangen habe, aus dem allen etwas formen zu wollen, werde ich zwei Leben nebeneinander führen, meines und das von Johanna, meiner Romanfigur.“ „Vielleicht ist der Grund, weshalb ich diese Geschichte aufschreiben will, der Versuch zu verstehen, warum die Welt ist, wie sie ist. Warum der eine Mensch krank wird und der andere nicht. Warum ein Mensch, den man liebt, verrückt wird.“
Erzählt wird von den Jugend- und Studienjahren, dem Elternhaus, der Ehe. Die Bearbeitung der Familiengeschichte in einer Psychoanalyse ermöglicht Johanna langfristig die Gestaltung eines Lebens, das insbesondere durch das Scheitern der Ehe und die Entscheidung, den Sohn beim Vater aufwachsen zu lassen, zwar durch große Verluste gekennzeichnet ist, aber schließlich doch aus dem Wechselbad von Manie und Depression hinführt zu einem Alltag, mit dem sie durchaus zufrieden ist.
„Ilka Scheidgen ist es gelungen, fernab von populärer Betroffenheitsliteratur die ergreifende Geschichte einer Frau nachzuerzählen, deren Leben zwar nicht der Normalität entspricht, deren Existenz diese Normalität aber ebenso in Frage stellt.“ - Kölner Stadt-Anzeiger
Die Autorin: Ilka Scheidgen, freie Schriftstellerin und Publizistin schreibt Lyrik, Erzählungen, Romane, Essays, Autorenporträts und Biografien. 2002 wurde sie für ihr literarisches Werk mit dem Kulturpreis des Kreises Euskirchen ausgezeichnet.
Homepage: www.ilka-scheidgen.de
Bei dem Roman handelt es sich um eine unveränderte Neuausgabe des 2003 im Psychiatrie Verlag Bonn erschienenen Buches in neuer Rechtschreibung
Die Geburt ist nicht ein augenblickliches
Ereignis, sondern ein dauernder Vorgang.
Das Ziel des Lebens ist es, ganz geboren
zu werden, und seine Tragödie, dass die
meisten von uns sterben, bevor sie ganz
geboren sind.
Erich Fromm
Es ist so leicht, verrückt zu sein, wenn du von dem, der sich erinnert, die Erinnerung nimmst, von dem, der auf die Landschaft schaut, die Landschaft, auf die er schaut, von dem, der spricht, den Gesprächspartner, und vom Betenden seinen Gott.
Jehuda Amichai
Inhaltsverzeichnis
Teil
Teil
Teil
Teil
Teil
1. Teil
Warum willst du diese Geschichte schreiben, haben sie mich gefragt. Ja, warum. Diese Frage hatte ich mir bisher nicht gestellt. Aber nun musste ich eine Antwort geben. Weil mich die sogenannten Geisteskrankheiten schon immer interessiert haben, sagte ich. Was interessiert dich so daran, insistierten sie. Und ich merkte, dass ich nicht darum herumkomme, auf diese Fragen eine Antwort zu finden, eine Antwort zu geben.
Dieses “schon immer” ist natürlich ungenau. Aber ich kann es präzisieren. Es fing damals an, als auch die Geschichte begann, die ich erzählen will.
Wir fuhren mit den Fahrrädern von der Schule nach Hause, Johanna und ich. Januar. Der Atem wurde von unseren Mündern gerissen durch den Fahrtwind. Schneller und schneller, den Rädern gleich, sprudelte Johanna Wörter, Sätze heraus. In die Schule gehen heißt, nicht sehen wollen. Eine Antwort geben, heißt Weltuntergang. Heute habe ich zum ersten Mal etwas Wahres gesagt. Ich bin zum ersten Mal eine Lebenskünstlerin geworden. Ich habe keine Schule mehr nötig. In die Schule gehen heißt, von jetzt ab nichts mehr dazulernen. Punkt ist, wenn man einen Punkt machen kann. Ich konnte noch nie einen Punkt machen. Humor ist, wenn einem der Punkt nicht alles bedeutet. Mir kann niemand etwas vormachen, weil ich meinen Punkt noch nicht gefunden habe. Darum ist mein liebstes Fach Deutsch. “Die Sprache ist die Quelle aller Missverständnisse” - Deuten Sie diesen Satz von Saint-Exupéry. Unsere Deutschlehrerin liebt solche Themen für Besinnungsaufsätze. Das Leben der Götter war Mathematik.
Es begann zu schneien. Das letzte Stück des Weges schoben wir unsere Fahrräder bis zu dem Haus von Johannas Eltern, einem großbürgerlichen Haus aus der Jahrhundertwende. Johanna hatte ganz plötzlich aufgehört zu reden. Sie sah mich an. Paradox ist das schönste Wort, es klingt auch schon so schön, findest du nicht, sagte Johanna. Mir fiel keine Antwort darauf ein. Plötzlich hatte es Johanna eilig. Tschüß bis morgen.
Am nächsten Tag fehlte Johanna in der Schule. Sie fehlte ein halbes Jahr lang. Und keiner wusste, wo sie war. Ihre Mutter sagte mir nur, dass Johanna sehr krank sei, dass man sie nicht besuchen könne. Aber über Briefe würde sie sich sicher freuen.
Also schrieb ich ihr. Immer an die Adresse ihrer Eltern.
Zwei Monate später, im März, erhielt ich das erste Lebenszeichen von Johanna, einen Brief auf einem dünnen linierten Blatt Papier. “Alle Deine Karten und Briefe sind bei mir angekommen. Tausend Dank! Wie Du mich umsorgst und verwöhnst! Vor allem Deine lustigen Briefe haben mich soo...aufgemuntert. Stell Dir vor, an meinem Namenstag musste ich ganz oft niesen. Was macht die Schule? Grüße die anderen. Mir geht es schon viel besser.” Es folgte ein kleiner Absatz. “Du, auch ich sah die Schneeflocken treiben, so langsam und sicher, wie von fester Hand gesendet. Ich bin glücklich, nicht zu schmelzen, sondern zu leben, immer weiter.”
Als Johanna verschwand an einen Ort, von dem ich nicht wusste, was er zu bedeuten hatte, war sie gerade siebzehn Jahre alt geworden. Ich war damals sechzehn Jahre alt.
Seitdem sind mehr als dreißig Jahre vergangen.
Mein Mann sagt oft, besonders wenn der Abend lang geworden ist, einer Beschwörungsformel gleich , diese beiden Sätze: Mit sechzehn Jahren habe ich beschlossen, herauszufinden, warum ich auf dieser Welt bin. Und ich werde nicht eher aus der Welt gehen, bis ich es herausgefunden habe.
Vielleicht ist der Grund, weshalb ich diese Geschichte aufschreiben will, ein ähnlicher: versuchen zu verstehen, warum die Welt ist, wie sie ist. Warum der eine Mensch krank wird und der andere nicht. Warum ein Mensch, den man liebt, verrückt wird.
Es ist nicht meine Geschichte, die ich erzählen werde. Und ich wusste lange nicht, ob ich das Recht hätte, über sie zu schreiben. Bis Johanna eines Tages zu mir sagte: Mach du es. Für mich.
Wir haben einen Anfang gemacht. Johanna kam mit dem Zug zu mir, und wir begannen unser Gespräch. Sie hat alte Briefe mitgebracht und Aufzeichnungen aus der Zeit ihrer ersten Erkrankung. Während wir reden, sehe ich die Szene von damals wieder vor mir, erlebe sie, als sei sie erst gestern passiert.
Wir fahren mit den Rädern von der Schule nach Hause. Und wie die Räder sich schneller drehen, drehen sich Johannas Gedanken im Kopf, immer schneller, schneller. Ihre Worte perlen, gleiten immer schneller, schneller. Ihre Sätze quellen wie ein Quell. Immer mehr, immer mehr. Die Bremsen der Fahrräder funktionieren. Die Bremse in Johannas Kopf scheint nicht mehr zu greifen. Ihr Seil ist gerissen. Irgendetwas hat es reißen lassen.
Weißt du noch, sagt Johanna, ich habe mir damals für mein Zimmer eine Tapete aussuchen dürfen. Meine Mondrian-Tapete. Lauter angedeutete halbe Rechtecke. Die Konstruktion über dem Leeren.
Ich erinnere mich nicht an die Tapete in Johannas Zimmer. Ich war nicht so wahrnehmungsaufgeladen wie sie.
Jugendschizophrenie. Die Diagnose, mit der Johanna ins Landeskrankenhaus eingewiesen wird. Ein Urteil. Ein Tabu.
Am Silvesterabend des Jahres 1943, einem Freitag, um 20 Uhr 45 wird Johanna geboren. Das erste Kind von Gertrud und Arnold Möhrle. Das ersehnte erste Kind ist kein Sohn, wie der Vater es sich gewünscht hat. Die Mutter ist glücklich über ihr Töchterchen. Sie gibt ihr den Namen Johanna. Wäre es ein Junge geworden, hätte er Johannes geheißen.
Der Vater ist als Stabsarzt im Feld. Die Mutter lebt bei den Verwandten ihres Mannes auf einem herrschaftlichen Anwesen im Münsterland. Selbst der entbindende Arzt im Matthiasspital muss von dem mächtigen Wunsch der Eltern nach einem Stammhalter gewusst haben. Als er das blasse und etwas bläuliche Baby hochhält und es der erschöpften Mutter zeigt, kommentiert er ihre Frage, was es denn sei: der Junge ist ein Mädchen.
Da fing es auch schon an zu weinen, schreibt die Mutter in ihr Tagebuch und notiert die Maße ihres Neugeborenen, um diese in einem Luftpostbrief an ihren Mann zu leiten: Länge 49 cm, Gewicht 2800 gr., Kopfumfang 34 cm.
Auf das Telegramm mit Johannas Geburtsanzeige, das die Verwandten für sie aufgeben, erhält sie erst drei Wochen später eine Nachricht aus Russland.
Ein Kriegsjahr geht zu Ende. Ein neues beginnt. Erst nach viereinhalb Monaten wird der Vater sein Kind zum ersten Mal sehen. Er hat zwei Wochen Heimaturlaub. Johanna darf morgens zu Vati ins Bett. Sie sagt brr. Ihr erstes Gemüse ist von Vati gepflückte Brennnesseln. Johanna isst den ganzen Teller leer.
Auf Familienfotos aus jener Zeit strahlt die Mutter glücklich, und auch der Vater scheint recht stolz auf sein Töchterchen zu sein. Nach diesem kurzen Urlaub zieht der Vater wieder in den Krieg.
Es galt einmal der Erklärungsansatz der “schizophrenogenen Mutter”, das heißt der Mutter, die durch ihr Verhalten gegenüber ihrem Kind schuld ist an der Entstehung oder am Ausbruch der Schizophrenie bei ihrem Kind.
Was hätte denn Johannas Mutter falsch gemacht? Was hat sie anders gemacht als Abertausende anderer Mütter, deren Kinder nicht schizophren geworden sind.
Die Mutter registriert freudig die Fortschritte, die Klein-Johanna von Woche zu Woche macht. Besondere Aufmerksamkeit widmet sie der ausreichenden Menge Nahrung, die ihr Kind zu sich nimmt. Peinlich genau notiert sie die täglichen Grammzahlen, die Johanna an Muttermilch trinkt und die sie mit dem Fläschchen zufüttern muss.
Ja, sie hat Johanna die Brust gegeben und war traurig, wenn sie zu wenig Milch hatte.
In einem kleinen Kalender hält sie fest, was für eine Mutter wichtig ist in der Entwicklung ihres Kindes: das erste Lächeln, die erste Träne, das erste Zähnchen, der erste Brei. Sie lacht, freut sich, wenn man mit ihr spricht. Sie hebt den Kopf hoch. Sie erzählt jetzt viel. Sie richtet sich an den Fingern hoch und dreht sich auf die Seite. Johanna sitzt allein! Sie ist sehr lustig, kann aber auch sehr zornig sein. Sie lernt stehen und das Töpfchen benutzen. Sie läuft an der Hand. Sie macht winke-winke zu Vatis Bild.
Johanna ist ein ein Viertel Jahre alt, als der Vater zum zweiten Mal zu Besuch kommt, auf Genesungsurlaub aus dem Lazarett. Sie kann jetzt die Treppe allein rauf und runter laufen. Sie ist ein lebhaftes und fröhliches Kind. Auf dem Schoß vom Papa fühlt sie sich ungemütlich. Er ist für sie doch sehr fremd.
Johanna lernt sprechen wie jedes andere Kind. Ihre ersten Worte sind Mama und Papa. Das ist so normal und selbstverständlich, dass ich es nicht zu erwähnen brauchte. Aber als sie fähig ist, ganze Sätze zu sprechen, darf sie bei dieser Anrede für ihre Eltern nicht länger bleiben. Sie muss zu ihren Eltern Vater und Mutter sagen. Dass das etwas Besonderes ist, merkt sie schon früh, wenn sie andere Kinder Mutti und Vati rufen hört. Eigentlich möchte sie viel lieber so sein wie ihre Spielgefährten, sich nicht von ihnen unterscheiden. Und doch spürt sie auch schon als kleines Kind ein Hochgefühl, ein Herausgehoben sein aus der Schar der Gleichaltrigen.
Ich sitze vor Bergen von Material. Tagebücher, Briefe, Notizzettel, fachmedizinische Gutachten, Fachbücher über Schizophrenie und über die manische Depression, die bespielten Kassetten mit unseren Gesprächen.
Ab jetzt, wo ich wirklich angefangen habe, aus dem allen etwas formen zu wollen und nicht nur protokollhaft Gehörtes und Gelesenes niederzuschreiben, werde ich zwei Leben nebeneinander führen, meines und das von Johanna, meiner Romanfigur. Es gibt sie in der Wirklichkeit, und doch wird meine Johanna mit dieser nicht deckungsgleich sein. Ich bin dabei, eine Figur zu erfinden.
Hatte die Mutter von Johanna eine “geizige Brust”? Nicht ausreichend gestillt worden zu sein, halten manche Psychiater für eine mögliche Ursache für das spätere Auftreten einer Manie. Ist das Kind durch das Saugen an der Brust satt geworden, fällt es in einen zufriedenen Schlaf.
Gibt es da wirklich einen Zusammenhang? Führt eine unzureichende orale und zudem körperlich zärtliche Befriedigung beim Saugen aus der Mutterbrust zu einer späteren Psychose? Es heißt, Kinder würden dadurch für ihr Leben geprägt. Sie könnten keine positive Lebenseinstellung aufbauen. Und was ist mit den Kindern, die nie gestillt wurden? Fest steht für Forscher, die sich mit der Entstehung von Psychosen, dem, was man früher Geisteskrankheiten nannte, beschäftigen, dass die oralen Bedürfnisse und Versagungen im Säuglingsalter immens wichtig sind und dass sie sich auf das spätere Leben auswirken.
Gertrud Möhrle schrieb ihre ersten Erlebnisse mit dem Stillen auf: Und nun kam der große Augenblick, das erste Anlegen. Meine kleine Johanna wusste gleich Bescheid, packte kräftig zu und “nuckelt wie ‘ne Alte”, wie Schwester Berta sagte. Ein seltsames Gefühl. Ich war sehr stolz, wenn es auch nur ein paar Gramm waren.
Abends zum ersten Mal im Sitzen gestillt, das geht viel besser. Die Brust ist zu Anfang immer ganz hart, dann kann das Kind schlecht fassen und beißt, das tut weh. Aber allmählich geht es, obwohl das Stillen anstrengend ist.
Nach einem wunderbaren Schlaf kam mein Kindchen, machte aber Zicken, hörte immer wieder mit dem Trinken auf, hatte aber sichtlich noch nicht genug. Eine dreiviertel Stunde quälten wir uns, waren beide rechtschaffen müde; dann war die Brust leer, und es schlief ein, das kleine Dingelchen, mein Kleinwinziges.
Heute um 7 bekam sie nicht genug. Erst trinkt sie 5 Min. furchtbar hastig, dann 5 Min. langsam und dann schläft sie ein, lässt aber beileibe nicht los, erst wenn man ihr lange die Nase zuhält. Mir erscheint das grausam, ebenso wie das Kläpsegeben, aber es muss sein, sagt der Onkel Doktor, der sie heute selbst tüchtig schüttelte. Nach dem Stillen bleibt sie immer noch etwas da, dann habe ich meine helle Freude an ihr. Meist schläft sie, blinzelt aber zuweilen auch mit den Äugelchen, die graublau sind. Sie ist ein echtes Möhrlein.
Heute Mittag hat sie auch nicht genug bekommen und wollte sich gar nicht beruhigen. Ich dachte, eine Mutter muss das doch fertig bringen, wiegte sie im Arm; schließlich streichelte ich ihr ganz zart das Bäckchen. Darüber schlief sie allmählich ein.
Komisch ist mein Häschen, wenn es sich beim Trinken anstrengen muss und die Stirn in Falten legt, dann abwechselnd ein Auge auf und zu macht und mich anblinzelt. Ich muss dann immer so lachen, dabei wird die Brust erschüttert, und sie trinkt weiter. Heute komme ich nicht auf 50 g, leider!
Heute hatten wir Alarm und mussten in den Keller. Danach trank sie nur 10 g! Ich bin ganz traurig. Woran mag das wohl liegen? Johännchen ist ganz wehrig, trinkt ganz hastig ein paar Züge und hört dann wieder auf. Nach einer halben Stunde hat sie 30 g getrunken. Wir pumpen, und es gibt noch 20 g, die sie aus der Flasche trinkt. Also 50 g hätte ich, warum trinkt sie dann nicht besser? Um 3 dasselbe Theater. “Das muss ganz anders werden, mein Kind”, würde Vati sagen. Wir müssen uns weiter anstrengen.
Dr. Wolters, dem ich mein Leid klagte, hat mir ein Präparat verschrieben, aber ich glaube nicht so recht daran, aber wohl an Bohnenkaffee. Doch den gibt es jetzt nicht. Weinen hilft ja nichts, aber ich bin sehr traurig. Wolters sagt: Wo nichts ist, hat der Kaiser sein Recht verloren.
Nach dem achten Tag endet das Tagebuch.
Immer habe ich Durst gehabt, sagt Johanna. Bei uns zu Hause durfte am Tisch nicht getrunken werden. Also ging ich hinterher zum Wasserkran und trank Wasser.
An eine Begebenheit aus der Kindheit kann sie sich noch gut erinnern. Sie war damals ungefähr vier Jahre alt. Vater und Mutter machten mit ihr eine lange Wanderung am Rhein entlang. Die kleinen Beinchen waren vom schnellen Laufen schon ganz müde. Da kamen sie an einer schönen Gastwirtschaft vorbei. Ach, sah das nett aus! Unter einer großen Kastanie standen Tische mit rotweiß-karierten Tischdecken, und die grünen Gartenstühle luden so recht zum Ausruhen ein. Johanna zupfte die Mutter am Rock, wies auf die Stühle und wimmerte: “Ich hab Durst. Kann ich eine Limonade haben?” Flehentlich sah sie zur Mutter hoch. Doch als diese gerade im Begriff war, schwach zu werden und dem Drängeln Johannas nachzugeben, herrschte der Vater sie an, das käme auf keinen Fall in Frage, wozu sie denn schließlich ihren Proviant im Rucksack mitgebracht hätten.
Mutter sah den Staub auf den Kinderschuhen und konnte sich gut vorstellen, dass ihre Kleine nach dem Marsch, den der Vater mit unverminderter Schnelligkeit fortsetzte, reichlich müde sein musste. Doch sie wagte nicht zu widersprechen. Ein scharfer Blick ihres Mannes sagte ihr, dass es zwecklos war, sich zu widersetzen. Sie wusste, dass Arnold eiserne Prinzipien hatte, auch wenn sie sich manchmal fragte, ob er es damit nicht übertrieb. Einer dieser Grundsätze war jedenfalls, auf einer Wanderung niemals in ein Restaurant zu gehen.
Schlaflosigkeit, drei Nächte lang. Der Vater sagt: Trink etwas Zuckerwasser, das hilft. Aber es half nicht. Bevor Johanna weggebracht wurde, schrieb sie zwei Kladden voll.
Bis jetzt hat mich leider niemand verstanden. Dann ist meine Mutter gestorben, weil ich sie dir schenken wollte. Dies ging aber nur am 9. März. Was machst du am liebsten, mein Vater? Ich habe nur eine Mutter gehabt. Zum ersten Mal konnte ich etwas glauben. Immer wenn jemand etwas Verkehrtes sagt, dann kann man zum ersten Mal glauben. Dies wirst du erst am 9. März verstehen, weil meine Mutter erst am 9. März gestorben ist, weil ich glaube, dass Sprache die Quelle aller Missverständnisse ist. Warum ist Sprache die Quelle aller Missverständnisse? Weil die Liebe Quelle der Missverständnisse ist. Heute habe ich zum ersten Mal geliebt, was ich bisher nie geglaubt habe. Nur deshalb, Mutter, kann ich dich verstehen, weil du auch Briefe schreibst. Briefe schreiben hat meine Mutter zum ersten Mal am 9. März gekonnt. Ich freue mich auf den Tod meiner Mutter, das ist mein einziger Glaube. Heute habe ich zum ersten Mal geglaubt, was Liebe ist. Liebe ist Humor. Denn nur Humor kann die Welt retten. Deshalb konnte ich nicht in die Schule gehen, weil ich zum ersten Mal geglaubt habe. Deshalb kann ich nicht mehr glauben, dass es unsere Deutschlehrerin Fräulein Kunze gibt. Die Sprache ist die Quelle aller Missverständnisse. Wahrheit ist, was nicht falsch ist, die Menschen nennen dies Humor. Heute habe ich zum ersten Mal etwas Wahres gesagt. Fräulein Kunze, am 9. März werde ich zum ersten Mal etwas sagen, was wahr ist und nicht falsch sein kann. Ich kann zum ersten Mal glauben. Liebes Fräulein Kunze, ich bin zum ersten Mal eine Lebenskünstlerin geworden.
Es geht noch seitenweise so weiter.
In der Rückschau beschreibt Johanna ihr Befinden in diesen drei Tagen folgendermaßen: Ich hatte ein absolutes Hochgefühl. Es war mir so, als wenn ich in einem Moment alle Zusammenhänge der Welt verstünde und erkenne. Ich glaubte, ganz viel verändern zu können. Ich fühlte mich mit einem Mal ganz wichtig und war überzeugt, Wesentliches beitragen zu können für eine positive Veränderung der Welt.
Als wir das letzte Mal gemeinsam von der Schule nach Hause fuhren, ahnten weder sie noch ich, dass ihr eine fünfmonatige Hölle bevorstand.
Aber ich muss noch weiterlesen in den beiden Heften, die Johanna mir mitgebracht hat. In dem einen kommt dreimal mein Name vor. Es ist das der letzten schlaflosen Nacht vor ihrer Einweisung in die geschlossene Abteilung der Psychiatrie.
Es gibt keinen subjektiven Kitsch, leider besteht er objektiv. Seltsam, alle Menschen können etwas auf Anhieb. Das habe ich bis vor zwei Tagen nicht gekonnt. Jetzt kann ichs. Es bleibt mir nichts mehr übrig, als die Leute zu reizen. Alle Unterschiede zwischen Humor, Spott usw. gibt es nicht. Für mich ist andere Leute ärgern leicht. Man muss sie ärgern, das ist ihnen ungewohnt, erregt sie; (leider) nur so kann man ihnen die Wahrheit sagen.
Bis jetzt habe ich geglaubt, die eigene Zeitepoche bestimmen zu können. Gott, danke, dass das nicht geht. Es ist doch logisch, dass das nicht geht, ebenso wie Gott nicht nicht absolut sein kann, so kann der Mensch nichts Absolutes schaffen.
Gott, warum ist der Mensch allein?
Für mich bleibt nur die Aufgabe, alles was bisher in der Welt ist, richtigzustellen. Ich muss erklären, weil mich die Menschen sonst nicht verstehen.
Niemand lernt dazu, alle lernen Phrasen. Es ist eine dumme Angewohnheit, zu schreiben, zu sprechen. Leider, das ist für mich viel schwieriger, es für die Menschen kompliziert auszudrücken. Als erstes werde ich die Bibel auf ihren Wahrheitsgehalt untersuchen. Das ist im Augenblick das Wichtigste. Bis jetzt habe ich sie noch nie gelesen, jetzt werde ich sie lesen.
Ich will Irrenhäuser besuchen.
Bis jetzt habe ich noch niemanden gefunden, der glaubt, außer mir; Gott, lass mich die Ilka angeln. Man kann Menschen angeln. Lass mich in den Augen der Welt verblüffende Fragen stellen. Das Einfache und nur das Einfache kann gelten. Das, was ich bisher nicht wusste, ist, ein Kind zu bleiben.
Warum machen sich die Leute das Leben kompliziert?
Bis jetzt habe ich noch niemanden gefunden, der weiß, was Liebe ist. Ein Glaube kann nur kindlich sein.
Ich werde die Welt auf den Kopf stellen.
Wahnsinn ist schön?
Mutter, hättest du jetzt gesagt, was du gerne möchtest, du hättest alles haben können, nämlich hier drin lesen, dann verstündest du mich, oder auch nicht.
Mutter, versteh doch, wie ich dich liebe.
Mutter, ich kann es nicht mehr aushalten, wenn du mich verstehen wolltest, wie man ein Kind liebt.
Ach, ich bin so müde, ich möchte schlafen, kann nicht.
Vater, wenn du mir einmal etwas Medizinisches erklären willst, tu es jetzt. Aber es bleibt eben immer etwas unerklärlich.
Käme doch einer, suchte und fände dies; aber weil es richtig ist, dass ich niemandem etwas zeigen kann, müssen sie schon zu mir kommen, wenn sie wollen. Willst du, Ilka?
Der Schlüssel zu meinem Buch ist vielleicht, dass ihr alles in Frage stellt. Du brauchst es hoffentlich nicht. Wann versteht mich einer? Schade, Shaw, dass du nicht mehr lebst, vielleicht hättest du mich verstanden.
Eins habe ich nie verstehen können, warum haben die “berühmten Leute” alles so kompliziert gemacht, wo es doch viel einfacher, leichter geht. Leicht ist das Angenehmste. Das muss man sich immer wählen. Da habt ihr einen meiner Grundsätze.
Ich wage zu behaupten, mit 18 weiser zu sein als alle Menschen über 18, die ich bisher kennengelernt habe. Verstehst du mich, Ilka? Die “Besserwisser” sagen jetzt zwar nein, sie sagen zu allem nein, was wahr ist.
“Die Sprache ist die Quelle aller Missverständnisse”. Das ist doch wenigstens klar geworden, weil das, was ich hier geschrieben habe, wahr ist, aber nicht klar genug ausgedrückt. Das nicht Klare wird missverstanden.
Alles was man ausspricht, möchte man ausgesprochen wissen.(Hoffentlich hat nicht das auch schon jemand vorher gedacht.) Wenn ich etwas finde, so freue ich mich, dass auch schon jemand so gedacht hat.
Hier enden die Aufzeichnungen von Johanna.
Johanna hatte in diesen drei Tagen ein Omnipotenz Gefühl. Keineswegs kam ihr der Gedanke, krank zu sein. Sie merkte auch nicht, dass sie sich immer weiter von der Realität entfernte. Aber es half ihr, dass sie die sie überschwemmenden Gedanken zu Papier bringen konnte.
Aus der Bibliothek ihres Vaters hatte sie sich kurze Zeit zuvor zwei Bücher herausgenommen und mit großer Intensität gelesen. Es waren die Bücher von Kretschmer “Geniale Menschen” und “Körperbau und Charakter”. Die Fragen nach Normalität und Genialität fesselten sie ungeheuer. Der Zufall wollte es, dass kurz darauf in der Schule über dieses Thema gesprochen wurde. Die Frage “was ist normal? was ist Normalität?” ließ sie nicht zur Ruhe kommen. Hinzu kam der Satz im Aufsatzthema “Die Sprache ist die Quelle aller Missverständnisse”, über den sie wieder und wieder nachdachte.
All diese Gedanken kreisten in Johannas Kopf, beunruhigten und fesselten sie, aber es war niemand da, mit dem sie darüber sprechen oder diskutieren konnte. Assoziationen kamen und überschwemmten sie. Gedankengänge verselbständigten sich, in denen sie sich verlor wie in einem Labyrinth.
In die Schule konnte sie so nicht gehen. Also hielt der Vater sie zunächst zu Hause. Die permanente Schlaflosigkeit wurde ihm dann aber auch suspekt. Als Arzt registrierte er, dass sie bedrohliche Ausmaße annahm.
Bei einem Freund, von dem er wusste, dass er ab und zu zu einer Nervenärztin in Behandlung ging, erfragte er deren Adresse.
Dann ging alles sehr schnell. Die Ärztin kam zu ihnen ins Haus und sprach mit Johanna. Sie merkte sofort, dass sie jetzt nur noch eine Beruhigungsspritze geben konnte und dass sie Johanna zur weiteren Behandlung in eine psychiatrische Klinik einweisen musste.
Johanna mochte diese Ärztin von Anfang an nicht. Sie war ihr ausgesprochen unsympathisch und sie dachte, die versteht mich ja gar nicht, wer ich bin und was ich denke. Aber dann waren ihre Gedanken und Gefühle schon durch die Medikamente gedämpft. Nur noch wie durch einen Schleier bekam sie mit, dass ein Krankenwagen gerufen wurde. Sie wurde auf eine Trage gelegt, und dann ging es quer durch D. zum Landeskrankenhaus. Im Volksmund sagt man dazu Irrenanstalt. Der Vater und die Ärztin begleiteten sie. Die Mutter blieb zurück, aufgelöst in Sorge und Kummer, was nun mit ihrer Tochter geschähe.
Johanna spricht ruhig. Sie ist konzentriert. Sie hat sich eine Menge vorgenommen zu erzählen. Uns fliegt die Zeit davon.
Weißt du noch? In der Obersekunda war ich neu in die Klasse gekommen. Wir waren von Berlin nach D. gezogen, und ich fühlte mich noch sehr fremd. Du hast mich, die Neue, als erstes begrüßt. Du botest mir an, mich auf meinem Nachhauseweg zu begleiten. Da fühlte ich mich schon ein bisschen weniger fremd.
Johanna sagt: Du bist der rote Faden in meinem Leben.
Wir kennen uns seit 39 Jahren. Seit 39 Jahren sind wir miteinander befreundet.
Versuche, zu erklären, warum es zum Ausbruch der manischdepressiven Psychose kam. Sie müssen Annäherungsversuche bleiben. 1962 als sie bei Johanna zum ersten Mal manifest wurde, hatte man in der Psychiatrie eine festumrissene Lehrmeinung dazu. Es gab die endogenen, d. h. erblich bedingten Psychosen, zu denen man die Schizophrenie und das manisch-depressive Irresein, wie man das Krankheitsbild der Zyklothymie auch nannte, zählte. Die exogenen Psychosen fasste man unter dem Begriff Neurosen zusammen. Letztere galten als heilbar, erstere nicht.
Mit Erklärungsversuchen zu einer endogenen Psychose oder “Geisteskrankheit” gab man sich zum damaligen Zeitpunkt nicht ab. Viele Patienten, die mit einer solchen Diagnose in eine Klinik eingewiesen wurden, blieben über Jahre dort hospitalisiert. Manche haben die Anstalt ihr Leben lang nicht mehr verlassen.
Johanna sagt: Wenn die Kenntnisse der Psychiatrie früher schon so weit gewesen wären, wie sie es heute sind, hätte Hölderlin nicht jahrelang geistig verwirrt und von der Außenwelt abgeschnitten in seinem Turmzimmer leben müssen.
Schon sehr früh hat Johanna gespürt, dass ihre Mutter sich in der Familiensituation, in die sie durch ihre Heirat hineingeraten war, nicht richtig wohl gefühlt hat. Von der Familie ihres Mannes wurde sie nie richtig akzeptiert. Während des Krieges und bis zur Rückkehr des Mannes aus englischer Kriegsgefangenschaft im Februar 1946 wohnte sie im Landhaus der Schwiegereltern. Das war ursprünglich zum Schutz der jungen Familie gedacht. Inzwischen war auch das zweite Kind, der lang ersehnte erste Sohn Eduard geboren. Doch fühlte sich Johannas Mutter dort eher geduldet als wirklich angenommen.
Sobald Arnold Möhrle zu seiner Familie zurückgekehrt war, zogen sie in das elterliche Haus in D., wo er seine Arztpraxis im Souterrain des im Krieg schwer beschädigten Hauses einrichtete. Das war zunächst als Übergangssituation gedacht, weil das Geld in den ersten Nachkriegsjahren knapp war. Es schien auch eine Menge Vorteile zu bieten. Der Vater musste nicht außer Haus tätig sein, außer zu Hausbesuchen, die ein praktischer Arzt damals noch regelmäßig machte. Frau und Kinder hatten ausreichend Platz in dem geräumigen Haus. Auch begann Frau Möhrle sogleich, in der Praxis ihres Mannes die Aufgabe einer Sprechstundenhilfe zu übernehmen.
Als das Haus vollständig wieder hergestellt ist, ziehen die Eltern von Arnold Möhrle zurück in das von ihnen erbaute Haus. Sie wohnen in der ersten Etage, der Sohn mit seiner Familie im Hochparterre.
Von nun an war eindeutig klar, wer im Hause das Sagen hatte. Johannas Großmutter, aus einer reichen Fabrikantenfamilie stammend, hatte das Geld mit in die Ehe gebracht. So hatten sie und ihr Mann Max sich gleich zu Anfang ihrer Ehe dieses großbürgerliche Haus in D. bauen können. Die Herkunft aus dem “Geldadel” hat sie ihre Familie, besonders aber ihre Schwiegertochter, die mit im Hause lebte, zeitlebens spüren lassen.
Gertrud Möhrle hat mit ihrer Heirat ihre eigene Existenz aufgegeben. Ihre Stärken lagen, ganz anders als in der Familie ihres Mannes, die väterlicherseits Ärzte und Juristen hervorgebracht hatte, im musischen Bereich. Sie las gerne und viel, spielte Cello in einem Quartett und hatte Fremdsprachen studiert. Als Auslandskorrespondentin hatte sie mehrere Jahre in London gearbeitet. Obwohl auch in ihrer Familie viele Naturwissenschaftler waren, wurde nebenbei das Musische sehr gepflegt, ein Gebiet, das in der Familie ihres Mannes völlig brach lag.
Johanna hat ihre Mutter nie musizieren gehört.
Ihre eigenen Begabungen und Bedürfnisse hat diese nach ihrer Heirat nicht ausgelebt. Sie hat geglaubt, ihre Interessen zugunsten ihrer Ehe aufgeben zu müssen, hat sich angepasst an die Familie , in die sie hineingeheiratet hatte. Häuslicher Frieden war ihr wichtigstes Ziel.
Und doch hat die Mutter darunter gelitten, ohne es offen zeigen zu können und zu wollen. Johanna entdeckte sie oft weinend oder mit verweinten Augen. Aber gesprochen hat sie nie über das, was sie bedrückt.
Die Mutter hat Johanna immer leidgetan.
Es war einfach kein Gleichgewicht der Gefühle vorhanden, erzählt Johanna. Da gab es einerseits sehr erhebende Ereignisse im Familiengeschehen. An die erinnert sich Johanna sehr lebhaft. Jeden Sonntag nach dem gemeinsam besuchten Gottesdienst in der nur wenige hundert Meter von ihrem Wohnhaus entfernten Heilig-Geist-Kirche waren sie zum Frühschoppen beim Regierungspräsidenten, einem Bruder von Johannas Großvater, eingeladen. Das waren Situationen, in denen auch schon die kleine Johanna mit ihren vier Jahren das Gefühl vermittelt bekam, dass sie zu einer ganz besonderen Familie gehören. Das empfand sie schon damals, dass da etwas stattfand, was über den Durchschnitt und den Alltag hinausging. Vielleicht wurde es ihr zusätzlich auch noch erklärt. Jedenfalls war es ganz anders als zu Hause. Ihre Eltern hat Johanna immer als sehr streng erlebt, unnötig streng, fand sie damals und auch im Nachhinein.
Deshalb waren diese Frühstücke, bei denen sie und ihr Bruder leckere Säfte und sogar einen Schluck Wein aus Kristallgläsern zu trinken bekamen und dazu die herrlichsten Plätzchen, die man sich vorstellen kann, schon etwas Besonderes.
Wenn Johanna sich zurückerinnert, ist es eigentlich immer so gewesen in ihrer Familie, dass da stets diese beiden gegensätzlichen Pole waren: sehr starke beklemmende Gefühle und auch gute, schöne und befreiende.
So versucht sie auch zu erklären, oder sie will es sich auch erklären, diese mangelnde Ausgeglichenheit. Wieweit sie auch ihre Empfindungen in die frühe Kindheit zurückverfolgt, dieses Wechselbad der Gefühle bestimmte das ganze Familienleben.
Gestern habe ich Johanna besucht. Es ist ein sommerlich warmer Tag Ende April. Wir sitzen auf dem Balkon. Die Birken im Hof schütteln ihr hellgrünes Kleid. Eine Mohnblume im Blumenkasten hat am Morgen ihre Blütenblätter entfaltet.
Wir erzählen. Ich habe noch so manche Fragen zu ihrer Familiengeschichte. Johanna holt aus dem Regal Fotoalben und Bücher. Eine Dokumentation der Tuchfabrik, die den Eltern ihrer Großmutter gehört hat, von ihren Anfängen 1835 bis zu deren Auflösung 1960, als die Zeiten für Stoffproduktion in Deutschland nicht mehr rentabel waren, zeigt sie mir. Ein Buch über einen Verwandten, der Bischof in Aachen war, ein weiteres über einen Onkel, der eine bedeutende Kunstsammlung besessen und diese in eine Stiftung umgewandelt hat. Auch in der Familie von Johannas Mutter existierten zwei Kattunfabriken. Es ist offensichtlich, dass Johannas Eltern aus begüterten und gehobenen gesellschaftlichen Familien stammen.
Dann zeigt sie mir die Stammtafeln ihrer beiden Eltern. Die der Mutter reicht bis ins Jahr 1657, die des Vaters bis 1704 zurück. In beiden Stammbäumen tauchen die Namen des jeweiligen Ehepartners in den schön gemalten Zweigen und Ästen an mehreren Stellen auf. Du musst dir vorstellen, sagt Johanna, meine vier Großeltern hatten alle ein gemeinsames Stammelternpaar. Eigentlich ist so etwas doch Inzucht. Das konnte ja nicht folgenlos bleiben.
Auch ein Versuch, etwas zu erklären, wofür es unsagbar viele Erklärungsmodelle gibt. Eine Krankheit, die auch heute noch mit einem Tabu belegt ist, eine Krankheit, die nicht nur den Kranken, sondern seine ganze Familie stigmatisiert, eine Krankheit, die allen daran Beteiligten unendlich viel Leid beschert, weil die Gesellschaft im allgemeinen, aber auch oft die Allernächsten auf sie verständnislos, ängstlich und hilflos oder mit Abwehr reagieren. Eine Krankheit, die mit Begriffen bezeichnet wird, die Angst machen: Wahnsinn, Irresein, Verrücktsein, Geisteskrankheit. Anders als bei körperlich Kranken, denen Mitleid und Fürsorge sicher sind, droht einem psychisch kranken Menschen Unverständnis und Ausgrenzung.
Ich habe Johanna immer als einen sehr sensiblen, einen besonders ehrlichen Menschen erlebt. Sie sagt, was sie denkt und kümmert sich dabei nicht darum, was vielleicht in dieser oder jener Situation zu sagen schicklich oder nützlich wäre. Ihre Gefühle sind wahr. Jegliches Taktieren oder ein Kalkül um eines Vorteils, einer besseren, angenehmeren Sichtweise ist ihr fremd. Wahrscheinlich ist sie dünnhäutiger. Sicher ist sie verletzlicher als viele von uns, die wir als normal gelten. Gerade diese Empfindsamkeit macht Johanna in meinen Augen zu einem Menschen, der intensiver erlebt, tiefere Gefühle für seine Mitmenschen hat und sein Leben kreativer gestaltet. Ich weiß, dass in ihr eine große Sehnsucht nach Liebe und Geborgenheit ist. Auch nach Verständnis und Harmonie.
Die Krankheit Wahnsinn ist, habe ich manchmal gedacht, bei manchen Menschen vielleicht der allerletzte Ausweg aus einer unerträglich gewordenen Lebenssituation, eine Art Schutz sogar davor, nicht das zerstören zu müssen, was ihnen das Liebste und Lebenswichtigste ist.
Doch was Johanna damals erleiden musste, als die Krankheit Schizophrenie bei ihr zum ersten Mal ausbrach, war entsetzlich. Gleich nach der Aufnahme wurde sie in einen sogenannten Wach Saal in der geschlossenen Abteilung der Psychiatrie gebracht. Ein Riesensaal mit sechzig oder siebzig Betten, dicht nebeneinander, nur durch einen schmalen Gang getrennt. Sofort bekam Johanna dort von einer Krankenschwester eine Beruhigungsspritze. Jetzt bekam Johanna richtig Angst und Panik. “Was soll das, wo bin ich hier?” schrie sie und schlug mit Armen und Beinen um sich. Die Stelle, wo ihr mit Gewalt die Spritze gesetzt worden war, schmerzte. Voller Süffisanz sagte Schwester Astrid zu einer Kollegin: “Und das soll die Tochter von einem Arzt sein!”
Man zog ihr die Kleider aus, zog ihr ein Anstaltshemd an und stieß sie unsanft auf ein Bett. Dann verlor Johanna erst einmal das Bewusstsein. Die Spritze hatte gewirkt. Sie war ruhiggestellt.
Als sie wieder wach wurde, - wie viel Zeit inzwischen vergangen sein mochte, dafür hatte sie keinerlei Gefühl - registrierte sie voller Verwunderung und Entsetzen, dass sie sich mit unzählig vielen Menschen in einem Raum befand und dass man ihr nicht den geringsten persönlichen Gegenstand gelassen hatte. Nackt bis auf das Hemd lag sie da. Ungläubig, was mit ihr geschehen war. Irgendwann sah sie die beiden Eltern neben dem Bett stehen, als sie wach wurde. Aber sie taten nichts, waren hilflos und mussten traurig und unverrichteter Dinge wieder fortgehen. Johanna sah in ihre ratlosen Gesichter und merkte, dass sie ihr in ihre hermetische Wahrheit nicht folgen konnten. Ihre übertrieben wirkenden besorgten Mienen und unsicher-fahrigen Gesten waren ein beredtes Zeugnis dafür. Was bedeutete es schon für sie, wenn die Eltern von irgendwelchem Alltagskram berichteten, der nichts mit ihren Gedanken und Gefühlen zu tun hatte? Für Johanna gab es keine Vergangenheit und keine Zukunft, nur die öde Gegenwart in diesem Haus.
So ging das tagein, tagaus. Mit Megaphen ruhiggestellt, fast kein Mensch mehr. Schlafend oder vor sich hindämmernd. Nach Wünschen oder Bedürfnissen wurde sie nie gefragt.
Einmal zog sich eine Frau nackt aus und tanzte auf dem Bett herum. Sofort kamen zwei Krankenschwestern, packten sie und verpassten ihr eine Spritze.
Johanna nahm nur wahr, dass ihre Fingernägel länger und länger wurden. Keiner kümmerte sich darum. Noch immer, nach Wochen in diesem schrecklichen Riesensaal, besaß sie nichts, was ihr gehörte, nicht einmal einen Kulturbeutel mit einem Kamm, einer Bürste oder einer Nagelschere. Und die Nägel wuchsen und wuchsen.
Für besonders unruhige Patienten gab es innerhalb des Wachsaals einen kleinen Extraraum. Eine Art Gefängniszelle oder eigentlich eher eine Folterkammer. Auch Johanna lernte ihn von innen kennen. Das war so ziemlich das Schlimmste, was sie jemals in ihrem Leben erlebt hat. Ein winziger Raum, in dem gerade eben eine Pritsche Platz hatte. Auf dieser Pritsche musste Johanna liegen, an Händen und Füßen mit Ketten gefesselt. Bewegungsunfähig. Preisgegeben. Entwürdigt. Gedemütigt. Nichts als die kahlen Wände um sich und in der Tür ein Fensterchen, durch das sie beobachtet werden konnte. Die Not, wenn sie auf die Toilette musste und niemand kam, um sie zu holen. So kam es vor, dass Johanna in ihren eigenen Ausscheidungen liegen musste.
Es war die Hölle.
Ob die Eltern von diesen Zuständen etwas ahnten? Wahrscheinlich nicht. Und sie werden auch nicht näher gefragt haben.
Irgendwann, es mochten vielleicht vier bis sechs Wochen vergangen sein, sah sich Johanna einmal im Spiegel. Ungläubig starrte sie den Kopf an, der ihr Spiegelbild sein sollte. Das sollte sie sein? Sie erkannte sich nicht. Die Haare lang und wirr. Sie, Johanna, die immer so gerne hübsch und adrett aussah. Es konnte nicht sein! Sie begriff es einfach nicht. Warum ließ man sie so verkommen? Warum achtete niemand darauf, dass sie gekämmt wurde?
In dem riesigen Wach Saal stank es nach den Ausdünstungen der vielen Menschen. Nur ab und zu wurden die Betten gewechselt, wenn Ab- oder Neuzugänge stattfanden. Johannas Bett stand direkt unter einem großen vergitterten Fenster. Der Blick heraus in den Anstaltsgarten machte sie traurig und erfüllte sie mit großer Einsamkeit. Die Bäume waren kahl. So unbelaubt fühlte sich auch Johanna. Ihre Phantasie hatten sie mit Beruhigungsmitteln weggespritzt.
Wenn die Eltern zu Besuch kamen, waren sie, obwohl man Johanna zuvor herausgeputzt hatte, erschüttert über das Aussehen ihrer Tochter. Doch sie glaubten, dass es ihr in ihrem Zustand nichts ausmachen würde, wie es um ihr Äußeres bestellt sei. Wie viel leichter ist es doch, dachte der Vater, die Kranken, die in seine Praxis kamen, zu behandeln. Bei ihnen konnte er erkennen, um welche Krankheiten es sich handelte. Ihre Krankheiten konnte er behandeln, ihre Wunden verbinden und heilen. An Johannas innere Wunden kam er nicht heran. Hilflos musste er mit ansehen, dass sie in einer ihm fremden Welt lebte, zu der er keinen Zugang hatte.
Eines Tages kam Johanna neben eine junge Frau zu liegen, die ihr gegenüber sehr aggressiv reagierte. In einem Anfall von Wut biss diese sie heftig in die Hand. Die Wunde blutete. Schwester Astrid kam mit einer Beruhigungsspritze zu der Bettnachbarin und schrie sie an: ”Was Sie brauchen, ist eine Zwangsjacke!” Johanna wurde in die Ambulanz gebracht. Ihre Hand musste genäht werden.
Auch wenn die Wunde schmerzte und schlecht heilen wollte, brachte dieser Zwischenfall etwas Leben und Abwechslung in den todlangweiligen Ablauf von Stunden, Tagen und Wochen. Nach der Megaphenbehandlung wurde zur Elektroschockbehandlung übergegangen. Noch immer schlief Johanna im Wach Saal.
Was mit ihr geschah, wenn sie nun abgeholt und in ein Behandlungszimmer gebracht wurde, in dem sie auf einer Art Operationstisch festgeschnallt und ihr lauter Kabel angelegt wurden, wusste sie nicht. Das Wort Elektroschocks hatte sie zuvor niemals gehört.
Natürlich wusste sie, dass sie in der “Klapsmühle” von D. war. Der bloße Name des Ortes, an dem sich die Klinik befand, galt in der Bevölkerung ja als Synonym für die Verwahrung von Bekloppten, Verrückten, geistig Verwirrten. So wie es in dem Berliner Schlager so lustig heißt: “Du bist verrückt, mein Kind, du kommst nach Plötzensee, wo die Verrückten sind, da gehörst du hin. Trallali, Trallala...” Auch die vielen komischen Menschen um sie herum legten ihr nahe, dass mit ihr etwas nicht stimmte. Aber was? Sie hörte nie Stimmen, hatte keinen Verfolgungswahn und keine Halluzinationen. Dennoch wollten die Ärzte, die sie an die Apparate anschlossen und durch ihr Gehirn Strom jagten, ihr ein Stück ihrer Persönlichkeit wegnehmen, da war Johanna sich sicher. Denn jedes Mal nach einer solchen Behandlung konnte sie sich an nah Zurückliegendes nicht mehr erinnern. Was hatten sie mit ihr vor? Würde es ihnen tatsächlich gelingen, die verstörenden Anteile zu entfernen und sie dennoch heil und ganz zu belassen? Insgesamt aber war Johanna so teilnahmslos und ergeben dem gegenüber, was mit ihr geschah, dass sie für Ärzte und Schwestern eine angenehme Patientin war. Es kam ihr nicht in den Sinn, zu fragen oder aufzubegehren. Denn so war sie erzogen worden, zu Ehrfurcht vor jedem Arzt. Ein Arzt, das wusste sie von ihrem Vater, will immer nur Gutes für seinen Patienten.
Während der Visite rauschte der diensthabende Arzt mit einem Tross Schwestern durch den Wach Saal, wandte sich zu dieser oder jener Patientin, auf die eine der Schwestern den Doktor mit leisen Einflüsterungen, begleitet von herrischen oder angewiderten Gesten, hinwies. Es handelte sich um besondere Problemfälle, die sich den schwesterlichen Anweisungen widersetzt hatten oder in sonst einer Weise eklatant auffällig waren.
Normalerweise war es nicht üblich, dass ein Arzt sich mit einem Patienten unterhielt, ihn nach irgendwelchen Ereignissen aus der Zeit vor dem Krankheitsausbruch oder nach seinen Familienverhältnissen befragte. Eine psychotherapeutische Behandlung gehörte damals nicht zum Katalog der Maßnahmen in einer psychiatrischen Klinik. Im Gegenteil, die Nervenärzte waren der Auffassung, dass nur eine medikamentöse Therapie oder die Elektroschockbehandlung überhaupt einen gewissen Grad an Besserung bei den sogenannten Geisteskrankheiten herbeiführen konnten.
Die Tage gingen dahin. Und es änderte sich nichts. Man war zum Nichtstun verurteilt. Manchmal träumte sich Johanna nach Hause oder in die Schule, aber diese Träume hatten etwas von Nebel, der sich entzog, wenn man ihn erfassen wollte. Johanna sah auf den Kieswegen im Klinikpark Menschen auf und ab gehen. Sie sehnte sich danach, Luft auf ihrer Haut zu spüren, den Wind durch ihre Haare streifen zu lassen. “Die linden Lüfte sind erwacht” , diese sehnsuchtsvolle Melodie ging ihr durch den Kopf, und sie wurde sehr traurig.
Ich schickte Johanna Briefe in ihr Exil, von dem ich glaubte, dass es ein normales Krankenhaus war. Und doch ahnte ich, dass sie sich dort sehr einsam fühlte. Ich versuchte, ihr mit Worten Mut zuzusprechen, sandte ihr Zeichen der Freundschaft in der Hoffnung, dass sie dort, wo sie war und wo ich sie nicht besuchen durfte, ihr ein wenig Trost spendeten, sie ein wenig aufzuheitern und sie wissen zu lassen, dass ich an sie dachte.
Es wird Frühling. Ob du auch die ersten zarten Frühlingsboten siehst? Ich denke jetzt an dich und wäre so gerne an deiner Seite. Du hast Schweres zu tragen. Aber du sollst wissen, dass du nicht allein bist. Wenn du mal traurig bist, lass dich einfach davon nicht unterkriegen! Du schaffst es ganz bestimmt! Alles wird wieder gut. Ich weiß, das sagt sich so leicht für mich, die ich nicht vom Leid betroffen bist. Aber, du glaubst mir doch, dass ich mit dir fühle?
Weißt du, ich kann mich noch sehr gut an meinen ersten Schultag auf dieser Schule erinnern. Ich stand da, und alle begafften die Neue! Nur du strahltest mich an! Sicher weißt du es gar nicht mehr, aber es hat mich sehr glücklich gemacht.
Gestern hatten wir unser Gruppentreffen. Wenn du erst wieder dabei sein könntest! Wir vermissen dich sehr!
Heut in der Schule ist’n Ding passiert bei der Wahl der Klassensprecherinnen. Statt 24 haben 27!! gewählt, zu Gunsten von Ursula Polke, wie sich bei der zweiten Wahl herausstellte. Ja, es geschehen Sachen! Sonst ist alles wie sonst (ein Supersatz, haha!) : langweilig, anstrengend, manchmal interessant.
In dieser Woche schreiben wir noch eine Mathe- und Lateinarbeit. Da heißt es noch ein bisschen büffeln...Fast hätte ich noch etwas Aufregendes vergessen zu erzählen. Vorigen Freitag ist mir im Stadion während des Sportunterrichts mein Fahrrad gestohlen worden. Ich war so blöd und hatte es nicht angeschlossen! Nun muss ich erst mal sehen, wo ich ein neues her bekomme. Ma chère, lass es dir gut, nein besser, gehen und werde bitte ganz schnell wieder gesund! Je t’ embrasse und bin dir in Gedanken ganz nah.
Ab und zu erhielt ich von Johanna einen Brief oder eine Karte. Selten genug, um auf die vielen Fragen, die ich hätte stellen mögen, wie es Johanna wirklich ging in der immer länger währenden Zeit ihrer Abwesenheit, daraus eine befriedigende Antwort ablesen zu können.
Auf einer Karte mit Maiglöckchen schrieb sie: Auch im März, da wird es wieder grün...Ostergrüße sind (fast) selbstverständlich! Viel Freude im nächsten Jahr (ich meine Schuljahr). (Erst) jetzt habe ich dein Namenstagsgedicht (ganz richtig) verstanden. Vielen Dank (auch) für your lovely letters and postcards. Wohin geht die Osterreise? Wenn noch jemand mitfahren möchte, ich verleihe mein Fahrrad gern. Ich habe Freude und Frieden gefunden (bezieht sich beides aufs Leben) , einstweilen noch im Bett. Ich denke viel an euch alle. Merci und good-bye.
Inzwischen war Johanna aus der geschlossenen Abteilung in die Nervenklinik verlegt worden. Endlich konnte sie sich freier bewegen, sie durfte auch in den Anlagen des Klinikgeländes spazieren gehen. Wie intensiv sie die Gerüche wahrnahm! Sie steckte ihre Nase in den Flieder und ließ sich von seinem Duft betäuben. Endlich dem versifften Gestank des “Gefängnisses” entkommen. Johanna betrachtete die Blumen in den Rabatten, die sauber geharkten Kieswege, die alten Buchen am Rande des Klinikparks. Eigentlich war es schön hier draußen, besonders jetzt, wo die Sonne alles, sie eingeschlossen, mit Wärme verwöhnte. Doch, leider, war die Zeit des Atemholens immer nur sehr kurz. Dann musste sie zurück in das hässliche alte Backsteingebäude mit den langen, nach Reinigungsmitteln riechenden Anstaltsfluren, zurück zu den Krankenschwestern, die ihre Patienten wie ein Regiment Kadetten befehligten, die sie schikanierten, anschnauzten und verhöhnten. Johanna fühlte sich von ihnen wie der letzte Dreck behandelt, nicht wie ein Mensch, sondern wie Material.
Johanna galt noch keineswegs als geheilt. Nach den Elektroschocks sollte nun eine neue Errungenschaft in der Psychosetherapie an ihr ausprobiert werden, die sogenannte Insulinkur.
Dieser Insulinkur mussten Johannas Eltern zustimmen, weil sie nicht ganz ungefährlich war. Sie wurden auch darauf hingewiesen, dass ihre Tochter dadurch sehr viel an Gewicht zunehmen würde. Doch das erschien ihnen das geringere Übel zu sein, wenn durch diese Methode der Behandlung eine Chance auf baldige Heilung bestünde.
Johanna wurde nicht gefragt.
Die Insulinkur war eine furchtbare Prozedur. Aus den verschiedenen Häusern der Anstalt wurden die Patienten, die für diese Behandlung vorgesehen waren, zu einem speziellen Gebäude gebracht. Dort wurde man auf ein Bett gelegt und bekam das Insulin verabreicht. Das Ganze dauerte mehrere Stunden. Eine Zeitlang war man regelrecht weg. Anschließend hatte man quälenden Hunger und Durst.
Die Schwester, die die Insulinpatienten betreute, war besonders biestig. Dass ihr der Beruf offenbar keinen Spaß machte, ließ sie ständig an den Patienten aus. “Na, was spinnst du denn heute wieder zusammen?” fragte sie Johanna höhnisch, dabei hatte sie gar nichts Besonderes gesagt. Zu einer anderen sagte sie, als sie etwas von einem weißen Pferd erzählte, das bei ihr zu Hause jetzt über die Koppel jagte: “Hat dein Engel dir das heute wieder zugeflüstert?” Es war eine Frau, die immer still vor sich hin lächelte und nur ganz selten sprach.
Durch die täglichen Insulininjektionen waren die Patienten ständig komagefährdet. Deshalb hatten sie Pillen bei sich, die sie sofort einnehmen mussten, wenn ihnen flau wurde, damit sie nicht ins Koma fielen. Insgesamt eine höchst gefährliche Situation. Aber es hieß, bei einigen Patienten habe diese Insulinkur geholfen, also versuchte man es halt damit.
Ob sie bei Johanna etwas geholfen hat, wer will es beurteilen? Ein sichtbarer Effekt war jedenfalls, dass sie ziemlich füllig geworden war. Und das gefiel ihr nicht besonders gut.
In der neuen Abteilung der Nervenklinik waren sie wenigstens bedeutend weniger Patienten in einem Raum. Auch durfte die Mutter Johanna dort öfter besuchen. Sie fragte Johanna auch nach Lektürewünschen, weil diese darüber geklagt hatte, wie entsetzlich langweilig ihr sei und wie groß ihre Sehnsucht nach guten Büchern. Was die Mutter dann aber mitbrachte, waren meistens fürchterlich langweilige Sachen, die sie wahrscheinlich nach dem Gesichtspunkt ausgewählt hatte, dass sie Johanna nicht unnötig aufregen sollten. Auch die Briefe, die, an Johanna gerichtet, an die Adresse der Eltern geschickt werden mussten, wurden vor ihrer Übergabe an sie auf Harmlosigkeit und Verträglichkeit geprüft.
Ob auch Johannas Briefe einer Zensur unterworfen wurden, bevor sie weitergeleitet wurden, weiß ich nicht. Sie waren so normal, wie Briefe nur normal sein können. Johanna nahm Anteil am schulischen Leben ihrer Freundinnen, sie reagierte auf das, was ihr an lustigen, berichtenswerten Geschehnissen aus dem Alltag brieflich übermittelt wurde. Sie bewies Humor und Anteilnahme. Sie reflektierte über sich und ihre Gefühle und schrieb darüber, wie jeder normale Mensch es getan hätte und tun würde.