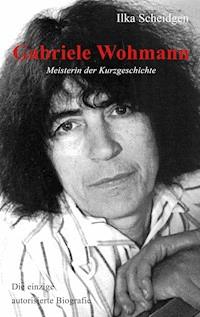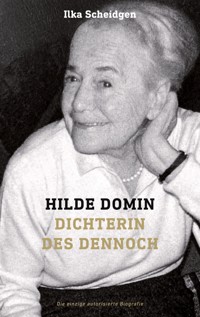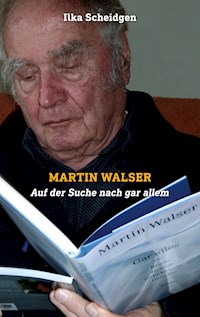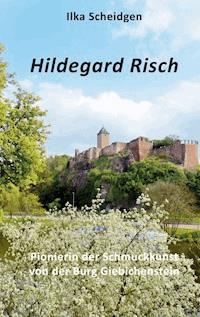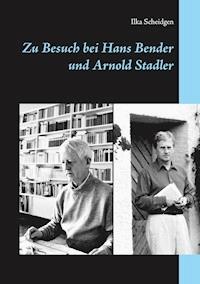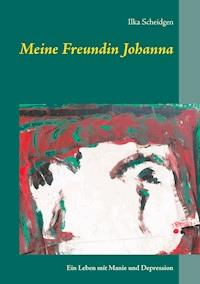Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
„Wir Schriftsteller des 20. Jahrhunderts werden nie mehr allein sein. Im Gegenteil, wir müssen wissen, dass wir dem gemeinsamen Elend nicht entrinnen können und dass unsere einzige Rechtfertigung, wenn es eine gibt, darin besteht, nach bestem Können für die zu sprechen, die es nicht vermögen. Wir müssen in der Tat für alle die Menschen sprechen, die in diesem Augenblick leiden.“ Dieser Satz von Albert Camus, anlässlich der Nobelpreisverleihung für Literatur an ihn im Jahre 1960, ist programmatisch zu verstehen für Autoren, die sich im 20. und 21. Jahrhundert den existenziell wesentlichen und bedrängenden Fragen gestellt haben und noch stellen. „Dichtung, die eine Not nicht mehr wendet, wird nicht zerschlagen, sondern vergessen“, formulierte Marie Luise Kaschnitz. Wie auch der Autor Patrick Roth in einem Text bekennt: „…abzutragen die Berge. Die Bilder, die uns ins Genick schossen, die Augen schlossen, die Herzen sprungbereit machen aus Angst…unseren Kampf mit der Schuld, mit den Schuldigern und Schuldigen.“ Der vorliegende Band mit dreizehn Dichterporträts möchte hinlenken auf die Tatsache, dass der Mensch ganz allgemein auf ein Transzendentes, auf Gott bezogen ist, auch und gerade trotz Auschwitz, nach dem alle Unschuld verloren ist und der unleugbaren Tatsache, dass der Mensch zu grauenhafter Vernichtungsgewalt fähig ist, der moderne Mensch nach dem Sinn von Gott, Erlösung, Leben nach dem Tod nur noch unter Vorbehalt zu fragen wagt oder ganz aufgehört hat, sich diesen elementaren Sinnfragen zu stellen. Die porträtierten Dichter haben sich den Sinnfragen des Lebens in ihrem Werk gestellt. Sie haben je eigene Antworten gefunden. Die Porträts laden den Leser ein, sich mit Leben und Werk dieser exemplarisch ausgewählten Autoren des 20. und 21. Jahrhunderts zu beschäftigen und mit ihnen oder durch sie sich offen zu halten für die Fragen, die unser Leben bestimmen. Denn Dichtung „ist immer ein Raum, der sich nicht abschließen lässt, der auf etwas Offenes weist ganz so wie der Glaube, der auf etwas hinweist, was meinen Horizont übersteigt“, wie es der Lyriker Christian Lehnert formuliert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 219
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch: „Wir Schriftsteller des 20. Jahrhunderts werden nie mehr allein sein. Im Gegenteil, wir müssen wissen, dass wir dem gemeinsamen Elend nicht entrinnen können und dass unsere einzige Rechtfertigung, wenn es eine gibt, darin besteht, nach bestem Können für die zu sprechen, die es nicht vermögen. Wir müssen in der Tat für alle die Menschen sprechen, die in diesem Augenblick leiden.“
Dieser Satz von Albert Camus anlässlich der Nobelpreisverleihung für Literatur an ihn im Jahre 1960 ist programmatisch zu verstehen für Autoren, die sich im 20. Und 21. Jahrhundert den existenziell wesentlichen und bedrängenden Fragen gestellt haben und noch stellen.
„Dichtung, die eine Not nicht mehr wendet, wird nicht zerschlagen, sondern vergessen“, formulierte Marie Luise Kaschnitz. Wie auch der Autor Patrick Roth in einem Text bekennt: „…abzutragen die Berge. Die Bilder, die uns ins Genick schossen, die Augen schlossen, die Herzen sprungbereit machten aus Angst…unsern Kampf mit der Schuld, mit den Schuldigern und Schuldigen.“
Die Porträts laden den Leser ein, sich mit Leben und Werk dieser dreizehn exemplarisch ausgewählten Autoren des 20. und 21. Jahrhunderts zu beschäftigen und mit ihnen oder durch sie sich offen zu halten für die Fragen, die unser Leben bestimmen. Denn Dichtung „ist immer ein Raum, der sich nicht abschließen lässt, der auf etwas Offenes weist ganz so wie der Glaube, der auf etwas hinweist, was meinen Horizont übersteigt“, wie es der Lyriker Christian Lehnert formuliert.
Ilka Scheidgen schreibt seit vielen Jahren Autorenporträts für Zeitungen und Zeitschriften. Ihr Band „Fünfuhrgespräche“ (2008) wurde ein großer Erfolg. Über ihre weiteren Veröffentlichungen informiert www.ilka-scheidgen.de
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Albert Camus
Hilde Domin
Marie Luise Kaschnitz
Christian Lehnert
Esther Maria Magnis
Francois Mauriac
Luise Rinser
Patrick Roth
Edzard Schaper
Reinhold Schneider
Arnold Stadler
Martin Walser
Gabriele Wohmann
Rezensionen
Einleitung
Das Dilemma der modernen Zeit ist, dass nach dem Sinn von Gott, Erlösung, Leben nach dem Tod viele nur noch unter Vorbehalt zu fragen wagen oder ganz aufgehört haben, sich diesen elementaren Sinnfragen zu stellen. Dichter haben schon immer eine Rolle als Propheten innegehabt.
Der vorliegende Band mit dreizehn Dichterporträts möchte hinlenken auf die Tatsache, dass der Mensch ganz allgemein auf ein Transzendentes, auf Gott bezogen ist, auch und gerade trotz Auschwitz, nach dem alle Unschuld verloren ist und der unleugbaren Tatsache, dass der Mensch zu grauenhafter Vernichtungsgewalt fähig ist.
Die porträtierten Dichter haben sich den Sinnfragen des Lebens in ihrem Werk gestellt. Sie haben je eigene Antworten gefunden. Die Hälfte der Porträts beruht auf persönlichen Begegnungen.
Die Porträts laden den Leser ein, sich mit Leben und Werk dieser zwölf exemplarisch ausgewählten Autoren des 20. und 21. Jahrhunderts zu beschäftigen und mit ihnen oder durch sie sich offen zu halten für die Fragen, die unser Leben bestimmen. Denn Dichtung „ist immer ein Raum, der sich nicht abschließen lässt, der auf etwas Offenes weist ganz so wie der Glaube, der auf etwas hinweist, was meinen Horizont übersteigt“, wie es der Lyriker Christian Lehnert formuliert.
Albert Camus
Als der Dramatiker, Romancier und Essayist Albert Camus am 4. Januar 1960 bei einem Autounfall ums Leben kam, trauerte die Welt um ein Idol, einen Aufrechten, einen Wahrheitssucher, einen, der sich in einer wahren „Besessenheit für die Gerechtigkeit“ (André Malraux) aufrieb, einen, der mit Wort und Tat für Humanismus gekämpft hatte. Sein Tod wurde als „absurd“ empfunden, im Sinne seines großen Essays „Der Mythos des Sisyphos - Ein Versuch über das Absurde“.
Camus war mit seinem Verleger und Freund Michel Gallimard im Auto unterwegs auf der Heimfahrt von Lourmarin in der Provence nach Paris. Kurzfristig hatte er sich entschlossen, nicht wie ursprünglich geplant mit dem Zug (zusammen mit seiner Frau) nach Paris zu fahren. Bei dem noch an der Unfallstelle im Fond des an einem Baum völlig zertrümmerten Autos gestorbenen Dichters fand man das unbenutzte Bahnticket sowie das unvollendete Romanmanuskript „Le Premier Homme“.
Mit dem Literatur Nobelpreisträger von 1957, den die schwedische Akademie für ein Werk auszeichnete, das „die Probleme beleuchtet, die sich in unserer Zeit dem Gewissen der Menschen stellen“, verlor die Welt einen ihrer ganz Großen. In einem Vortrag an der Universität Uppsala im Zusammenhang mit der Nobelpreisverleihung hatte er geäußert: „Wir Schriftsteller des 20. Jahrhunderts werden nie mehr allein sein. Im Gegenteil, wir müssen wissen, dass wir dem gemeinsamen Elend nicht entrinnen können und dass unsere einzige Rechtfertigung, wenn es eine gibt, darin besteht, nach bestem Können für die zu sprechen, die es nicht vermögen. Wir müssen in der Tat für alle die Menschen sprechen, die in diesem Augenblick leiden.“
Der Schriftsteller William Faulkner bekannte in einem Nachruf: „Auch im Augenblick, da er an den Baum prallte, suchte und befragte er sich noch. Ich glaube nicht, dass er im Getöse jenes Augenblicks die Antwort gefunden hat. Ich glaube nicht, dass man die Antworten überhaupt finden kann, ich glaube nur, dass es ständig und ohne Unterlass eines der menschlichen Absurdität teilhaftigen Sterblichen bedarf, um sie zu suchen. Es gibt ihrer nie viele zur gleichen Zeit. Aber zumindest einen gibt es immer irgendwo, und das genügt, um uns alle zu retten.“
Und Jean-Paul Sartre, der literarische und philosophische Weggefährte, dessen anfängliche Freundschaft mit Camus 1952 zerbrach, als Sartre sich auch auf dem Höhepunkt sowjetischen Terrors zum Kommunismus bekennt und gleichzeitig in seinem Magazin Les Temps Modernes Camus philosophische Inkompetenz vorwirft, weil er sich gegen den Imperialismus in West und Ost engagiert, gegen jegliche Ideologie und für die Menschenrechte eines jeden Individuums, anerkennt nach Camus' Tod in dessen Werk „das Vorhandensein des Moralischen, mitten in unserer Epoche“. Sartre schrieb: „Er (Camus) stellt in unserem Jahrhundert, und zwar gegen die Geschichte, den wahren Erben jener langen Ahnenreihe von Moralisten dar, deren Werke vielleicht das Echteste und Ursprünglichste an der ganzen französischen Literatur sind." Posthum wies er Camus den ihm gebührenden Rang zu.
Leben und Werk von Albert Camus von seinem Tod her aufzurollen, scheint mir nur folgerichtig. Denn es ist der Tod, gegen den er in all seinen Werken anschrieb. „Wenn der Tod die einzige Lösung ist. befinden wir uns nicht auf dem richtigen Weg. Der richtige Weg führt zum Leben, an die Sonne ...“
Unter der Sonne Algeriens wurde Albert Camus am 7. November 1913 in Mondovi geboren. Bereits im Oktober 1914 stirbt sein Vater Lucien Auguste Camus, der in Belcourt als Kellermeister in einer Weinhandlung gearbeitet hatte, an der Front der Marne-Schlacht. Die Mutter, eine einfache Frau, die des Lesens und Schreibens unkundig ist. zieht mit Albert und seinem Bruder Lucien zu ihren Eltern und muss zuerst in einer Rüstungsfabrik, später als Putzfrau arbeiten. Diese ärmliche Welt seiner Kindheit beschreibt Camus in mehreren frühen Erzählungen, die unter dem Titel „Licht und Schatten" 1937 als sein erstes Buch in Algerien veröffentlicht werden. Schon hier finden sich Gedanken, die für Camus lebenslang von Bedeutung bleiben sollen. „Der wahre Mut besteht immer noch darin, die Augen weder vor dem Licht noch vor dem Tod zu verschließen“ und „dass es darauf ankommt, menschlich und einfach zu sein. Nein, es kommt darauf an, wahr zu sein, dann fügt sich alles andere ein, die Menschlichkeit und die Einfachheit.“
In dem unvollendet gebliebenen Roman „Der erste Mensch“, der erst 1994 posthum in Paris veröffentlicht wurde und mit seinem Erscheinen zu einer wahren Camus-Renaissance und -Begeisterung führte, kehrt der Held Cormery - so nennt sich Camus in diesem autobiografischen Buch - in diese Welt der Einfachheit, einer Art karger Vollkommenheit zurück. Es geht um Heimkehr, um das Wiederfinden des verlorenen Paradieses der Kindheit, um die „Suche nach der verlorenen Zeit“, um dadurch seine besitzlose Familie dem Nichts des Vergessens, der Namen- und Geschichtslosigkeit zu entreißen. Auch um die Suche nach dem Vater, dem schmerzlich entbehrten, an dessen Grab in St. Brieux in der Bretagne sich der Sohn plötzlich bewusst wird, dass er mit seinen vierzig Jahren bereits elf Jahre älter ist als der gefallene Vater, und er empfindet: „Etwas entsprach hier nicht der natürlichen Ordnung, und eigentlich herrschte hier, wo der Sohn älter war als der Vater, nicht Ordnung, sondern nur Irrsinn und Chaos.“
Zwischen seinem ersten Buch „Licht und Schatten" und dem Manuskript „Der erste Mensch“, wie es bei Camus' Tod vorgefunden wurde, sollten 23 Jahre vergehen und noch weitere 24 Jahre bis zu dessen endgültigem Erscheinen. Zu der Neuauflage seines ersten Buches im Jahre 1958 hatte Camus geschrieben, dass seine gesamte Arbeit vergeblich gewesen sei, sollte es ihm nicht gelingen, dieses noch einmal geschrieben bzw. das Buch seiner Kindheit vollendet zu haben. Denn eins ist für ihn sicher, „dass nämlich ein Menschenwerk nichts anderes ist als ein langes Unterwegssein, um auf dem Umwege der Kunst die zwei oder drei einfachen, großen Bilder wiederzufinden, denen sich das Herz ein erstes Mal erschlossen hat.“ Diese „Umwege der Kunst“ hatten einige der wichtigsten Werke der Weltliteratur hervorgebracht.
Der Grundschullehrer Louis Germain erkennt die außergewöhnliche Begabung seines Schülers Albert und fördert ihn, so dass Camus das Gymnasium und später die Universität besuchen kann. Ihm wird er das gedruckte Exemplar seiner Nobelpreisrede widmen. Schon bald nach Beginn seines Studiums beschließt Camus, dem auf Grund seines Gesundheitszustandes (er erkrankte an Tuberkulose, die ihn zeitlebens beeinträchtigte) eine Professorenlaufbahn verschlossen bleibt, Schriftsteller zu werden. Alles ich ihm drängt dazu, sich mitzuteilen und in Worten auszudrücken.
Bald schon, ab 1932, schreibt er Essays für algerische Zeitschriften und wendet sich früh dem Theater zu. das seine große Liebe und Quelle des Glücks bleiben soll. „Mich erfüllt ein ausgeprägtes Verlangen, die Menge des Unglücks und der Bitterkeit, die die Menschheit vergiftet, verringert zu sehen.“ Camus schreibt Theaterbearbeitungen, führt Regie und spielt auch selbst. Als Journalist beim Alger Republicain kommt er mit den Problemen der Araber in Berührung und schreibt Sozialreportagen über das Elend der Kabylen, wobei er sich unmissverständlich und unerschrocken auf die Seite der Unterdrückten und Rechtlosen stellt.
1938, ein Jahr vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, beginnt Camus mit drei seiner wichtigsten Werke, die sich mit dem Absurden beschäftigen: dem Roman „Der Fremde“, dem philosophischen Essay „Der Mythos des Sisyphos“ und dem Theaterstück „Caligula“. Bezeichnend ist, dass er diese drei Werke, an denen er arbeitet, sein „Oeuvre“ nennt. Es spricht für die Genialität des Dichters und Denkers Albert Camus, dass er als Fünfundzwanzigjähriger nicht etwa unausgegorene Jugendwerke schreibt, sondern in den drei Sparten, die alle gleichermaßen seinem nach Wahrheit dürstenden Intellekt entsprechen, bereits vollendete Kunstwerke schafft.
Der Roman „Der Fremde" erschien 1942 während der deutschen Okkupation Frankreichs und wurde als Ausdruck einer Generation verstanden, die während zweier Weltkriege den Zusammenbruch aller Werte und Ordnungen erfuhr. Mersault, ein kleiner Angestellter in Algier, tötet ohne ersichtlichen Grund am Strand unter glutheißer Sonne einen Araber, wird vom Gericht des Mordes angeklagt und zum Tode verurteilt. Der Bericht über diese Ereignisse, auch über den Tod der Mutter, von Mersault in Ichform scheinbar teilnahmslos vorgetragen, entbehrt jeden Sinnzusammenhang. Alles ist gleichgültig. Es geschieht. Und das ist die Absurdität des Lebens, wie Camus sie sieht. - Caligula protestiert aus Schmerz über den Tod seiner geliebten Schwester Drusilla gegen eine Welt, die „in ihrer jetzigen Gestalt nicht zu ertragen ist“. Denn: „Die Menschen sterben, und die Menschen sind nicht glücklich.“ Doch in seinem Wahn, das Unmögliche zu wollen, (dass man ihm den Mond herbeischaffe) wird er zum blutrünstigen Tyrannen. Einem vermeintlichen „Alles ist erlaubt“, wenn dem Leben ein Sinn abgesprochen wird, lässt Camus in der Figur des Dichters Scipio dem Kaiser Caligula entgegenhalten: „Diese Welt besitzt zumindest die Wahrheit des Menschen ... Und die Welt hat keine anderen Seinsgründe als den Menschen, und ihn muss man retten, wenn man die Vorstellung retten will, die man sich vom Leben macht ... und es heißt, der Gerechtigkeit, die er als einziger sich vorzustellen vermag, ihre Chance gewähren.“ Klar, hellsichtig und geradlinig schlägt Camus früh den Weg seiner Arbeit und seines Lebens, die nach Bekunden seiner Freunde in absolutem Einklang miteinander standen, ein: Das als absurd erkannte Dasein trotzdem zu leben, es als Herausforderung anzunehmen. „Die wahre Großzügigkeit gegenüber der Zukunft besteht darin, alles der Gegenwart zu geben.“
Und das hat Camus getan.
1943 fährt er ins besetzte Paris, schreibt für die Untergrundzeitung Combat. deren Mitbegründer er ist, engagiert sich in der Resistance. Er lernt die Existenzialisten Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir kennen, deren nihilistischen Ansatz er jedoch nicht teilt. In Paris, fern der Sonne Algeriens, kann er allerdings nicht heimisch werden. Die ungeheizten Wohnungen, die er mit seiner Frau Francine und den 1945 geborenen Zwillingen Jean und Catherine bewohnt, sind seiner Gesundheit abträglich und stimmen ihn depressiv. Immer wieder muss er zu Kuraufenthalten aufbrechen, in denen er unverdrossen, auch gegen Schreibhemmungen, Zweifel und Entmutigung an seinen nächsten Werken arbeitet.
Mit großem Mut schreibt er weiter im Combat Leitartikel, die sich mit den wichtigsten Fragen der Zeit, dem weiteren Verlauf des Krieges, der gegenseitigen Anerkennung ehemaliger Feinde und dem Umgang mit Kollaborateuren widmet. Ganz Paris spricht über Camus' Beiträge. Er ist zu einer Berühmtheit und einem Helden geworden. Bezeichnend ist auch seine Einstellung während der letzten Kriegs- und ersten Nachkriegsjahre, nie einseitig Stellung zu beziehen, grundsätzlich gegen die Todesstrafe zu sein. Er kann und will, obwohl er als linker Intellektueller gilt, sich keinem Lager zuordnen lassen, („Gibt es eine Partei der Leute, die nicht sicher sind, recht zu haben? Dort bin ich Mitglied.“) - setzt sich bewusst zwischen alle Stühle, was ihm auch Anfeindung und Isolation seitens der Linken und Kommunisten beschert und eine falsch verstandene Zustimmung rechter Kreise.
1947 erscheint sein Roman „Die Pest“ und wird sofort zu einem großen Erfolg. Dieser Roman steht zeitlich und gedanklich zwischen den beiden philosophischen Essays „Der Mythos von Sisyphos“ und stellt somit das Bindeglied dar zwischen der Erkenntnis des auf sich selbst zurückgeworfenen, hilf- und hoffnungslosen Menschen in der Absurdität der condition humaine zu demjenigen, der gegen diese revoltiert und dadurch zu einer tiefen mitmenschlichen Kommunikation und Solidarität findet: „Ich empöre mich, also sind wir.“ Die Verneinung mündet dadurch zu einer Bejahung des Seins. Die Sinnleere einer absurden Welt kann durch die Überwindung des leidvollen Schicksals durch wahrhaftiges, liebendes und gerechtes Handeln in der Gegenwart der Wirklichkeit den Menschen ausfüllen und sogar glücklich machen: „Wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen.“
Die Revolte in ihrer Reinform sah Camus in der Kunst verwirklicht. In seiner Nobelpreisrede kam er noch einmal dezidiert darauf zu sprechen: „…Die Kunst ... ist ein Mittel, die größtmögliche Zahl von Menschen anzurühren, indem sie ihnen ein beispielhaftes Bild der gemeinsamen Leiden und Freuden vorhält ... Darum betrachten die wahren Künstler nichts mit Verachtung; sie fühlen sich verpflichtet, zu verstehen, nicht zu richten ... ihre Aufgabe ... besteht darin, den Zerfall der Welt zu verhindern.“
„Die Pest“ ist eine Allegorie auf die soeben erfahrene, erlittene Zeit der Unmenschlichkeit des Krieges. In der algerischen Hafenstadt Oran bricht die Seuche aus und isoliert deren Bewohner durch Quarantäne von der Außenwelt. Die vier Hauptprotagonisten kann man als vier widersprüchliche Seiten in Camus selbst verstehen.
Da ist zuerst der Arzt Rieux, der sich aufopferungsvoll und trotzdem illusionslos der mörderischen Epidemie entgegenstellt und sich mit den Leidenden solidarisiert. Der Jesuitenpater Paneloux sieht zunächst in der Pest eine Art Gottesgericht. Der Tod eines unschuldigen Kindes führt ihn dazu, gegen den als ungerecht empfundenen Tod in einem Sanitätstrupp mitzuhelfen, bis er schließlich auch ein Opfer der Seuche wird. Die Gespräche zwischen Rieux und Paneloux zählen für mich zu einer der spannendsten existentiellen Auseinandersetzungen innerhalb der Literatur. In Tarrou findet Rieux einen Freund, der zunächst nur beobachtend abwartet, dann aber zum tätigen Helfer wird - und ebenfalls stirbt.
Der kleine Büroangestellte Grand schreibt schon seit Jahren in einsamer Zurückgezogenheit an einem Roman, über dessen ersten Satz er allerdings nicht hinauskommt. Mit ihm teilt Camus die Liebe zum Schreiben. Tarrou stellt die vielleicht wichtigste Frage in diesem Roman, die meines Erachtens für Camus die alles entscheidende ist: „Kann man ohne Gott ein Heiliger sein, das ist das einzig wirkliche Problem, das ich heute kenne.“
Sie alle, die gemeinsam gegen die Pest kämpfen und dabei bis auf den Arzt Rieux, der sich am Schluss des Romans als deren Chronist zu erkennen gibt, diesen Kampf mit dem Leben bezahlen, haben erkannt und erfahren, dass nur das Mitgefühl, die liebende Verbundenheit mit einem Menschen, - denn „eine Welt ohne Liebe (ist) eine tote Welt“ - Ehrlichkeit, Güte und Selbstlosigkeit den Menschen dazu befähigen, die Daseinsabsurdheit zu bewältigen und dadurch zu einer moralischen Kraft zu finden, im Hier und Jetzt ganz Mensch zu sein.
Ich erinnere mich an die Faszination, die „Die Pest“ und „Der Mythos des Sisyphos“ auf uns Schüler Anfang der sechziger Jahre ausgeübt hat. Ich erinnere mich an hitzige Diskussionen. Wir lasen ja auch Kierkegaard, Gabriel Marcel, Andre Gide, Dostojewski - Autoren, mit deren Werk sich auch Camus intensiv auseinandergesetzt hatte.
Ihren „Sprung“ in die Metaphysik auf die Daseinsfrage allerdings lehnte Camus für sich ab, ohne ihn jedoch anderen abzusprechen. Er war nie apodiktisch und im Grunde ein Gottsucher par excellence. Nur war er so redlich zuzugeben, dass wir letztlich nichts wissen können, nichts als das Leben selbst.
Und deshalb lehnte er sich gegen den Tod auf, kämpfte für Gerechtigkeit und Mitmenschlichkeit. Sein vordringlichstes Anliegen war, dem leidenden Menschen zu helfen (zahlreiche Petitionen gegen Verhaftungen von Kollegen, Hinrichtungen, rassistische Polizeiaktionen, für die Gleichberechtigung der Araber in Algerien, für die Kriegsdienstverweigerer im Algerienkrieg hat er verfasst) und die Menschen zu lieben ohne einen Gott, ohne den Glauben an eine Weiterexistenz nach dem Tod.
In der Gestalt des Arztes Rieux findet dieses Anliegen exemplarisch Gestalt. Im Grunde ist Camus' Werk ein zutiefst religiöses. Mit Dorothee Solle würde man heute sagen, er hat „atheistisch an Gott geglaubt“. Von den Dominikanern in Paris eingeladen, in ihrem Kloster einen Vortrag zu halten, sagte er: „…möchte ich festhalten, dass ich mich nicht im Besitz irgendeiner absoluten Wahrheit oder einer Botschaft fühle und deshalb niemals vom Grundsatz ausgehen werde, die christliche Botschaft sei eine Illusion, sondern nur von der Tatsache, dass ich ihrer nicht teilhaftig zu werden vermochte.“
Und in einem Interview mit Jean-Claude Brisville im Jahre 1959 antwortete er auf die Frage: „Eines Tages haben Sie geschrieben ‚Geheimnis meines Universums: sich Gott vorstellen ohne die Unsterblichkeit der Seele‘ - Können Sie Ihren Gedanken verdeutlichen?“ - „Ja. Ich habe einen Sinn für das Heilige, und ich glaube nicht an ein zukünftiges Leben; das ist alles.“
In seinen letzten Tagebüchern (1951-1959) notiert Camus viele Gedanken zu Romanprojekten, immer wieder auch zu „Der erste Mensch“. Viele hat er nicht mehr ausführen können. Beim Lesen scheint mir oft eine eigentümliche Traurigkeit herauszuhören zu sein. „Zu sterben erschreckt mich nicht, wohl aber im Tod zu leben.“ „Wenn ich alt bin, möchte ich die Gunst erfahren, auf diese Straße nach Siena zurückzukehren, der nichts auf der Welt gleichkommt, um dort in einem Graben zu sterben, nur von der Güte jener unbekannten Italiener umgeben, die ich liebe.“ „Anbetung. Das Rätsel der Welt.“ „Was ich gesagt habe, habe ich zum Wohle aller gesagt und zum Wohle jenes Teils von mir, der dem Alltag zugekehrt ist. Aber ein anderer Teil von mir erkennt ein Geheimnis, das nicht offenbart werden kann - und mit dem ich werde sterben müssen.“
Ob er geahnt hat, dass ihm nicht mehr viel Zeit bleiben würde? Die letzte Eintragung vom Dezember 1959 trägt eine seltsam anmutende, resümeehafte Note: „Manchmal klage ich mich an, unfähig zu sein, jemand zu lieben. Vielleicht stimmt das, aber ich war fähig, ein paar Menschen zu erwählen und ihnen, unabhängig, von ihrem Tun, getreulich das Beste meiner Selbst zu bewahren.“ Liebe, Freundschaft, Freiheit waren für Albert Camus lebensbestimmend. „Denn die Freundschaft ist die Kunst des freien Menschen. Und es gibt keine Freiheit ohne gegenseitiges Verständnis“. Und das Licht. So sagte er in seiner Nobelpreisrede: „Ich habe nie vermocht, auf das Licht zu verzichten, das Glück des Seins, das freie Leben, in dem ich aufgewachsen bin.“
Der Philosoph Ludwig Wittgenstein, ein Zeitgenosse von Camus, obwohl Camus dessen Schriften wahrscheinlich nicht kannte, weil sie zu Camus' Lebzeiten nicht in französischer Übersetzung vorlagen, schreibt in seinem Tractatus logico-philosophicus: „Wenn man unter Ewigkeit nicht unendliche Zeitdauer, sondern Unzeitlichkeit versteht, dann lebt der ewig, der in der Gegenwart lebt ... Ist denn dieses ewige Leben dann nicht ebenso rätselhaft wie das gegenwärtige? Die Lösung des Rätsels des Lebens in Raum und Zeit liegt außerhalb von Raum und Zeit.“
Im Tagebuch notiert Albert Camus für den „Premier Homme“: „Roman-Ende. Mama. Was ihr Schweigen ausdrückte. Was dieser stumme und lächelnde Mund rief. Wir werden auferstehen.“
Der plötzliche „absurde“ Tod hinderte Camus daran, bis zu diesem Romanende zu gelangen.
Vielleicht eine weitere eigenartige Koinzidenz mit Wittgenstein, dessen letzte Aussage im Tractatus lautet: „Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen.“
Hilde Domin
Hilde Domin ist eine der bedeutendsten deutschen Lyrikerinnen der Nachkriegszeit. Als Zeugin des 20. Jahrhunderts, in dem so viel Unheilvolles geschah, wurde Hilde Domin auf Lese- und Vortragsreisen bis unmittelbar vor ihrem Tod nicht müde, ihre Erfahrungen weiterzugeben.
Ich hatte das große Glück, die Dichterin Hilde Domin während ihrer letzten zwanzig Lebensjahre bis zu ihrem Tod am 22. Februar 2006 persönlich zu kennen, zu erleben. Aus unserem ersten Kennenlernen über meine Gedichte erwuchs eine Freundschaft, die dazu führte, dass sie einwilligte, dass ich über sie eine Biografie schreibe. An dieser Biografie haben wir gemeinsam intensiv gearbeitet. Es ist die einzige von ihr autorisierte Biografie.
Lyrik sei, so hob Hilde Domin hervor, ein wunderbares Mittel, die Identität des Menschen zu stärken. Dadurch, so hoffte sie, würde er weniger anfällig für Ideologien. In ihren Gedichten ruft sie auf gegen Konformismus, Mitläufertum, Anpassung und fordert auf zu Zivilcourage und Solidarität mit den Schwachen und Verfolgten. Wie frisch und lebendig Gedichte bleiben, erfuhr Hilde Domin durch die Rückkopplung ihrer Leser und Zuhörer. Besonders wichtig war der Dichterin der Austausch mit der jungen Generation. An sie wollte sie ihre Botschaft weitergeben. In ihren Gedichten scheint eine Moral auf, die das wahrhaftige Wort und das eigene Handeln zum Maßstab für einen möglichen Wandel macht. „Ich bin ein Dennoch-Mensch, ganz sicher“, bekräftigte Hilde Domin mehrfach in unseren Gesprächen, „mein Glaube ist, dass ein Dennoch immer möglich ist.“
Wer sie war, war in allen literarischen Feuilletons, in Fernseh- und Radiobeiträgen anlässlich ihres Todes im Februar 2006 zu erfahren. Mit großer Einmütigkeit und einem tiefem Respekt wurden die große Dichterin und ihr Werk gewürdigt. Sie, die mit ihren Lesungen bis zuletzt die Nähe der Menschen suchte und mitten aus einem tätigen Leben gerissen wurde, hat mit ihrer Dichtung eine für eine Lyrikerin schier unglaubliche Zahl an Menschen erreicht. Dass auch Staatsoberhäupter zu ihren Bewunderern gehören, zeigt nur, wie breit gefächert ihre Anhängerschaft war. Bundespräsident Horst Köhler, der von der Todesnachricht sichtlich bewegt war, sagte: „Mit leichter Hand schrieb Hilde Domin Verse voller Hoffnung und Ermutigung. Unvergessliche Zeilen stammen aus ihrer Feder. Sie werden zu dem gehören, was von der Lyrik des zwanzigsten Jahrhunderts bleibt."
Hilde Domin wurde am 27. Juli 1909 als Hilde Löwenstein in Köln geboren, wo sie als Tochter eines jüdischen Rechtsanwalts in einem liberalen, großbürgerlichen Haus aufwuchs. In Heidelberg begann sie 1929 mit dem Jurastudium, wechselte dann zu Nationalökonomie, Philosophie und Soziologie. Sie studierte bei so bedeutenden Professoren wie dem Rechtsphilosophen Gustav Radbruch, dem Soziologen Karl Mannheim und dem Philosophen Karl Jaspers. Diese wissenschaftliche Bildung befähigte die Dichterin zu komplexen Analysen in der Poetik, die sie mit ihrer bedeutenden Schrift „Wozu Lyrik heute?“(1968) zu einer ambitionierten Lyriktheorie verdichtete. Was an dieser innovativen Theorie besticht, ist Domins von der eigenen Dichtung geprägte bildhafte und dennoch präzise Sprache.
Als sich die Anzeichen mehrten, dass in Deutschland der Nazismus eine unheilvolle Entwicklung nehmen würde, verließ sie 1932 gemeinsam mit ihrem zukünftigen Ehemann Erwin Walter Palm, dem Studenten der klassischen Philologie und Architektur, ihr Land Richtung Italien, wo sie beide ihre Studien fortsetzten. 1935 promovierte Hilde Domin in Florenz über Staatsgeschichte der Renaissance. 1936 heiratete das Paar in Rom. Ihre Flucht führte sie 1939 weiter über England bis in die Dominikanische Republik, in der sie von 1940 bis zu ihrer Rückkehr nach Deutschland im Jahre 1954 lebten. Während ihres Exils war Hilde Domin in England und Santo Domingo als Universitätslehrerin, Übersetzerin, Photographin und Mitarbeiterin ihres Mannes tätig.
Es war auch eine Sprachodyssee, die endete mit der „Heimkehr ins Wort“, in die deutsche Sprache. Die Rückkehr bedeutete die bewusste Hinwendung zum Land ihrer Geburt und ihrer Sprache, in dem es nun galt, „Vertrauen - das schwerste ABC“ neu zu buchstabieren.
Ihre Geburt als Dichterin hatte sie in der Fremde erlebt: „Wie ich, Hilde Domin, die Augen öffnete, die verweinten, in jenem Hause am Rande der Welt, wo der Pfeffer wächst und der Zucker und die Mangobäume, aber die Rose nur schwer, und Äpfel, Weizen, Birken gar nicht, ich verwaist und vertrieben, da stand ich auf und ging heim, in das Wort. Von wo ich unvertreibbar bin.“ Das Schreiben rettete sie aus einer Lebenskrise. „Ich war ein Sterbender, der gegen das Sterben anschrieb. Solange ich schrieb, lebte ich.“
Ein Turm im Haus in Heidelberg war lange Jahre (1961-2006) der Ort ihres Schaffens - aber es war für sie nie ein Elfenbeinturm, in dem sie sich vor der Welt verschlossen hat. Die vier Fenster darin waren für sie das Wesentliche. Es waren für sie die Öffnungen zur Welt, zu den Mitmenschen, wie Start- und Landeplätze für den Vogelflug, zu dem liebsten Vogel, dem „Menschenvogel“, wie sie ihn nannte, für den sie ihre Gedichte schrieb für eine Welt des Unrechts, der Verfolgungen und Demütigungen, gegen die zu kämpfen sie nicht müde wurde.
Ihr, die als Jüdin erfahren hatte, wie ein Mensch bedroht wird, zum Opfer wird und von einem Augenblick zum nächsten zur Hilflosigkeit verurteilt wird, war das Hauptanliegen die Verteidigung der Menschenwürde, „das Unverlierbare, ohne das Leben sinnlos ist.“
Die Gewissheit und die bewusste Annahme des Nicht-Heimisch-Seins, ihr Halt-Suchen und -Finden in den Lüften, unter den Vögeln, an der Rose ist immer am Zartesten, Vergänglichsten, festgemacht. Es ist die conditio humana: zerbrechlich, ungewiss, verlierbar.
Dies findet sich ausgedrückt in den von ihr verwendeten Metaphern: Rose, Schmetterlingsflügel, Vogel, Blüten, Wind, um nur einige zu nennen. Unmoderne Vokabeln wie Glück, Heimat, Liebe, Wunder, Gnade zu gebrauchen, hat sich Hilde Domin niemals gescheut. Eines der schlichtesten und zugleich schönsten und ausdrucksstärksten Gedichte von Hilde Domin ist dieses: „Nicht müde werden / sondern dem Wunder / leise / wie einem Vogel / die Hand hinhalten.“ In unserer lauten, schnelllebigen Welt sind gerade diese verhaltenen Worte von der Art Poesie, die wir alle dringend benötigen.