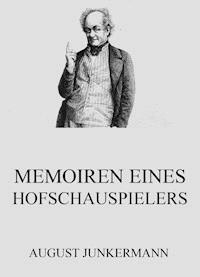
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
August Junkermann war ein deutscher Schauspieler und als Rezitator ein bedeutender Interpret der Werke Fritz Reuters. Dies ist seine Autobiografie.
Das E-Book Memoiren eines Hofschauspielers wird angeboten von Jazzybee Verlag und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 314
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Memoiren eines Hof-Schauspielers
August Junkermann
Inhalt:
August Junkermann – Lexikalische Biografie
Memoiren eines Hof-Schauspielers
Vorwort.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.
XXV.
XXVI.
XXVII.
XXVIII.
XXIX.
XXX.
XXXI.
Memoiren eines Hof-Schauspielers, A. Junkermann
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN:9783849628857
www.jazzybee-verlag.de
August Junkermann – Lexikalische Biografie
Schauspieler und Vorleser, geb. 15. Dez. 1832 in Bielefeld, verstorben am 15. Mai 1915 in Berlin. Trat bei der Artillerie ein, um Offizier zu werden, ging aber 1853 zur Bühne über und begann seine theatralische Laufbahn in Trier. Nach mehreren Engagements in Berlin, Bremen, Wien, Weimar u. a. O. wurde er 1871 Mitglied des Hoftheaters in Stuttgart, dem er bis 1884 angehörte. Seitdem hat er allein und mit von ihm zusammengestellten Gesellschaften Gastspielreisen in Deutschland und Nordamerika gemacht. Er spielt komische Rollen mit großem Erfolg; sein Hauptverdienst aber liegt in der Darstellung der Gestalten Fritz Reuters, dessen Werke fast sämtlich teils von ihm selbst, teils von andern für ihn dramatisiert worden sind. Auch als Vorleser der Werke Reuters, dem er besonders in Süddeutschland und Wien neue Verehrer gewann, hat er sich einen Namen gemacht. Er veröffentlichte: »Memoiren eines Hofschauspielers« (Stuttg. 1889) und »Humoristikum, eine Sammlung heiterer Vortragsstücke« (5. Aufl., das. 1899; neue Folge, 2. Aufl. 1900).
Memoiren eines Hof-Schauspielers
Vorwort.
Den nachfolgenden Aufzeichnungen schicke ich die Bitte voraus, der freundliche Leser möge die Veranlassung zur Drucklegung derselben nicht in einer persönlichen Eitelkeit suchen. Ich folge mit der Veröffentlichung der Ereignisse aus meinem Leben dem Wunsche zahlreicher und lieber Freunde und Gönner.
Beim Niederschreiben dieser Erinnerungen hielt ich mich verpflichtet, nicht nur der freudigen und heiteren Begebnisse, sondern auch der Niederlagen, der trüben und sorgenschweren Stunden zu gedenken, die mir zumal im Anfang meiner Laufbahn, nicht erspart blieben.
Ich erlaube mir ferner hervorzuheben, daß ich keineswegs den Ehrgeiz hatte, mit der Publikation dieser Erinnerungen ein litterarisches Opus von irgend welchem Wert auf den Markt bringen oder gar einem Reklamebedürfnisse genügen zu wollen, ich schrieb sie wahrheitsgetreu und ohne jedwede Prätension nieder, wie mein Gedächtnis mir sie überlieferte. Auf die kritische Wagschale wolle das Buch niemand legen, denn ich bin Schauspieler und nicht Schriftsteller, und als Entschuldigung für die Schwächen des Buches sage ich mit Fritz Reuter:
»Wenn Einer deiht wat hei deiht,
Dann kann hei nich mihr dauhn as hei deiht.«
Objektiv genommen, müßten diese Memoiren schwere Anfechtung erfahren; nur als subjektive Aeußerung über ein Künstlerleben und dessen Wechselfälle werden sie ihre Berechtigung finden.
Es war auch nicht meine Absicht, eine Geschichte des Stuttgarter Hoftheaters zu schreiben, was berufenere Männer wie Adolf Palm und Feodor Wehl bereits gethan, indes meinen Freunden oder auch jenen ungekannten Lesern, die sich für Geschichten und Begebnisse aus der Theaterwelt interessieren, hoffe ich mit der Lektüre dieses Buches einige angenehme Stunden der Unterhaltung zu bereiten. Das nur ist der Zweck, und auch hierbei sage ich mit Fritz Reuter:
»Wer 't mag, de mag 't,
Und wer 't nich mag, de mag 't ja woll nich mägen!«
Wiesbaden, August 1888.
August Junkermann.
I.
Als ich ein 13jähriger Knabe war, und in meiner Familie schon die Frage erörtert wurde, welchen Beruf ich wählen sollte, kam ein Artillerie-Lieutenant mit einem kleinen Remonte-Kommando in meine Vaterstadt Bielefeld. Mein Vater, der die Bürgermeistergeschäfte verwaltete und zugleich Garnisonverwaltungs-Inspektor war, hatte mit dem jungen Offizier geschäftlich zu verhandeln. Die Köln-Mindener Eisenbahn war damals noch im Bau begriffen, der Verkehr stak noch in den Kinderschuhen und es gehörte zu den Seltenheiten, wenn außer den Truppenabteilungen vom 15. Infanterie-Regiment, (von welchem das Füsilier-Bataillon von Bielefeld stand), fremde Truppengattungen in meine Vaterstadt kamen. Daher machte der Artillerie-Lieutenant in seiner schmucken Uniform mit dem schwarzen Sammtkragen, zumal er ein bildhübscher Mann war, ganz besonderes Aufsehen.
Mein Vater hatte die Gewohnheit, uns Kinder auf seinen täglichen Spaziergängen mitzunehmen; auch der fremde Artillerie-Lieutenant war unser Begleiter. Die Füsiliere der Garnison, die uns begegneten, machten dem Lieutenant ganz besonders aufmerksame Honneurs, wohl der fremden Uniform wegen, die Posten faßten das Gewehr so stramm an, als wäre der Lieutenant ein Stabsoffizier. Oder erschien mir das alles so außergewöhnlich, weil auch ich einen ganz anderen Respekt vor der Artillerie bekommen hatte, als vor den Füsilieren meiner Vaterstadt?
Aus dem Spaziergangsgespräche meines Vaters mit dem Lieutenant entnahm ich, daß auch mein Vater eine ganz besondere Hochachtung vor der Artillerie-Waffe hatte. Meine Hochachtung ging in Begeisterung über, als der Lieutenant mit mir freundliche Worte sprach. Ich durfte ihn am andern Tage besuchen und als er mir nun versuchsweise erlaubte, Säbel und Mütze von ihm anzulegen, und meinte, ich würde einen schmucken Offizier abgeben, da stand mein Entschluß fest, ich müsse Artillerie-Offizier werden; es gab für mich nichts Höheres mehr.
Nach zwei Tagen marschierte der Lieutenant mit seinem Kommando ab. Halb Bielefeld gab ihm das Geleite. Des Lieutenants letzter Gruß galt mir, denn ich begleitete ihn allein noch eine Stunde weiter, als meine übrigen Landsleute.
Mein Vater war anderer Meinung über meine Zukunft, obwohl sein Grundsatz war, seine Jungens zu nichts zu zwingen und ihren Beruf sich selber wählen zu lassen.
Als ich das Gymnasium absolviert, gab mich mein Vater ins Gewerbe-Institut; sein Lieblingswunsch wäre gewesen, daß ich mich im Maschinenfach ausgebildet hätte, aber der Lieutenant hatte mir's angethan, ich konnte keinen anderen Gedanken fassen, als Artillerie-Offizier werden. Indes besuchte ich noch die beiden Klassen des Gewerbe-Instituts, aber die Artillerie-Uniform hatte mir die Sinne zu sehr verwirrt, ich verstand die Anfangsgründe der Geometrie und Mathematik nicht, und statt mich nochmals den ersten Kursus in der zweiten Klasse durchmachen zu lassen, versetzte man mich per Schub in die erste, und wenn ich nun in diesen Wissenschaften noch nicht dumm genug war, so wurde ich es in der ersten Klasse. O liebe Jugend, möchtest du es doch begreifen: »was du von der Minute ausgeschlagen, bringt keine Ewigkeit zurück!« – Ich habe es in meinem Leben in der Geometrie zu nichts mehr gebracht, denn weil ich den Anfang der Geometrielehre in meinem Artillerie-Uniform-Dusel nicht verstanden, verstand ich die Mitte und das Ende gar nicht. Ein entsetzliches Gefühl beschlich mich, wenn die Geometriestunden herannahten, und eine Beschämung nach der andern blieb mir auf der heißen Schulbank nicht erspart. Mein guter Lehrer, Dr. Köhler, verzeih mir's heute noch, daß ich dir so oft das Blut durch meine Dummheit ins Gesicht getrieben – ich sehe dich noch vor mir in deiner Röte, die aus deinem Gesicht auf mich herabstrahlte, ohne die schlechte Saat zu ergiebiger Ernte zu bringen! Schlechte Zeugnisse, die nicht ausbleiben konnten, hatten meinen Vater wohl erbittert, und als ich einst meine Stiefmutter in der Person meines jüngeren Bruders beleidigt hatte, kündigte mir mein Vater sein Haus und ich zog hinaus in die weite Welt.
Mein nächstes Reiseziel war Münster in Westfalen. Dort war mein Artillerie-Lieutenant. Zu ihm ging ich, und bat ihn, sich meiner anzunehmen, ich wollte in die Artillerie eintreten. Ich war damals noch nicht ganz 17 Jahr, aber mein kräftiger Körperbau ließ eine Ausnahme zu, ich wurde ärztlich untersucht, tauglich befunden und nachdem mein Vater die nötigen Papiere gesandt, trat ich als Offiziers-Aspirant in das königl. preußische 7. Artillerie-Regiment zu Köln.
Mein Vater gab mir 5 Thaler monatlichen Zuschuß. Damit konnte ich keine weiten Sprünge machen, ich mußte in der Kaserne wohnen und lernte das Soldatenleben der untersten Stufe kennen. Ich glaube nicht, daß es viele Offiziere gibt, die, wenn sie als Avantageure eingetreten sind, in der Kaserne gewohnt, ihr Kommisbrot als Hauptnahrungsmittel zu sich genommen, ein rasches Avancement gefunden haben. Es gehört etwas klein Geld und ein, wenn auch nicht flottes, doch etwas feineres Auftreten dazu. Ich wurde in die Kategorie der Dreijährigen, der westfälischen Bauernsöhne geworfen, die meistens nicht einmal dem Unteroffizier, geschweige den Lieutenants und dem Hauptmann durch besondere Intelligenz zu imponieren vermögen. Empfehlungen hatte ich auch weiter nicht, mein Vater ging von dem Grundsatze aus, daß man von der Pieke aus alles ergreifen und erlernen müsse. Er hatte sich selbst vom simplen Bauernjungen zum Bürgermeister emporgearbeitet, und mich nach meiner Konfirmation zu einem Schlosser in die Lehre geschickt, weil er sich keinen Maschinenbauer, der ich ja doch werden sollte, denken konnte, der nicht das Schlosserhandwerk erlernt hat. Es ist ja möglich, daß das früher so war, aber beim Militär bringt man die Lieutenantsanlage besser von der Kadettenschule mit, oder man tritt als Offiziers-Aspirant mit einem großen Geldbeutel oder doch mit dem gesellschaftlichen Nimbus ein, wenn man Karriere machen will. Die napoleonischen Ideen, daß jeder Korporal den Marschallstab im Tornister trage, habe ich in der preußischen Armee, außer beim alten Derfflinger, sich selten verwirklichen sehen.
Mein idealer Traum, in den mich der schmucke Artillerie-Lieutenant in Bielefeld gelullt, wich bald der enttäuschenden Wirklichkeit. Es wurde mobil gemacht, ich lernte kennen, was arbeiten heißt, und schon fing ich an, mit Recht jeden Infanteristen zu beneiden. Der sorgt doch nur für sich und sein Gewehr – aber die Pferde, die Pferde – was erfordern die für Pflege und Arbeit! Ich habe in meinem ganzen Leben nicht wieder so geschwitzt als beim Pferdeputzen. Unsere Batterie begab sich auf den Marsch, niemand wußte wohin. Wir zogen mit unseren Kanonen durch das Sauerland. Glatteis trat plötzlich ein. Die Pferde konnten nicht geschärft werden, wir mußten sie mit Gefahr des Lebens die Berge hinauf befördern, und waren sie oben, kehrten wir um und zogen die Kanonen unter den schrecklichsten Flüchen der Vorgesetzten selber hinauf. Ich glaube, Hannibal kann es bei seinem Zuge über die Alpen nicht schlimmer gehabt haben.
Wir kamen endlich nach langen Irrfahrten in die Umgegend Kölns zurück.
Die Reue kam denn auch bald über mich, umsomehr, da man gar keine Anstalten machte, mich als Avantageur zu behandeln. Ich kam in ein Quartier an der Wahner Heide, ungefähr drei Stunden von dem Orte entfernt, wo man uns die Quartierzettel gegeben. Mein Geld- und Brotvorrat war erschöpft. Wir bezogen in der Nähe der Wahner Heide unsere Kantonnements, und mit entsetzlichem Hunger kam ich endlich spät abends in mein Quartier, in der Hoffnung, mitfühlende Bauern zu finden, die dem Vaterlandsverteidiger durch ein frugales Abendbrot den Heldenmut zu stählen gesonnen wären. Ich hatte von Jugend auf gelernt, alles zu essen, mein Vater hatte uns Kinder so gewöhnt, und wenn wir einmal was nicht essen mochten, so mußten wir vom Tische aufstehen; plagte uns der Hunger abends, so wurde uns das Gericht vom Mittag wieder vorgesetzt, und diese Manipulation so lange fortgesetzt, bis wir's hinunterwürgten. Ein probates Mittel! Ich konnte in meiner Jugend keine Kartoffelsuppe essen, heute esse ich sie, dank der Strenge meines Vaters, sehr gern.
Westfalen ist darin überhaupt einzig. In meiner Kindheit gab es einen Bauern dort, der sich damit befaßte, im Essen verwöhnte Hunde wieder zu veranlassen, die ihrem Geschlechte gebührende Nahrung anzunehmen und sich die üppige Kost zu verkneifen. Ja die Kunstfertigkeit in seiner Methode brachte es dahin, daß große Hunde, die zu ihm geschickt wurden, weil sie partout nur noch Fleisch essen wollten, schließlich Tannenäpfel mit Appetit verzehrten. Der Bauer Laux war sprichwörtlich geworden, und wenn einer übermütig war und sich über schlechte Kost beklagte, so hieß es: »De möt nah'n Buer Laux, do lihrt hei Dannenäppel freten.«
Ich weiß nicht, wie Tannenäpfel schmecken, aber sie sind mir wenigstens von Ansehen bekannt – was man mir aber in meinem Wahner Quartier vorsetzte, war mir völlig unbekannt. In einer irdenen Schüssel stand eine weiße Flüssigkeit vor mir. Aha, dacht' ich, Milchsuppe als Einleitung. Allein meine Wirtin machte mir gleich begreiflich, daß das alles sei, was sie im Hause hätte. Groß genug war die Portion, noch größer mein Hunger, ich bat, sich nicht weiter zu entschuldigen und mit Vorreden aufzuhalten, denn unnützer Zeitverlust schien mir bei meinem Hunger ein Menschenleben kosten zu können, und langte in die Schüssel, meine Sehnsucht zu befriedigen. Ich stieß auf harte Gegenstände, ein saftiges Grün leuchtete in meinem Löffel. Mein Gott, was war das? Buttermilchsuppe war's, das wurde mir schnell klar. Aber was war das Grüne? In Buttermilchsuppe gehörte doch sonst nichts hinein, und hier –? Nur Mut, dachte ich, »wat de Buer Laux kann, dat kann ick ook, und sünd et ook keene Dannenäppel, denn wieren't doch – – – greune Bohnen!« Ich esse Bohnen gern, aber in dieser Zusammenstellung, Buttermilch und grüne Bohnen, das war mir neu! Gott gesegne's – ich konnt's nicht essen! – Ich suchte einen Kameraden im nächsten Quartier auf, um mir Nahrung zu verschaffen. Er saß mit seinen Wirtsleuten am Tisch und aß – – – Buttermilchsuppe mit grünen Bohnen!! Jetzt wurde mir erst klar, daß die guten Bauersleute uns mit ihrer Nationalspeise traktieren wollten. Ich wurde freundlichst eingeladen, Platz zu nehmen und mitzuessen. Dankend lehnte ich ab und ging mit meinem Kameraden, der durch Reste von Brot, Schnaps und etwas Wurst, die er noch besaß, unsern Hunger so leidlich zu stillen vermochte. –
Wir kamen bald darauf nach Köln und wurden in der Dominikaner-Kaserne einquartiert.
Wenn eine Kaserne eine Weile unbewohnt ist, und die Truppen mit weißen Hosen wieder heimkehren, so pflegt der erste, der das Zimmer einer Kaserne betritt, plötzlich in weiß und schwarz gesprenkelten Beinkleidern dazustehen, so anhänglich sind die kleinen schwarzen Bewohner der Strohsäcke an ihre Krieger, daß sie wie der Hund an seinem Herrn hinaufspringen, sobald sie ihn wiedersehen. Ich war dieser erste, obwohl ich diese Anhänglichkeit gar nicht beanspruchen konnte, denn ich war ja fremd hier.
Diese Dominikaner-Kaserne hat mir die militärische Karriere eigentlich verleidet, ich erlebte so viel Unangenehmes darin, daß mein Entschluß feststand: Soldat bleibst du nicht, wenn du nicht mußt! Aber ich mußte leider. Die Armee blieb mobil, wir wurden nach Bronzell geführt, der historische Schimmel war gefallen, Bayern und Preußen war längst wieder versöhnt, die Infanterie ging nach Hause, aber die Artillerie blieb mobil. Ich konnte nicht entlassen werden, man fand meine Schlagfertigkeit zu erhalten für zu notwendig. Moltke war damals noch nicht der allgewaltige Stratege, sonst, hätte er mich in meiner Kriegstüchtigkeit gesehen – er hätte mich sofort entlassen, um die Artillerie auf eine höhere Stufe bringen zu können.
Nach meinen geometrischen Kenntnissen wurde ich merkwürdigerweise gar nicht gefragt – und ich ärgerte mich zu sehr, daß man mit dem Avancement gar nicht beginnen wollte. In solchem Aerger stand ich einmal auf einer Kölner Bastion in kalter Winternacht auf Posten. Das Faschinenmesser hatte ich gezogen, Fausthandschuhe und Ohrenklappen zierten meine Extremitäten, ich ging, »starrend vor Frost«, auf und ab, der Schnee quietschte unter meinen eisigen Füßen – als ich plötzlich den Offizier der Ronde in der Person des Herrn Lieutenant Cäsar herankommen sah! Der Lieutenant Cäsar war nicht sehr beliebt bei der Batterie – er drillte seine Untergebenen und war der reine Meldebruder. Melden und anzeigen war sein Höchstes! Frost und Unmut, zweistündiges Nachdenken über meine traurige Lage hatten mich als zwecklosen Posten auf der Bastion ohnehin in gerade nicht rosige Stimmung versetzt, als der Offizier der Ronde im echten Lieutenantstone mich anredete: »Kennst du auch deine Instruktionen und weißt du, was du auf deinem Posten hier zu thun hast?« Mich verdroß das »du« noch mehr. Ich schwieg. In Wahrheit wußte ich's nicht, denn in der Wachtinstruktion war nichts vorgesehen, niemand wußte es und ich glaube der Lieutenant Cäsar wußte es auch nicht. Es gibt solche Posten, auf denen man die obige Frage nicht zu beantworten vermag. Schnarrend wiederholte er auf mein Schweigen seine Frage, nur mit einem kleinen Zusatze, indem er sagte: »Esel, warum stehst du hier auf Posten?« Mein Zorn wuchs mit dem Esel. Sagen darf so ein Lieutenant alles – der Kanonier darf's bloß denken. Ich dachte mir also, wenn er dich für einen Esel hält, kannst du ja auch eselhaft antworten, und erwidere ihm denn so recht dummdreist: »Um den Herren Lieutenants die Honneurs zu machen!«
»Ochse von einem Bauernlümmel,« brummte er vor sich hin und hob den Schleppsäbel auf, mir eins damit überzuziehen; aber der Gedanke, daß so'n Bauernlümmel auch dadurch nicht gescheiter würde, ließ ihn davon abstehen.
Der Lieutenant Cäsar verschwand, die Ablösung kam und löste mich ab. Auf der Wachtstube, die gewöhnlich zwischen 20–25 Grad Hitze aufzuweisen hat, um die erstarrten Glieder der abgelösten Posten zu erwärmen, erkundigte ich mich bei dem Bombardier, was der Posten auf der Bastion für einen Zweck, was er zu bewachen, zu beobachten habe. Der Bombardier wußte es auch nicht. Ob der Lieutenant Cäsar meine Dummheit höheren Orts gemeldet hat, ich weiß es nicht, aber vielleicht ist die Frage näher erörtert worden, warum der Posten dort stand. Andere haben auch keine Antwort geben können, kurz, der Posten wurde bald darauf eingestellt und unsere Batterie hatte einen Wachtdienst weniger zu verrichten.
Bald darauf wurde ich zum Bombardier befördert, ich weiß nicht ob infolge meiner dummdreisten Antwort, die ich dem Lieutenant Cäsar gegeben, oder ob man wirklich militärische Talente in mir entdeckt hatte. Ich ließ mir eiligst die goldenen Tressen um den Aermelaufschlag nähen, worin die Abzeichen des Bombardiers bestanden, und ging durch die Straßen Kölns, über die Rheinbrücke nach Deutz, um mich überall sehen zu lassen. Ich glaube, wenn einer Feldmarschall wird, kann er nicht die Freude haben, die ich damals empfand, und ich konnte nicht begreifen, wie die nüchternen Zivilgesichter nicht anders an mir vorbeigingen als früher. Kein Mensch nahm Notiz von mir. Ne so was! Ich war aufs höchste beleidigt. Endlich begegnet mir ein gemeiner Infanterist. Der Mann geht an mir ohne zu grüßen vorüber. »Na wart«, denk ich – »den will ich aber Mores lehren.« Ich gehe also auf ihn zu: »Sie! – warum grüßen sie nicht?« »Entschuldigen Sie,« stammelte er, »ich habs nicht gesehen!« – »Nicht gesehen,« sagte ich, »dann sperren sie Ihre Glotzaugen auf. Kehrt! Marsch!«
Ich schritt nun etwas auffallend mit den Armen schlenkernd weiter und strich mir sehr oft das Haar an der Stirn glatt, um meinen neuen Zierat am Aermelaufschlag näher vor Augen zu haben. Wenn ein Gemeiner an mir vorüber ging, fühlte ich stets, ob der obere Knopf meiner Uniform, der Haken des Halskragens geschlossen war etc., und verfehlte durch diese Manipulation die beabsichtigte Wirkung nicht – ich wurde gegrüßt von den Gemeinen, und meine Brust schwelgte so recht im bombardierlichen Hochgefühle, als mir auf der Rheinbrücke die Tochter unseres Speisewirtes begegnete, die hinter der Dominikanerkaserne wohnte. Das Mädchen war eine reizende Blondine, auf welche Eigenschaft hin ihre Eltern sich oft an uns durch Verabreichung schlechter Kost versündigten, aber das Mädchen übte einen unwiderstehlichen Reiz auf uns aus, wir blieben Stammgäste trotz der schlechten Kost. Mich schien sie besonders ins Herz geschlossen zu haben, trotzdem sie für Militär kein besonderes Faible hatte. Als sie mir nun auf der Rheinbrücke begegnete, präsentierte ich mich ihr sofort in meiner neuen Würde, immer fleißig militärisch grüßend, damit sie meine Handtreffen bewundern sollte. Ich kehrte mit ihr um, sie nach Hause zu begleiten, und als wir so recht in tiefem Gespräch verwickelt sind, klopft mir jemand mit dem Stiele der Reitpeitsche auf die Schulter und ruft schnarrend: »Sie, – warum grüßen Sie nicht?!« Der Lieutenant Cäsar stand vor mir und kanzelte mich in Gegenwart der schönen Blondine so lange herunter, daß ich Not hatte, meine Schöne, die schließlich vorausgeeilt, wieder einzuholen. »Sehen Sie,« empfing sie mich, »man kann mit euch Soldaten nicht über die Straße gehen« und kaum hatte sie dies für mich so harte Wort gesprochen, als mein Hauptmann Lachner uns entgegenkam Abermals mußte ich sie allein weiter gehen lassen und Front machen. Mein Hauptmann hatte mir den Rücken zugekehrt und sich in ein Gespräch mit einem Herrn verwickelt, er sah mich nicht und ließ mich endlos lange in Front dastehen, während meine Schöne in der Straße verschwand.
Am andern Mittag zum Appell las der Feldwebel den Parolebefehl vor: Bombardier Junkermann erhält 24 Stunden Mittelarrest, weil er dem Herrn Lieutenant Cäsar nicht die vorschriftsmäßigen Honneurs gemacht!
Ein trauriges Ende nahm der erste Bombardiertag. Ich wechselte auch mein Kosthaus und habe mich später vor der schönen Blondine nie wieder sehen lassen.
II.
Bald darauf wurde ich nach Wesel versetzt. Die Abteilung dort kommandierte der alte Major v. Derschau, einer jener braven Offiziere, die sich durch Humanität die Liebe ihrer Untergebenen in einem Maße erwerben, daß jeder sein Leben freudig für sie läßt. Im Dienste war der Major streng und unnachsichtlich, aber außer Dienst ein Vater seinen Kindern, seinen Soldaten. Es entstand in seiner Abteilung ein Männergesangverein, der alte Herr liebte Gesang über alles. Ich konnte mit einigen musikalischen Fähigkeiten aufwarten, ich übte mich in der Kaserne oft auf meiner Geige und anderen Instrumenten, denn mein Vater hatte mit aller Strenge darauf gehalten, daß wir Musik schon als Kinder trieben. Der alte Major v. Derschau hatte mich in der Kaserne geigen hören und veranlaßte mich infolgedessen die Leitung des Männergesangvereins zu übernehmen, ja, er dispensierte mich dafür von manchem Dienst, und ich kann sagen, wir leisteten etwas in dem Verein. Die erste musikalische Aufführung war ein Ständchen, das wir dem alten Major brachten. Ich sehe ihn heute noch, wie der alte Herr aus der Thür trat, zitternd vor Freude sich den weißen Schnurrbart drehend, als er »den Tag des Herrn«, die erste That aller Gesangvereine, von uns Söhnen des Mars vortragen hörte.
Das »Bild der Rose« mit Brummstimmen hatten wir einstudiert; wir besaßen für das Solo keinen Tenor als mich, und ich hatte kaum die Stimmlage eines Baritonisten; aber mächtige Bässe hatten wir, die das Transponieren nach der Tiefe hin gar nicht genierte – es war ein schreckliches Gebrumme, »ein Lied, das Stein erweichen, Menschen rasend machen kann,« aber der alte Major war entzückt davon. Er ließ uns alle näher treten und bewirtete uns mit Speise und Trank. Unser Repertoir wurde abgesungen und ich mußte schließlich zu Solovorträgen greifen, die ich damals schon kultivierte. Der Major hatte seine helle Freude daran, und meinte: »Mensch, Sie sind ja ein wahrer Künstler, Sie müssen zum Theater gehen, Soldat werden Sie doch nie!«
Wir machten mit unseren Gesangsproduktionen immer größere Fortschritte, so daß wir uns bald öffentlich konnten hören lassen.
Eine Theatertruppe kam nach Wesel. Der Direktor war der in der Theaterwelt damals sehr bekannte Obstfelder, der in Gemeinschaft mit seinem Schwiegersohne Käuneke das Theater in Wesel leitete. Wir machten die Bekanntschaft der Sänger und Schauspieler, und es dauerte auch nicht lange, so standen wir auf der Bühne als Chorsänger in der Oper. Zuerst machten wir in »Figaros Hochzeit« mit. Das war leicht, da die Oper ja nur einen Chor enthält. Allein der Sänger Albes versprach sich durch unsere Mitwirkung eine gute Benefizeinnahme, und bat uns, die Chöre zu »Templer und Jüdin« einzustudieren. Wir machten uns dran, und ich mußte sogar den »Richard Löwenherz« übernehmen, der einige Takte zu singen, das andere aber zu sprechen hat. Ich hatte solche Angst vor meinen drei Takten unter meinem Harnisch, daß ich bei der Aufführung meinen Einsatz verfehlte, und der Kapellmeister am Pulte für mich freundlichst diese drei Takte sang. Aber die Artillerie-Unteroffiziere und Feuerwerker hatten großen Erfolg gehabt. Das Haus war voll und die ganze Stadt sprach tagelang von den vorzüglichen Chören, um welche jedes Hoftheater fortan Wesel beneidete.
Die Herren Chargierten der Artillerie hatten Blut geleckt, der alte Major v. Derschau hatte sich sehr günstig über die Leistungen in der Oper gegen sein Unteroffiziere ausgesprochen und der Künstlerehrgeiz fuhr in die braven Artilleristen.
Die wandernde Theatertruppe verließ Wesel, der Winter war noch lange nicht zu Ende, und man beschloß in unserer Batterie ein Liebhabertheater zu gründen. Intelligente Feuerwerker standen uns hilfreich zur Seite und es währte nicht lange, da hatten wir unsere regelmäßigen Theateraufführungen. »Humoristische Studien«, »Der Sohn auf Reisen«, »Das bemooste Haupt« waren unsere Hauptstücke. Mit dem Kalinsky, dem Peter und dem Strobel machte ich ganz besonderes Aussehen. Die Damenrollen waren alle von kräftigen Artilleristen besetzt. Wir machten an das Talent zur Darstellung von Damenrollen keine anderen Ansprüche, als daß die Liebhaberinnen wenigstens keinen Schnurr- und Backenbart haben durften. Der Feuerwerker Köster und der Bombardier Rauch (jetzt Zeughauptmann a.D. in Breslau) waren bartlos oder doch so zart bebartet, daß dieser störende Schmuck für Frauengesichter bei der mangelhaften Oelbeleuchtung abends nicht sichtbar war. In komischen Stücken machten uns die Frauenrollen, von kräftigen Männern dargestellt, nicht viel Kummer und Kopfzerbrechen. Es war damals beim schönen Geschlecht eine so günstige Hut- und Schleiermode für diesen Zweck, daß wir das wettergebräunte Kriegerantlitz ganz bequem darunter verstecken konnten. Operngucker hatte unser Publikum nicht, und zur Vorsicht ordnete ich an, daß Hut und Schleier von den Darstellern niemals abgenommen werden durften.
In Wesel lebte damals der Oberstabsarzt Deetz, der mir viel von seinem Sohne erzählte, welcher eben zum Theater gegangen war und in Karlsruhe auf der Hofbühne bedeutende Lorbeeren erntete. Der Herr Oberstabsarzt meinte, ich müßte auch Karriere auf der Bühne machen, es könnte mir nicht fehlen.
Dieser Ausspruch reifte den heimlich schon gefaßten Entschluß in mir, ich müsse Schauspieler werden.
Unsere Batterie wurde bald darauf nach Münster versetzt.
Auch dort wurde Theater gespielt! Wir zogen aus bürgerlichen Kreisen Talente an uns und wagten uns an größere Aufgaben in der dramatischen Kunst. Meine Kameraden hatten die Theaterdirektion in Münster auf mich aufmerksam gemacht, und ich trat denn auch bald öffentlich im Stadttheater zu Münster auf. Der dort engagierte Bassist Graf forderte mich auf, bei seinem Benefiz mitzuwirken. Es geschah. Ich spielte den »Kurmärker«. Die kräftigen Hände meiner Artillerie-Kameraden belohnten mich mit frenetischem Applaus und ließen eine andere Ansicht seitens der übrigen Theaterbesucher gar nicht aufkommen, wiewohl ich am andern Tage hörte, daß im münsterschen Publikum sich verschiedene Ansichten über meine Leistung geltend gemacht hatten. Den schlagendsten Beweis des Nichtgefallens erhielt ich aber erst am andern Tage auf der Parole durch meinen Hauptmann.
Der Herr Hauptmann Credner besuchte öfters das Theater, er mußte demnach ein Verehrer der Kunst sein; er war auch am gestrigen Abend im Theater gewesen, und ich ging nach dem enormen Beifall, der mir durch seine ganze Batterie am Abend vorher zuteil geworden, mit dem Bewußtsein zum Apell, das jeder Schauspieler kennt, wenn er am Tage nach einer gelungenen Rolle sich öffentlich zeigt. Leider teilt das Publikum oft nicht die Empfindungen, die wir haben – so war's auch bei meinem Hauptmann.
Der Hauptmann pflegte beim Appell die Avancierten für gewöhnlich nicht der Musterung zu unterziehen, ob sie die Knöpfe gut geputzt, ob sie rein gewaschen und die Kleider ohne Flecken – aber heute ging der Herr Hauptmann auch die Front der Avancierten entlang. Er fand alles in Ordnung; als er aber zu mir kam – ich stand als der jüngste Bombardier auf dem linken Flügel – besichtigte er mich ganz besonders, ging um mich herum und musterte mich von allen Seiten. Ich wurde ganz stolz und meine Dilettantenbrust hob sich zu künstlerischer Arroganz, denn ich glaubte schließen zu können, daß der Herr Hauptmann in der Nachwirkung des gestrigen Abends noch ganz im Anblick des Künstlers versunken sei. Mit einemmale reißt mir der Hauptmann den Helm vom Kopfe, hält ihn hoch in der Luft und schreit mit Stentorstimme über den Kasernenhof, daß alles zu uns herüberblickt: »Mit dem Helme haben Sie wohl Komödie gespielt!?« – Alles war stumm, aus des Hauptmanns Augen schossen Blitze, die mir deutlich sagten, daß ich ihm gestern in der Komödie gar nicht gefallen hatte, und er wiederholte seine Frage mit dem Zusatze: »Sie Schnurrant – wie sieht der Helm aus – antworten Sie – haben Sie damit Komödie gespielt?«
Ich war damals gar nicht eitel in Toilette, es konnte ja sein, daß das Messingzeug nicht so geputzt war, wie es dem Herrn Hauptmann an diesem Morgen wünschenswert erschien, ich selber hatte nichts an dem Helm gefunden, was mein Auge beleidigt hätte – und so antwortete ich denn auf die wiederholten Fragen, und weil ich mich durch den Ausdruck »Schnurrant« denn doch etwas gekränkt sah, ganz stolz im Gefühle des beleidigten jungen Künstlers: »Nein, Herr Hauptmann, dazu kann ich das Ding nicht brauchen!« – Ich weiß es nicht mehr genau, was nun geschah, denn mir verging Hören und Sehen, als der Herr Hauptmann mir den Helm wieder aufsetzte, so unsanft vollzog er diese Manipulation, und immer noch schien ihm der Helm nicht richtig zu sitzen, denn ich fühlte, wie der Helm mir bald das linke, bald das rechte Ohr abzuschneiden drohte, so mächtig fiel er wiederholt auf mein Haupt nieder, das statt Lorbeeren, wie ich gehofft, nun eine Dornenkrone umwand. Mein damals noch üppiges Haar war durch die unsanfte Bearbeitung mit dem Artilleriehelme wohl in Unordnung geraten und erschien dem Herrn Hauptmann dadurch in unvorschriftsmäßiger Länge. Nach nochmaliger Umkreisung knipste er mit dem Zeigefinger auf meine Uniform, ob er keine Staubwolke hervorzaubern konnte, und als dies vergebens, kehrte er wieder zur Besichtigung meiner derangierten Haarfrisur zurück und meinte: »Sie tragen ja wohl schon eine Künstlerfrisur? – Feldwebel,« rief er, »lassen Sie dem Bombardier Junkermann mal den Polkakopf stutzen und führen sie ihn 24 Stunden in Arrest.«
Ich wurde abgeführt – fern von Madrid über mein Schicksal nachzudenken. In späteren Jahren habe ich oft Gelegenheit gehabt, über eine verunglückte Rolle zu sinnen, aber eine solche Ruhe des Nachdenkens habe ich nie wieder gefunden als in meinem Arrest. Ich ließ die Worte der Rolle des Kurmärkers 24 Stunden lang in meinem Gedächtnisse vorüberziehen, und so oft ich auch die Rolle in meinem späteren Leben gespielt – ich habe sie nie wieder memorieren brauchen, der Herr Hauptmann hatte sie mir mit den 24 Stunden Arrest und mit dem Helme zu fest in meinen Kopf gedrückt. – – –
Tage, Wochen und Monate vergingen noch, bis ich endlich meine Entlassung vom Militär erhielt und meinen Plan, zum Theater zu gehen, ausführte.
Ich wandte mich wieder nach Köln und stellte mich einem Theateragenten vor. Dieser verschaffte mir ein Engagement nach Trier ans dortige Stadttheater.
Auf Anraten des Agenten mußte ich ein Repertoir gespielter Rollen aufsetzen, denn ohne solches engagiert man einen Schauspieler nicht. Die Rollen, die ich auf dem Liebhabertheater gespielt hatte, genügten dem braven Manne aber nicht, ich mußte welche hinzu lügen, und mit Herzklopfen und leerem Geldbeutel reiste ich den Rhein und die Mosel hinauf ins erste Engagement nach Trier.
III.
Es war im Jahre 1854, als ich in Trier zum erstenmale als bezahlter Schauspieler die Bühne betrat und zwar in der Rolle des »Manasse van der Straaten« in Gutzkows »Uriel Acosta«. Zum erstenmale wurde mir der Unterschied zwischen Dilettant und Künstler klar. Wo waren meine braven Artilleristen mit den ausgiebigen Händen zum Beifallklatschen? Mein Publikum in Wesel und Münster, das mich so überschüttet mit Beifall – wo war es? Wie habe ich es herbeigesehnt! Wenn der Dilettant in einem Liebhabertheater vor sein Publikum tritt, in den Kreis seiner Bekannten und Freunde, wie jubelt ihm da alles zu, wie täuscht sich das Publikum selbst, wenn es bereit ist, das Prädikat »ausgezeichnet« sofort in Anwendung zu bringen, wo doch meistenteils der göttlichen Kunst nichts als eine Verhöhnung zuteil wird. Du lieber Gott, wie hilflos stand ich vor dem Trierer Publikum, unter dem mich niemand kannte, niemand mir Wohlwollen entgegenbrachte. – Ich sehe mich heute noch, wie ich bald den einen, bald den andern Arm wie einen Windmühlflügel hob, bald einen Schritt vor, bald einen rückwärts, aber niemals seitwärts machte, um mich nicht, wenn ich die Fassung ganz verlor, zu weit von dem rettenden Souffleurkasten zu entfernen. Meine Sinne vergingen mir, die Liebhabertheaterroutine nützte mir gar nichts mehr – es ist ein himmelhoher Unterschied zwischen Liebhaberei und Broterwerb – ich konnte absolut die Würde des alten Van der Straaten nicht herausbringen. Erst vernahm ich ein Kichern, später ein herzliches, um nicht zu sagen höhnisches Lachen im Auditorium – ich ging ab, und jenes ominöse Zischen, das den Schauspieler empfindlicher berührt, als den Reisenden das Zischen einer Lokomotive, wenn er den Zug verpaßt, begleitete mich bis in die Garderobe.
Im Zwischenakt kam der Direktor Werdermann auf die Bühne. Der Mann war bisher so freundlich, sein Benehmen das eines Kavaliers, er war preußischer Lieutenant gewesen und aus guter Familie, aber den Blick, den der Mann mir zuwarf, vergesse ich nicht – er war zu schrecklich; so voller Vorwürfe, so voll Verzweiflung hatte mich mein Hauptmann in Münster nicht angesehen, als ich Komödie gespielt hatte. Ich kam mir vor, als hätte ich durch mein entsetzliches Debüt die Direktion des Stadttheaters in Trier ruiniert. So weit ich dieses Theater kennen gelernt, sind zum Glück geringfügige Anlässe genügend, um seinen Ruin herbeizuführen. Das Publikum in Trier interessiert sich nicht sehr für Theater und mancher Direktor ist dort zu Grunde gegangen, auch der meinige verfiel später diesem Schicksal; ob ich die Ursache war, ist mir nie recht klar geworden.
Die Kritik in der Trierer Zeitung feierte mein erstes Debut mit folgenden Worten:
»Herr Junkermann, unzweifelhaft noch ein junger Anfänger, spielte den Manasse van der Straaten – wir hoffen, diesen biedern Mimen zum ersten und letztenmale auf unserer Bühne gesehen zu haben.«
Am andern Morgen erhielt ich natürlich meine Kündigung, denn ich war dem Direktor die 18 Thaler Monatsgage, die ich beziehen sollte, offenbar nicht wert.
Trübe Stimmungen und harte Zeiten kamen über mich.
Gleichwohl trat bald nachher ein Umstand ein, der mir zu statten kam, weil er mich auf die Bahn führte, auf welcher mir dankbarere Aufgaben erwachsen sollten. Es erkrankte der Komiker der Trierer Bühne, Weirauch (ein Bruder des weiland berliner Possendichter und Komiker Weirauch); der Zettel von dem Feldmannschen Lustspiel »Der Sohn auf Reisen«, in welchem Stücke Weirauch abends den Peter spielen sollte, war bereits ausgetragen, als Weirauch plötzlich starb.
Ich hatte die Rolle auf meinem Repertoire stehen – hatte sie nicht gelogen, sondern wirklich gespielt auf dem Artillerie-Liebhabertheater zu Wesel, der alte Major v. Derschau und der Oberstabsarzt Deetz hatten ihre helle Freude daran gehabt. Der Direktor Werdermann schrieb mir also in seiner Not um die Abendvorstelluug, ob ich die Rolle nicht übernehmen wolle. Er wolle mir auch einen Thaler dafür als Honorar geben, ich möge ihm nur die Vorstellung retten, es könne mir ja egal sein, ob ich nochmals verhöhnt würde, ich hätte dann doch einen Thaler und könnte damit bis zum nächsten Theaterorte reisen, um dort mir durch Kollekte weiter zu helfen.
Ich machte seine Logik auch zu meiner eigenen. Meine vierzehntägige Kündigungszeit war vorüber, ich saß schon einige Tage ohne Verdienst in Trier, meine Ersparnisse waren aufgezehrt – Hunger thut weh – ich griff zu und acceptierte den Vorschlag, machte schnell Probe, die Rolle konnte ich gut auswendig, und wagte mich damit abermals auf die weltbedeutenden Bretter mit einem Thaler Honorar in Aussicht. Ich wollte mir auf den Thaler einen kleinen Vorschuß geben lassen – der Direktor lehnte aber ab, er traute mir wohl nicht und befürchtete, ich würde vor der Vorstellung damit durchgehen.
Vor dem Theater in Trier lag damals eine Wirtschaft, in der man guten Apfelwein trank. Hammer hieß der damalige Wirt. Der gute Mann borgte mir bis nach dem Theater, wo ich mein Honorar erhielt, das Getränk, dessen ich zur Stärkung und zur Erlangung des nötigen Mutes zu meinem Vorhaben bedurfte. Der Apfelwein, zu viel genossen, giebt eine rabiate Stimmung, ich trank mir Mut, weil ich glaubte, ich könne ohne diesen meine Aufgabe des Abends nicht erfüllen – ich trank beinahe zu viel – allein ich war nun erst in der richtigen Stimmung, in die mich der Direktor durch seinen Brief versetzen wollte, und ich phantasierte auf dem Wege vom Wirtshause bis zur Garderobe von nichts anderem als von den Erfolgen des Peter auf dem Weseler Liebhabertheater, dachte mir, warum sollen in Trier die Menschen so ganz anders als in Wesel sein, laß sie doch lachen, 's ist ja eine komische Rolle, und mit einer Frechheit trat ich vor die Rampen, um die ich mich in späteren Jahren oft beneidet habe. Jugend, Verzweiflung und Apfelwein – sie vermögen viel!
Ich spielte, man lachte, ich wurde dreister, man rief mich nach dem ersten Akte heraus – ich gefiel, man rief mich zum Schlusse des Stückes nochmals, die guten Trierer hatten einen vergnügten Abend verlebt – und ich auch.
Am andern Tage schrieb die Kritik: »Wir müssen unser hartes Urteil über Herrn Junkermann zurücknehmen und alles auf die Direktion wälzen, die es nicht verstand, den jungen Mann in dem ihm zusagenden Fache zu verwenden.« –
Donnerwetter, war ich stolz! Ich ging spazieren, um mich sehen zu lassen, da begegnet mir der Theaterdiener mit einem Briefe der Direktion an mich in der Hand, er gibt ihn mir, ich öffne und lese: »Geehrter Herr! Wenn Sie für 12 Thaler monatlicher Gage im Engagement verbleiben wollen, nehme ich meine Kündigung zurück. Werdermann, Direktor.«
Ich blieb, bekam komische Rollen und gefiel auch noch mit 12 Thaler Gage.
So unglaublich es heute klingt, man konnte damals in Trier mit 12 Thaler monatlich leben, ja ich habe mir noch ein paar Pfennige dabei gespart! Allein Trier ist nun einmal eine Stadt, die nicht die ganze Saison Theater liebt, der Direktor Werdermann mußte wie so viele seiner Vorgänger und Nachfolger die Trierer Bühne mitten in der Saisen wegen Mangels an Besuch schließen. Das Personal zerstob in alle Winde. Wer sich retten konnte, that es. Der eine zog ins Vaterhaus, der andere in ein neues Engagement, und wer beides nicht hatte, suchte sich durch Vorstellungen auf eigene Faust arrangiert, das Leben zu fristen.
So ging mir's. Zu meinem Vater wollte ich nicht zurück, ich hatte ohne seinen Willen meine Laufbahn gewechselt – ich wollte ihm nicht mehr zur Last fallen.
Ein in früherer Zeit und in seiner Art berühmter Schauspieler namens Dotter vereinigte sich mit mir und einer Sängerin, Riefenstahl, zu einer Konzert-Tournee. Herr Dotter hatte als »Essighändler« und »Viehhändler von Oberösterreich« eine gewisse Berühmtheit in der Theaterwelt erlangt, als Deklamator mangelte ihm jedoch jeglicher Ruf. Er meinte, ohne Subskription zögen wir das Publikum der Kleinstädter nicht in den Konzertsaal; ich besaß noch einen braunen, halbrund weggeschnittenen Frack mit goldenen Knöpfen, und mit diesem Kleidungsstück angethan hielt mich Herr Dotter für außerordentlich geeignet, von Haus zu Haus mit dem Subskriptionsbogen zu laufen, um die Leute zu uns ins Konzert zu locken.
Ich hatte damals den »Rummel« nicht los, unsere Ware anzupreisen, und meistens wurde ich mit den lakonischen Bemerkungen: »Bettelei, hier wird nichts gegeben« – »Das geht den ganzen Tag hier so« – abgewiesen. Wenn ich dann abends mit dem mageren Subskriptionsbogen ins Hotel kam, empfing mich Herr Dotter mit saurer Miene und meinte: »Damit können wir ja nicht einmal unsere Hotelrechnung bezahlen.«





























