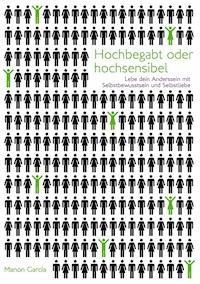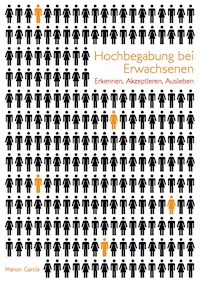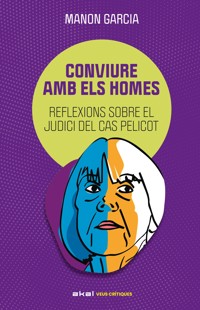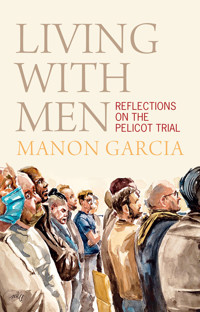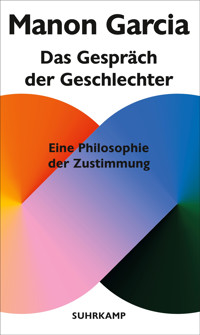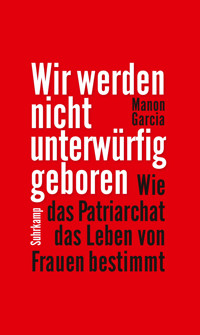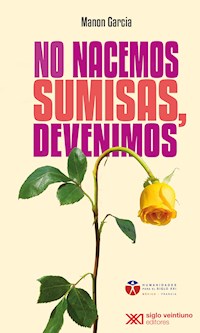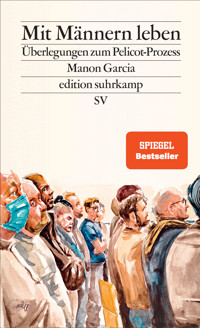
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Eine Reportage zum wichtigsten Gerichtsprozess unserer Zeit
Die monströsen Verbrechen an Gisèle Pelicot, die von ihrem Mann über Jahre betäubt und von ihm und fast 70 anderen Männern vergewaltigt wurde, haben die Welt erschüttert. Das sich anschließende Gerichtsverfahren avancierte zu einem der aufsehenerregendsten Prozesse der letzten Jahrzehnte, nicht nur wegen der Schwere der Schuld, sondern weil weithin klar wurde, dass das dort Verhandelte Millionen von Frauen betrifft.
Manon Garcia, eine der wichtigsten Feministinnen der neuen Generation, reiste zum Prozess nach Avignon, um diesen akribisch zu dokumentieren. Sie verbindet ihre präzisen Beobachtungen über den Verlauf des Verfahrens, die Angeklagten und deren Reaktion auf die Vorwürfe mit Überlegungen zur Rolle der Frau in der patriarchalen Gesellschaft. Und sie verknüpft sie mit eigenen Erfahrungen der alltäglichen Gefahr, Opfer zu werden. Angesichts der Abgründe männlicher Gewalt gelangt sie zu der existenziellen Frage: Wie noch mit Männern leben?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 235
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Cover
Titel
3Manon Garcia
Mit Männern leben
Überlegungen zum Pelicot-Prozess
Aus dem Französischen von Andrea Hemminger
Suhrkamp
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Zur Gewährleistung der Zitierfähigkeit zeigen die grau gerahmten Ziffern die jeweiligen Seitenanfänge der Printausgabe an.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
Die Originalausgabe erschien 2025 unter dem Titel Vivre avec les hommes. Réflexions sur le procès Pelicot bei Climats (Paris).
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2025
Der vorliegende Text folgt der deutschen Erstausgabe, 2025.Korrigierte Fassung, 2025.
© Suhrkamp Verlag GmbH, Berlin, 2025© Climats, un département des éditions Flammarion, Paris, 2025
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung nach einem Konzept von Willy Fleckhaus: Rolf Staudt
Umschlagabbildung: Zeichnung © ZZIIGG
eISBN 978-3-518-78425-9
www.suhrkamp.de
Widmung
5Für Gisèle Pelicot, Caroline Darian und all die anderen
Für Maxime und Caroline
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Inhalt
Informationen zum Buch
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Inhalt
Einleitung
Die Zustimmung
Die alte Dame und der Gynäkologe
Inzestmissbrauch
Unauffällige Männer
Männlichkeit(en)
Don't you want me baby
Eine ununterwürfige Frau unterwerfen
Wut
Der Strafprozess
Die Videos
Mazan schreiben
Das Normale und das Pathologische
Der Richter in uns
Ein gutes Opfer
Lemaire
Der fünfte Akt des Dominique P.
14. Dezember
Vergewaltigbar
Que reste-t-il de nos amours?
Man müsste die Frauen ein wenig lieben
Danksagung
Anmerkungen
Informationen zum Buch
3
5
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
9»Man muss die Männer sehr lieben. Sehr, sehr. Sehr lieben, um sie lieben zu können. Sonst ist es nicht möglich, sonst kann man sie nicht ertragen.«
Marguerite Duras, Das tägliche Leben
»Netzhaut und Pupillen
Den Jungen leuchten die Augen
Für ein falsches Spiel
Den Mädchen unter die Röcke zu schauen«
Alain Souchon, »Sous les jupes des filles«
11
Einleitung
Als ich an diesem Morgen um 7.15 Uhr am Gericht in Avignon ankomme, fallen mir die Frauen auf, die geduldig vor dem Gitter warten. Ich gehe zu einer englischen Kollegin, die in der Schlange auf mich wartet, neben mir stehen zwei junge Frauen in den Zwanzigern, zu denen sich bald eine dritte gesellt, die ihnen Kaffee und Croissants bringt. Auf der anderen Straßenseite flattert ein riesiges Transparent an der Stadtmauer. »Eine Vergewaltigung ist eine Vergewaltigung«, insistiert es als Antwort auf Äußerungen von Guillaume de Palma, einem der Verteidiger, der in den ersten Prozesstagen erklärt hatte, dass »es Vergewaltigung und Vergewaltigung gibt«, und damit bedeutete, dass die massenhaften Vergewaltigungen, die Gisèle Pelicot zu erdulden hatte, letztlich nicht so schlimm waren, keine »echten Vergewaltigungen«. Feministische Plakatiererinnen trugen den Prozess in die Straßen von Avignon, indem sie Botschaften an die Wände schrieben, vor allem entlang des von Gisèle genutzten Weges. Die Botschaften sind in mehreren Sprachen verfasst; je nach Prozessphase unterstützen sie Gisèle oder greifen empörende Formulierungen der Angeklagten oder ihrer Anwälte auf.
Vor uns befindet sich eine Gruppe älterer Frauen. Es besteht kein Zweifel, sie kommen regelmäßig. Sie kennen sich, reden miteinander und gruppieren sich um eine von ihnen, deren natürliche Autorität ins Auge springt. Brigitte, tadellos gekleidet und geschminkt, der Schal passt zum Lippenstift, nimmt seit September jeden Morgen den Bus um 6.19 Uhr, um zum Gericht zu kommen, obwohl die 12Verhandlungen erst um 9 Uhr beginnen. Brigitte, Bernadette, Dominique und die anderen beeindrucken mich. Diese Frauen, Rentnerinnen, sind zu Beginn dieses Prozesses gekommen, als sie von ihm in der Lokalpresse gehört hatten. Erst an einem Tag, dann an einem anderen, bis sie beschlossen, dass sie den Herbst 2024 hier verbringen würden. Sie sind zu Expertinnen geworden, kennen den Fall in- und auswendig, die Namen der Angeklagten, ihrer Anwält:innen, die Verteidigungsstrategien.
An diesem 4. November, als die Verhandlung nach einer einwöchigen Pause zu Allerheiligen wieder aufgenommen wird, ist das beherrschende Gesprächsthema die Organisation des Prozesses: Das Gericht in Avignon, das sich nicht auf den Fall vorbereitet hatte, dass Gisèle Pelicot die Möglichkeit ablehnen würde, den Prozess unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden zu lassen, ist von dem Ausmaß der öffentlichen und journalistischen Aufmerksamkeit überfordert. Der Verhandlungssaal ist zu klein, um das Gericht, die Angeklagten, ihre Anwält:innen, die Nebenklägerinnen, die Journalist:innen und die Zuschauer:innen aufzunehmen. Es wurde beschlossen, dass das Publikum den Prozess von einem Übertragungsraum aus verfolgen soll. Aber auch dieser Raum ist zu klein, sodass die Zuschauer:innen sehr früh kommen müssen, um einen Platz zu ergattern, den sie während der Sitzungsunterbrechungen jedoch zu verlieren drohen. Praktisch bedeutete dies, dass die Frauen, die seit Beginn des Prozesses gekommen sind und jeden Morgen vor Sonnenaufgang aufstehen, bei Gisèle Pelicots Rede vor den Ferien nicht zugegen sein konnten: Bevor Gisèle sprach, wurde eine kurze Pause gemacht, der Übertragungsraum geleert, und die Nachzügler:innen, die draußen warteten, kamen anstelle des Stammpublikums zum Zuge.
13Wie ich sie beklagen höre, dass ihre regelmäßige Anwesenheit keine Berücksichtigung findet, scheint mir dies nicht so dramatisch und die Entrüstung vielleicht ein wenig überzogen. Im Laufe der Zeit werde ich jedoch im Gegenteil denken, dass die Frage der Warteschlange, des Übertragungsraums und wer das Recht hat, etwas zu sehen, entscheidend ist: Sie macht das Finanzierungsproblem der Justiz in Frankreich sichtbar, aber auch das des Platzes der Bürger:innen und Journalist:innen im Strafprozess. Als ich nach drei Tagen im Übertragungsraum dank einer Akkreditierung schließlich in den »echten« Saal eintreten kann, erkenne ich das Ausmaß all dessen, was ich nicht gesehen, nicht gefühlt, nicht verstanden habe. Die Kamera, die im Gerichtssaal filmt, ist starr: Man sieht in der Totalen die Richter:innen, die Staatsanwält:innen und das Pult, an das die Expert:innen, die Zeug:innen und die Angeklagten treten, die als freie Männer vor Gericht erscheinen. Die Polizisten, die Anwält:innen der Verteidigung, die inhaftierten Angeklagten sieht man nie. Genauso wenig die Verständigung unter den Angeklagten, ihr Gekicher, noch, wie Dominique Pelicot von seiner Glaskabine aus physisch über den Prozess zu herrschen scheint. Ich werde darauf zurückkommen. Umgekehrt sehen und hören die Richter:innen, Staatsanwält:innen und Journalist:innen die Reaktionen des Publikums nicht.
Je mehr Zeit vergeht, desto länger wird die Warteschlange vor den Gittern des Gerichtsgebäudes: junge Frauen, die sich für den Prozess interessieren, eine Mutter und ihre Tochter, die von weit her gekommen sind, um »Gisèle« zu sehen und um zu verstehen, eine Schauspielerin aus Westfrankreich. Später kommen noch Männer, aber mir gelingt es nicht, mit ihnen zu sprechen: Für uns, die wir 14an diesem Morgen hier sind, ist ihre Anwesenheit ein Rätsel. Was wollen sie? Sind sie in der Hoffnung hier, Videos vom Missbrauch von Gisèle Pelicot zu sehen? Brigitte beruhigt uns: Heute wird es keine Videos geben. Aber an den Tagen, an denen Aufnahmen gezeigt werden, sagt sie uns, ist der Andrang groß, und man wird »kleine hechelnde Ärsche« im Übertragungsraum sehen können. Wer sind dann diese Männer? Einige scheinen zu denken, dass man sich das nicht entgehen lassen sollte, dass der Besuch ein Muss ist, aber sie sprechen nicht mit uns, mit Ausnahme von zwei Männern, die offensichtlich hoffen, mit den anwesenden Frauen Kontakte zu knüpfen.
Einige Minuten bevor die Tore geöffnet werden, kommen Männer nach vorn zum Gitter, ohne sich in die Schlange einzureihen. Mein erster Gedanke ist, dass sie alle zu überholen versuchen, dann vermute ich jedoch, dass sie sicherlich für andere Fälle, andere Prozesse warten. Mir entgeht so zunächst das Offensichtliche: Einige von ihnen sind Angeklagte in dem Prozess, für den ich mich interessiere. Von den fünfzig, die neben Dominique Pelicot angeklagt sind, ist einer auf der Flucht, einige sind im Gefängnis, doch die Mehrheit befindet sich nicht in Untersuchungshaft. Sie kommen morgens ins Gericht, man begegnet ihnen auf dem Gang auf dem Weg zur Toilette oder zum Kaffeeautomaten. An Tagen mit großem Andrang tragen sie eine Maske und in der Vorhalle eine Kapuze, um nicht fotografiert zu werden, doch das ist nicht immer der Fall. Und da man sie auf dem Bildschirm im Übertragungsraum nicht sieht, wenn sie im Zeugenstand sind, verbringe ich die ersten Tage damit, mich bei jedem Mann ohne Anwaltsrobe, den ich vorbeigehen sehe, zu fragen: Vergewaltiger oder nicht; und sobald ich sie identifiziert und entdeckt habe, wie sehr einige von ihnen die 15bei der Verhandlung anwesenden »rasenden Feministinnen« hassen, bekomme ich ein mulmiges Gefühl.
Noch bevor ich an den Gittern, in der Vorhalle oder im Übertragungsraum angekommen war, hatte ich schon das Gefühl, beim Prozess zu sein, den Prozess zu verstehen, in diesem Prozess zu leben. Als Philosophin und Spezialistin für feministische Fragen und insbesondere für die Begriffe der »Unterwerfung« und der »Zustimmung« war ich seit Monaten von dieser Geschichte, von diesem Prozess gefangen, der mir wie eine endlose Deklination all der Fragen erscheint, die mich seit fast fünfzehn Jahren fesseln. Bereits im Juni 2023, als Lorraine de Foucher in Le Monde über diese Geschichte zu berichten begann, wurde ich von ihr ergriffen. Ich lese jeden Tag bis zur Erschöpfung alle Artikel, die ich finden kann, und habe das Gefühl, nur an sie, nur an diese Männer, nur an dieses Zimmer in Mazan zu denken. Aber an diesem schönen provenzalischen Wintermorgen sehe ich, dass die anderen dort anwesenden Frauen sich von dem Prozess genauso in den Bann ziehen lassen wie ich und genauso den Eindruck haben, dass diese Verhandlungstage etwas von ihrem Leben betreffen. Ich mache hier die Erfahrung einer Solidarität, die weder abstrakt noch unmittelbar politisch ist: Jenseits der Frage, ob Dominique Pelicot ein Monster ist oder nicht, ob Gisèle etwas ahnte oder nicht, ob die anderen Männer gewöhnliche Männer sind oder nicht, sehe ich an diesem Morgen, dass dieser Prozess etwas mit uns macht, mit uns, die wir alle zusammen warten. Wir sind alle bewegt, als Gisèle Pelicot kommt. Sie ist umgeben von ihren beiden Anwälten, die sie vor der Gewalt der Welt zu schützen scheinen, und wird, wie jeden Morgen und jeden Abend, mit Beifall empfangen. In dieser Vorhalle 16hat die Idee von einem »feministischen Wir« etwas Greifbares, Konkretes.
Das ist zweifellos das, was mich davon überzeugt, dieses Buch zu schreiben: In diesem Prozess betrifft uns etwas – ohne dass ich genau wüsste, wer dieses »uns« ist –, das sich nur schwer in einer Momentaufnahme, einem Gastbeitrag oder einem Artikel zusammenfassen lässt. Dies ist nicht nur der Prozess (der Kultur) der Vergewaltigung, der Prozess der Chemischen Unterwerfung, der Prozess dieser Männer. Es muss natürlich der faire, rechtsstaatliche, den Einzelnen betrachtende Prozess dieser einundfünfzig Männer sein, aber es ist nicht dieser Prozess, auf den wir in der Kälte sauber aufgereiht warten und für den mehr als dreihundert Journalist:innen aus der ganzen Welt eine Presseakkreditierung beantragt haben.
Eine der zentralen Thesen dieses Buches lautet: Was den Vergewaltigungsprozess von Mazan zu einem im historischen Sinne großen Prozess macht, ist paradoxerweise, dass er der ausschließlichen Hoffnung auf die Strafjustiz ein Ende setzt. Es ist der Prozess, der zeigt, dass Prozesse niemals ausreichen werden: Wenn es einem einzelnen Mann in einem kleinen Flecken wie Mazan gelingt, mindestens siebzig verschiedene Männer, die in einem Umkreis von weniger als 50 Kilometern wohnen, zu sich nach Hause zu holen (die dafür benutzte Website Coco funktioniert über Geolokalisierung, und Dominique Pelicot wollte sicherstellen, dass die Männer schnell anreisen können), wie viele Männer gibt es dann in Frankreich, die bereit sind, eine bewusstlose Frau zu vergewaltigen, wenn sich die Gelegenheit dazu bietet? Wenn so viele Angeklagte angesichts der unzweideutigsten und erdrückendsten Videos, die man sich nur vorstellen kann, immer noch ver17suchen, die Taten oder ihren Vorsatz zu leugnen, was können dann Richter:innen oder Geschworene tun, wenn sie es nicht mit einem akribischen und von der Videoaufzeichnung besessenen Sammler zu tun haben? Wenn die meisten dieser Männer sich so wenig für ihre Taten zu schämen scheinen, so schnell Entschuldigungen finden, selbst nach langen Haftstrafen, wie kann man dann in ihrer Strafe etwas anderes sehen als eine temporäre Bestrafung, die nicht viel ändern wird? Wenn ihre Anwält:innen so viele sexistische Klischees verwenden und nicht müde werden, ihre Mandanten zu verteidigen, indem sie sie für nicht verantwortlich erklären, wie werden diese Männer, ihre Familien, ihre Freund:innen dann in diesem Prozess etwas anderes sehen als Ungerechtigkeit? Kein Strafwesen wird umfassend, mächtig und effizient genug sein, damit Männer aufhören zu vergewaltigen. Was aber, wenn »die Justiz ihre Arbeit machen lassen« – wie die Leute fordern, die feministische Auswüchse befürchten – keine Chance hat, das Problem zu lösen? Wie viele Frauen verfolgt mich auf quälende Weise eine Frage und taucht immer wieder auf, wenn ich am wenigsten damit rechne: Können wir mit Männern leben? Um welchen Preis?
Ich weiß, dass diese Frage irritierend, verletzend und unerträglich sein kann, aber mir wäre es lieber, dass sie mich verletzt, anstatt mich unablässig zu verfolgen. Ich wünschte, ich könnte dazu aufrufen, sich erst einmal zu beruhigen und zu differenzieren, aber mehr noch als gewöhnlich wird durch diesen Prozess in meinem Alltag ein Licht auf die enorme Geduld, Resilienz oder vielleicht sollte man besser sagen Unterwerfung geworfen, die uns begleiten. Ich ziehe mich an und mache mir Sorgen – nicht zu sexy (man muss sich nicht wundern, dass sie vergewaltigt wird), nicht zu ungepflegt (uh, kein Wunder, dass ihr Mann sie 18betrügt, hast du gesehen, wie sie sich gehen lässt?). Wenn ich dieses Kleid anziehe, werden mich meine Student:innen dann ernst nehmen? Gut, zumindest habe ich das Glück, älter zu werden und damit weniger beachtet zu werden. Ich gehe die Treppe hinunter und mache mir Sorgen – was, wenn wieder einmal ein übergriffiger Mann im Flur steht –, ich bringe meine Töchter zum Kindergarten und gehe dabei durch einen Park. Zum Glück bin ich mit den Kindern zusammen, die Männer, die im Park herumlungern, sprechen mich vor allem an, wenn ich allein bin. Ich schaue mir die Nachrichten an. Ah, Puff Daddy? Ja, gut, das hätte man sich denken können. Aber auch der beliebte Priester Abbé Pierre hat Frauen vergewaltigt? Online-Kommentare zu Videos von mir oder anderen – »Haha, aber die, ich würde die nicht einmal mit einem Stock vergewaltigen«. Der Kollege, der sich wundert, dass ich am Institut für Philosophie unterrichte (»Bist du nicht in den Gender Studies?«), sehr enge Angehörige, die das Unentschuldbare ihrer Freunde oder Verwandten entschuldigen, grausame Familiengeschichten, jahrzehntelange Lügen, die in einem Brief aufgedeckt werden, der Inzestmissbrauch von den einen und von den anderen, Schläge, verbale Gewalt. Das politische Klima ist nicht hilfreich, so soll es die Schuld der Frauen und des Feminismus sein, wenn junge Männer immer mehr für die äußerste Rechte von Donald Trump über die deutschen Rechtsextremen bis Jordan Bardella stimmen; das kommt dabei heraus, wenn man den Männern den freien Zugang zum Körper der Frauen verwehrt!
Ich könnte endlos viele Arten aufzählen, wie meine Existenz und die anderer Frauen durch die Gewalt von Männern eingeschränkt wird, aber hier geht es mir um etwas anderes: Ich will verstehen, was sich in diesem Pro19zess abspielt. Ist es einfach die morbide Faszination für das Böse? Wenn man die Artikel zu Beginn des Prozesses liest, die sich in den brutalsten und schockierendsten Details verloren haben, gewinnt man diesen Eindruck. Dieser Prozess ist, wie die Prozesse nach dem Zweiten Weltkrieg, die Terroristenprozesse und die Prozesse gegen schwere Sexualverbrecher, auf seine Weise ein Prozess des Bösen. Doch Dominique Pelicot ist nicht allein auf der Anklagebank. Dies ist nicht der Prozess eines einzelnen Mannes, sondern der einer Gruppe, von der einige Mitglieder nicht identifiziert wurden und in aller Ruhe ihren Beschäftigungen nachgehen. Die unterschiedlichen Profile, Alter und Geschichten der anderen fünfzig Angeklagten werfen Fragen auf und versetzen einen in Angst und Schrecken: Könnte es sein, dass ein Otto Normalbürger bereitwillig die schlafende Frau seines Nachbarn vergewaltigt, wenn man ihm die Gelegenheit dazu gibt? Bei dieser Frage beginnt sich für viele von uns plötzlich alles zu drehen, insbesondere für diejenigen, die dachten, dass #MeToo vielleicht die letzte Episode im Kampf gegen geschlechtsspezifische und sexualisierte Gewalt sein würde.
Kurz gesagt, es handelt sich nicht, wie 1978 in Aix-en-Provence, wo die Vergewaltigung von zwei jungen Frauen durch drei Männer ein enormes Echo auslöste, um einen Vergewaltigungsprozess, sondern vielmehr um einen Prozess, in dem sich eine ganze Reihe grundlegender Fragen über die Beziehungen zwischen Männern und Frauen, über das Böse, die Gewalt, den Inzestmissbrauch, die Geschlechternormen und die Macht konzentrieren. Bücher über die großen Prozesse füllen viele Regale; es gibt Gerichtschroniken, literarische Werke, Arbeiten von Historiker:innen und Soziolog:innen, und natürlich gibt es auch Hannah Arendts Buch Eichmann in Jerusalem. Diese Bücher fes20seln mich, aber ich möchte hier einen etwas anderen Weg einschlagen: Anstatt Tag für Tag eine Chronik des Prozesses zu schreiben, möchte ich den Prozess, seine kleinen Sätze, manchmal die Fakten, oft die mediale Berichterstattung über ihn nutzen, um als Philosophin die Fäden zu entwirren, die sich darin verwoben finden. Da dieser Prozess einer der großen Prozesse ist, in denen man das Monströse und das leibhaftige Böse zu entdecken glaubt, gleichzeitig aber auch ein absolut gewöhnlicher Prozess mit gewöhnlichen Angeklagten und einem »guten Opfer« (ich werde darauf zurückkommen), müssen seine Herausforderungen eine nach der anderen aufgerollt werden. Wie der Prozess von Aix im Übrigen nicht ohne den Kontext verstanden werden kann, in dem er stattfand – der Aktivismus des Mouvement de libération des femmes und seine Mobilisierung für die Kriminalisierung der Vergewaltigung, das in Libération erschienene feministische Manifest von 1976 gegen Vergewaltigung, aber auch der Einsatz der Anwältin Gisèle Halimi gegen den Algerienkrieg und die Nutzung von Prozessen zu politischen Zwecken –, kann der Prozess von Avignon nicht außerhalb der Sequenz des französischen Feminismus verstanden werden, die zweifellos mit dem Fall Dominique Strauss-Kahn eingeleitet und mit der #MeToo-Bewegung richtig eröffnet wurde.
Ich glaube im Anschluss an Simone de Beauvoir auch, dass sich die Philosoph:innen nicht allzu viele Illusionen über die Macht der Sprache der Philosophie machen sollten. Es gibt Gefühle, Erfahrungen und Wahrheiten, die die Philosophie nur schwer fassen kann. Und diese Gefahr ist bezüglich der sexuellen Gewalt besonders groß, insofern diese Fragen als dermaßen entfernt von der Philosophie galten. Im Gegensatz zu den streng philosophi21schen Büchern, die ich in den letzten Jahren geschrieben habe, erlaube ich mir hier eine freiere, zuweilen persönlichere Form. Ich glaube nicht, dass dies die Objektivität meiner Analysen beeinträchtigt, im Gegenteil: Nur wenn man auch der subjektiven Erfahrung eines Prozesses wie diesem Rechnung trägt, kann man voll und ganz verstehen, was es heißt, in der Welt, die dieser Prozess ans Licht bringt, ein menschliches Wesen und insbesondere eine Frau zu sein.
22
Die Zustimmung
»Wenn man nicht weiß, was man tun soll, kann man immer ein Gesetz machen, das kostet nicht viel und macht Freude. Ob es wirksam ist, ist eine andere Frage!«
Robert Badinter, einen italienischen Politiker zitierend
Häufig wurde gesagt, der Vergewaltigungsprozess von Mazan sei der Prozess der Zustimmung (consentement)1 gewesen. Und wahrscheinlich wird er am Ende als eine wichtige Etappe auf dem Weg der Verallgemeinerung des Vokabulars der Zustimmung bei der Betrachtung sexueller Gewalt gelten. Doch dieser Wendepunkt wird und sollte kein juristischer Wendepunkt sein. Er wird, wie ich hoffe, ein Wendepunkt in der gesellschaftlichen Vorstellung von der Vergewaltigung sein. Denn selbst wenn das Konzept der Zustimmung in den Köpfen noch nicht als der entscheidende Begriff angekommen ist, um zu verstehen, was bei der sexuellen Gewalt nicht geht, und dass man seiner bedarf, zeigt dieser Prozess, dass er sich in der Sphäre des Rechts bereits durchgesetzt hat.
Ich will dies erläutern: Seit der #MeToo-Bewegung hört man oft, dass die Definition der Vergewaltigung im französischen Strafgesetzbuch unbedingt geändert werden müsse. Die Argumentation ist folgende: Sie geht von der Feststellung aus, die ich absolut teile, dass sexuelle Gewalt sehr weit verbreitet ist. Die Zahlen sind eindeutig: Schätzungen zufolge sind in jedem Jahr in Frankreich durchschnittlich 230 000 Frauen im Alter von 18 bis 74 Jahren Opfer von Vergewaltigung, versuchter Vergewaltigung und/oder sexuellen Übergriffen;2 laut der Virage-Umfrage haben 14,5 Prozent der Frauen und 3,9 Prozent der Män23ner im Alter von 20 bis 69 Jahren sexuelle Gewalt erlebt;3 alle drei Minuten wird in Frankreich ein Kind Opfer einer Vergewaltigung oder eines sexuellen Übergriffs, das sind 160 000 Kinder pro Jahr.4 Angesichts dieses Ausmaßes wird die Vermutung angestellt, dass diese Gewalt nicht so weit verbreitet wäre, wenn sie strenger bestraft würde und die Täter mehr Angst vor den Konsequenzen hätten. Die uns zur Verfügung stehenden Zahlen zeigen auf jeden Fall, dass diese Gewalt selten bestraft wird, weil sie selten angezeigt, selten geglaubt und von Polizei und Justiz selten angemessen behandelt wird. Ein wesentlicher Kritikpunkt ist, dass viele Fälle von sexueller Gewalt als sexuelle Nötigung und nicht als Vergewaltigung betrachtet werden (und daher eine geringere Strafe erhalten) oder keine strafrechtliche Verurteilung nach sich ziehen. Insbesondere in einigen sehr medienwirksamen Fällen wurden die Angeklagten mit der Begründung freigesprochen, sie hätten nicht gewusst, dass das Opfer das Geschehene nicht wollte. Daraus wird geschlossen, dass das Problem darin besteht, dass Artikel 222-23 des Strafgesetzbuchs die Vergewaltigung definiert als »jedweden Akt sexueller Penetration oder jedweder oral-genitaler Akt, der an der Person eines anderen oder an der Person des Täters durch Gewalt, Zwang, Drohung oder Überraschung begangen wird«, anstatt sie, wie in immer mehr Ländern üblich, durch die Nicht-Zustimmung des Opfers zu definieren.
Ich werde auf die Probleme einer solchen Gesetzesänderung zurückkommen, doch zunächst möchte ich zeigen, dass im Vergewaltigungsprozess von Mazan wie auch in anderen Prozessen das Einvernehmen nicht abwesend, sondern im Gegenteil absolut allgegenwärtig ist. Aus der von der Untersuchungsrichterin vorgelegten Anklageschrift 24geht beispielsweise hervor, dass jeder der Angeklagten zu einem möglichen Einvernehmen von Gisèle Pelicot befragt wurde. Einer »gab zu, dass Pelicot, Gisèle nicht zustimmte«, ein anderer erklärte, dass ihm »die Situation nicht als Vergewaltigung, sondern als die eines einvernehmlichen Paars« dargestellt wurde. Er bestritt daher die Vorwürfe, räumte aber, nachdem er die Videos gesehen hatte, ein, dass »Gisèle [Pelicot] nicht zugestimmt haben konnte«. Ähnliche Kommentare finden sich in den Vernehmungsprotokollen der anderen Angeklagten. Die Soziologin Océane Pérona hat der Art und Weise, wie Polizisten bei sexueller Gewalt ermitteln, ihre Dissertation und eine Reihe von Artikeln gewidmet. Sie zeigt insbesondere, dass »die Polizeibeamten die Angeklagten systematisch nach ihrem Wissen hinsichtlich der Zustimmung oder Nicht-Zustimmung der Klägerinnen fragen«. Sie greifen bei ihren Befragungen immer wieder auf den Begriff der Zustimmung zurück, obwohl er in der Definition der Vergewaltigung nicht vorkommt. Tatsächlich und wie sie anhand des Urteils im Fall »Dubas« von 1857, wo ein Mann sich ins Bett einer Frau schlich und sich als ihr Ehemann ausgab, in Erinnerung ruft, definiert der Kassationshof die Vergewaltigung mittels »des Fehlens des Einverständnisses« und beschreibt dieses Fehlen des Einverständnisses als Gewalt, Zwang oder Überraschung durch den Täter. Das Gesetz erwähnt das Einverständnis zwar nicht, doch stellt die Rechtsprechung klar einen Zusammenhang zwischen Gewalt, Zwang und Überraschung, zu denen später noch die Drohung hinzukommt, und der Nicht-Zustimmung her und legitimiert folglich die Verwendung des Vokabulars der Zustimmung in der polizeilichen Vernehmung und im Strafprozess.5
Daraus darf man jedoch nicht schließen, dass damit für 25die Kläger:innen alles gewonnen ist, ganz im Gegenteil. Die Verwendung des Begriffs der Zustimmung ist leider keine Garantie für einen guten Umgang mit sexueller Gewalt. Auch hier erweisen sich die Arbeiten von Océane Pérona als hilfreich, weil sie zeigen, dass die Einschätzung der Polizisten, ob das Opfer zugestimmt hat oder nicht, das heißt, ob eine Straftat vorliegt oder nicht, auf der Heranziehung dessen beruht, was man im Anschluss an die Arbeit von John Gagnon und William S. Simon als »sexuelle Skripte« bezeichnet.6 Jeder von uns hat aufgrund seiner persönlichen, sozialen und beruflichen Situation und aufgrund seiner Erfahrungen eine Vorstellung davon, wie sexuelle Beziehungen aussehen und aussehen sollten. Wir begehren nicht »wie Tiere«, die Sexualität ist vielmehr ein soziokultureller Lernprozess. Da es zum Beispiel kulturell geteilte Szenarien hinsichtlich der Sexualität gibt, kann man sich die Zustimmung manchmal wie ein Mautticket oder einen QR-Code vorstellen: Weil man oft denkt, dass man weiß, wozu man zustimmt, wenn man dem Sex zustimmt (zum Beispiel dass ein Geschlechtsverkehr im Eindringen eines Penis in eine Vagina besteht, dem eventuell ein »Vorspiel« vorausgeht und das mit der Ejakulation des Penis endet), kann man meinen, dass man nicht darüber diskutieren muss, worauf man Lust hätte und wie der Geschlechtsverkehr aussehen sollte. Dass man kurz gesagt davon ausgehen kann, dass es ein vorab geschriebenes Drehbuch gibt, das in dem besteht, wozu man ja gesagt hat.
Mit anderen Worten: Polizisten haben, wie alle, eine bestimmte Vorstellung davon, wie eine normale sexuelle Beziehung aussieht, unter welchen möglichen Umständen Gewalt angewendet wird etc. Diese Vorstellungen variieren jedoch je nach den Lebensumständen des Einzel26nen, den demografischen Merkmalen und insbesondere dem Geschlecht. Wenn Sie zum Beispiel eine junge lesbische urbane Schriftstellerin sind, die ein langes Studium absolviert hat, werden Ihnen nicht dieselben sexuellen Skripte zur Verfügung stehen wie einem geschiedenen 50-jährigen Schutzmann in einer Kleinstadt. Océane Pérona zeigt, dass die sexistischen Vorstellungen, die sie bei Polizisten beschreibt, auf der Ebene dieser sexuellen Skripte angesiedelt sind: Die von ihr betrachteten Beamten haben Schwierigkeiten, die Möglichkeit der Vergewaltigung einer Prostituierten ernst zu nehmen, weil sie in den Anzeigen eine Form sehen, »geschäftliche Differenzen« zu regeln; sie neigen dazu zu glauben, dass eine Frau, die zu einem Mann geht, von dem sie weiß, dass er mit ihr schlafen will, nicht vergewaltigt werden kann, selbst wenn der Mann sich weigert, ein Kondom zu benutzen; dass ein weißes Mädchen, das eine Vergewaltigung in der Schule anzeigt, dies vielleicht tut, weil sie nicht zugeben will, dass sie einvernehmlichen Geschlechtsverkehr hatte, usw. Die Bewertung von Szenen anhand von sexuellen Skripten ist nicht nur Polizisten eigen, doch der Einsatz dieser Skripte durch Polizisten bei dem Versuch zu ermessen, ob eine Person einer sexuellen Interaktion zugestimmt hat oder nicht, kann sexistische und damit ungerechte Verzerrungen offenbaren.