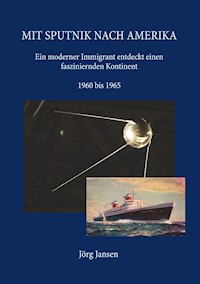
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Jörg Jansen wurde 1930 in Mülheim an der Ruhr geboren, wo er bis 1951 lebte. Nach einem Studium an der Technischen Hochschule in Aachen und nach einer kurzen Lehrtätigkeit in England ging er "für ein Jahr" in die USA, um von den weit fortgeschrittenen Technologien der USA zu profitieren. Allmählich dehnte sich das Jahr zu Jahrzehnten aus, in denen er in der Forschung und Entwicklung gearbeitet hat. Seit 1997 lebt er im Ruhestand mit seiner Frau Birgit in Los Alamos in New Mexico. Es ist die Geschichte von einem "high-tech" Immigranten, der mit einer Welle von Wissenschafts- und Ingenieurtalent in die USA gespült wurde. Nach dem Erfolg des sowjetischen Satelliten Sputnik importierte Amerika Wissenschaftler und Ingenieure aus Europa, die ihre amerikanischen Kollegen unterstützen sollten, die Sowjets einzuholen und letztlich das Weltraumrennen zu gewinnen. Die Erfahrung und Erlebnisse des Autors sind ganz anders als die Geschichte von Millionen vor ihm, die oft unvorstellbare Entbehrungen auf sich genommen hatten, um das Land ihrer Träume zu erreichen. Jörg hatte seinen ersten Kontakt mit Amerika, als ihm die freundlichen amerikanischen Soldaten im Mai 1945 Schokolade und Kaugummi schenkten. Damals und in den folgenden Jahren hatte er viele Fragen über dieses ungewöhnliche Land, wo er dann 15 Jahre später Antworten fand. Er lässt den Leser an seinen unerwarteten Entdeckungen und Erlebnissen in der Neuen Welt voller Spannung teilnehmen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 327
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dieses Buch ist meiner lieben Frau gewidmet, die die meisten
meiner Entdeckungen miterlebt hat. Sie hat das Manuskript
sorgfältig redigiert und meinem Gedächtnis nachgeholfen, wenn
Not am Mann war.
Inhalt
Prolog
Lunch in Reading
Erinnerungen an 1945
Loughborough College
Über den Atlantik
Die neue Welt im März 1960
Transitron
Wakefield
Eine neue Sprache
Autos, Kaffee und TV
Der schwarze Anzug
Das neue Klima
Man zeigt, wer man ist
Helvetia
Samstag im Supermarket
Geschäftsreisen
Gesellschaftliche Kontakte
Gefahr im Atlantik
Der herrliche Sommer von 1960
Der schicksalhafte Vierte Juli
Die modernen Immigranten
Homo Americanus
Das verwirrende Masssystem.
The Spruces
Die Helvetia sinkt
Maine und Mehr
Die erste Kommune
Hochzeit im Blizzard
Hochzeitsreise im Faltboot
Lohnerhöhung auf amerikanische Art
Letzter Sommer an der Ostküste
Im Beach and Tennis Club
Go West, junges Paar
General Atomic
San Francisco, San Diego, La Jolla
Die absurde Welt des Alkohols
Unsere neuen Nachbarn in La Jolla
Segeln auf dem Pazifik
Ein neues Klima im Südwesten
Unsere neuen Jobs
Der kalte Krieg wird zu heiss
Wir erkundigen den Westen
Mexiko
Staatsbürgerschaft
Ins nächste Abenteuer
Prolog
Es war im Summer 1958, in dem ich mit einigen Freunden die Weltausstellung in Brüssel besuchte. Direkt am Haupteingang ragte über uns in den Himmel das riesige Atomium, eine 165 millionenfache Vergrösserung eines Eisenatoms. Kolossal! Allerdings wurde der Goliath sofort in den Schatten gestellt von einer kleinen unscheinbaren Kugel mit einem Durchmesser von ungefähr dreissig Zentimetern, aus der vier dünne Antennen herausragten. Ich entdeckte sie am Eingang zu dem riesigen Pavillon der Sowjet Union. Sie stand dort auf einem Pedestal oberhalb einer Bronzeplatte mit der Aufschrift »Sputnik 1, der erste Satellit im Weltraum«. Ein junger Mann in einer schmucken Uniform teilte mir voller Stolz mit, dass dieses Wunderwerk – von Wissenschaftlern und Ingenieuren der grossen Sowjetunion entwickelt – am 4. Oktober 1957 in den Weltraum geschossen wurde. Es wog 83,6 Kilogramm und verbrannte nach 1440 Umläufen und drei Monaten bei der Rückkehr zur Erde in der Atmosphäre. Seine Radiosignale wurden von Radioamateuren auf der ganzen Welt empfangen. Die Nachbildung auf dem Pedestal war eine Demonstration der technologischen Fähigkeiten seines Landes.
Der Erfolg dieses kleinen Objects hatte unvorhersehbare Konsequenzen. Die völlig unerwartete Ankündigung im Jahr zuvor löste die Sputnik Krise in den USA aus. Das Rennen der zwei Grossmächte um den Weltraum hatte begonnen. Es brachte mit sich völlig neue und unerwartete wissenschaftliche und technologische Entwicklungen für die kommenden Jahrzehnte. Ich ahnte noch nicht, dass dieses kleine Wunderding auch meine Zukunft auf den Kopf stellen würde.
Die Erkenntnis, daß die Sowjets ihnen im Weltraumrennen plötzlich weit voraus waren, zwang die Amerikaner zu aussergewöhnlichen Anstrengungen. Die Zahl der einheimischen Wissenschaftler und Ingenieure reichte bei weitem nicht aus, um den sowjetischen Vorsprung in Kürze einzuholen. So kam es, dass die Weltraumfirmen in aller Eile technisches Talent von Europa importierten. Eine dieser Firmen hieß Transitron Electronics. Sie lag in der Nähe von Boston an der Route 128.
Lunch in Reading
»Kurt! Kuuurt! Wo gehst Du hin? Ist’s schon Zeit zum Lunch?« Kurt hatte seine Hand schon an der Türklinke, als er sich umdrehte und sagte: »Ich fahr’ nach Reading und mach’ mir ein Lunch zu Hause. Möchtest Du mitkommen? Ich mach’ Dir einen besseren Lunch als hier in der Cafeteria.« Als ich noch zögerte, drängte er: »Komm’ schon und schalte Deine Oszilloskope ab. Lass’ uns gehen!«
Was sollte ich da schon machen. Ich wusste, dass mein Freund gerne kochte und dass seine kulinarischen Fähigkeiten die des Transitron Cafeteria Kochs in den Schatten stellten. »OK! Ich packe zusammen, wart’ noch eine Sekunde.« Auf dem Parkplatz stiegen wir in seinen Bel Air und fuhren die wenigen Meilen nach Reading.
Kurt hatte dort eine kleine Wohnung mit Küche gemietet, damit er seinem Interesse an der Kochkunst freien Lauf lassen konnte. Im Gegensatz zu ihm war ich glücklich mit meinem Zimmer an der Bryant Street in Wakefield, das sich nicht durch den Luxus einer Küche auszeichnete. Ich war kein Koch und hatte kaum je ein Kochutensil berührt.
»Kann ich Dir irgendwie helfen?« »Ja, deck’ den Tisch, während ich uns zwei gute Omeletts bereite.« »Sonst noch was?« »Siehst Du die Flasche Rotwein auf dem Gestell? Mach’ sie auf und schenk’ uns zwei Gläser ein.« Dann grinste er: »Ein besonderes Ereignis! Du bist der erste Gast in meiner neuen Wohnung.« Ohne Frage, das Omelett war superb. Ich kannte Kurt schon seit einiger Zeit und wusste, dass er von Thun in der Schweiz kam und an der ETH Elektronik studiert hatte. Bei einer Tasse Kaffee erkundigte ich mich: »Seit wann arbeitest Du eigentlich schon bei der Transitron? Und wann und warum kamst Du in dieses Land?«
«Das ist ganz einfach. Ich bin überzeugt, dass die schweizerische Uhrenindustrie früher oder später von mechanischen Uhrwerken auf elektronische umschalten wird. Wie Du sicherlich weisst, fabrizieren sie hervorragende mechanische Uhren seit Jahrhunderten und sind dafür weltberühmt. Aber ich und auch viel andere sehen die Wandlung kommen mit der rapiden Entwicklung der Technologie der Halbleiter. Die Komponenten werden in ein paar Jahren so klein sein, dass man ihren Gebrauch zuerst in grösseren Uhren und bald auch in Armbanduhren vorhersagen kann. Nun gut, ich möchte an dieser Entwicklung mitmachen. Die Transitron war meine Wahl, weil ich so viel wie möglich über die modernen Halbleiter lernen wollte, um mit diesem Wissen in der schweizerischen Uhrenindustrie einen guten Job zu finden. Nach ein paar Jahren werde ich wieder in die Schweiz zurückkehren.«
Nachdem wir noch länger über die Entwicklung elektronischer Uhren gesprochen hatten, fragte Kurt: »Sag‘ mal, warum bist Du denn hier und was hast Du für Pläne?«
«Meine Gründe sind so ähnlich wie Deine. Während der letzten drei Jahre habe ich mich mit der Kontrolle von Induktionsmotoren mittels Selenium Gleichrichtern befasst. Es wäre natürlich noch viel einfacher die Motoren mit Gleichrichtern zu regeln, die elektronisch gesteuert werden können. Da es solche schon in den USA gibt, entschloss ich mich, für ein oder zwei Jahre für die amerikanische Halbleiterindustrie zu arbeiten. Mit dem neuen Wissen werde ich sicher bei der Weiterentwicklung in Deutschland einen guten Job bekommen. – So kam ich Mitte März zur Transitron. Wie es dazu kam, ist allerdings eine lange Geschichte.«
Erinnerungen an 1945
Die Geschichte begann in Thüringen im April 1945, als die Soldaten der Deutschen Wehrmacht ihre Gewehre weggeworfen, ihre
Uniformen gegen Zivilkleider ausgetauscht und sich in die Bevölkerung der Dörfer und Städtchen eingeblendet hatten. Die Bürger Ronneburgs hatten schon weisse Bettlaken aus allen Fenstern gehängt, als die amerikanischen Sherman Panzer mit einem wahnsinnigen Krach über die Pflastersteine unserer alten Strassen donnerten. Für uns war damals der elende Krieg endlich zu Ende. Meine Familie war im Februar von Waldenburg in Schlesien vor der Roten Armee geflohen und hatte Unterschlupf in Ronneburg in Thüringen in der Nähe von Gera gefunden.
Als wir Kinder vorsichtig in die Stadt schlichen, um den Einmarsch der amerikanischen Truppen mitzuerleben, wurden wir schwer enttäuscht. Kein amerikanischer Soldat marschierte. Sie fuhren mit Panzern, Lastwagen und vor allem Jeeps ganz lässig durch unser Städtchen. Und wenn sie zu Fuss gingen, dann war es auf weichen, leisen Kreppsohlen. Aus den Jeeps und Lastwagen liessen sie die Beine baumeln, im Schwimmbad liessen sie sich auf dem Dreimeter Brett fotografieren anstatt hinunter zu springen, und auf einem umgestürzten deutschen Schilderhaus machten sie es sich bequem. Mit einem freundlichen Grinsen auf den Gesichtern gaben sie uns Kaugummi, das sie kauten und das ich in meiner Unwissenheit ass. Allerdings nur ein einziges Mal, oh Schreck. Wie konnten diese laxen Typen auf ihren Kreppsohlen nur den Krieg gegen die disziplinierten deutschen Soldaten in ihren genagelten Stiefeln gewonnen haben? Was waren das für Leute, und wie sahen ihr Land, ihre Dörfer und Städte wohl aus? Wir Kinder konnten uns einfach nicht vorstellen, wie Amerika einerseits eine riesige, moderne Armee hatte, wenn andrerseits noch Cowboys und Indianer im fernen Westen lebten und arbeiteten.
Diese und ähnliche Fragen tauchten bei mir in den folgenden Jahren immer wieder auf. Aus Neugier bewarb ich mich während des Studiums für eine Stelle im damaligen Fulbright Programm, das annehmbaren Kandidaten ein Jahr an einer amerikanischen Universität gewährte. Leider hatte ich keinen Erfolg, weil für Ingenieurstudenten fast keine Plätze zur Verfügung standen. Später wurde mein Freund Alfred von seinem Onkel, der eine Fabrik für elektrische Hochspannungsanlagen betrieb, für ein Jahr nach Georgia im Südosten der USA geschickt, um in einer ähnlichen Fabrik eines guten Bekannten zu arbeiten. Zuerst schrieb Alfred begeisterte Briefe, dann schwärmte er nach seiner Rückkehr nur noch von seiner aufregenden Reise durch die USA. Das war genug! Was er tun konnte, wollte ich auch. Und so wurde eine Idee geboren und in mein Gedächtnis geladen.
Loughborough College
Ich arbeitete damals an der TH Aachen als Assistent am Institut für Elektrische Maschinen und unterstützte nebenher Professor Löbl bei seinen wöchentlichen Vorlesungen als Gastprofessor. Er hatte mich wie üblich nach seiner Vorlesung zum Abendessen eingeladen, bei dem wir uns im allgemeinen über interessante Probleme der Elektrotechnik und manchmal über die Examen seiner Studenten unterhielten.
Dieses Mal änderte er plötzlich das Thema: «Jansen, ich bin der Meinung, dass Sie erst einmal die Welt da draussen kennen lernen sollen, ehe Sie sich in Deutschland niederlassen und für eine Firma wie Siemens oder AEG arbeiten. Lassen Sie sich mal internationalen Wind um die Ohren blasen. Ich habe etliche Freunde in England, die Ihnen sicher eine Stelle für ein halbes oder ganzes Jahr beschaffen würden.« Das war Musik für meine Ohren. Ich musste erst einmal tief atmen, ehe ich antworten konnte: »Wirklich? Ist das Ihr Ernst? Das wäre ja großartig. Das kommt so plötzlich, dass ich ein bisschen Zeit brauche, darüber nachzudenken.« Professor Löbl lächelte: »Warten Sie aber nicht zulange mit Ihren Überlegungen, wenn Sie möchten, dass ich mit jemandem Kontakt aufnehme für eine Stelle nach diesem Semester.« Wir beendeten diese überraschende Unterhaltung mit einem doppelten Steinhäger auf meine aufregende Zukunft.
Der unerwartete Vorschlag brachte meine Gedanken von früher wieder an die Oberfläche, einmal Amerika kennen lernen zu wollen. England konnte das ideale Sprungbrett dazu werden; meine Räder drehten sich. Einerseits hatte ich eine viel versprechende akademische – oder industrielle – Karriere vor mir in einem Deutschland, das dringend junges Ingenieurtalent brauchte, um die Lücken zu füllen, die der Krieg hinterlassen hatte. Ich wollte auch nicht das Institut so bald verlassen, an dem ich mich vielleicht habilitieren wollte. Und dann noch die Trennung von Freunden und Familie! Auf der anderen Seite war der Sog der Welt jenseits der Grenze einfach zu überwältigend. In einem anderen Land – vielleicht sogar in Amerika – zu arbeiten, kam mir vor wie ein Traum. Welche Möglichkeiten! Als ich Professor Löbl zwei Wochen später wieder traf, brannte ich darauf, seine Vorschläge zu hören.
«Jansen, ich erinnerte mich an meinen alten Freund Besag, der heute Professor an einem kleinen College in England ist. Ich sprach mit ihm, worauf er mir diesen Brief geschickt hat: »Das College wäre interessiert, Sie für wenigstens ein halbes Jahr als assistant professor for electrical machinery einzustellen. Er würde Sie gerne auf seiner nächsten Reise nach Deutschland treffen. Dann könnte man über die notwendigen Details sprechen.« Was für eine Chance! Am liebsten wäre ich meinem alten Tutor um den Hals gefallen: »Tausendfachen Dank! Das ist ja wirklich einmalig.«
Da das Wintersemester am Loughborough College im September anfing, hatte ich noch zwei Monate, um meine Arbeiten im Institut abzuwickeln und schleunigst das notwendige technische Englisch zu lernen. Auch mein Doktorvater Professor Brüderlink dachte, es sei eine gute Idee, ein englisches College kennen zu lernen und anschließend wieder nach Aachen zurück zu kommen. Herr Besag kam im Juli und bestätigte die Offerte. Wir einigten uns, dass ich einen Kurs über das Thema meiner Doktorarbeit Hochleistungsgleichrichter geben würde.
Von jetzt an verflog die Zeit wie im Winde; und es wurde bald dringend, Pass und Visum zu beschaffen. Noch eine Woche mit meiner Familie in Mülheim, dann Fahrpläne studiert, Koffer gepackt und mein Fahrrad vorbereitet. Am Abend meiner Abfahrt von Aachen begleitete mich eine Gruppe von Freunden mit Sang und Klang zum Bahnhof. Der Mitternachtszug nach Calais brachte mich zur Fähre, dann über den Kanal nach Dover, und weiter per Zug zur Victoria Station in London. Zu meiner grössten Überraschung wurde mir dort gesagt, dass alle Züge nach Norden, also auch nach Loughborough, von einem anderen Bahnhof, St. Pancras, abführen. Hier gab es offenbar ein anderes System als in Deutschland, wo man von demselben Bahnhof weiterfahren würde. Etwas eingeschüchtert nahm ich ein Taxi quer durch die Riesenstadt zur St. Pancras Station. Eines von diesen altmodischen hoch gebauten Taxis zu finden war leicht, meine Koffer und mein Fahrrad einzuladen war schon etwas schwieriger trotz der Höhe und Geräumigkeit des Autos; aber den Fahrer zu verstehen war fast unmöglich. Ich dachte nicht, dass ich in England sei; aber mit Ach und Krach ging es dann schon. Später erklärten mir die Besags, der Mann hätte Cockney gesprochen – einen typisch Londoner Slang.
Am Nachmittag kam ich auf dem winzigen Bahnhof von Loughborough in Leicestershire an, liess mein Gepäck am Bahnhof, und radelte zum College. Dort empfing mich Herr Besag, stellte mich ein paar Kollegen vor und gab mir eine Tour durchs College. Nachdem wir das Gepäck vom Bahnhof abgeholt hatten, nahm er mich zu sich nach Hause. Ich würde so lange bei ihnen wohnen, bis man ein Zimmer in einer der Halls, einem Studentenwohnheim, gefunden hätte. Mir gefiel die Besag Familie sehr gut, und ich genoss dort zwei angenehme Wochen vor dem Sturm.
In diesen Wochen konnte ich meine Vorlesung vorbereiten. Nicht leicht, weil ich mit den technischen Ausdrücken immer noch rang. Hoffentlich würden die Studenten mein Englisch verstehen ohne still vor sich hin zu lächeln. Vielleicht waren sie zu höflich, oder es gab nicht genug zum lächeln oder war die Vorlesung zu interessant; ich überlebte die ersten Wochen mit Anstand. In kurzer Zeit begann ich die Vorbereitung für eine zweite Vorlesung über die Kontrolle elektrischer Maschinen, die ich dann zwei Monate später begann.
Trotz aller Arbeit hatte ich genügend Zeit, mit Menschen im College und ausserhalb des Colleges Bekanntschaft zu machen. Ich genoss viele Einladungen, machte oft Radausflüge und Wanderungen in die Umgebung, und war ganz begeistert, als mich die Rudermannschaft des Colleges dazu einlud, mit ihnen zu rudern. Welch eine Ehre! – Jedermann, der mit dem Auto durch England gefahren ist, weiss, was es bedeutet auf der linken Strassenseite zu fahren. So musste auch ich meine Erfahrungen machen, vor allen Dingen an Kreuzungen richtig abzubiegen oder den Weg aus den vielen round-abouts hinaus zu finden.
Manchmal half ich Chemiestudenten deutsche Veröffentlichungen zu verstehen oder zu übersetzen. (Die meisten chemischen Veröffentlichungen aus dem Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts kamen von Deutschland.) Das war oft sehr amüsant, weil sie immer voll Verzweiflung nach dem Verb suchten, das ja im Deutschen am Schluss des Satzes steht. Die englische Sprache – wie die meisten Sprachen – folgt der Regel: Subjekt, Verb, Objekt. Oft sprachen wir auch über Stellenangebote im British Commonwealth und in den USA, die sie im Manchester Guardian gefunden hatten. Das regte allmählich meine Neugier an, und ich begann nach Stellenangeboten für Ingenieure Ausschau zu halten. Ich fand sie überall, in Südafrika, in Indien, in Canada und Australien; aber die meisten waren von amerikanischen Unternehmen, die sich für jedes technische Talent interessierten.
Zaghaft beantwortete ich hier und da eine amerikanische Annonce. Und zu meinem Erstaunen – kaum konnte ich es fassen – flatterten die Antworten herein. Die meisten Firmen antworteten, dass sie Interviews in den grossen London Hotels hielten. Sie mieteten dort eine ganze Suite und schleusten die Kandidaten von Raum zu Raum. Die Wissenschaftler, die mich interviewten, waren kaum an Zeugnissen und dergleichen interessiert. Stattdessen prüften sie sehr gründlich, was man eigentlich wirklich auf ihrem Fachgebiet wusste. So wurde auch ich von Raum zu Raum geschickt, bis ein Interviewer an meinen Kenntnissen interessiert war. Das war sicher die beste Methode, da sie ja kaum eine Ahnung hatten, welche Qualität die verschiedenen europäischen Universitäten hatten und was ihre Zeugnisse bedeuteten. Ich habe übrigens viele Jahre später in den USA dasselbe gemacht, wenn ich Leute interviewte, da ich zu wenig über die Güte der dortigen Colleges wusste, um mich auf ihre Zeugnisse verlassen zu können.
Nach vielen Bewerbungen, Interviews und Angeboten suchte ich mit Hilfe meiner Kollegen die günstigste Stelle für mich aus: Die Transitron Electronics Company in Wakefield, Massachusetts. Sie lag an der damals sehr berühmten Route 128, die einen Halbkreis um Boston beschreibt. Dort hatten sich viele junge elektronische Firmen in der Nähe von der Harvard Universität und dem Massachusetts Institute of Technology angesiedelt. Das Mekka der neuesten Wissenschaft und Technik! Transitron entwickelte und produzierte Halbleiter Materialien und Produkte wie Dioden und Transistoren. Dieses entsprach genau meinem Interesse. Man muss wissen, dass damals Europa weit hinter den USA war im Hinblick auf die neuesten Entwicklungen. Im Institut an der TH Aachen brauchten wir noch Vakuumröhren für elektronische Instrumente, während die Amerikaner schon längst Halbleiter in ihren elektrischen Schaltungen verwendeten. Schliesslich war der Transistor ja auch in den Bell Labs in New Jersey erfunden worden.
Ich wollte nicht nur von meinen zukünftigen amerikanischen Kollegen lernen, sondern auch dieses Land der Gegensätze kennen lernen. Wie konnten da Cowboys im wilden Westen Rinderherden durchs weite Land treiben, wie konnten dort Indianer in uralten Pueblos hausen, wenn in demselben Land die neuesten und fundamentalsten wissenschaftlichen und technischen Fortschritte gemacht wurden? Ich wollte all das aus erster Hand erleben. Dazu kam noch der Anreiz einer finanziellen Bonanza, wenn man den enormen Unterschied zwischen den Gehältern berücksichtigte. Der Dollar war damals 4,25DM wert. In Aachen verdiente ich das Äquivalente von $235 im Monat. Dagegen offerierte Transitron $700, ein Gehalt das nicht einmal erfahrene Ingenieure in Deutschland verdienten.
Meine Kollegen der Fakultät feierten das bevor stehende Abenteuer mit mir. Umsonst machte mir der Präsident des Colleges eine permanente sehr gute Offerte. Die Würfel waren gefallen. Als ich Professor Löbl schrieb, antwortete er sofort voller Begeisterung: »Junger Mann, gehen Sie und lassen Sie sich den Wind der Welt um die Ohren blasen. Ich wünsche Ihnen viel Glück, und halten Sie mich bitte auf dem Laufenden.« Als ich zu Hause von meinen Plänen berichtete, war die Begeisterung nicht so groß. Meine Mutter hätte ihren Sohn lieber in der Nähe behalten. Vielleicht sah sie damals schon weiter in die Zukunft und ihren Sohn auf der anderen Seite des Atlantiks. Für sie war Amerika einfach zu weit entfernt.
Natürlich lebten in meiner Brust auch zwei Seelen. Hier das kleine und komfortable College mit meinen netten Kollegen, jungen begeisterungsfähigen Studenten, einem herrlichen typisch britischen Campus und einem Chef, der zufrieden mit mir war und mich fördern wollte. Dort das verlockende Amerika, dass schon viele Millionen in seinen Bann gezogen hatte. Hier meine Familie und Freunde und eine «normale« Karriere bei einer deutschen Firma oder der Technischen Hochschule und dort Ungewissheit gemischt mit der Hoffnung, dass alles klappen würde.
Ich konzentrierte mich jetzt auf das neue Abenteuer. Zuerst teilte ich der Transitron mit, dass ich den Job annehmen und anfangs März bei ihnen anfangen würde. Als ich meinen britischen Freunden erzählte, dass ich mein Fahrrad mitnehmen wollte, lachten sie aus vollem Halse: »Was stellst Du Dir eigentlich vor? Da drüben fährt kein Mensch Fahrrad. Die wissen nicht einmal, was ein Fahrrad ist. Alles fährt mit dem Auto, je größer desto besser. Dort sind die Entfernungen einfach riesig. Lass‘ Dein Fahrrad lieber hier.« Was blieb mir anderes übrig als ihnen Recht zu geben und mein wunderschönes dreigängiges, leichtgewichtiges Rad zu verkaufen. Herr Besag nahm es mit Begeisterung.
Wenn man also wirklich in den USA unbedingt ein Auto brauchte, blieb mir nichts anderes übrig, als klein beizugeben und gegen meine Überzeugung an den Kauf eines Automobils zu denken. Ich war schon immer ein Gegner des Autos gewesen, und wünschte, dass der Verbrennungsmotor nie erfunden worden wäre. War ich doch völlig davon überzeugt, dass das Auto letztlich unsere Städte und das Land ruinieren würde. Die Zukunft zeigte sehr bald, wie recht ich gehabt hatte, als ich Los Angeles zwei Jahre später zum ersten Mal besuchte und den Horror der Freeways mit dem dazugehörigen Smog erlebte. Und wie ist es um die total überfüllten Innenstädte Europas bestellt, die überhaupt nicht für den Autoverkehr geplant wurden?
Also, wenn es sich nicht vermeiden liess, würde ich mir lieber hier in England ein Auto kaufen. Ich kannte mich erstens mit amerikanischen Autos überhaupt nicht aus und zweitens hatte ich ein hübsches Sportauto in einem Schaufenster entdeckt, einen knallroten MGA. Eines Tages nahm ich meinen Mut zusammen, stellte mein Fahrrad vor dem Geschäft ab, und erkundigte mich im Verkaufsraum nach dem Auto. Obwohl der Verkäufer sehr freundlich war, war es offensichtlich, dass er mich für einen Studenten hielt, der sich einmal etwas umgucken wollte, ohne auch nur die geringste Absicht zu haben, ein Auto zu erwerben. Erst als ich mich dann ernsthaft für Preise, mögliche Farben und Ausstattungen interessierte, wurde er aufmerksam. So kaufte ich mir einen MGA, allerdings hellblau mit einem Dach, für das amerikanische Abenteuer.
Was nun? Ich hatte noch nie ein Auto gefahren. Schleunigst zu einer Fahrschule, um Fahrstunden zu nehmen. Ich lernte auf der linken Straßenseite zu fahren, und zwar in einem Auto, das für den Linksverkehr eingerichtet war, d.h. mit dem Steuerrad und dem Rückspiegel auf der rechten Seite und der Gangschaltung und Handbremse links von mir. Für mich war das kein Problem, da ich sowieso noch nie Auto gefahren war und mit dem Fahrrad den Linksverkehr schon gemeistert hatte. Als ich später mit meinem nagelneuen MG, der für die USA zum Rechtsfahren eingerichtet war, von dem Autogeschäft wegfahren wollte, realisierte ich mit Schrecken, dass ich auf der linken Seite sass und mein linker Rückspiegel nutzlos war, wenn ich jemanden auf der rechten Seite überholen wollte. (Damals gab es noch keine Rückspiegel auf beiden Seiten des Autos.) Ausserdem befanden sich Gangschaltung und Handbremse nun rechts von mir. Kaum an die neue Situation gewöhnt musste ich schon wieder umlernen, als ich in Deutschland und anschliessend Amerika rechts fahren musste. Glücklicherweise gab es weder in England noch später ein Unglück!
Ich erhielt meinen Führerschein gerade früh genug, um noch einige kleine Trips durchs Land zu machen. Ehe ich mir ein Billet für ein Schiff beschaffen konnte, musste ich zuerst um die Erlaubnis für die Seereise mit meinem zukünftigen Brötchengeber ringen. Sie standen auf dem Standpunkt, dass ich fliegen sollte: «Es ist schneller und billiger, und wir möchten, dass Sie hier so früh wie möglich anfangen.« Was bedeutete schon eine extra Woche, und der Preis war obendrein fast der gleiche. Außerdem ließ ich mir auf keinen Fall die Gelegenheit nehmen, mit dem Schiff nach Amerika zu fahren wie schon Generationen von Einwanderern vor mir. Am Schluss gab die Firma nach.
Um in den USA arbeiten zu können, musste ich immigrieren, wenn ich mich nicht um irgendeines von den befristeten Arbeitsvisen bewerben wollte. Das letztere war zeitraubend und sehr kompliziert. Das erstere erledigte im wesentlichen die Firma. Ich brauchte nur nach Liverpool zu fahren, mich beim amerikanischen Konsulat mit meinem deutschen Pass vorzustellen, Immigrationsformulare mit sechs Kopien auszufüllen und zu schwören, dass alle meine Antworten zu einer Myriade von Fragen wahr waren. Zum Beispiel durfte ich kein Kommunist sein, keine kriminellen Vorstrafen haben und keine Absicht haben in das Prostitutionsgeschäft einzusteigen. Darauf bekam ich mein Visum und eine permanente alien registration card, die in den USA als green card bekannt ist. Ich war bereit zur Einreise!
Der Februar ging schon zur Neige, als ich meine letzten Vorlesungen hielt und mich von meinen Studenten, meinem Chef, den Kollegen und vielen Freunden und Bekannten, die ich in den letzten Monaten gewonnen hatte, verabschiedete. «Good bye, so long, I had a wonderful time.« Der Abschied war fast so schwer wie vor einem halben Jahr in Aachen, da ich viele Menschen lieb gewonnen hatte. Sie hatten mir alle geholfen, meine ersten Schritte im neuen Land zu machen. Sie hatten mich wie selbstverständlich in ihre Kreise aufgenommen, so dass ich mich wie zu Hause gefühlt hatte. Als Deutscher hatte ich allerdings am Anfang Bedenken, weil ich aus meiner Sicht noch immer die Last des Dritten Reiches auf meinen Schultern trug. Kein Mensch hatte jemals ein Wort gesagt. Auf Wiedersehen College und Loughborough; ich war auf meinem Weg mit meinem hellblauen MG, der gerade genug Platz hatte für einen Koffer. Das andere Gepäck hatte ich nach Southampton verfrachtet, wo es auf mein Schiff geladen würde. Die Reise nach Süden und vor allem durch das Londoner Gebiet ging sehr langsam von statten und war gar nicht so einfach. Ich wagte kaum jemanden zu überholen oder andere gefährliche Manöver zu machen, kam aber doch noch am Nachmittag in Lynn an der Küste an, von wo das Auto und ich am nächsten Tag zur belgischen Küste geflogen wurden. Ganz seltsam, das Auto und ich mit zwei freundlichen Piloten allein in diesem Frachtflugzeug.
Durch Belgien von nun an auf der rechten Strassenseite; noch eine Prüfung meiner Fähigkeit, mich an sich immer wieder ändernde Situationen zu gewöhnen. Dazu kam noch, dass die Belgier die Angewohnheit hatten, in der Dunkelheit nur mit Parklichtern zu fahren. In Aachen noch eine letzte Karnevalsfeier und endgültiger Abschied von den langjährigen Freunden. In Mülheim genoss ich den Kreis der Familie und der Jugendfreunde. Ich kaufte mir einen Überseekoffer, wie sie damals noch üblich waren, in den ich alle meine Habe einpackte und den ich nach Bremerhaven schicken liess. Endlich kam der Tag, an dem ich mit meiner Mutter im kleinen Auto nach Bremerhaven aufbrach, wo wir noch meinen Freund Klaus trafen, der von Hamburg herüber gereist war. Nach einem langen Abschied – vielleicht ahnte meine Mutter schon, dass ihr Sohn eventuell viel länger als zwei Jahre dort drüben bleiben würde – ging es am nächsten Tag aufs Schiff. Ein Riesendampfer, die SS United States, die den Atlantik in der Rekordzeit von vier Tagen überqueren sollte. Von hoch oben dem obersten Deck winkte ich «Auf Wiedersehen«, während unten auf dem Pier eine Kapelle spielte: «Muss i denn, muss i denn zum Städele hinaus, und Du mein Schatz bleibst hier.« Die Reise ins Unbekannte hatte begonnen!
Über den Atlantik
Noch am selben Tag landete die SS United States in Southampton, wo die Reisenden von England zustiegen und wo auch mein übriges Gepäck – hoffentlich – eingeladen wurde. Einige Stunden später ging es hinaus auf den bewegten Atlantik. Mir gefiel jede Minute dieser herrlichen Seefahrt, so richtig wie ich es mir vorgestellt hatte. Oft konnte man mich auf einem der gemütlichen Deckstühle finden, wo ich ein Fachbuch über die Physik der Halbleiter studierte. Ich wollte mich schleunigst über dieses Gebiet informieren, damit ich nicht bei der Transitron erschien ohne jede Grundlage für meinen neuen Job. Dazwischen gab es Zeit, das eine oder andere Buch aus der umfangreichen Schiffsbibliothek zu lesen oder mit Mitreisenden – hauptsächlich Amerikanern mit weniger Engländern und Deutschen – zu plaudern. Den gelegentlichen Rundgang ums Deck wechselte ich ab mit Schwimmen in einem kleinen Schwimmbad auf einem unteren Deck. Das Wasser in dem Bad war ganz aufgewühlt und drohte dauernd über den Rand zu platschen. Kein Wunder; denn um diese Jahreszeit – im März – war der Atlantik wild mit riesigen Wogen, die das gewaltige Schiff dauernd in Bewegung hielten. Ein Nordwestwind blies ohne Unterlass so stark, dass das Schiff eine horizontale Lage nur am Ende jedes Rollzyklus erreichte. Die meiste Zeit blieb es gegen Backbord geneigt. In der Nähe des Bugs konnte man sich überhaupt nicht aufhalten, da man kontinuierlich von Salzwasser besprüht wurde. Als ich in Wakefield ankam, musste ich meinen nagelneuen Regenmantel reinigen lassen, weil er voll von Salzflecken war.
Kaum kamen wir in das offene Meer, als die Mannschaft begann, überall Seile von Wand zu Wand und von Pfosten zu Pfosten zu spannen. Diese Seile waren unsere Rettung; denn man konnte sich immer in ihnen fangen, wenn das Schiff wieder einmal eine besonders starke unerwartete Bewegung machte. Treppen hinauf und hinunter zu gehen war besonders gefährlich für Knochen und Magen, wenn die ganze Treppe plötzlich auf einen zukam oder unter einem verschwand. Es dauerte weniger als einen Tag, bis man eine große Zahl der Passagiere mit etwas grünlich-bläulichen leidenden Gesichtern auf Sesseln und Sofas herum sitzen sah. Im Speisesaal wurde es bald auch leerer, und manche Tische waren überhaupt nicht mehr besetzt.
Das Glück wollte es, dass ich bei der ersten Mahlzeit mit einigen Geschäftsleuten zusammen sass. «Junger Mann, ich möchte Ihnen gerne einen Rat geben,« sagte einer von ihnen. «Wenn sie diese Reise geniessen und nicht seekrank werden wollen, müssen Sie drei Grundregeln beachten: Essen und trinken Sie immer gut, machen Sie niemals eine abrupte Bewegung gegen die Bewegung des Schiffes, und bringen Sie so viel Zeit wie möglich auf dem Deck zu.« Ein anderer Tischnachbar fügte hinzu: « Ein voller Magen, ein gutes Glas Wein oder ein Gläschen Schnaps hier und da und viel frische Luft werden Sie schon beschützen.« Hatten die Recht! Sorgfältig folgte ich ihrem Rezept und hatte keinerlei Probleme auf der ganzen Reise. Dieses einfache Rezept hat mir später noch oft geholfen, beim Segeln auf dem Ozean oder beim Fliegen in kleinen Flugzeugen unter ungünstigen Wetterbedingungen. Ich schloss mich an ein paar andere junge Leute an, die auch nicht seekrank wurden. Uns machte es Spass, auf dem Deck herumzustromern, im Kino Filme anzugucken – wobei die seitlichen Vorhänge dauernd in die Leinwand pendelten –, in dem aufgewühlten Schwimmbad zu schwimmen, und abends auf einer schwankenden Tanzfläche zu tanzen. In unserem Übermut machten wir den gelegentlichen Umschwung an den Seilen, wenn niemand von der Mannschaft in der Nähe war.
Leider dauerte der ganze Spass nur vier Tage. Wenn man sich überlegt, dass es vor nicht all zu langer Zeit noch zwei bis drei Wochen dauerte, den Atlantik zu überqueren, so war die Geschwindigkeit dieses Schiffes schon beachtlich. Als Ingenieur war ich natürlich neugierig, den Maschinenraum zu besichtigen. Das ging aber leider nicht, weil das Schiff bei der Entwicklung von neuen Antrieben im Zusammenhang mit der US Navy beteiligt war. Ich spekulierte, ob es vielleicht nukleare Antriebe ausprobierte. Es stellte sich später heraus, dass das nicht der Fall gewesen war; sicherlich auch keine gute Idee für ein Passagierschiff.
Der Höhepunkt jedes Tages war der Tanz im Ballsaal von neun bis zwölf. Zum Glück lernte ich eine junge Dame kennen, die nicht nur immun gegen Seekrankheit war aber auch hervorragend tanzen konnte. Wir wirbelten über die Tanzfläche und hingen an Seilen oder Pfosten, wenn die See zu rau wurde. Dies wurde zur aufregendsten Tanzerfahrung meines Lebens. In den Ruhezeiten schloss ich mich einer Gruppe lustiger Amerikaner an, die – von der Kapelle begleitet – amerikanische Schlager und Volkslieder sangen. Manchmal gelang es mir mit zu singen; sonst begnügte ich mich damit, die Melodien zu summen. Wir hatten so viel Spass, dass alle enttäuscht waren, wenn die Kapelle um zwölf Uhr quittierte, obwohl der Tag noch weitere neunzig Minuten dauerte. (So viel Zeit gewann das Schiff jeden Tag in seinem Rennen gegen Westen.) Da ich damals noch alle möglichen Lieder, Tänze, Boogies und dergleichen auswendig konnte, setzte ich mich ans Klavier und unterhielt den Saal, bis der nächste Tag wirklich anfing. Offenbar gefiel es dem Publikum so gut, dass mich die Unentwegten am nächsten Abend baten wieder zu spielen. Und dann passierte die Überraschung!! Fragte mich doch der Bandleader am letzten Abend, ob ich nicht mit seiner Band in einer Bar in Manhattan spielen wollte. Er bot mir wahrhaftig einen Job an. Ich könnte mich in den ersten zwei oder drei Wochen mit der Band einüben, und dann abends in der Bar von 9:00 bis 2:00 Uhr mit der Band spielen. Was für eine intrigierende Möglichkeit, eine neue exotische Karriere einzuschlagen!! Aber der kühle Ingenieurverstand behielt die Oberhand, und bedauernd lehnte ich dieses unerwartete Jobangebot ab. Die bevorzugte Ingenieurkarriere lief dann auch weiter für die nächsten 45 Jahre. Das Klavierspiel blieb jedoch mein Hobby bis heute.
Die neue Welt im März 1960
Der Steward klopfte am nächsten Morgen um sechs Uhr an die Türe: «Rise and shine!« Ich machte mich so schnell wie möglich fertig, wollte ich doch das Einlaufen in den Hafen von New York auf keinen Fall verpassen. Als ich aufs Deck kam, war es noch stockfinster; aber auf der Starbord Seite sah ich schon die riesigen Wolkenkratzer wie schwarze drohende Gespenster aufragen. Obwohl diese pechschwarze Silhouette hier und da durch helle Fenster unterbrochen wurde, flösste sie mir ein gewisses Grauen ein. Dieses nahm noch zu, als mich die schneidende Morgenkälte wie ein wildes Biest attackierte. Plötzlich erdrückte mich der Gedanke, meine nächsten Jahre in solch einem fremden und kalten Land zuzubringen. Hatte ich wirklich die richtige Entscheidung gefällt? Wäre es nicht besser, den Irrtum zuzugeben und schleunigst umzukehren? …Zu spät!! Ich hatte es nun einmal bis hierhin geschafft und könnte das Abenteuer auch weiter durchstehen, ganz gleich was da auch käme.
Nur langsam setzte sich das Licht des Tages gegen die bedrohliche Nacht durch. Und nach dem ich gefrühstückt, meine Bordrechnung mit dem Zahlmeister beglichen, dem Stewart sein Trinkgeld gegeben und meinen Koffer auf das Deck gebracht hatte, sah die neue Welt nicht mehr ganz so bedrohlich aus, ganz besonders, als die Morgensonne begann, die blau-weiss-roten Schornsteine unseres Schiffes zu erleuchten. Ich versammelte mich mit den anderen Passagieren auf dem Deck und sah zu, wie das Riesenschiff von winzigen Schleppern in den Hafen und zum Pier gezogen wurde. Kleine Männchen zogen dort unten an gewaltigen Seilen, legten das Schiff an, und liessen schließlich die Landungsbrücke auf den Pier hinunter. Schnell verabschiedete ich mich von meinen Mitreisenden und betrat kurz darauf amerikanischen Boden, den Boden der neuen Welt. Wir hatten es tatsächlich in vier Tagen bei sehr aufgewühltem Meer und beachtlichem Gegenwind vom alten zum neuen Kontinent geschafft.
Auf dem Dock ein Riesengewühl von Passagieren und ihren Familien oder Freunden, die sie in Empfang nahmen, von Bergen von Gepäck und einem Gewimmel von Schiffspersonal, Gepäckträgern, Hotel Ausrufern, Taxi Chauffeuren und Zuschauern, die diesen Kolossus bestaunten. Letztlich war die SS United States, das größte und schnellste Passagierschiff der USA und der Welt, ein Nationaljuwel!
Als ich meinen MG an einem Krane baumelnd vom Himmel herunter kommen sah, ging ich erst einmal dorthin um meine Eigentumsrechte geltend zu machen. Ein Schiffstechniker schloss die Batterie, die offenbar vor der Reise abgeschaltet worden war, wieder an und startete den Motor, um sicher zu stellen, dass er noch ansprang. Oh Wunder, alles funktionierte; und ich konnte ganz vorsichtig ein wenig aus dem Gewühl hinausfahren. Als nächstes mussten Auto und Gepäck, das auf dem Pier abgestellt worden war, durch die Zollkontrolle und ich durch die Passkontrolle. Dann half mir jemand vom Schiffspersonal eine Frachtfirma zu finden und mit ihnen über den Transport meines Gepäcks zur Transitron in Massachusetts zu verhandeln.
Zu guter Letzt fragte ich meinen Helfer, wie das eigentlich mit einer Autoversicherung wäre. Er gab mir Telefonnummern von Versicherungsagenten an, die ich prompt anrief, einen nach dem anderen. «Ich bin hier gerade mit meinem Auto von England angekommen und befinde mich auf dem-und-dem Pier. Wie kann ich eine Versicherung mit Ihnen abschließen?« «Es tut uns schrecklich leid; aber wir versichern nur Einwohner dieses Landes. Wenn Sie hier keinen Wohnsitz haben, können wir nichts für Sie tun.« Immer wieder dieselbe Antwort, ein schöner Reinfall. Als ich allmählich im Begriff war aufzugeben und alles Betteln mit dem letzten Agenten nichts eingebracht hatte, sagte er plötzlich und sicherlich aus Mitleid: «Junger Mann, fahren Sie g-a-a-a-nz langsam und immer auf der rechten Seite s-e-e-e-hr vorsichtig nach Boston.« Na danke schön. Aber was blieb mir anderes übrig; und trotz des ungewohnten vielspurigen Verkehrs in und um New York klappte es.
Zu meiner großen Überraschung und noch größeren Freude entdeckte ich plötzlich eine deutsche Freundin am Ende des Piers. «Renate, das ist ja wunderbar. Wo kommst Du denn her?« Worauf sie antwortete: «Du wirst es nicht glauben, aber meine Eltern haben mir geschrieben, dass Du auf dem Weg nach New York wärest und wann und mit welchem Schiff Du dort ankommen würdest. Willkommen in den USA.« Grosse Umarmung! Renate studierte ein Jahr lang Geologie am Barnard College, das zur Columbia University gehörte. Sie hatte schon ein Zimmer für mich in einem Studentenheim reserviert; und so fuhren wir g-a-a-nz langsam und s-e-e-h-r vorsichtig in der rechten Bahn bis zur 125. Strasse, wo das Heim gelegen war. Nachdem ich mich dort einquartiert hatte – glücklicherweise war es so billig, dass ich mir dieses mit meinen teuer erkauften Dollars leisten konnten -, parkte ich das Auto auf einer der Nachbarstrassen. Dort, oder überhaupt in New York, einen freien Parkplatz zu finden, war ein kleineres Wunder. Ich hatte auf keinen Fall die Absicht, den Wagen wieder zu benutzen, solange ich in dieser verkehrswütigen Stadt weilte.
Dann ging es los mit der Subway zum ersten Stadtbummel im neuen Land. Ehe Renate wieder zu ihren Vorlesungen gehen musste, lud sie mich noch in einen Drugstore zu einem Kaffee und einer Doughnut ein. Ein Drugstore war eine kleine Drogerie, in der man auch etwas Einfaches essen und trinken konnte. In einem lang gestreckten Raum befand sich eine lange Theke, an der einige Leute auf hohen Hockern sassen und einen Kaffee oder einen Softdrink zu sich nahmen. Man konnte dazu auch eine Kleinigkeit essen wie zum Beispiel ein Danish, eine Doughnut, oder ein Ice cream. Renate erklärte mir, dass man in einem Drugstore meistens auch ein Frühstück oder ein Sandwich oder eine Suppe zum Lunch bekommen konnte. Die Doughnut, das wahrscheinlich meist gegessene kleine Gebäck in den USA, ist eine Art Berliner, aus dem das Zentrum entfernt wurde; in Kürze ein Torus aus Teig.
Eine sehr nette ältere Kellnerin, die hinter der Theke stand, fragte mich: «What would you like, honey?« Mir verschlug das Honey schier die Sprache. Was für eine unglaubliche Intimität erlaubte sich diese Frau mir gegenüber, einem völlig fremden Deutschen? Während ich noch Luft holte, sah ich Renate grinsen und realisierte, dass es besser war, keine unfreundliche Bemerkung zu machen und stattdessen freundlich zu antworten: «A coffee with cream and a doughnut, please.« «What kind would you like?« Aha! Sie und Renate erklärten mir mit grosser Geduld, dass es viele unterschiedliche Arten gäbe mit allen möglichen süssen Übergüssen; worauf ich eine einfache (plain) Doughnut bestellte. Kaffee und Gebäck schmeckten gut, und der ganze Spass kostete 30 Cents für uns beide. Renate kühlte meine zurückgehaltene Erregung ab und erklärte mir: «Diese nette Frau hat es besonders gut gemeint mit ihrer Anrede. Sie hat auf Anhieb erkannt, dass Du ein unerfahrener Ausländer bist. Deswegen wollte sie Dir gegenüber besonders freundlich sein.« Hier würde also ohne weiteres ein Fremder honey oder sweetie zu einem sagen, um einem eine Freundlichkeit zu erweisen. Und wie oft habe ich das noch in den folgenden Jahrzehnten erlebt und mich an der Herzlichkeit dieser Menschen erfreut. Es gibt überhaupt keine Frage: Die Amerikaner sind ein einmalig freundliches, hilfreiches und zuvorkommendes Volk!
Während Renate zurück zum College fuhr, zog ich los, um die Metropole zu entdecken. Da in New York die Avenues und Streets





























