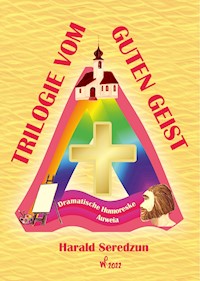Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Rhapsoden im antiken Griechenland waren umherziehende Sänger. Die Mondscheinrhapsodie zieht von den rheinhessischen Hügeln nach Marokko und bis in den Yellowstone – der Liebe wegen. Sie besingt mit der Melodie der Sprache, die lyrische Anmutungen, umgangssprachliche Wendungen, stichwortartiges Stakkato mit einer Neigung zur Alliteration verbindet die Liebe zwischen der jungen Thea und dem deutlich älteren Christoph. Gefühle brechen aus mit der Wucht eines Vulkans und erstarren wie erkaltende Lava. Liebe erweist sich als Macht, die im Menschen wirkt und nicht aus ihm stammt. In der Mondscheinrhapsodie sucht nicht eine Handlung ihre Sprache, sondern die Melodie der Sprache gestaltet das Geschehen und kreiert dabei eine eigene literarische Form.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 188
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Harald Seredzun
Mondscheinrhapsodie
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Rhapsoden…
Teil 1 – MONDSCHEINRHAPSODIE
Teil 2 - INDIANISCHE RHAPSODIE
Impressum neobooks
Rhapsoden…
…waren im antiken Griechenland umherziehende Sänger, die alles Mögliche im Repertoire hatten. Rhapsodien sind Musikstücke, die keiner festen Form folgen. Sie lassen verschiedene Themen erklingen, die lose miteinander verbunden sind. Die „Mondscheinrhapsodie“ bindet sich an keine feste literarische Form. Sie „besingt“ das Geschehen in aneinandergereihten Szenen.
Wenn ich lese, was ich geschrieben habe, bin ich von manchen sprachlichen Wendungen und vom Fortgang des Geschehens manchmal überrascht. Es kommt mir vor, als habe das alles ein anderer geschrieben. Vielleicht fühle ich mich deshalb von fern an eine Aussage von Paul Celan erinnert: Ein Gedicht duldet die Mitwisserschaft dessen, der es macht, nur solange, als es braucht, um zu entstehen.
Die „Mondscheinrhapsodie“ erzählt von der Liebe. Liebe erweist sich dabei als eine Kraft, die in den Menschen wirkt, aber nicht aus ihnen zu stammen scheint. Menschen singen die Melodien ihres Lebens, aber sie komponieren sie nicht.
In das Geschehen eingestreut sind philosophische Gedankensplitter und Reflexionen, zum Beispiel über das Wesen des Bösen oder das Wesen der Ökologie.
Der Stil wechselt häufig zwischen umgangssprachlichen und gehobenen Wendungen, die teils veraltet anmuten. Er zeigt einen Hang zur Alliteration, kommt manchmal stichwortartig daher, liebt lyrische Momente, bevorzugt aneinandergereihte kurze Sätze, meidet Nebensätze, liebt das Kompakte. Die „Szenen“ des Geschehens sind mit Begriffen aus der Musik überschrieben: der Klang der Sprache gestaltet das Geschehen.
Harald Seredzun
Teil 1 – MONDSCHEINRHAPSODIE
INTRADA(kurzes Eröffnungsstück)
Terrasse
Der Mond sah sanft
durch kahle Kronen
machte das Dunkel mild
über den Hügeln
rote Spur
des vergangenen Tages
Zeit des Mondes
der sich entfernt
Das Haus lag am Rand des Dorfes. Er trat auf die Terrasse. Sein Blick schwebte über Felder zu Hügeln, an denen Weinstöcke hochstiegen. Die Kirche stand am Hang wie aus der Erde gewachsen. Ihr kleiner Turm nickte den Reben zu. Der Bach suchte mitten durchs Dorf seinen Weg zum Strom, der ihn nach Holland mitnahm. Flugzeuge flogen lautlos, scheinbar sternenfern. Wolkenschleier huschten dem tauchenden Tag hinterher.
Er atmete den Augenblick, der sich augenblicklich zum Vergangenen gesellte. Bilder der Kindheit und Jugend stellten sich ein, umkreisten ihn wie Bilder aus einem anderen Leben.
Er gedachte des holprigen Pflasters, über das er als Kind gesprungen war. Basalt, graues Urgestein zwischen einst stattlichen Häusern aus wilhelminischer Zeit, heimgesucht vom Krieg, gezeichnet vom Größenwahn, manche nur noch Ruinen.
Das Kind kannte Kargheit, er kannte sie nicht. Es trug gebrauchte Klamotten, Schuhe drückten sanft auf die Zehen, das Kind blieb munter.
Sommerferien verbrachte der Junge in Nachbars Garten. Für Reisen fehlte Geld, dem Jungen fehlte nichts. Die Gesellschaft von Nachbars Töchterlein war angenehm für beide. Der Maulbeerbaum an der Mauer trug süße Früchte den ganzen Sommer lang.
Der Junge verehrte Fußballer eines kleinen Vereins, der seinerzeit große Erfolge erzielte. Die Lokalzeitung orderte manchmal einen Sonderzug. Fans fuhren für wenig Geld zum Auswärtsspiel. Wenn der Zug aus dem Bahnhof rollte, winkten Frauen mit Betttüchern von den Balkons. Flatternde Fahnen winkten zurück. Aus Lautsprechern tönte der River-Kwai-Marsch, damals ein Hit. Als der Verein fast Deutscher Meister wurde, stand die Stadt Kopf. Als die Nationalmannschaft Weltmeister wurde, erhoben sich Köpfe, als könnten sie Krieg und Zusammenbruch in das Vergessen entlassen.
Das Kino schenkte dem Jungen große Erlebnisse, anders für ihn nicht zu haben:
Er ahnte, wie groß Gefangene waren. Als pfeifender Chor marschierten sie ein ins Lager am River Kwai, die gerechte Sache in den Beinen und den Gesichtern. Ihr Colonel taumelte tragisch in den Tod.
General Santa Anna zerschoss in Texas Fort Alamo, zügelte zornig sein zerrendes Pferd. Die zerlumpte Frau schritt aus rauchenden Trümmern. Santa Anna nahm den Helm vom Haupt und grüßte sie mit der Geste tiefer Verneigung. Die Szene grub sich ein.
Er war gern allein, damals schon, scheute sich, feste Freundschaft zu schließen. Beziehungen ängstigten ihn. Er fuhr mit dem Fahrrad hinaus aus der Stadt, ein Waldweg führte zur alten Mühle. Bescheiden bot sie Bewirtung an, Handkäse mit Butterbrot. Vier Holztische standen auf sandigen Grund. Klappstühle knirschten, das Mühlrad ächzte wundersam wohlig, abseits vom brausenden Bach verließ ein Rinnsal die Mühle heimlich plätschernd. Geräusche, die bei ihm blieben.
Er radelte weiter zur Klosterruine. An der Mauer des Chores erwarb ein begütertes Bauernpaar einst seine Grabstätte. Die Nähe des Klosters wehrte wirksam dreisten Dämonen, so dachte man. Die Auferstehung des Fleisches schien im Schatten der Kirche gesichert.
Schule war schön. Lehrer ließen lange Leine ganz gegen das damals Gewohnte. Tanzschule förderte harmlose Tändeleien. Liebeleien spielten eine Rolle am Rande. Eigentlich blieb er allein.
„Du bist ein Autist“, sagte kess eine Kommilitonin. Er fühlte sich nicht getroffen, dachte, die spinnt, dachte später, vielleicht lag sie gar nicht so falsch.
Wirtschaftswunder waberte durch seine Welt, Wohlstand wuchs allenthalben. Manager machten Jagd auf erfolgreich Examinierte, „Kopfjäger“ kreierten Karrieren. Die lukrative Laufbahn lag vor ihm. Die Branche boomte, er bekam bald beste Bezahlung.
Er fragte sich: lebe ich mein Leben, oder lebt es mich?
Viele Jahre lang lebte er in der Stadt. Nächte zerfleddert von grellem Glitzern, loderndem Lärm. Müde Luft lag zwischen Fassaden, die scheinbar himmelwärts flohen. Er gedachte der stressigen Straßen, der Schaufenster, wo er gern bummelte.
Stille stieg von den Hügeln, umarmte das Haus. Müdigkeit schaukelte seine Gedanken. Er warf dem Mond ein Adieu zu: „Du bist klein“, sagte er leise, gemahnte den Mond, die gewaltige Größe der Sterne zu gewärtigen. „Doch deine Nähe macht dich groß. Nähe macht immer groß.“
Der Mond schien zufrieden, geboren aus kosmischer Kollision, gehalten in gewaltiger Gravitation, seit Jahrhunderten mit Gedichten bedacht, sendet Licht, das nicht sein eigenes ist, entfernt sich um jährlich knapp vier Zentimeter.
Er verließ die Terrasse, legte sich schlafen, schlief schnell ein, schlief gut.
Arapaho
Er lungerte vorm Eingang des Saloons herum. Rancher warfen ihm Münzen zu. Er nahm sie, bettelte nicht, gekrümmt saß er aufrecht. Sein Gesicht wusste alles.
Vor Tausenden von Jahren durch Eis und Schnee gewandert. Stolzer Stamm, rastlose Reiter, oft kriegerisch unterwegs, Bezwinger der Büffel, schier ewige Jagdgründe in der Prärie. Gegen Bleichgesichter chancenlos, Niederlage total. Alles eingraviert ins Gesicht des Arapaho vor dem Saloon.
Nachts ritt er auf seinem Pony durchs Land, einstmals frei, jetzt voller Besitztümer. Kämpfe vorüber, Gefahren gebändigt, Niederlage besiegelt. Sonne gerbte sein Gesicht, Mond verklärte es. Er flog auf dem Pony mit der Leichtigkeit der Besiegten, bestrahlt von blutgetränkter Erde, umrauscht vom Singen der Nacht - Ritt durch Kathedralen aus roten Felsen zu Jagdgründen in des Himmel grüner Au.
Es konnte nicht anders sein: der Arapaho war sein Bruder. Sie zogen einst fort aus Afrika, das noch niemand so nannte. Warum sie fortzogen, weiß keiner genau. Vielleicht Klimawandel. Sie wanderten durch Arabien, das noch niemand so nannte, wendeten sich nach Westen - deswegen steht er im Mondlicht auf der Terrasse - andere wanderten nach Osten, nach Norden, über die Beringia, die noch niemand so nannte, entdeckten Amerika lange, sehr lange bevor Amerigo Vespucci über den Ozean segelte. Der Arapaho blieb sein Bruder.
AUBADE (Morgenmusik)
Krokusse
Februar fand sich
in linder Luft
hellblauer Himmel
wölbte sich wolkenlos
Sonne wanderte durch Weinberge, Wälder,
wilder Wind
verweilte weit weg
Hoch Helge herrschte herrlich unbeweglich
nächtliche Fröste taten nicht weh
Sonne lockte siegessicher
Krokusse aus duftender Erde
sie breiteten Blütenpracht aus
beflissen bewundert
von Magnolien, Forsythien
Saft rumorte in ihren Zweigen
bald wollten sie nachlegen
Frühling noch üppiger feiern
Krokusse wiegten sich sorglos
zitterten freudig erregt
wenn Bienen sie summend besuchten
ahnten anmutig
nichts von eigener Schönheit
widersprachen niemandem
dem Last auf dem Gemüt saß
sagten wortlos:
die Welt ist wunderschön
man konnte zustimmen
man konnte es lassen
Krokusse wussten
sie verdankten
die Macht ihrer Zartheit
dem großen Gestirn
erhoben die Kelche
zu ihm in die Höhe
falteten furchtsam die Blüten
beim Sinken der Sonne
ruhten im Mondlicht
verblühten
bevor die Rosen sich rührten
TRIPTYCHON(dreiteiliges Musikstück)
Nachtigall
Seele formte ihr Gesicht, ihre Hände, ihre ganze Gestalt. Ihre Augen sandten Seele in die Welt. Sie wusste es nicht, ihre Freundinnen merkten es nicht, auch ihre Eltern erkannten es nicht. Vielleicht erkannte es niemand.
Sie tanzte gern auf dem Trampolin ganz ohne sportlichen Ehrgeiz. Sie tanzte zum Rhythmus der Rockmusik von der CD, sprang voll Lust in die Höhe, lachte besonders dann, wenn ein Sprung ihr misslang. Sie hüpfte durchs Leben. Jahre vergingen vergnüglich.
Sie schickte sich an, eine Frau zu werden. Kindliche Anmut blieb ihr bewahrt. Sie weckte Begehren, wusste es nicht, wollte es nicht. Finn fand sie schön, so schön. Andere fanden es auch. Ihre Seele nahmen sie nicht wahr, Finn auch nicht. Er war lustig, mutig, charmant. Seinem gewinnenden Blick erlag sie bereitwillig. Sie gingen miteinander, umarmten sich, drückten sich innig. Finn spürte: sie gehört zu mir. Sie ahnte: Liebe muss ein himmlischer Einfall sein.
Sie hörten Songs von Leonard Cohen, George Moustaki, sahen sich alte Filme an mit Shirley MacLaine und James Dean, lasen Gedichte von Hanns Dieter Hüsch, Romane von Hermann Hesse, sie fuhren mit dem Ruderboot durch Altrheinarme.
„Was hast du gestern Abend gemacht?“ fragte sie.
„Es war Vollmond“.
„Ja und?“
„Ich habe mich vom Vollmond bräunen lassen.“
Sie kicherte, dachte: typisch Finn.
„Und du, was hast du gemacht?“
„Ich habe der Nachtigall gelauscht.“
Finn wusste: im Baum vor ihrem Haus besang den Mond jedes Jahr eine Nachtigall.
„Da hat deine Nachtigall anscheinend so den Mond bezirzt, dass er vergaß, mich zu bräunen.“
Sie kicherte wieder.
„Werde halt doch die Sonne bitten, mich zu bräunen, ist letztlich dasselbe Licht.“
Sie mochte den braunen Teint seiner Haut.
Postkarte aus Oran
Die Sonne ließ sich nicht lange bitten, brannte beharrlich Sommer ins Land. Hitze hockte auf Häusern und Hügeln.
Finn holte sie ab, floh mit ihr ans Flussufer. Sie schwammen im Schatten der Pappeln. Sie stieg aus dem Wasser, schüttelte sich, ihre Haut glänzte, Finn schwamm noch weiter.
Nach einer Weile kam er am Ufer entlanggelaufen, schüttelte sich, nicht wegen des Wassers.
„Ekelhaft, ekelhaft, uh.“
„Was ist?“
„Da hinten, wo ich aus dem Wasser stieg…“
„Warum bist du nicht hier ans Ufer gegangen?“ Sie sah es gern, wenn er gebräunt aus dem Wasser stieg.
„Ich suchte ein Örtchen…also da hinten liegen tote Ratten, elf habe ich allein im Vorbeigehen gezählt, manche von Artgenossen angeknabbert.“
„Igitt.“
„Sollen wir gehen?“
„Ich denke schon.“ Sie packte ihre sieben Sachen.
Im Dorf herrschte helle Aufregung. Finn hielt sein ‚hässliches Entlein‘ an, fragte den Erstbesten: „Was ist denn hier los?“
„Bei der Kneipe hat man riesige Ratten im Abfallcontainer gefunden. Der Kammerjäger hat Gift ausgelegt, meinte, es gebe vielerorts eine Plage. Hitze und Trockenheit regten die Ratten an, sich höllisch zu vermehren.“
„Das scheint mir auch so.“ Finn kratzte sein Kinn.
Grillen am Abend abgesagt. Appetit abhandengekommen.
Sommer glühte, Hitze herrschte hemmungslos, im Freibad herrschte Hochbetrieb, am Flussufer nicht. Finn schüttelte den Kopf über seinen Freund Albert, der ausgerechnet in diesem brutal heißen Sommer Urlaub in Algerien machte. Finn sollte ursprünglich mitkommen, weigerte sich.
Die bunt glänzende Ansichtskarte befand sich sehr bald im Briefkasten. Finn fand sie fabelhaft, bedauerte aber deswegen nicht, dass er zu Hause geblieben war. Die Ansichtskarte zeigte Fort Santa Cruz in leuchtender Landschaft hoch über Oran. Mit Kugelschreiber hatte Albert gekritzelt:
„In der Kapelle unterhalb von Fort Santa Cruz erflehten einstmals Bewohner Orans göttliche Hilfe. Cholera war ausgebrochen.“
Finn mochte Albert sehr, schätzte seine Sensibilität und Intelligenz, war nur genervt, wenn Albert sein Lieblingsthema strapazierte: „die Rechnung“. So nannte Albert sein Thema. Und diese „Rechnung“ ging so: er zählte auf, was schön und gut war in der Welt und stellte es dem gegenüber, was hässlich und schlecht war.
Zum Schönen machte er stets die gleiche Vorbemerkung: „Das Schöne bleibt mir rätselhaft. Warum empfinde ich eine Landschaft schön, eine Blume, den blauen Himmel? Weil das Zusammenspiel meiner Sinne mit den Dingen mir dieses Empfinden beschert. Gibt es das Schöne an sich? Ohne meine Sinneswahrnehmung bliebe das Schöne den Dingen fremd. Egal, es ist schön, das Schöne zu sehen, zu hören, zu riechen – dabei schnupperte er immer in der Luft herum - zu schmecken – dabei schmatzte er.
Wenn er vom Guten sprach, zählt er auf, was große Hilfswerke für Menschen in Not leisteten, was Einzelne an Hilfsbereitschaft zu Wege brachten. Er fand das durchaus beachtlich.
Dann aber wurde sein Blick starr. Er sprach von Naturkatastrophen, Krankheiten, Verbrechen, vom Elend, in dem Millionen dahinvegetierten. Seine „Rechnung“ kam zu einem klaren Ergebnis: das Schlechte übertraf das Gute beträchtlich.
„Bist du sicher, dass deine „Rechnung“ aufgeht?“ fragte ein Schulkollege, der zum Gespräch hinzukam. „Ich glaube, du machst deine „Rechnung“ ohne den Wirt.“
Albert hörte ihm gar nicht zu.
„Wenn es mich nicht gäbe“, sagte er in seltsam heiterem Ton, „dann blieben die Dinge, wie sie sind, aber ich wüsste nichts davon, ich würde nicht darunter leiden.“
Finn machten diese Gedanken Angst. Er sagte nur: „Ich bin froh, dass es dich gibt, ich bin froh, dass es mich gibt, ich bin glücklich über so viele schöne Dinge. Ich will leben.“
Albert lächelte gütig, aber sein Lächeln hatte etwas Abwesendes.
Albert lächelte und litt. Wenn irgendwo auf der Welt etwas Schreckliches geschah, fiel er ins Loch, monatelang. Depressionen lähmten ihn, Therapien nützten nichts. Nur Sommer auf Sylt wirkten Wunder.
„Das Meer schickt seine Wellen, sie nehmen den Kummer mit. Alles geht unter. Ich auch.“
Finn suchte stets einen Grund, solche Gespräche zu beenden. Sie taten ihm nicht gut.
„Verschweigen wir, was uns verwehrt ist…“
Letzte Rosen blühten. Sie dachte, wie lange ist es schon her, dass Krokusse blühten. Ein Gedicht von Stefan George fiel ihr in die Hände:
Es lacht in dem steigenden jahr dir
der duft aus dem Garten noch leis,
flicht in dem flatternden haar dir
eppich und ehrenpreis.
Die wehende saat ist wie gold noch,
vielleicht nicht so hoch mehr und reich,
rosen begrüßen dich hold noch,
ward auch ihr glanz etwas bleich.
Verschweigen wir, was uns verwehrt ist,
geloben wir glücklich zu sein,
wenn auch nicht mehr uns beschert ist
als noch ein rundgang zu zwein.
SäHändeHHHie verabredete sich mit Finn zu einem Herbstspaziergang im Naturschutzgebiet. Dort gab es einen Weg, der von Apfelbäumen gesäumt gleich einer schmalen Allee in den Herbst führte. Die Bäume trugen viele alte Apfelsorten, die man nirgendwo kaufen konnte. Kleine, dicke, runzlige Äpfel, manche mit rauer Schale, rund wie ein Fußball, oval wie ein Football, sie wuchsen, wie sie wollten, machten sich lustig über genormte, gelackte Artgenossen im Supermarkt.
Finn pflückte einen Apfel vom tiefhängenden Zweig. Sie nahm ihn, biss hinein, Saft sprudelte wie ein Springbrunnen in ihrem Mund. Sie schlürfte, verspeiste den Apfel mit Kernen und Stiel.
„Was für ein tolles Aroma!“ rief sie in den Herbsttag hinein, „was hat die Natur für großartige Einfälle!“
Von der Krone eines beachtlichen Baumes leuchtete ein dicker Apfel reif und rot.
„Den pflücke ich dir“, sagte Finn, „das ist ein Paradiesapfel.“
„Paradiesapfel? Na, ich weiß nicht“, meinte sie skeptisch, „da kannst du ganz schön klettern, bis du an den herankommst, nicht ganz ungefährlich, lass es lieber.“
Finn ließ es nicht. Er kletterte behände von Ast zu Ast, stieg geschickt immer höher, bis er dem roten Apfel ganz nah kam, musste am Ende sich etwas strecken, ergriff ihn, hielt ihn schon fest in der Hand, rutschte ab auf der Rinde, schlug gegen den Stamm, stürzte kopfüber, blieb auf dem Bauch reglos liegen.
Sie erkannte sofort, was geschehen war, rief mit dem Handy den Rettungsdienst. Es dauerte. Der Rettungswagen musste mit der Fähre ins Naturschutzgebiet übersetzen. Es gab keine Rettung.
Das ganze Dorf kam zur Beerdigung. Finn war einziger Sohn, seine Mutter lebte allein.
Ganz am Ende schloss er sich dem Trauerzug an. Es tobte in ihm. Es musste doch jetzt der kommen, der den Trauerzug anhalten könnte: Junger Mann, ich sage dir, stehe auf!
Ein Menschenleben versank in der Grube, als würde die ganze Welt versinken. Mit welchem Recht blühen Blumen, grünen Gräser, reifen Reben, mit welchem Recht atme ich? Der Sinn seines Herzschlags schien ihm abhandengekommen.
Er blieb stehen, wollte den Trauerzug wieder verlassen, ging doch weiter mit, sah nichts, hörte nichts, fand sich später noch immer abseits vom Grab, als alle schon längst den Friedhof verlassen hatten. Mit welchem Recht stehe ich, gehe ich? Er ging. Es zerwühlte ihn. Er wagte nicht an das Mädchen zu denken, dessen Anmut erstarrt war.
CAPRICCIO (Musikstück, das sich nicht an tradierte Formen hält)
Wieder Krokusse
Als im Jahr darauf die Krokusse sich wieder aus der Erde wagten, begegnete er ihr auf dem Weg zum Bahnhof. Sie grüßte, lächelte abgrundtief. Ihr Blick sandte Seele aus. Sie ging mit festem Schritt. Er schaute ihr nach: sie ist schön, so schön.
Am Abend des gleichen Tages läutete es, er öffnete, sie stand vor ihm.
„Kann ich reinkommen?“
„Ja, sicher, aber wie komme ich zu der Ehre?“ Er war perplex.
Sie trat ein, ging schnurstracks ins Wohnzimmer. Er folgte. Sie schaute sich um, bemerkte die einfache Einrichtung, lauter Möbel vom Baumarkt.
„Schön“, sagte sie.
Er war völlig verdattert. Nicht weil sie ‚schön‘ sagte. Weil sie da war.
„Was führt Sie zu mir?“
Sie ging zur großen Glastür vor der Terrasse, bewegte sich, als ob ihr der Raum vertraut sei.
„Auf unserer Terrasse steht ein Teleskop, mit dem kann man Ganymed sehen.“
Sie setzte anscheinend voraus, er wisse, wer Ganymed sei: der größte Mond im Sonnensystem.
„Ganymed“, sagte er, „der Schönste der Sterblichen, von Zeus entführt.“
Sie drehte sich um, sah ihn an mit dem Blick einer Fragenden, die mehr wusste als der, den sie fragte.
„Erzähle!“ Es klang fast auffordernd.
Dass sie ihn duzte, verdatterte ihn immer noch mehr. Kurz gab er Auskunft:
„Zeus war von der Schönheit des Ganymed so angetan, dass er sich in einen Adler verwandelte und ihn auf den Olymp trug.“
„Aha, der Göttervater liebte also Schönheit.“
Er versuchte seiner Verwirrung zu entkommen: „Wollen wir uns setzen?“
Sie antwortete, indem sie sich setzte, die hellbraune Couch stand mit Blick zur Terrasse.
„Darf ich Ihnen etwas anbieten?“ fragte er.
„Was hast du vorrätig?“ Sie blieb beim Du.
„Leider nicht viel, nur edelsüßen Wein und Traubensaft. Und Wasser natürlich, still und prickelnd.“
„Kein Alkohol, Traubensaft ist gut.“
Er ging konfus in die Küche.
Im Dorf kannte jede jeden, jeder jede, wie man sich so kennt im Dorf. Die beiden kannten sich vom Sehen, hatten nie ein Wort miteinander gewechselt. Er hatte sie wahrgenommen, wenn sie so dastand, mit anderen sprach, dabei lebhaft gestikulierte, Anmut floss durch all ihre Bewegungen.
Als guten Beobachter sah er sich mitnichten, hielt sich überhaupt nicht für einen visuellen Typ, bescheinigte sich dennoch, einen Blick für Menschen zu haben. Er hatte sie sehr bewusst wahrgenommen. Doch auf den Gedanken, sie habe ihn auch wahrgenommen, wäre er niemals gekommen.
Mit zwei Flaschen kam er aus der Küche: „Roten oder weißen?“
„Weißen, der hat meist mehr Aroma.“
„Finde ich auch.“
Er nahm zwei Gläser aus der Vitrine, goss ein.
„Ich muss nochmals fragen“ – er vermied, sich zwischen Du und Sie zu entscheiden – „wie komme ich zu der Ehre?“
„Keine Ehre, ich wollte schon länger wissen, wer du bist – darf ich beim Du bleiben?“ Er nickte. „Von Hinzugezogenen weiß man wenig. Wie heißt du eigentlich?“
„Christoph.“
„Thea.“
Sein offener Blick schien verletzlich. Er sah über den Couchtisch hinweg nach unten, schwieg ein Weilchen, sagte dann:
„Ich spreche nicht gern über mich, bin Typ Einsiedler. Und wenn ich das sage, habe ich schon mehr gesagt, als ich möchte. Ich bin nicht interessant.“
„Interessant“, wiederholte sie, „ich finde dich interessant, doch will ich dir nicht zu nahetreten.“
Er empfand nicht, dass sie ihm zu nahtreten könne, nahm dieses Empfinden verwundert wahr, sagte nur:
„Keine Sorge.“
Sie tranken beide einen Schluck.
„Ich muss es nochmal wiederholen: Wie komme ich zu der Ehre? Ein älterer Herr wird von einer jungen Frau überrascht, von einer sehr schönen jungen Frau, ich finde, das verlangt nach Erklärung.“
„Erklärung, was für ein Wort, das klingt nach Schule. Erklären kann ich nichts. Älterer Herr klingt auch ziemlich doof, hast du ein Problem mit dem Alter? So alt bist du doch gar nicht. Übrigens, ich habe nicht einmal gefragt, ob ich störe…“.
„Tust du nicht.“
„Eigentlich wollte ich auch nicht jetzt deine Zeit beanspruchen, ich wollte nur fragen, ob ich mal zu einem Gespräch kommen kann.“
„Sicher, jederzeit. Ich mache meistens Homeoffice, ich kann meine Zeit einteilen. Wann willst du kommen?“
„Weiß ich noch nicht, ich melde mich.“
Sie erhob sich plötzlich, als sei sie auf einmal in Eile, sie ging wieder zur Terrassentür.
„Krokusse, ich mag Krokusse.“
„Da haben wir etwas gemeinsam.“
Er folgte ihr zur Terrassentür. Inzwischen sah der Mond aus dem Blau, noch ganz vorsichtig, als wolle er der Sonne behutsam bedeuten, dass ihre Zeit sich bald neige.
Sie drehte sich um, ging rasch Richtung Haustür. Er beeilte sich, zu folgen. Sie warf ihm mit der Hand ein Adieu zu, ohne es auszusprechen, verschwand.
Er schaute ihr nach, schloss die Tür, nicht in der Lage, das Durcheinander zu durchblicken, dass sie in ihm hinterlassen hatte. Er ging zu seinem Bücherschrank: Goethe, gesammelte Werke, Gedichte der Sturm-und-Drang-Zeit, „Ganymed“:
„Wie im Morgenglanze
Du rings mich anglühst, Frühling…“
Auch einen Gedichtband von Hölderlin nahm er in die Hand, blätterte zielsicher, wieder „Ganymed“:
„Der Frühling kömmt. Und jedes, in seiner Art,
Blüht. Der aber ist ferne; nicht mehr dabei…“
Die Sonne überstrahlte Himmel und Häuser, Krokusse erhoben die Kelche, reckten sich, öffneten sich, zarte Blüten verströmten köstliche Kraft, riefen unhörbar und dennoch vernehmlich nach Frühling.
Mandelzweig
Krokusse waren verblüht, Winter kehrte für ein kurzes Gastspiel zurück.
Er begutachtete den trockenen Rasen vor der Terrasse, dachte jeden Tag an sie. Gemeldet hatte sie sich nicht. Er sagte sich: was soll sie mit mir anfangen, bin viel zu alt. Aber vielleicht sucht sie gerade einen älteren Gesprächspartner, vielleicht sucht sie ein Stück Lebenserfahrung. Wenn sie nicht kommt, auch gut. Wäre zwar schade, aber normal. Sie darf bei einem alten Mann ruhig reinschauen, ihn etwas aufkratzen, sich vielleicht einen Spaß daraus machen. Jugend hat Rechte eigener Art. Vielleicht wollte sie eine Wette gewinnen oder… er hielt inne: ich bin verrückt, mir so viele Gedanken zu machen. Er verordnete seinen Gedanken einen Stopp. Sie ließen sich nicht stoppen. Er dachte jeden Tag an sie.
Wetterbericht meldete: die frostigen Tage sind ausgestanden, Frühling ist wieder im Anmarsch, Erste Knospen springen an Mandelbäumen auf. Diese Meldung ließ ihn aufhorchen. Mandel- und Apfelblüte waren seine Favoriten unter der Baumblüte, wenngleich er eine üppige Kirschblüte keineswegs verschmähte.