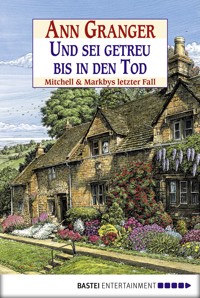9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Das Verbrechen hat viele Gesichter - ein Fest für alle Fans des klassischen englischen Detektivromans
Von einer neugierigen Nachbarin, die niemandem traut, bis zu einem eifersüchtigen Neffen, der sein Erbe unter allen Umständen beschützen will; von einer Geistererscheinung auf einem Kreuzfahrtschiff bis zu einem Oxford-Studenten, der seiner Vergangenheit nicht entkommen kann - Ann Grangers Krimis führen uns von den schottischen Highlands bis zur rauen Küste Cornwalls und von der viktorianischen Ära bis in die Gegenwart.
Fans in aller Welt lieben die unterhaltsamen und spannenden Geschichten, die Ann Granger im Laufe ihrer langen Karriere verfasst hat. Ihr dreißigjähriges Jubiläum als Krimiautorin feiern wir mit dieser Auswahl ihrer achtzehn fesselndsten Kurzkrimis.
Von der Autorin der beliebten Krimireihen um Meredith Mitchell und Alan Markby, Lizzie Martin und Benjamin Ross sowie Jessica Campbell
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 765
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressumWidmungEinleitungAlles, was eine Dame wissen mussEin seltener FinoOptische TäuschungChili, Feuerwerk und eine Prise MordArme ConnieBlind DateEin gefährlicher SchrittDer BeobachterMord auf dem SpeiseplanAuf AbwegenEin Unglück kommt selten alleinDer Geist des KaminsDie Wahrheit über die LiebeSeltsame TräumeEine Frage des VertrauensRhabarberkuchenZeitschienenAuntie … bist du das?Originaltitel und ÜbersetzernachweiseÜber dieses Buch
Das Verbrechen hat viele Gesichter - ein Fest für alle Fans des klassischen englischen Detektivromans
Von einer neugierigen Nachbarin, die niemandem traut, bis zu einem eifersüchtigen Neffen, der sein Erbe unter allen Umständen beschützen will; von einer Geistererscheinung auf einem Kreuzfahrtschiff bis zu einem Oxford-Studenten, der seiner Vergangenheit nicht entkommen kann - Ann Grangers Krimis führen uns von den schottischen Highlands bis zur rauen Küste Cornwalls und von der viktorianischen Ära bis in die Gegenwart.
Fans in aller Welt lieben die unterhaltsamen und spannenden Geschichten, die Ann Granger im Laufe ihrer langen Karriere verfasst hat. Ihr dreißigjähriges Jubiläum als Krimiautorin feiern wir mit dieser Auswahl ihrer achtzehn fesselndsten Kurzkrimis.
Von der Autorin der beliebten Krimireihen um Meredith Mitchell und Alan Markby, Lizzie Martin und Benjamin Ross sowie Jessica Campbell
Über die Autorin
Ann Granger war früher im diplomatischen Dienst tätig und lebt heute mit ihrer Familie in der Nähe von Oxford. Bestsellerruhm erlangte sie mit den Mitchel-und-Markby-Krimis, eine Reihe, die mit den Romanen um die Ermittlerin Jessica Campbell fortgesetzt wird. Zudem schreibt sie an der Lizzie-Martin-und-Benjamin-Ross-Serie, die im viktoriansichen England spielt.
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Deutsche Erstausgabe
Für die Originalausgabe:Copyright © 2021 by Ann GrangerTitel der englsichen Originalausgabe:»Mystery In The Making«First published in Great Britain in 2021 byHEADLINE PUBLISHING GROUP
Für die deutschsprachige Ausgabe:Copyright © 2025 byBastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6–20, 51063 Köln
Vervielfältigungen dieses Werkes für das Text- und Data-Mining bleiben vorbehalten. Die Verwendung des Werkes oder Teilen davon zum Training künstlicher Intelligenz-Technologien oder -Systeme ist untersagt.
Textredaktion: Angela Kuepper, München
Umschlaggestaltung: Thomas Krämer unter Verwendung der Umschlaggestaltung von Lucy Davey
Einband-/Umschlagmotiv: Cover Illustration © Lucy Davey
eBook-Produktion: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7517-8407-8
luebbe.de
lesejury.de
Für meine Mutter,Norah Davey Granger,und für meine Großmutter,Sarah Davey Martin
Einleitung
Die folgenden Geschichten wurde alle zu verschiedenen Zeiten und vor vielen Jahren geschrieben. Sie jetzt versammelt zu sehen, fühlt sich für mich, ihre Schöpferin, wie ein unerwartetes Wiedersehen mit alten Freunden und Bekannten an. Die Tür öffnet sich, ich gehe in den Raum, und da sind sie, all die Charaktere, die meiner Fantasie entsprungen sind. Was für ein kunterbunter Haufen diesen Raum bevölkert. Die Luft hallt von ihren Stimmen wider. »Wo warst du, seit wir uns zum letzten Mal gesehen haben?«, fragen wir einander. »Was hast du so gemacht?«, und in manchen Fällen: »Was für eine Überraschung, dich hier zu sehen!« Und wenn ein, zwei dieser Figuren vielleicht denken: Hättest du mich nicht netter machen können? Hübscher? Freundlicher? Klüger?, nun, dann sind sie viel zu höflich, um das auch auszusprechen. Allerdings wäre es jetzt ohnehin zu spät, ihr Schicksal zu ändern, und solch ein Wiedersehen ist auch nicht der rechte Zeitpunkt, um sich zu beschweren.
In meinen über dreißig Jahren als Schriftstellerin habe ich alle möglichen Arten von Büchern geschrieben, doch die längste Zeit waren Krimis mein Metier. Allerdings sind Autoren auch immer Leser, und das lange, bevor sie Schriftsteller geworden sind, und ich liebe Bücher schon seit meiner Kindheit. Auch hatte ich das Glück, eine Mutter und eine Großmutter zu haben, die beide leidenschaftliche Leserinnen waren, und so kam ich schon früh mit allen möglichen Büchern in Kontakt, von denen die meisten eigentlich nicht für junge Leser gedacht waren. Die einzigen Kindergeschichten, an die ich mich erinnere und die ich verschlang, hatten mit Pferden zu tun, vor allem das wunderbare Garn, das die Schwestern Pullein-Thompson gesponnen hatten. In ihren Büchern gab es immer fast so viele Ponys wie Menschen. Es waren aufregende Abenteuergeschichten, oft mit einem Hauch von Mystery. Später in meinem Leben, viel später, hatte ich dann das Glück, Josephine Pullein-Thompson zu treffen und ihr zu sagen, wie sehr ich ihre Bücher genossen hatte.
Meine Großmutter, bei der ich viele Jahre lang die Ferien verbrachte, lebte im New Forest. Die frei laufenden Ponys, das Symbol dieses Gebiets, waren damals sogar noch viel freier als heute. Vor dem Haus meiner Oma gab es eine Grasfläche, und manchmal kam eine kleine Herde der Tiere vorbei und wartete am Tor meiner Großmutter. Sie brachte ihnen dann immer Wasser in einem Blecheimer, und die Ponys stellten sich tatsächlich der Reihe nach an, der Leithengst an der Spitze.
Für mich ist das wieder eine Parallele zum Schreiben. Charaktere und Plot fliegen zunächst ungeordnet durch meinen Kopf. Nur langsam sortieren sie sich. Einige drängen sich jedoch immer wieder nach vorn, während andere sich erst einmal durch den Rest durchkämpfen müssen, um dann später aufzutreten.
Meine Mutter mochte historische Romane und Biografien. Meine Großmutter hatte jedoch eher einen Hang zu Western und Krimis. Sie kaufte nahezu alles, was sie in die Finger bekam, vor allem auf Flohmärkten. Wenn sie ihre Beute nach Hause brachte, wurde alles auf einen Haufen gekippt, und den durchzuwühlen war wie eine Schatzsuche. Ein paar dieser Bücher waren natürlich in schlechtem Zustand, doch das war mir egal. Tatsächlich fühlte es sich an, als würde ich sie mit all den vorherigen Besitzern zusammen lesen. Wenn es um Bücher geht, dann hatte ich schon immer das Gefühl, bei Freunden zu sein.
Im Heim meiner Eltern in Portsmouth folgte ich dem Beispiel meiner Großmutter und plünderte jeden Secondhandladen und jeden Flohmarktstand, vor allem nach Hardcovern. Bevor man die lesen konnte, musste die Bindung jedoch verstärkt werden, damit sie nicht auseinanderfielen, und anschließend wurden sie im Ofen bei niedriger Temperatur gebacken, »um die Keime abzutöten, denn man weiß ja nicht, wo sie gewesen sind!«. Modernen Lesern mögen diese Maßnahmen vielleicht extrem erscheinen, aber das war eine Zeit, in der Antibiotika noch nicht so leicht zu haben waren.
Die ersten Krimis, die ich zwischen diesen alten Schinken fand und verschlang, waren die Gerichtsdramen um den Anwalt Perry Mason, geschrieben von Erle Stanley Gardner, selbst ein Rechtsanwalt. Gardners Bücher sind nach heutigen Maßstäben recht knapp gehalten, doch das macht sie noch lange nicht zu Kurzgeschichten beziehungsweise zu dem, was man gemeinhin darunter versteht.
Kurzgeschichten sind erst viel später Teil meiner Lektüre geworden. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass meine Mutter und Großmutter Zeitschriften gelesen hätten, in denen solche Geschichten häufig zu finden sind. Also hatte ich keine Erinnerung, auf die ich hätte zurückgreifen können, als ich selbst mit dem Schreiben von Kurzgeschichten begonnen habe – außer vielleicht in einer Hinsicht, und das hat wieder mit Perry Mason zu tun, denn da galt: Was auch immer geschieht, es muss schnell geschehen.
Eine Kurzgeschichte ist ziemlich kniffelig. Jemand, der noch nie eine geschrieben hat, stellt sich häufig vor, dass Kurzgeschichten doch viel leichter sein müssen, als einen ganzen Roman zu verfassen. Tatsächlich ist das jedoch genau umgekehrt, und zwar aufgrund des engen Rahmens für das Narrativ. Genau wie ein Roman braucht eine Kurzgeschichte einen Anfang, einen Mittelteil und ein Ende. Aber es gibt dort keinen Raum, um Nebenschauplätze zu bedienen oder sonst wie abzuschweifen. Jedes einzelne Wort zählt.
Gleichzeitig müssen die Figuren von Anfang an greifbar und real wirken. Es bleibt schlicht keine Zeit, sie kennenzulernen. Der Leser, die Leserin muss sie sofort erkennen und an sie glauben. Einige von ihnen mögen angenehm erscheinen, andere finster … und neue Bekanntschaften sind manchmal auch nicht das, was sie zu sein scheinen!
Dem Autor bleibt nur wenig Raum für Fehler, und der Weg ist voller Fallstricke. Der Autor kann nicht in Beschreibungen fliehen, dafür ist schlicht kein Platz. Trotzdem muss ein stimmiges Bild gezeichnet und den Charakteren Tiefe verliehen werden.
Ein paar der Storys in diesem Band sind länger als andere, weil sie ursprünglich als Fortsetzungsgeschichten für Zeitschriften gedacht waren. Bei Fortsetzungsgeschichten gibt es noch ein paar andere Herausforderungen. Hier hat der Autor zwar mehr Platz für seine Geschichte, aber er kann nicht alles auf einmal erzählen. Jede Episode muss ein zufriedenstellendes Ganzes ergeben und zugleich das Verlangen im Leser wecken zu wissen, was als Nächstes geschieht.
Wenn man sich hinsetzt, um eine Kurzgeschichte zu schreiben, gleicht das dem Öffnen eines Schmuckkästchens. Man sieht all die bunten, funkelnden Objekte, und jedes repräsentiert eine Figur oder ein Element der Geschichte. Dann sucht man sich die heraus, die man braucht, und platziert sie auf dem Schachbrett der eigenen Fantasie. Sie sind alle an einem entscheidenden Punkt in ihrem Leben, und ihr Schicksal liegt in deinen Händen. Kein Wunder, dass einige von ihnen da ein wenig besorgt aussehen. Aber für den Autor kann das ein Powertrip sein! Ich habe es wirklich genossen, diese kurzen Geschichten zu schreiben. Ich hoffe, Sie genießen es auch, sie zu lesen.
Traurigerweise gibt es heute immer weniger Möglichkeiten, Kurzgeschichten zu veröffentlichen. Zeitschriften suchen sie nicht länger so, wie sie sie einst gesucht haben. Deshalb möchte ich meiner Agentin Isobel Dixon danken, die fest daran geglaubt hat, dass man diese Geschichten in Buchform sammeln kann. Mein Dank gilt auch meiner Lektorin bei Headline, Clare Foss, die die Idee aufgegriffen und umgesetzt hat.
Und so erhebe ich das Glas auf das Wiedersehen mit all meinen alten Freunden, die diese Geschichten bevölkern. Und sie prosten mir ebenfalls zu. (Denn sie genehmigen sich gern mal ein Schlückchen oder ein Glas Sherry!) »Wirklich schön, dich wiederzusehen!«, rufen sie. »Auf all die glücklichen Erinnerungen!« Und hoffentlich auch: »Du hast dich gut gehalten!«
Ann Granger
Alles, was eine Dame wissen muss
Zu Jane Pritchards Kindheitserinnerungen zählte unter anderem ein Buch. Es hatte ihrer Großmutter gehört und trug den Titel: Alles, was eine Dame wissen muss. Jeder kann sich wohl an einflussreiche Literatur erinnern, auch wenn er sie schon vor langer Zeit gelesen hat, und das altehrwürdige Handbuch hatte die junge Jane fasziniert. Verziert mit Bildern einer schmunzelnden Dame, die kleine Notizen schrieb oder in Hut und Handschuhen jemanden besuchte, lehrte es die Leserinnen die korrekte Reaktion auf jede nur erdenkliche Situation, in die man als arglose Frau geraten konnte. Bewaffnet mit diesen Regeln, die so stramm waren wie ein fest geschnürtes Korsett, zog die Dame von Welt hinaus ins Leben und fürchtete weder Menschen noch gesellschaftliche Fallstricke, im Gegenteil: Dank ihrer Kenntnis der Etikette würde sie stets Herrin der Lage sein.
Unglücklicherweise hatte das wunderbare Buch Jane nicht verraten, wie sie mit einem Mörder umgehen sollte – jedenfalls nicht, soweit sie sich erinnerte. Aber vermutlich hatte die Autorin das nur übersehen. Jane gestattete sich einen Moment der Tagträumerei und entwarf im Geiste einen Leserbrief:
Sehr geehrter Herausgeber,
vor Kurzem habe ich die Bekanntschaft eines Gentlemans mit mörderischen Neigungen gemacht …
Ich bitte um Ihren Rat …
Jane schüttelte den Kopf, nachdem sie kurz die Konzentration verloren hatte, rutschte auf ihrem Stuhl herum und lächelte den jungen Mann nervös an, der ihr in dem winzigen Wohnzimmer gegenübersaß. Er war ein ganzes Stück jünger als sie – um die acht Jahre vielleicht –, und sie war siebenunddreißig. Sein Äußeres war recht ansprechend, wäre da nicht dieser prüfende Blick gewesen; er trug eine leicht spießige, aber sportliche Jacke sowie eine Hose mit Bügelfalte. Kurz wünschte Jane sich, sie hätte sich etwas anderes angezogen als abgeschnittene Jeans und ein ausgewaschenes Sweatshirt.
Eine Dame, die sich mit ihrer Toilette Mühe gegeben hat, wird sich stets behaglich fühlen.
»Soll ich uns noch etwas Tee machen?«, fragte Jane. Sie wollte die Gelegenheit nutzen, für fünf Minuten aus dem Zimmer zu fliehen, um die Fassung wiederzuerlangen. Die Situation war äußerst stressig, und sie sollte sich lieber konzentrieren, anstatt sich in exzentrischen Fantasien zu ergehen.
»Vielen Dank«, sagte der junge Mann und griff nach dem Becher, den Jane ihm zuvor gegeben hatte. »Brauchen Sie Hilfe?«
»Nein, danke!«, antwortete Jane ein wenig zu nachdrücklich und lief in die Küche, um den Kessel aufzusetzen.
Tee wird zwischen vier und fünf Uhr nachmittags serviert. Dazu sollte eine Auswahl an sowohl schlichten als auch raffinierten Kuchen gereicht werden. Servietten sind essenziell.
Jane öffnete eine Dose und starrte verzweifelt auf den einen krümeligen Keks, der verlassen auf dem Boden lag. Dann tunkte sie den Teebeutel in das kochende Wasser und eilte zu ihrem Besucher zurück.
»Tut mir leid. Ich habe weder Kuchen noch anderes Gebäck«, entschuldigte sich Jane.
»Das esse ich sowieso nie«, sagte der junge Mann, nippte an dem Becher, den Jane selbst mit lustigen Katzen bemalt hatte, und schaute aus dem Terrassenfenster auf den Rasen.
»Einen netten Garten haben Sie da«, bemerkte der Mann. »Ich bin auch ein kleiner Hobbygärtner.«
Er wollte sie mit freundlichen Worten ermuntern, und sie verstand sofort. »Ich habe dieses Cottage vor gut einem Jahr gekauft«, erzählte sie, »nach meiner Scheidung. Davor habe ich in London gelebt. Aber wissen Sie, die meisten Leute in meinem Bekanntenkreis waren gemeinsame Freunde, und na ja … Ich wollte einfach nur weg und noch einmal neu anfangen. Ich bin Schriftstellerin. Außer meinem Computer und einem Stapel Papier brauche ich nicht viel.«
Jane hatte das schreckliche Gefühl, ihm das schon einmal gesagt zu haben. Wie ein Kind, das etwas für eine Schulaufführung auswendig gelernt und dann einen Fehler gemacht hatte, musste sie noch einmal von vorn anfangen.
»Ich weiß, dass das Cottage abgelegen ist, aber das hat mir nichts ausgemacht. Das tut es noch immer nicht. Und mir war auch klar, dass es hier ein Nachbarhaus gibt, versteckt hinter den Bäumen, aber ich habe noch nicht einmal darüber nachgedacht, wer dort leben könnte. Ich glaube, anfangs habe ich mir vorgestellt, es sei leer, vollkommen verlassen …«
Jane hielt inne und fragte sich, ob das einfach nur eine Phrase oder ob ihr gerade ein Freud’scher Fehler unterlaufen war. »Ich meine«, fuhr sie mit fester Stimme fort, »ich habe dort nie jemanden ein oder aus gehen sehen. Deshalb war es auch eine echte Überraschung für mich, als eine Woche nach meinem Einzug plötzlich Mr. Warren auftauchte.«
Jane war draußen im Garten gewesen, um eine Wäschespinne aufzubauen. Der Metallpfosten war schwer, und sie brauchte eigentlich jemanden, der ihn festhielt, während sie ihn verkeilte. Wenn sie das nicht ordentlich machte, dann würde der erste Windstoß in die Wäsche fahren wie in die Segel eines Schiffes und die einzelnen Teile einfach davontragen.
Auf der anderen Seite der Hecke zwischen Janes und dem Nachbargrundstück raschelte etwas. Dann tauchte plötzlich ein Kopf dahinter auf wie eine Puppe in einem Kasperletheater. Der Kopf gehörte einem Mann, der ungefähr genauso alt war wie Jane, vielleicht auch ein wenig älter, ein-, zweiundvierzig. Er hatte glattes mausgraues Haar und einen kleinen, ordentlich gestutzten Schnurrbart.
»Kann ich Ihnen behilflich sein?«, fragte er. Natürlich konnte er.
Als er in den Garten trat, bekam Jane ihn von Kopf bis Fuß zu sehen und erkannte, dass auch der Rest seines Erscheinungsbildes an eine Maus erinnerte. Der Mann war klein, ein wenig rundlich, und er trug eine braune Hose sowie einen beigen Pullover. Unter dem Adamsapfel hatte er eine kastanienbraune Krawatte geknotet, und er huschte hin und her und stellte die Wäschespinne mit geschickten Händen auf. Dabei lächelte er Jane die ganze Zeit über an und entblößte seine leicht vorstehenden Schneidezähne.
»Es ist wirklich schön, wieder eine Nachbarin zu haben«, sagte er. »Mein Name ist übrigens Harold Warren. Ich lebe mit meiner Mutter zusammen.«
Jane stellte sich ihm mit knappen Worten vor.
»Sie sind Schriftstellerin?«, hakte Mr. Warren nach, und seine Augen funkelten. »Ich liebe Bücher. Ich lese alles Mögliche, einfach alles, was ich in die Finger bekomme.«
Mr. Warren erklärte weiter, dass er unverheiratet sei, und seine Mutter, mit der er sich das Haus teilte, alt und gebrechlich. Sie sei ständig auf Hilfe angewiesen, sagte er. Deshalb arbeitete er wohl auch nicht. Und Jane nahm an, dass seine Mutter Rente bekam. Sie dankte Mr. Warren für seine Hilfe und bot ihm eine Tasse Tee an.
Mr. Warren schüttelte den Kopf. »Ich kann meine Mutter nicht so lange allein lassen.«
Und mit diesen Worten kehrte er auf seine Seite der Hecke zurück.
Schweigen senkte sich über Janes Wohnzimmer. Janes Besucher nippte an seinem Tee, und Jane griff nach ihrem eigenen Becher.
»Haben Sie ihn danach noch öfter gesehen?«, fragte ihr Besucher in beiläufigem Ton.
Jane schüttelte den Kopf. »So gut wie nie. Der Garten der Warrens ist vollkommen verwildert, und ihr Haus kann man wegen der Bäume von hier aus nicht erkennen. Die Einfahrt liegt außerdem hinter der Kurve, ein Stück die Straße runter. Deshalb sehe ich auch nicht, wenn jemand kommt oder geht. Dann und wann habe ich einmal ein Auto gehört, und manchmal habe ich es auch gesehen, wenn ich die Straße hinuntergegangen bin. Außerdem musste Mr. Warren ja auch mal raus. Dann hat er mir immer zugewunken, und manchmal hat er auch das Fenster heruntergelassen und mir einen Gruß zugerufen. Gelegentlich haben wir kurz miteinander geplaudert. Er hat mir leidgetan, und ich habe ihn immer als vorbildlichen Sohn gesehen. Als ich das nächste Mal richtig mit ihm gesprochen habe, da hat er mir ein paar Äpfel gebracht.«
Jane war wieder hinten in ihrem Garten und jätete gerade Unkraut in einem Blumenbeet. Da war ein Rascheln auf der anderen Seite der Hecke zu hören, und wie schon beim letzten Mal tauchte Mr. Warrens Kopf über der Hecke auf. Jane schrie überrascht auf und ließ fast die Hacke fallen. Mr. Warren entschuldigte sich dafür, sie erschreckt zu haben, und hielt eine Plastiktüte in die Höhe.
»Ich dachte, Sie hätten vielleicht gern ein paar Äpfel. Das ist allerdings Fallobst. Also werden Sie sie direkt essen müssen. Die halten nicht lange. Aber es sind Bramley, sehr gut zum Einkochen. Wir haben mehr, als Mutter und ich verarbeiten können.«
»Wie geht es Ihrer Mutter denn?«, fragte Jane.
»Ach, wie immer.« Er seufzte. »Da kann man nichts machen. Die Arme. Es ist ziemlich anstrengend, aber wir kommen schon zurecht.«
Und mit diesen Worten eilte er davon.
Das war das zweite Mal, dass er sich als freundlicher Nachbar erwiesen hatte. Jane fühlte sich verpflichtet, es ihm gleichzutun.
Ein Gegenbesuch sollte weder zu schnell erfolgen noch allzu lange dauern.
Jane backte mit den Äpfeln ein paar Kuchen. Die fror sie dann ein bis auf zwei. Einen wollte sie selbst essen, und mit dem anderen machte sie sich auf den Weg zum Haus der Warrens. Vermutlich kochte und backte Mr. Warren nicht viel, denn er hatte mit seiner Mutter ja alle Hände voll zu tun.
Wenn man jemanden besucht, der ans Haus gefesselt ist, ist eine kleine, selbst gebackene Leckerei stets willkommen.
Jane ging die lange, überwucherte Einfahrt zum Haus hinauf. Die Kronen der stolzen alten Bäume trafen sich über ihrem Kopf und sperrten das Tageslicht aus. Es war kühl und feucht. Das Laub war vom Regen glitschig. Überall herrschte Stille. Noch nicht einmal Vogelgesang war zu hören.
Das Haus selbst tauchte mit der gleichen erschreckenden Plötzlichkeit vor Jane auf wie Mr. Warrens Kopf über der Hecke. Den Kuchen wie ein religiöses Opfer in beiden Händen haltend, blieb Jane stehen und studierte die Szenerie. Hätte sie es nicht besser gewusst, sie hätte geglaubt, das Haus sei verlassen. Auf den schmalen Fenstern lag eine dicke Staubschicht, und die Mauern waren offensichtlich schon seit Ewigkeiten nicht mehr gestrichen worden. Zu ihrer Rechten und ein Stück abseits stand eine Garage zwischen den Bäumen. Abdrücke in der feuchten Erde zeigten, wo ein Auto entlanggefahren war, doch das war die einzige Spur von Leben. Das Garagentor war geschlossen.
Als Jane sich der Haustür näherte, sah sie neben den Stufen Gartenabfälle, die die Kellerfenster verstopften. Jane stieg die steinernen Stufen hinauf, und das Laub knirschte unter ihren Füßen. Dann legte sie die Hand auf den angelaufenen Messingklopfer. Das Geräusch hallte durchs Haus wie ferner Donner.
Einen Augenblick später hörte Jane Schritte, die sich der Tür näherten. Nur unter Mühen ließ sie sich öffnen. Die Scharniere waren wohl angerostet. Schwach war durch den Spalt eine Gestalt auf der anderen Seite zu erkennen. Dann wurde die Tür weiter geöffnet, und Mr. Warren stand da in seiner mausgrauen Hose, dem beigen Pullover und mit der kastanienbraunen Krawatte. Er trug Slipper.
»Oh«, sagte er und blinzelte Jane an. »Mrs. Pritchard!«
Jane hielt ihm den Kuchen hin. »Ich wollte Ihnen den hier bringen. Ich dachte, weil Sie so nett waren und mir die Äpfel geschenkt haben. Ich habe gleich mehrere davon gebacken. Vielleicht wollen Sie ja …«
»Danke. Ja. Aber Sie sollten wirklich nicht …«, unterbrach Mr. Warren sie. Er wirkte aufgeregt und streckte die Hand nach dem Kuchen aus.
Doch bevor er die Hand um das Tablett schließen konnte, öffnete sich hinter ihm, in den Tiefen des finsteren Flurs, eine Tür, und die Silhouette einer Frau trat hindurch.
Die Frau, die Jane zunächst nicht deutlich erkennen konnte, bewegte sich langsam auf sie zu. Sie hatte einen seltsamen, unregelmäßigen Gang, und sie streckte die Hand aus, um sich an der Wand abzustützen. Jetzt konnte Jane erkennen, dass sie ein unansehnliches Kleid aus bedrucktem Stoff und eine schmutzige Strickjacke trug. Ihr Haar war grau, aber voll; es fiel ihr lose und in verfilzten Strähnen bis auf die Schultern. Sie hatte große blassblaue Augen, die sie nun staunend auf ihre Besucherin richtete. Es war zwar unmöglich, das Alter der Frau einzuschätzen, doch ihre Haut wirkte bemerkenswert glatt.
Dann traf Jane der Geruch: ein ekelhafter Gestank von alter Unterwäsche und Schweiß, von Dreck, steifer Kleidung und ungewaschener Haut. Die Füße der Frau waren nackt – deshalb bewegte sie sich auch so leise –, und die ungeschnittenen Zehennägel hatten sich zu Krallen gekrümmt wie bei einem Raubvogel.
Janes Gesichtsausdruck verriet, dass sie etwas sah, doch Mr. Warren schien ohnehin zu fühlen, dass da jemand hinter ihm war. Er wirbelte herum und stieß ein Geräusch aus, das teils aus Überraschung, teils aus Verzweiflung oder Verlegenheit, teils aber auch aus Wut zu bestehen schien.
Sofort lief Mr. Warren zu der zerlumpten Gestalt und packte sie fest am Arm.
»Du sollst doch nicht hier draußen sein«, sagte er.
»Wer ist das?«, fragte die Frau und starrte Jane über Mr. Warrens Schulter hinweg staunend an. Jetzt sah Jane auch, dass die Pupillen in den blassblauen Augen deutlich vergrößert und seltsam unfokussiert waren.
Jane hob die Stimme und antwortete: »Mein Name ist Jane Pritchard, Mrs. Warren. Ich wohne in dem Cottage nebenan. Ich nehme an, Ihr Sohn hat Ihnen von mir erzählt …«
»Ich habe keinen …«, begann die Frau verärgert.
Warren trat zwischen die beiden Frauen. Er blickte über die Schulter zu Jane und sagte gereizt: »Sie versteht das nicht. Das ist Demenz.« Er begann, seine Mutter zu dem hinteren Raum zu schieben.
»Komm, meine Liebe. Zurück in die warme Küche. Du wirst dich noch erkälten.«
»Du hast mir die Schuhe weggenommen«, beschwerte sich die alte Frau.
»Nein, das habe ich nicht«, erwiderte Mr. Warren in autoritärem Ton. »Du ziehst sie immer selbst aus.«
Er stieß sie durch die Tür am Ende des Flurs, schloss sie und lief wieder zu Jane zurück.
»Sie sehen es ja selbst, Mrs. Pritchard«, begann er rasch. »Sie leidet unter Demenz, und dagegen kann man leider nichts tun.«
»Ich verstehe«, erwiderte Jane. Sie wusste nicht so recht, wie sie das ausdrücken sollte, aber die Frau war vollkommen verdreckt. Man sollte sie zumindest einmal baden und ihr die Zehennägel schneiden. »Hilft Ihnen jemand mit Ihrer Mutter, Mr. Warren? Vielleicht könnte die Bezirkskrankenschwester ja einmal die Woche vorbeikommen und Ihnen … äh … zur Hand gehen.«
»Nein!«, wehrte Mr. Warren sich in scharfem Ton. »Das ist nicht nötig!« Er riss sich wieder zusammen. »Ich will ja nicht undankbar klingen, Mrs. Pritchard, und es ist wirklich sehr freundlich, dass Sie sich Gedanken machen. Aber ich kann sehr gut allein für meine Mutter sorgen. Außerdem machen Fremde ihr Angst. Ich bin der Einzige, dessen Hilfe sie akzeptiert.«
Mr. Warren schickte sich an, Jane die Tür vor der Nase zuzuschlagen, doch sie hielt noch immer die Kuchenplatte in der Hand, und sie wollte, dass er sie nahm. Also streckte sie die Arme aus. Die Folge davon war, dass die sich schließende Tür Jane erwischte, und fast hätte sie den Kuchen fallen gelassen, doch Mr. Warren fing ihn im letzten Moment auf.
»T… Tut mir leid«, stammelte er. »Ich habe nicht erwartet … Das ist keiner ihrer guten Tage. Aber das soll Sie nicht kümmern. Wir kommen schon zurecht, Mutter und ich. Ich kann auch ganz gut kochen, wenn ich das sagen darf.« Und mit diesen Worten entblößte er seine Nagezähne und verschwand.
»Ich habe mich tierisch geschämt, und um ehrlich zu sein, kam ich mir auch ziemlich dumm vor«, erzählte Jane ihrem Besucher.
Der junge Mann hielt den leeren Becher in beiden Händen und beobachtete Jane aufmerksam.
»Ich wollte mich doch nicht einmischen«, fuhr Jane fort. »Himmel, ein neugieriger Nachbar kann einem das Leben zur Hölle machen! Außerdem hatte ich Mitleid mit ihm. Wie schlimm muss es sein, den ganzen Tag dort eingesperrt zu sein – und die ganze Nacht –, und das mit jemandem in diesem Zustand. Natürlich war mir sofort klar, dass er Hilfe benötigte, aber er hat mein Angebot abgelehnt. Er wirkte fest entschlossen, sich selbst um sie zu kümmern. Wissen Sie …« Jane zögerte. »Ich habe mich irgendwie für die beiden verantwortlich gefühlt. Ich weiß, einerseits ging mich das nichts an, aber andererseits … Wenn jemand in Not ist, dann ignoriert man das doch nicht einfach, oder? Meiner Einschätzung nach hätte er früher oder später ohnehin Hilfe gebraucht, und je früher desto besser … für beide. Deshalb beschloss ich, die Sache eine Woche lang auf sich beruhen zu lassen, und dann noch mal vorbeizugehen.«
Im Laufe der folgenden Woche sah Jane keine Spur von Mr. Warren. Am Samstagnachmittag schien die Sonne nach mehreren bewölkten Tagen strahlend hell, und Jane beschloss, einen Spaziergang zu machen. Das Buch, an dem sie zu arbeiten versucht hatte, war an einem seltsamen Punkt angelangt. Sie brauchte eine Pause.
Bei der Rückkehr zum Cottage kam sie an Mr. Warrens Einfahrt vorbei, und spontan entschied sie sich für einen Besuch.
Diesmal würde sie jedoch nicht an die Vordertür klopfen. Offensichtlich war sie nicht täglich in Gebrauch, und bei der letzten Gelegenheit hatte Jane mit ihrem Klopfen die alte Dame gestört. Außerdem war es auf dem Land ohnehin üblich, die Hintertür zu benutzen. Das hatte sie ganz vergessen. Also würde sie diesmal um das Haus herumgehen und diskret an die Küchentür klopfen.
Der hintere Teil des Grundstücks war genauso verwildert wie die Front. Hier hatte vor Jahren ein produktiver Obsthain gestanden, doch jetzt wurden die Apfelbäume schon lange nicht mehr geschnitten, und zwischen ihnen wucherte das Gras. Direkt am Haus hatte sich das Gebüsch in einen wahren Urwald verwandelt.
Neben der Hintertür stand ein Fenster offen, und eine Bewegung auf der anderen Seite erregte Janes Aufmerksamkeit. Es war Mr. Warren, doch als sie ihm zuwinken wollte, drehte er sich zur Seite, ohne sie zu sehen, und kehrte in den Raum zurück, außer Sicht.
Jane ging zum Fenster und lugte hinein. Sie hatte die Hand gehoben, um ans Glas zu klopfen, doch dann hielt sie inne.
Ja, das war die Küche, groß, altmodisch und unsauber. Mrs. Warren saß auf einem klapprigen, viel zu dick gepolsterten Sessel neben einem antiken Küchenschrank. Sie trug noch immer dasselbe verdreckte Blumenkleid, aber eine andere, wenn auch nicht sauberere Strickjacke. Ihr Gesicht glänzte vor Schweiß, und ihr verfilztes Haar klebte an der Haut. Die großen blauen Augen hatte sie weit geöffnet, und ihr stand eine derartige Angst ins Gesicht geschrieben, dass Jane unwillkürlich die Hand vor den Mund schlug, um nicht laut aufzuschreien.
Warren beugte sich gerade über seine Mutter und hielt ihr ein Glas mit Wasser oder irgendeiner anderen Flüssigkeit an den Mund.
Mrs. Warren schüttelte den Kopf und wand sich.
»Jetzt komm schon«, befahl Mr. Warren in rauem Ton »Runter damit!«
»Ich will nicht, Harold …«, wimmerte die alte Dame.
»Du wirst tun, was ich dir sage. Ich muss ins Dorf, und ich will nicht, dass du hier rumläufst, während ich weg bin.«
»Das werde ich nicht, Harold. Versprochen.«
Mr. Warren drückte ihr weiter das Glas an den Mund. »Wenn du das nicht trinkst«, sagte er, »dann gibt es heute kein Abendessen und morgen auch nicht … vielleicht noch nicht einmal übermorgen.«
Jane hegte nicht den geringsten Zweifel daran, dass Mr. Warren das auch so meinte und dass er diese Art von Strafe schon öfter angewandt hatte. Sein Tonfall war vollkommen anders als alles, was sie bis jetzt in seiner Stimme gehört hatte. Er klang nicht nur bedrohlich, sondern so, als freute er sich gar auf die bevorstehenden Grausamkeiten.
Und die alte Frau empfand das genauso. Jane beobachtete, wie sie den Inhalt des Glases schluckte. Ein Teil davon lief ihr übers Kinn und hinterließ Flecken auf ihrem bedruckten Oberteil.
Warren drehte sich wieder zum Fenster um. Jane hatte gerade noch genug Zeit, um sich zu ducken. Sie hörte fließendes Wasser und das Stöhnen von Metall. Die Spüle musste sich direkt am Fenster befinden. Jane wartete zwei, drei Minuten, und als sie schließlich einen Blick riskierte, sah sie Warren nicht mehr. Mrs. Warren hingegen saß noch immer auf ihrem Stuhl und hatte die Augen geschlossen. Schwach murmelte sie vor sich hin.
Jane lief zu dem Gestrüpp zurück und versteckte sich zwischen den Büschen. Nach einer Weile hörte sie das Knarren des Garagentors, dann das Grollen eines startenden Motors. Warren fuhr die Einfahrt hinunter und war verschwunden. Alles war still.
Jane kam aus ihrem Versteck und lief zum Haus. Die Küchentür war abgeschlossen, doch das Fenster stand noch einen Spalt offen – Gott sei Dank. Jane wusste nicht, wie lange Warren im Dorf bleiben würde, aber das war ihre einzige Chance, ins Haus zu kommen.
Sie zog das Fenster weit auf und kletterte auf die Fensterbank.
»Mrs. Warren? Bitte, haben Sie keine Angst! Ich bin’s nur. Jane aus dem Cottage …«
Doch Mrs. Warren lag einfach in ihrem Sessel. Offensichtlich schlief sie tief und fest.
Jane gelang es, über die Spüle zu klettern und sich dahinter auf den Boden gleiten zu lassen. Sie lief zu dem Sessel und der reglosen Gestalt darin. Sofort stieg ihr wieder der säuerliche Gestank in die Nase, doch diesmal war Jane darauf vorbereitet, und so ignorierte sie ihn einfach. Sanft rüttelte Jane die Frau an der Schulter, doch Mrs. Warren schlief einfach weiter. So aus der Nähe betrachtet und vollkommen entspannt, wirkte die Frau deutlich jünger. Die Falten auf ihrer Haut waren nicht sonderlich tief. Das graue Haar wiederum war zwar verdreckt, aber dick. Ordentlich gewaschen und frisiert wäre es sogar prachtvoll gewesen. Jane runzelte die Stirn, berührte vorsichtig eines der Augenlider der Schlafenden und schob es hoch.
»Unter Drogen …«, murmelte Jane. Sie richtete sich wieder auf und drehte sich um. Das Glas stand noch auf der Arbeitsplatte und daneben ein kleines Fläschchen, wie man es in der Apotheke bekam. Jane griff danach. Es enthielt eine kristalline weiße Substanz, und auf dem schon älter wirkenden Aufkleber stand: Chlorhydrat. Der Rest war nicht mehr zu lesen, doch das war auch egal. Jane wusste genau, was das bedeutete.
Warren hatte sich also ein altmodisches, aber ohne Zweifel wirksames Schlafmittel mischen lassen und es seiner Mutter aufgezwungen. Das kam Jane ziemlich drastisch vor. Bei längerem Gebrauch von Chlorhydrat drohten schwere Nebenwirkungen wie Abhängigkeit, Depressionen und kardiologische Störungen. Auch wenn man die alte Frau nicht allein lassen konnte, rechtfertigte das nicht im Mindesten den Einsatz eines Mittels wie Chlorhydrat.
Jane ging durch die Küche und schaute in den Flur. Er war noch genau so, wie sie ihn von ihrem letzten Besuch her in Erinnerung hatte: schäbig, der Teppich abgewetzt. Irgendwo tickte leise eine Uhr, aber nicht hier. Das Geräusch drang durch eine halb offene Tür, die zu einem Raum auf der anderen Seite des Flurs führte. Jane ging hinein.
Bei dem Raum schien es sich um eine Mischung aus Wohn- und Arbeitszimmer zu handeln. Offenbar nutzte Warren ihn. Hier war es deutlich wärmer und sauberer als sonst wo im Haus. Der Gasofen musste vor Kurzem noch gebrannt haben. Es gab auch ein paar Bücher, aber nicht so viele wie im Haushalt eines eifrigen Lesers, und als solcher hatte Warren sich ja bezeichnet. Allerdings gab es ein großes Fernsehgerät und einen neuen CD-Player. Bei den anderen Möbeln handelte es sich größtenteils um solide, recht teure Stücke einschließlich eines großen viktorianischen Sekretärs. Er stand offen. Warren musste gerade erst daran gearbeitet haben. Jane sah mehrere Papiere auf der Schreiboberfläche.
Jane wusste, dass sie das eigentlich nicht tun sollte, doch extreme Umstände erforderten extreme Maßnahmen. Sie trat zum Sekretär und warf einen raschen Blick auf die Papiere. Es handelte sich um Kontoauszüge, und die Summen darauf ließen Jane blinzeln. Ein wenig Familiengeld? Das war verdammt viel! Doch auf den Ausdrucken stand nur ein Name: Harold Warren. Also lief alles auf den Namen des Sohnes.
Jane lief ein Schauder über den Rücken, und was lange nur ein Verdacht gewesen war, verwandelte sich in furchterregende Sicherheit. Aber wie sollte sie das beweisen? Die Kontoauszüge reichten nicht dafür. Wenn die alte Frau senil war, dann hatte der Sohn natürlich volle Kontrolle über ihre finanziellen Angelegenheiten. Vermutlich war er sogar ihr Vormund.
Aber in den Fächern des Sekretärs fanden sich noch andere Papiere und mit etwas Glück auch eindeutigere Beweise. Jane wusste nicht, wie viel Zeit ihr blieb, bis Warren wieder zurückkehrte. Hektisch holte sie eine Handvoll Papiere aus den Fächern und blätterte sie durch. Da waren Rechnungen für Gas, Strom und Autoreparaturen.
Ein Umschlag rutschte aus dem Stapel in Janes Hand, fiel zu Boden und gab seinen Inhalt preis. Jane schnappte erschrocken nach Luft und sammelte das Zeug rasch ein.
Das waren Fotos. Jane breitete sie auf dem Teppich aus. Die Bilder waren gemischt, doch eines, gar nicht mal so alt, zeigte ein Paar. Die Frau trug einen eleganten Zweiteiler und hielt einen Blumenstrauß in der Hand. Sie lächelte glücklich in die Kamera. Der Mann neben ihr hatte Ansteckblumen am Kragen, und der Boden vor den beiden war voller bunter Flecken. Konfetti.
Der junge Mann in Janes Wohnzimmer rutschte auf dem Sofa herum. Vorsichtig stellte er seinen Becher wieder auf den Tisch. »So«, sagte er. »Da haben Sie also herausgefunden, worum es wirklich ging.«
»Ja, das waren Hochzeitsfotos. Der Mann war Warren, und die Frau war eindeutig diejenige, die er mir als seine Mutter vorgestellt hatte, auch wenn sie jetzt in einem furchtbaren Zustand war. Aber das war nicht seine Mutter. Das war seine Frau!«
»Und dann haben Sie die Polizei kontaktiert.« Endlich lächelte Detective Sergeant Sullivan. »Sie haben gerade noch rechtzeitig reagiert und ein furchtbares Verbrechen verhindert, Mrs. Pritchard.«
»Ja, aber ich kann ehrlich gesagt nicht behaupten, das alles zu verstehen, auch jetzt noch nicht. Was genau hatte er denn vor?«
»Oh …« Sullivan machte eine weit ausholende Geste. »Es war eigentlich recht einfach. Clevere Täter planen immer einfach. Es ist ein Fehler, kompliziert zu denken. Warren ist davon ausgegangen, dass die meisten Menschen schlicht glauben, was man ihnen sagt. Warum sollten sie einem auch misstrauen? Er hat Ihnen erzählt, sie sei seine Mutter, und Sie hatten keinen Grund anzunehmen, dass es sich anders verhielt.
Als die beiden sich kennenlernten, war Warren Apotheker in einer kleinen Stadt am Meer. Mrs. Beryl Darcy, wie sie damals hieß, war Witwe. Nach dem Tod ihres Mannes stand sie finanziell zwar ziemlich gut da, fühlte sich aber einsam. Sie hatte keine Familie, und tatsächlich war sie in die kleine Stadt am Meer gekommen, um sich Gesellschaft zu suchen. Die fand sie bei Warren.
Er war mehrere Jahre jünger als sie, aber sie hatte immer auf sich geachtet und konnte sich schöne Kleider leisten. Deshalb kam ihr auch gar nicht in den Sinn, dass ein jüngerer Mann sie nicht attraktiv finden könnte. Die beiden heirateten. Vermutlich fütterte er sie über einen langen Zeitraum hinweg mit kleinen Dosen starker Medikamente. Irgendwann hatte er dann die vollständige Kontrolle über sie. Er brachte sie dazu, ihm ihr Geld und ihren Besitz zu überschreiben. Dann musste er sie nur noch loswerden.
Er kaufte ein einsam gelegenes Haus, zog mit ihr dorthin und begann, sie langsam zu vergiften, sodass sie die Hälfte der Zeit gar nicht mehr wusste, was los war. Wenn jemand fragte, dann sagte er, sie sei seine Mutter, die nie das Haus verließ.
Hätte er jedoch ›Frau‹ gesagt, dann hätte das die Neugier der Leute geweckt, und sie hätten sich gefragt, warum er sich keine Hilfe holte. Aber eine ältere Dame … Nun, da akzeptierten die Leute die traurige Situation schlicht, und sie betrachteten Warren als fürsorglichen Sohn. Irgendwann hätte er dann erzählt, dass man sie in ein Pflegeheim gebracht habe, und kurz darauf hätte er ihren Tod verkündet. Die angebliche Beerdigung wiederum hätte dann irgendwo weit weg stattgefunden – in ihrem ›Heimatort‹ vielleicht. Das hätte doch jeder geglaubt, und warum auch nicht?«
Jane schauderte. Sullivan stand auf und ging zur Terrassentür, durch die man in Janes Garten und zu der Hecke blicken konnte, hinter der das Gestrüpp von Warrens Grundstück lag.
»Vermutlich hätte er sie tatsächlich irgendwo dort verscharrt«, sagte der Sergeant, »oder sie unter dem Kellerboden begraben. An einem sicheren Ort. Und dann … Nun, er hätte sich einfach davonstehlen, ins Ausland gehen und einen neuen Anfang machen können. Oder wenn er sich sicher genug gefühlt hätte, dann hätte er auch in dem Haus wohnen bleiben können.«
Sullivan schaute über die Schulter zurück zu Jane. Sie war kreidebleich.
»Sie haben definitiv einen Mord verhindert, Mrs. Pritchard. Wir sind gerade noch rechtzeitig zu Mrs. Warren gekommen.«
»Wie geht es der armen Frau jetzt?«, flüsterte Jane.
»Sie ist zwar immer noch schlecht beieinander, aber sie erholt sich gut. Sie weiß, was passiert ist, und sie brennt darauf, Sie kennenzulernen, um sich bei Ihnen zu bedanken.«
»Ich brauche keinen Dank«, sagte Jane. »Aber ich werde sie besuchen. Ich bin ja so froh, dass es ihr gutgeht. Und was wird mit ihm passieren? Ich hoffe doch, dass man ihn einsperrt und den Schlüssel wegwirft.«
DS Sullivan verzog das Gesicht. »Das ist zu viel gehofft. Er wird seine Strafe absitzen, und dann … Wer weiß? Vielleicht wäre er einfach verschwunden, und wir hätten nie wieder etwas von ihm gehört. Aber einmal Hochstapler, immer Hochstapler. Diese Leute greifen gern wieder auf ihre alten Tricks zurück. Er könnte glauben, dass er jetzt weiß, was falschgelaufen ist, und sich vornehmen, es beim nächsten Mal richtig zu machen.«
Sullivan warf Jane einen verschmitzten Blick zu. »Persönlich glaube ich, dass er hiergeblieben wäre und sich nach einem neuen Opfer umgesehen hätte, wäre er damit durchgekommen. Es gibt jede Menge alleinstehende Frauen mit ein wenig Geld, die an ruhigen Orten leben, einsam …«
Seine Stimme verhallte, und er schaute sich demonstrativ im Raum um.
»W… Wollen Sie damit etwa sagen«, erwiderte Jane leise, »dass der Mord, den ich verhindert habe, schlussendlich mein eigener hätte sein können?«
»Sie sind wesentlich klüger als die arme Beryl Darcy Warren«, versicherte ihr Besucher ihr freundlich. »Aber vermutlich ja, ich denke, er hat Sie sich als nächstes Opfer ausgesucht.«
Sergeant Sullivan schaute wieder zum Fenster hinaus und nickte anerkennend. »Ja, Sie haben da einen wirklich hübschen Garten, Mrs. Pritchard. Tatsächlich ist hier alles ganz nett. Machen Sie sich keine Sorgen, nur weil Sie allein hier wohnen.« Er drehte sich wieder um und lächelte Jane an. Er sah verdammt gut aus. »Wir werden ein Auge auf Sie haben.«
Hm, dachte Jane, griff sich die leeren Becher und marschierte in die Küche.
Alles, was eine Dame wissen muss, Großmutters altes Buch, hatte sein Bestes getan, die wichtigste aller Regeln jedoch vergessen:
Aufpassen, meine Dame! Immer aufpassen!
Ein seltener Fino
Als Gentleman spricht man niemals über Geld. Das bedeutet aber keineswegs, dass ich, obwohl ich unbestreitbar ein Gentleman bin, mir niemals Gedanken um das Finanzielle gemacht hätte. Unmittelbar vor den unglückseligen Vorfällen, von denen ich berichten möchte, hatte ich sehr viel über Geld nachgedacht – eine äußerst leidvolle Angelegenheit.
Ich sollte es wohl näher erklären. Seit einigen Jahren arbeitete ich an meinem Buch Flora und Fauna der Iberischen Halbinsel. Ich war und bin noch immer überzeugt, dass mein Buch, wenn es erst vollendet und veröffentlicht ist, das unverzichtbare Referenzwerk zu diesem Thema schlechthin sein wird.
Ursprünglich widmete ich meine Arbeit dem berühmten Naturforscher Charles Darwin. Ich hatte den großen Mann sogar kurz vor seinem Tod im Jahre 1882 besucht. Ich reiste nach Cambridge und erhielt nur unter erheblichen Schwierigkeiten und allein dadurch, dass ich darauf beharrte, meine Forschung sei von überragender Wichtigkeit, Zutritt zum Haus seiner Familie. (Vorausschauend hatte ich ein Exemplar des Manuskripts mitgebracht, um es Darwin vorzulegen. Ich war mir sicher, er würde es zu schätzen wissen.)
Leider muss ich sagen, dass der große Wissenschaftler mich bitter enttäuschte. Mir ist bewusst, dass er zum Zeitpunkt meines Besuchs alt und krank war, aber trotzdem fand ich sein Benehmen schroff bis hin zur Grenze der Unhöflichkeit. Ich überreichte ihm mein Manuskript, doch statt seiner Freude Ausdruck zu verleihen, sagte er nur, er werde einen Blick darauf werfen, falls er einmal Zeit habe. Er legte es höchst gleichgültig zur Seite und fragte mich, ob ich noch etwas wolle. Aber gewiss, verkündete ich, ich erbäte seine Erlaubnis, ihm mein Buch zu widmen.
»Na ja«, sagte er, »wenn Sie möchten. Mir ist es gleichgültig. Ich werde nicht mehr leben, wenn es veröffentlicht wird.« Er fügte hinzu: »Falls es veröffentlicht wird!«
Ich fuhr nach Hause und strich die Widmung. Persönlich bin ich fest davon überzeugt, dass er auf meine Gelehrsamkeit neidisch war.
Natürlich musste ich im Lauf meiner Forschung oft Spanien und Portugal besuchen und dort einige Zeit verbringen. All das kostete Geld: mein gesamtes Vermögen, wie es sich fügt. Die Reste meines persönlichen Kapitals hatte ich schon vor einigen Jahren für mein Vorhaben ausgegeben. Seit dieser Zeit war ich von den Zuwendungen meiner Tante Matilda abhängig.
Meine Tante (die ältere Schwester meines verstorbenen Vaters) war eine reiche, kinderlose Witwe. Sie bewohnte allein ein großes Haus in Chertsey – demjenigen in Surrey –, zusammen mit einer ältlichen Köchin und einer Zofe. Einen Gärtner gab es auch, der mindestens siebzig sein musste. Von den Dienstboten abgesehen, leistete ihr nur ein Dackel namens Oscar Gesellschaft.
Oscar war kein junger Hund mehr. Seine Schnauze war recht grau, er war übergewichtig und von üblem Temperament. Die Menschen behaupten oft, Maulesel oder Kamele seien die störrischsten aller Tiere. Sie können noch nie mit einem alten Dackel zu tun gehabt haben. Entschied sich Oscar, einen bequemen Sessel in Beschlag zu nehmen, war es das Beste, ihn dort nicht weiter zu stören. Seine Zähne mochten vom Alter gelb sein, aber sehr spitz waren sie auch.
Was meine Tante angeht, nun, es heißt immer, Menschen würden sich an ihr Haustier angleichen, und sie hatte gewisse Charakterzüge mit Oscar gemeinsam. Auch sie war ältlich (aber rüstig und gesund), stämmig, hatte recht kurze Beine und wenig Geduld. Sowohl sie als auch Oscar hatten eine scharfe Nase und ein wachsames Auge.
Ich musste mich sehr anstrengen, um in Tante Matildas Gunst zu bleiben. Sie hätte ihre Zuwendungen vom einen Augenblick zum anderen einstellen können, und wäre das geschehen, wäre auch meine Arbeit zum Stillstand gekommen. An diese Möglichkeit wollte ich gar nicht denken. Zu alldem kam die Frage ihres Testaments.
Nun hatte ich Grund zu der Hoffnung, sie würde mir ihr Vermögen hinterlassen. Ich hatte zwar zwei Cousinen, aber sie waren Frauen und hatten geheiratet, sodass sie nicht mehr den Familiennamen trugen. Nur ich brachte den Namen in die nächste Generation, und das hatte Tante Matilda mehrmals erwähnt.
Nicht dass die Cousinen die Hoffnung schon aufgegeben hätten. Oh nein! Ständig besuchten sie Tante Matilda, brachten ihre unerquicklichen Kinder mit und überschütteten sie mit kleinen Aufmerksamkeiten. Ihre Besuche häuften sich, wenn ich zu Feldstudien in Spanien oder Portugal weilte. Ich war mir sicher, sie ergriffen die Gelegenheit beim Schopfe, mein Ansehen bei meiner Tante zu unterminieren, um meiner Aussicht auf die Erbschaft zu schaden.
Als wäre das nicht genug, hatten beide Cousinen sich entschieden, ihre sehr unansehnlichen Töchter nach meiner Tante zu benennen (auch wenn meiner Meinung nach drei Matildas in einer Familie bei Weitem zu viele waren).
Nun hatte Tante Matilda eine einzige kleine Schwäche (sah man vom Verwöhnen ihres elenden Köters ab). Sie wusste guten Sherry zu schätzen. Wie es sich fügte, führte meine Forschung mich in die schöne Region Spaniens um Jerez, deren Name mit jenem berühmten Aperitif synonym ist; ein wunderbarer Teil der Welt.
Dieser Teil Andalusiens ist das Spanien der Träume. Tags reist man durch eine Landschaft aus Burgen, großen Landhäusern, weiß getünchten Dörfern und Viehweiden, auf denen Stiere für die Arena gezüchtet werden. Nachts entspannt man sich unterm Sternenzelt in der milden warmen Luft, das Klimpern der Gitarren im Ohr, in einer Hand ein Glas mit einem Getränk, das sich mit dem Nektar der Götter messen kann. Denn man befindet sich im Geburtsland des Sherrys. Er ist ein Wein, der wie die Frauen Spaniens Schönheit, Würde und Anmut in sich vereint. Er bezaubert das Auge, verführt die Nase, und sein Geschmack muss langsam genossen werden. Man rollt ihn um die Zunge. Man schließt die Augen und ergibt sich einem Erlebnis, das durch seinen physischen Zauber geradezu erotisch wirkt.
Man sollte wissen, dass der allerbeste Sherry aus Weinbeeren gewonnen wird, die auf kalkigem Boden wachsen. Die sandigeren Böden liefern einen geringeren Wein. Aber der wahrhaft große Fino, ah, er ist etwas derart Besonderes und Seltenes, dass die mit ihm gefüllten Flaschen so grimmig gehütet werden wie ein Nationalheiligtum und das Land nur selten verlassen. Bei meinem letzten Besuch gelang es mir jedoch, in Sanlúcar de Barrameda eine Flasche dieser einzigartigen Schöpfung zu ergattern. Ein Triumph!
Ich brachte ihn mit nach England und nach Chertsey, um ihn Tante Matilda zu schenken. Ich malte mir ihr Entzücken aus, den ausgezeichneten Eindruck, den meine Aufmerksamkeit hinterlassen würde. Ich erwog sogar die durchaus denkbare Möglichkeit, dass sie sofort ihren Anwalt verständigen mochte, um mich zum Alleinerben einzusetzen.
Ich fand sie in nachdenklicher Stimmung vor. Sie begrüßte mich mit weniger Freude als erhofft. Gleichgültig. Ich präsentierte ihr die Flasche seltenen Finos, zuversichtlich, dass er ihre Stimmung ändern würde.
»Hab Dank, Charles«, sagte sie. »Stell ihn einfach auf die Anrichte.«
Das war nicht die Reaktion, die ich erwartet oder erhofft hatte!
»Liebe Tante«, sagte ich, »kann es sein, dass dich etwas bedrückt? Fühlst du dich nicht wohl? Wenn das der Fall sein sollte, empfehle ich ein Glas des ausgezeichneten Fino, den ich dir gerade geschenkt habe. Er dürfte dich rasch aufmuntern.«
»Mich bedrückt allerdings etwas«, antwortete meine Tante. »Sieh dir doch einmal Oscar an, bitte. Sag mir, was du denkst.«
Unwillig richtete ich den Blick auf den Dackel, der neben meiner Tante auf dem Sofa saß. Ich starrte ihn an. Er starrte mich an. Ich verbarg meine Abneigung für ihn. Er verbarg weder seine Abneigung noch seine Verachtung.
»Er kommt mir vor wie immer«, sagte ich.
Ich sprach die Wahrheit. An ihm hatte sich nichts verbessert. Vielleicht war er ein bisschen dicker geworden, aber vermutlich war es besser, wenn ich nicht darauf einging.
Meine Tante seufzte. »Er ist nicht er selbst. Er ist wirklich recht unruhig. Ich habe den Tierarzt gerufen, damit er nach ihm sieht, aber er konnte nichts feststellen und war so taktlos, Oscars Alter zu erwähnen. Ich habe ihm sehr deutlich gesagt, dass ich keinen Grund sähe, weshalb das Alter ein Tier beeinträchtigen sollte, für das so gut gesorgt wird. Die Dienste dieses Mannes werde ich nicht wieder in Anspruch nehmen. Gleichzeitig fürchte ich, dass tatsächlich mit Oscar etwas nicht stimmt.«
Sie strich dem Tier über den Kopf. Oscar drehte die Augen zu ihr hoch.
»Er ist so klug«, gurrte meine Tante. »Er versteht jedes Wort, das wir sprechen.«
Zu entscheiden, wie ich darauf antworten sollte, war schwierig. Ich wagte nicht, denselben Fehler wie der Tierarzt zu begehen und Oscars Alter zu erwähnen, besonders, weil meine Tante ebenfalls nicht mehr die Jüngste war.
»Nun«, sagte ich, »weißt du, liebe Tante, wir alle erleben doch von Zeit zu Zeit kurze Phasen der Antriebslosigkeit und eines allgemeinen Gefühls, deprimiert zu sein. Das muss keine Erkrankung bedeuten. Eher rührt es von der Jahreszeit her; die kurzen Tage und langen Stunden der Dunkelheit im Winter sind ein Beispiel. Auch eine Woche mit schlechtem Wetter, das uns im Hause hält und die körperliche Ertüchtigung verhindert, kann ein Grund sein. Oscar benötigt nur ein wenig Ermutigung und vielleicht ein Tonikum, das auf Hunde abgestimmt ist. In kurzer Zeit wird er wieder auf dem Damm sein.«
Oscar bedachte mich mit einem Blick, den ich nur als sarkastisch bezeichnen konnte. Vielleicht verstand er nicht nur jedes Wort, das gesagt wurde, sondern auch viel von dem, was unausgesprochen blieb.
Meine Tante war sofort aufgemuntert. »Wie freundlich von dir, Charles«, sagte sie. »Danke für deinen Rat – oh, und danke für den Sherry. Wie lieb von dir, daran zu denken, wie sehr ich ihn mag.«
Sehr zufrieden verließ ich Chertsey.
In der folgenden Woche fuhr ich wieder dorthin. Ich stellte fest, dass meine Tante in weit besserer Stimmung war, geradezu fröhlich. Ich warf einen Blick auf die Anrichte. Die Flasche Fino war so gut wie leer. Nur noch ein Glas oder zwei waren übrig. Vor meinem inneren Auge klopfte ich mir auf die Schulter.
»Wie schön, dich wiederzusehen, Charles«, sagte Tante Matilda.
Es wurde immer besser.
»Ich freue mich, dass du erheblich fröhlicher wirkst als bei meinem letzten Besuch«, sagte ich. »Bedeutet das, dass sich Oscars Zustand verbessert hat?«
Ich sah den Hund an. Er hatte einen merkwürdigen Ausdruck in den Augen. Auch er vermittelte einen Eindruck von Milde, aber sein Blick wirkte etwas benebelt.
»Ach, es geht ihm so viel besser!«, rief meine Tante begeistert. »Und dafür habe ich dir zu danken, Charles.«
»Mir?« Ich war erstaunt.
»Aber ja. Ich habe deinen Ratschlag beherzigt.«
Ich zögerte. »Welchen Ratschlag meinst du denn genau, Tante?«
»Oscar ein Tonikum zu geben. Mehr war nicht erforderlich, damit er wieder der Alte wurde.« Sie wies auf die Anrichte. »Ich habe ihm einen oder zwei Tropfen von deinem Fino ins Futter gemischt. Das hat ihm richtig gutgetan. Er ist besser gelaunt, und er schläft tief und fest.«
Einen Augenblick oder auch zwei erschien es mir, als bliebe die Welt stehen. Ich konnte nicht fassen, was ich da hörte. Ich bildete es mir doch hoffentlich nur ein? Der Fino, den ich mit solchem Entzücken aus Spanien mitgebracht und Tante Matilda mit derart großen Hoffnungen geschenkt hatte … Er war einem Dackel vorgesetzt worden? Das war doch nicht möglich. Aber: Oh doch, das war es. Ich sah Oscar wieder an. Sein benebelter Blick, seine grundlose Milde … der Hund war betrunken!
In meinen Ohren brauste es. Mir schien der Kopf zu platzen. Sollte alles, was ich für wertvoll hielt und voller Hoffnung auserwählten Empfängern überreichte, derart verschmäht werden? Darwin hatte mein geliebtes Manuskript zur Seite gelegt und offen bezweifelt, ob es zu einer Veröffentlichung tauge. Diese dumme alte Frau hatte einen seltenen, großen Sherry behandelt, als wäre er ein Tonikum für Hunde. Lebten denn nur Philister auf dieser Welt?
Ich hörte mich mit zusammengebissenen Zähnen fragen: »Hast du irgendetwas davon selbst getrunken?«
Sie schüttelte den Kopf. »Ich habe ihn für den lieben Oskar aufgespart.«
Die Ungerechtigkeit all dessen war zu viel für mich: die Beleidigung meiner Person, meiner Arbeit und eines großartigen Tropfens, die Entwürdigung all meiner Anstrengungen …
Ich sah rot, stürmte zur Anrichte und ergriff die Flasche. Ich schüttete die Hälfte dessen, was darin übrig war, in ein Glas auf dem Tablett und trug es zu Tante Matilda.
»Trink!«, befahl ich.
Sie sah mich beunruhigt an. Ich musste recht aufgebracht wirken. Nun, ich war aufgebracht.
»Aber was ist mit Oscar …«, begann sie.
Ich gestattete ihr nicht auszureden und beugte mich über meine Tante. Am Kiefer packte ich sie und öffnete ihren Mund. »Trink!«, schrie ich sie an. Ich goss ihr das Glas Fino, alles auf einmal, zwischen die Lippen, während sie sich wehrte und keuchte, panisch protestierte.
Ich muss es ihm lassen, Oscar versuchte, seine Herrin zu verteidigen. Er sprang mich an, aber sein allgemeiner Mangel an Fitness, sein Gewicht und sein jüngster Sherry-Genuss wendeten sich gegen ihn. Er fiel vom Sofa und plumpste schwerfällig auf den Teppich, wo er liegen blieb und mich ohnmächtig anfunkelte.
Um zu verhindern, dass der Wein ihr wieder aus dem Mund lief, verschloss ich Tante Matilda mit beiden Händen die Lippen und wiederholte meinen Befehl, den Sherry zu schlucken.
Sie wehrte sich noch immer, und dann drang ein merkwürdiger Laut aus ihrer Kehle. Ihre Augen traten hervor. Sie krallte kraftlos nach meiner Hand.
Zu spät erkannte ich, dass sie keine Luft bekam. Ich riss die Hände weg und versuchte, sie wiederzubeleben, aber vergebens. Mit einem Mal lag sie still da, und ich wusste, dass sie tot war. Ihre Augen starrten schrecklich zu mir hoch, und kein Leben stand mehr in ihren.
Mir war klar, dass ich nicht den Kopf verlieren durfte. Ich ging zur Anrichte und goss die letzten Tropfen Sherry in ein sauberes Glas. Ich hob es an die Lippen und kostete ihn. Ah! Wenn auch nur flüchtig, wurde dieses Getränk endlich von jemandem genossen, der ihn zu schätzen wusste.
Oscar betrachtete mich die ganze Zeit und knurrte tief in der Kehle. Ich nahm mein Glas an den kleinen Tisch am Sofa und stellte es ab. Ich zerraufte mir das Haar und eilte in die Halle, wo ich nach der Zofe rief.
»Hilfe! Hilfe! Meiner Tante ist unwohl. Rufen Sie den Arzt!«
Der Arzt kam rasch, aber bei Weitem zu spät. Ich berichtete, meine Tante und ich hätten uns ein Gläschen von dem seltenen Fino gegönnt, den ich ihr bei meinem letzten Besuch geschenkt hatte, als sie plötzlich keine Luft mehr bekommen habe. Ich deutete auf mein Glas auf dem Tisch und Tante Matildas, das auf den Teppich gefallen war. Oscar schnüffelte genießerisch daran und versuchte, die verbliebenen Reste auszulecken.
Ich fürchtete, der Arzt könnte die roten Male am Kiefer meiner Tante bemerken, daher erwähnte ich zur Erklärung, dass ich versucht hätte, sie zu retten, indem ich ihr den Mund aufzwang, aber vergeblich. Ich raufte mir die Haare und die Kleidung. Ich schluchzte.
Der Arzt hatte Mitgefühl und klopfte mir auf den Arm. »Mein guter junger Mann, Sie sind verstört, aber geben Sie sich keine Schuld! Solche traurigen Vorfälle ereignen sich so schnell, dass nur wenig getan werden kann, wenn kein Mediziner dabei ist. Kein Laie hätte Ihre Tante retten können.«
Die Leichenschau befand auf Unfalltod. Nach der Trauerfeier versammelten sich meine Cousinen, ihre Gatten und ich beim Anwalt zur Verlesung des Testaments. Jeweils kümmerliche dreihundert Pfund hatte meine Tante jeder meiner Cousinen, mir und den beiden kleinen Matildas hinterlassen.
Dreihundert Pfund! Mehr nicht? Und mir, der den Familiennamen weitergab, dieselbe Summe wie den beiden Frauen und ihren grässlichen Töchtern? Selbst aus dem Grab heraus gelang es Tante Matilda, mich zu kränken.
Und was wurde aus dem großen Haus und Chertsey und dem Rest des Geldes? Man kann es kaum fassen. Meine Tante hatte eine Stiftung geschaffen, deren einziger Nutznießer Oscar war. Kurz gesagt war Oscar der Universalerbe. Die Stiftung schrieb vor, dass er weiterhin im Haus in Chertsey wohnen sollte. Die Köchin, die Zofe und der Gärtner sollten ihre Arbeit behalten, das Haus instandhalten und sich um den Hund kümmern. Erst wenn Oscar starb, sollte alles verkauft und der Erlös an diverse Tierschutzvereine verteilt werden.
Es lag im Interesse der Dienstboten, dass Oscar so lange lebte wie möglich, denn bis er starb, behielten sie ihre Pfründe. Trotz ihrer fleißigen Bemühungen verschied Oscar zwei Jahre später. Der Tierarzt, der den Kadaver untersuchte, stellte fest, dass er sehr alt gewesen sein musste, geradezu steinalt für Hundeverhältnisse.
Oscar war wohl ein Hund mit viel Glück gewesen. Aber womöglich hatte es am Ende doch an dem Tonikum aus einem seltenen Fino gelegen.
Optische Täuschung
1.
Der Froschmann saß allein da. Unbequem hockte er auf einem zerfallenden Baumstumpf, der einmal einen längst verschwundenen Steg gestützt hatte. Er trug weder Maske noch Schwimmflossen und hatte die Kopfhaube seines Taucheranzugs zurückgestreift. Das Gesicht hatte er in den Händen vergraben, und Hetty Farrell sah nur einen zerzausten braunen Haarschopf. Der Rest von ihm ließ an eine gestrandete Amphibie unbekannter Spezies denken.
Sie hatte gerade ihr Auto neben dem großen weißen Kastenwagen mit der Aufschrift Unterwasser-Suche und -Rettung geparkt, der hinter dem Rücken des Tauchers stand, verdeckt von einer Reihe überwucherter Bäume. Der Froschmann war allerdings kein offizieller Polizeitaucher, kein Teil des Teams, das im Kastenwagen angerückt war. Er war eindeutig ein Amateur und von der Arbeit ausgeschlossen, die am Seeufer vor sich ging.
Ich nehme an, dachte sie voll Mitgefühl, er ist der arme Kerl, der die Leiche gefunden hat.
Die hektische Betriebsamkeit ringsum stand in scharfem Kontrast zu seiner brütenden Gestalt. Ein Motorboot der Wasserpolizei, am Ende eines schmalen Stegs aus Holzlatten vertäut, schlingerte auf dem See, während Gestalten an Bord gingen und es verließen. Zwei uniformierte Beamte der Cumbria Constabulary, hinzugezogen, um Schaulustige auf Abstand zu halten, beantworteten gutmütig Fragen, während sie den Leuten den Zutritt zum Steg verwehrten. Die Meute aus Bootsfahrgästen, deren Ausflug sich unerwartet verschoben hatte, schwatzte, spekulierte und hantierte mit Fotoapparaten.
Am hinteren Ende der Menge stand auf einer natürlichen Erhebung des Geländes die hochgewachsene, dürre Gestalt von Bradley Wills und blickte majestätisch zum funkelnden Wasser des Sees. Sein herrischer Blick nahm sowohl die Aktivitäten des Suchtrupps als auch die steilen Hänge der Fells auf der anderen Seite von Coniston Water in sich auf. Mit seinem erhobenen Kinn und den hinter dem Rücken verschränkten Händen war er die personifizierte Unnahbarkeit.
Die aufgeregten Schaulustigen betrachteten ihn voll Ehrfurcht aus der Ferne und spekulierten wild, welchen Rang er einnahm. Einige hielten ihn optimistisch für den Polizeipräsidenten, manche vermuteten unter Verlust jeder Verhältnismäßigkeit sogar den Lord Lieutenant der Grafschaft in ihm. Andere lagen richtig und stuften ihn als einen Inspector ein.
Keiner von ihnen schenkte der schlanken, aber sportlichen jungen Frau in Cordjeans, festen Schuhen, dicken Socken und Pullover auch nur einen Blick, die auf sie zukam, während ihr der braune Bubikopf um die Ohren tanzte. Nur eine weitere Wandererin, dachten sie, wenn sie überhaupt etwas dachten.
Fast hatte sie Bradley Wills auf seinem Hügel erreicht und musste ein Grinsen unterdrücken. Unweigerlich gingen ihr Cowpers Zeilen durch den Kopf:
Ich bin Herrscher, so weit das Auge reicht,
Denn wer bestritte wohl mein Recht?
Dennoch war Hetty sich bewusst, dass der Inspector noch so sehr vorgeben konnte, die Menge nicht zu bemerken – er musste über sie extrem erbost sein. Bradley Wills war für seinen Mangel an Geduld bekannt. Im Augenblick fror er seine Verärgerung ein. Sein Panzer aus Gleichgültigkeit würde vermutlich ohne Warnung von irgendetwas durchstoßen werden, was das Maß vollmachte, und dann würde Wills’ Temperament sehr zum Missvergnügen aller Umstehenden hervorbrechen.
Hetty näherte sich der hoch aufragenden Gestalt mit einiger Vorsicht und räusperte sich respektvoll. »Guten Morgen, Sir.«
Der Inspector entspannte sich so weit, dass er den Kopf zu ihr neigte, ohne ihn allerdings in ihre Richtung zu drehen.
»Farrell«, sagte er, zur ganzen Welt, wie es schien.
»Jawohl, Sir. Ich bin so schnell gekommen, wie ich konnte. Irgendwelche Fortschritte?«
Wills nahm einen Arm vom Rücken und schaute auf eine große, teuer aussehende Armbanduhr. »Sie sind nun lange genug dort unten.«
Ein gereizter Unterton war seiner Stimme anzumerken. Im selben Moment, in dem er die Feststellung traf, besaß einer der Kamerabegeisterten die Unverschämtheit, ihn zu knipsen. Dass er nun zu irgendjemandes Urlaubserinnerungen an den Lake District gehörte, erwies sich als der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte.
Das Gesicht des Inspectors lief dunkelrot an. Die Muskeln um Mund und Kiefer zuckten alarmierend. Er hob einen Finger, deutete und brüllte: »Sagen Sie diesem erbärmlichen Kerl, er soll sofort damit aufhören! Ich beschlagnahme seine Kamera, wenn er noch ein einziges Foto aufnimmt, auch wenn es von seiner Frau und seinen Kindern ist!«
Der Fotograf stolperte erschrocken zurück und hätte dabei fast den Apparat fallen gelassen. Einer der Uniformierten näherte sich geschwind, doch der Fotograf hatte sich bereits getrollt, bevor der Beamte die Stelle erreichte, an der er gestanden hatte.