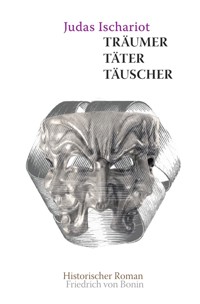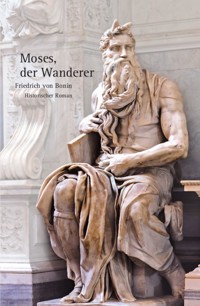
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Moses: Ein abenteuerliches Leben in grauer Vorzeit. Der Mann, nach dem die ersten drei Bücher des Alten Testamentes benannt sind. Eine Geschichte für Bibelforscher, seien es Christen, Juden oder Mohammedaner? Aber warum haben sich dann in der Neuzeit Geistesgrößen wie der Psychoanalytiker Sigmund Freud, der Ägyptologe Jan Assmann damit beschäftigt? Nach groben Schätzungen dreitausend Jahre nach dem Leben Moses, gesetzt, der hätte überhaupt je gelebt? Dies ist ein historischer Roman, der das Leben des geheimnisvollen Mannes nachzeichnet, lebensnah, als wäre es heute geschehen. Der unsere Fragen nach den zehn Plagen, die Gott gesandt haben soll, beantwortet. Der die erstaunliche Tatsache behandelt, dass Ramses, der damalige Pharao in Ägypten, einer der mächtigsten Männer seiner Zeit, sechshunderttausend bewaffnete Israeliten mit ihren Familien gegen seinen Willen aus Ägypten ausziehen ließ. (Wir erinnern uns der bebilderten Geschichten aus unserer Kinderbibel). Nach der Lektüre können wir auf die Idee kommen, dass die uralte Erzählung der Bibel von dem Manne Moses gewaltige Parabeln enthält, die uns noch heute bewegen: Von einem Manne, der mit seinem Leben hadert, weil von ungewisser Herkunft und ohne Perspektive. Von dem Mann, der in einer plötzlichen Vision eine Lebensaufgabe vor sich sieht, an der er wächst, durch die er sich selbst findet und die ihn zu Taten führt, die eigentlich weit über seine Kräfte gehen. Und von einem Volk, das unterdrückt wird, gequält und gefoltert, das sich aus einer jahrhundertelangen Knechtschaft befreit, seine Kraft entdeckt und durch diese Kraft zu einem erobernden Volk wird, das sich Land aneignet, in dem es sich niederlässt und unversehens und unter Missachtung seiner Vergangenheit die Ureinwohner seines neuen Staatsgebietes unterdrückt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 541
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Buch
Moses ist Feldherr und Ägypter, aber auch Abkömmling der unreinen und zerlumpten Hebräer. Er gilt heute als der Stifter der jüdischen und christlichen Religionen und doch weiß niemand, ob er je gelebt hat.
In diesem historischen Roman ersteht die Welt Moses in seiner Zeit, das Reich der Ägypter und die Parallelgesellschaft der Hebräer in Ägypten vor unsern Augen, wir erleben die Not des Volkes Israel und seine Flucht, seinen Hunger bei der Wanderung durch die Wüste und seine Tapferkeit. Und immer ist Moses bei ihm, groß, aufrecht, stark und innerlich von Zweifeln zerrissen. Ist er Abgesandter Gottes oder nur ein rechthaberischer, selbstgerechter Mann, der sich zum Führer des Volkes Israel aufschwingt?
Josua, Moses Nachfolger, erzählt dem jebusitischen Schreiber Abdi Hepa die Geschichte vom Auszug aus Ägypten, damit er sie aufschreibt.
Der Autor
Geboren 18.08.1946 aufgewachsen in Emlichheim, Grafschaft Bentheim, Niedersachsen. Gymnasium in Nordhorn, 1966 Abitur.
Studium der Rechtswissenschaft in Göttingen, 2. Juristische Staatsprüfung in Hamburg 1976.
Seit 1979 selbständiger Rechtsanwalt, seit 1983 auf Notar, in Bremerhaven.
Er lebt in Bremerhaven, ist verheiratet und hat keine Kinder.
Anfänge schriftstellerischer Tätigkeit etwa 2004.
Bisher sind von ihm erschienen:
„Rudolf Mittelbach hätte geschossen“ (2012)
„David, König der Israeliten“ (2012)
„Der Lauf der Zeit“ (2014)
Impressum:
©Copyright 2016: Friedrich von Bonin
Friedrich v. Bonin
Moses, der Wanderer
Von Sonn´ und Welten weiß ich nichts zu sagen,
ich sehe nur, wie sich die Menschen plagen
der kleine Gott der Welt ist stets vom gleichen Schlage
und ist so wunderlich als wie am ersten Tage
1.
Wer ist Gott? An dieser Frage reiben sich seit Jahrhunderten und Jahrtausenden die Menschen auf, in unserem Kulturkreis die Juden, die Christen und die Muslime. Ist er der Gott der Juden, Jahwe, ist er die dreieinige Gottheit, Gott, Christus und Heiliger Geist oder ist er Allah, den Mohammed beschrieben hat?
Oder findet sich Gott gar in den Religionen der fernöstlichen Religionen, ist er Buddha, männlich, Shiva, weiblich, mehrere Götter wie im Shinto oder noch weiter?
Ist Gott nicht einer und nicht viele, ist Gott nicht alles, in allem und über allem?
Ist Gott vielleicht im mittleren Westen der USA, in dem aufrechte und ehrfürchtige Bewohner hadern mit der modernen Welt, Menschen, die die Erkenntnisse der Physik, wissenschaftliche Erkenntnisse über die Entstehung der Arten aus dem Schulunterricht zu verbannen suchen, weil diese Weisheiten nicht denen ihrer Heiligen Schrift entsprechen?
Oder ist Gott vielleicht gar nicht? Ist er vielleicht untergegangen, hat aufgegeben angesichts der Gier des modernen Menschen der sogenannten westlichen Welt nach immer mehr Geld, Konsum oder Macht, nach Frauen und Luxus?
Oder hat er nie existiert, ist er die Erfindung von Menschen, die in namenloser Furcht vor dem Tode Schutz suchten in der Vorstellung von einer besseren Welt nach diesem Tode, in ihrer Angst vor den Schrecken des Lebens den Trost brauchten des Unterdrückten vor den Gewalten der Unterdrücker, die vor der Regellosigkeit des Lebens eine Regel, ein Gesetz suchten?
Fragen über Fragen, deren Antwort wir nicht kennen und auch nicht zu erfahren hoffen. Auf unserem Weg zur Formulierung dieser Fragen, nicht zu ihrer Beantwortung, stoßen wir auf eine Reihe von Überlieferungen, eine aufregender als die andere, Überlieferungen, die von Gründungen berichten, von Untergängen, von Brüchen, von Kriegen und Friedensschlüssen, einige banal, andere von dramatischer Bedeutsamkeit. Wir sahen Reiche wie das Perserreich, die griechischen Republiken, das Römerreich, das Heilige römische Reich deutscher Nation, aufsteigen und untergehen, wir sahen Nationen entstehen und vergehen.
Und wir fragten uns nach ihren Göttern, nach denen, die die Ideologie dieser Reiche bestimmten, nach den Religionen der Menschen und wo sie herkamen.
Auf diesen Reisen begegnete uns immer wieder ein uraltes Staatsgebilde, das sich über Jahrhunderte und Jahrtausende hielt, dessen Untergang wir sahen, nicht aber sein Entstehen, Ägypten. Als die jüdisch christliche Tradition begann, mit Abraham, Isaak und Jakob, waren die Pyramiden längst erbaut, in damals schon grauer Vorzeit, in die schon zu der Zeit niemand hinunterblicken konnte, keine Überlieferung gab es, nur verschwommene Nachrichten.
Und in diesem uralten Reich begegnet uns eine Gestalt, breit und hoch, schwarzbärtig, angestrengt, energisch und stotternd von Glauben, rechthaberisch und machtvoll: Moses. Moses, an den von den drei großen Religionen, die ihren Ursprung in jenem Stück Wüste zwischen Ägypten, dem Roten Meer, Sinai und Palästina haben, erinnert wird, Moses, der das Volk der Hebräer lehrte, es gebe nur einen Gott und die Götter der Ägypter seien sündhaft, ihre Lebensart verdammenswert. Damit brach er alle Traditionen der Religion, die bisher jede Art von Gottheit zu verehren gestattete, der erste Stifter einer Religion, in der ein eifersüchtiger Gott darauf achtete, dass es außer ihm keinen Gott gebe. Der erste?
Forscher haben auf ein seltsames Phänomen hingewiesen: Ob Moses je gelebt hat, ist unter Historikern äußerst umstritten, um nicht zu sagen, wird geleugnet. Ein anderer ist in Ägypten gewesen, dessen Existenz verbürgt ist und der ebenfalls gelehrt hat, es gebe nur einen Gott und die Verehrung aller anderen Gottheiten sei sträflich und verwerflich: Amenhotep der Vierte, ein Pharao in Ägypten, der sich selbst während seiner Herrschaft in „Echn´aton“ umbenannte und der weit vor der Zeit, in der das Leben Moses vermutet wird, gelebt hat. Echn´aton nahm ein schlimmes Schicksal, nicht nur, dass ihm nur relativ kurze Zeit zu herrschen vergönnt war, eine Zeit, in der es ihm trotz ihrer Kürze gelang, einen totalitären und repressiven Gottesstaat aufzubauen. Seine Erinnerung wurde auch noch von den ihm folgenden Pharaonen aus den Annalen getilgt, zu gefährlich war diese Lehre, als dass man sie in der Welt hätte lassen können. Er sei ein Ketzerkönig gewesen, dessen Nennung strafbar war, so strafbar, dass er tatsächlich für mehr als dreitausend Jahre vollkommen vergessen war, bis erste Kunde von ihm Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts entdeckt wurde.
Der eine, Echn´aton, geschichtlich verbürgt, vergessen, der andere, dessen historische Existenz höchst zweifelhaft ist, Moses, durchgängig bis in unsere Tage erinnert und verehrt. Wer war er also, dieser Moses, oder besser, wer war er nicht und an wen erinnern wir uns? Wir jedenfalls glauben an seine Geschichte, er gab seinen Zeitgenossen, den Hebräern, den einen Gott, und der gab ihnen das Gesetz. Wer also ist dieser Gott? Ist er Gott oder ist er das Gesetz? Wir wollen diesem Moses in seine Zeit folgen, wollen ihm hinterher spüren, um unseren Fragen näher zu kommen.
2.
Wir wollen es ganz zu Anfang bekennen: Wir erzählen die Geschichte Moses, weil wir von den Geschichten des Alten Testamentes nicht loskommen, Geschichten, die voller Leben sind, voller Abenteuer, Tod und Verdammnis, aber auch voller Liebe und unendlichem Glück. Es sind Geschichten, die das Alte Testament erzählt, es ist nicht Geschichte, die beschrieben wird. Wollten wir Geschichte schreiben, nicht Geschichten, ist sehr fraglich, ob wir uns der Person Moses überhaupt genähert hätten.
Geschichtsschreiber haben sich erbitterten Streit geliefert, zum Beispiel, ob die Religion des Einen Gottes, die über den Glauben der Juden, über das Christentum, oder über den Islam auf uns gekommen ist, ihren Ursprung in Ägypten hatte. Ja, sagen die einen, vor Moses hat der genannte Echn´aton als Pharao in Ägypten regiert und die Lehre von dem Einen Gott verbreitet, er war der erste.
Nein, antworteten die Zweiten, vor Echn´aton hat sich schon Abraham, dem Urvater unseres Glaubens, Jahwe offenbart, der eine, der der Alleinige Gott ist.
Aber, erwidern wieder die ersten, woher wollen wir denn wissen, ob Abraham je gelebt hat, ob er wirklich Gott gesucht und gefunden hat? Von Echn´aton wissen wir, er ist in den ägyptischen Schriften genannt. Von Abraham wissen wir nichts, nur das, was im Alten Testament steht.
Moses hat zur Zeit Ramses des Zweiten gelebt, sagen Geschichtsschreiber. Ramses der Zweite war einer der mächtigsten Pharaonen in der Geschichte Ägyptens überhaupt. Hätte der zugesehen, wie sechshunderttausend waffenfähige Männer aus Ägypten auszogen und vierzig Jahre vor seiner Nase im Sinai herumzogen? Niemals!
Hat Moses also vor oder nach Ramses gelebt? Hat Moses überhaupt gelebt? Mit diesen Fragen müssten wir uns beschäftigen, wenn wir Geschichte schreiben wollten, und tatsächlich hat es Versuche genug gegeben, Moses als geschichtliche Figur einzuordnen, mit mehr oder weniger Sachkenntnis, aber immer mit viel Spekulation, sowohl was die Personen, die Zeiten und die geographischen Verhältnisse angehen.
Wir lassen die geschichtlichen Fragen unangetastet. Wir werden die Rätsel, die um Moses ranken, nicht auflösen. Wir wollen einer Geschichte hinterherspüren, die wir uns spannender nicht ausdenken können, die aber in der Quelle, dem Alten Testament, an entscheidender Stelle für unseren Geschmack von zu großer Kürze ist, die Zusammenhänge nicht berührt, die uns an der Geschichte interessieren. An anderer Stelle ist die Quelle, vor allem, wenn es um Stammbäume geht oder um die einzelnen Gesetze, die Gott gab, von einer ausschweifenden Ausführlichkeit, die wenigstens uns manchmal langweilig erschien.
I Abdi-Hepa
1.
Eine grelle Sonne, blendend, aber nicht wärmend, stieg über die Berge im Osten, die vor Sonnenaufgang nur als schwarze weiche Linien in den dunklen Nachthimmel geragt hatten und fing an, sie zu färben, erst dunkelblau, dann in ein rötliches ocker um schließlich den lindgrünen Flaum zu belichten, den die langen und ausgiebigen Winterregen auf die Berghänge gezaubert hatten. Noch immer war der Winter nicht vorbei, im Schein der aufgehenden Sonne jagten sich im Westwind schwarze Wolken. Natürlich waren die Hirten froh über den Segen, den das Himmelswasser brachte, das die Weiden grün gefärbt und durch das die Herden reichlich Futter hatten.
Ich dagegen liebe die Wärme der Sommersonne, die Hitze meinetwegen, und leide unter dem Winter. Fröstelnd zog ich die Wolldecke fester, in die ich mich gehüllt hatte und beschleunigte meinen Schritt.
„Komm morgen zu Sonnenaufgang“, hatte mein Auftraggeber gesagt, „und sei pünktlich, ich hasse Unpünktlichkeit.“
Und so war ich genau zur festgesetzten Stunde am Ziel, denn hier, am Weg zu dem Pass Michmas, der in das Ephraim Gebirge führte, lag einsam am Berghang, das feste und große Haus des greisen Josua, des Propheten und Richters Israel, der mich gerufen hatte. Und dem Ruf Josuas gehorchte man, wenn man in diesen Zeiten in Kanaan lebte.
An der Südostseite des Hauses, auf einer Bank, sah ich die stille, zusammengesunkene Gestalt des Hausherrn, der unbeweglich sein Gesicht in die aufgehende Sonne hielt und mich nicht wahrzunehmen schien.
„Glaubst du an Jahwe, Hepa, und befolgst die Gesetze?“
Er hatte mich also doch gesehen, oder vielmehr gehört, denn es war allgemein bekannt, dass Josua seit Jahren vollkommen blind war, dass sich aber in dem Maße, wie sein Augenlicht abnahm, sein Gehörsinn schärfte. Er nannte mich bei meinem Kurznamen, eigentlich heiße ich Abdi-Hepa, das war aber den Israeliten von je her zu lang.
„Das sind gleich zwei Fragen, Herr“, antwortete ich bescheiden, „welche soll ich zuerst beantworten?“
„Du irrst dich, Hepa, es ist in Wirklichkeit nur eine Frage. Denn wenn du an Gott glaubst, befolgst du auch seine Gesetze, oder du wärest dumm, was ich nicht glaube. Befolgst du aber die Gesetze Jahwes, bist du gläubig, warum sonst solltest du sonst seine Gesetze befolgen? Merke: Gott und die Gesetze sind eins, Moses, unser Prophet, hat uns aus dem ägyptischen Diensthaus geführt und uns den Gott unserer Väter zurückgebracht und mit ihm seine Gesetze. Sie stammen von Gott, Moses hat sie uns nur gebracht, damit wir, das Volk Israel, sie befolgen und ihr mit uns. Denn wenn wir seine Gesetze nicht achten, straft der Herr das ganze Volk.“
Ich schwieg. Was hätte ich antworten sollen? Etwa, dass ich, Hepa, aus dem Dorf Jerusalem keineswegs zu seinem Volk gehöre? Oder dass der Jahwe des Volkes Israel keineswegs auch mein Gott war oder unser Gott? Dass ich Jebusiter sei, Angehöriger eines Volkes, das seit Menschenaltern in Kanaan wohnte und das von den eindringenden Israeliten erst besiegt und dann unterdrückt worden sei? Nein, dergleichen antwortete man nicht, wenn man Jebusiter war und dem mächtigen, wenn auch uralten Josua gegenüberstand.
Josua hatte mich rufen lassen und gefragt, ob ich bereit und in der Lage sei, die Geschichte, die er zu erzählen habe, die Geschichte von Moses Leben und dem Auszug seines Volkes aus Ägypten, anzuhören und aufzuschreiben. Er wusste, dass ich ein Geschichtsschreiber war, mein Ruf ist, ohne falsche Bescheidenheit gesprochen, in ganz Kanaan und darüber hinaus bekannt. Ich habe in Ägypten bei den bedeutendsten Lehrern studiert, Geschichte, Astronomie, Gottesgelehrsamkeit und die Kunst des Schreibens und Lesens und bin dann aus Ägypten, wo ich die Priesterschulen in Theben, in On und in Memphis besucht habe, nach Kanaan zurückgekehrt. Das Leben eines Privatgelehrten in Kanaan erschien mir erstrebenswert, ich hatte mich auf eine angesehene Stellung unter den Jebusitern gefreut. Aber niemand wollte oder konnte mit meinen Künsten etwas anfangen, niemand war bereit, mir eine Stellung zu geben, mit deren Erträgen ich meinen Lebensunterhalt fristen konnte, und so schlug ich mich mit einzelnen Schreibaufgaben durch das Leben. Ernähren konnte ich mich durch diese Arbeiten nicht, ich würde verhungern, könnte ich nicht meine Einnahmen durch Hirtentätigkeit aufbessern.
Das Leben war nicht einfach für uns nach der Ankunft dieser Israeliten, die aus dem Osten kamen vor etwa einem Menschenalter. Ich war ein Kind damals, meine Eltern lebten ein friedliches Leben in dem kleinen Dorf Jerusalem, mein Vater war der Oberpriester der Göttin Astarte und lebte von den Opfergaben, die die Menschen in der Umgebung ihm und seiner Familie gerne brachten dafür, dass er um Fruchtbarkeit flehte, und, wie ich mit Stolz bemerke, nicht vergebens flehte. Die Bauern in unserer Gegend waren mit reichlichen Oliven-, Orangen- und Weinernten gesegnet und zeigten freigebig ihre Dankbarkeit gegen die Göttin. Das ging gut, bis die Israeliten kamen und mit mehreren großen Schlachten, einer bei Jericho und einer hier im Ephraim Gebirge, nicht nur uns Jebusiter, sondern auch die Kanaaniter, die Amalekiter und andere Völkerschaften besiegten und sich zu Herren des Landes aufwarfen. Sie waren Nomaden, aber sie hielten fest zusammen wie ein Volk und vor allem, sie verehrten einen Gott, Jahwe. Wer mit ihnen, die die Herren des Landes waren, zu tun haben wollte, musste diesen Jahwe verehren, allen andere Göttern abschwören und ihre Gesetze einhalten.
Gebote, die einzuhalten teilweise einfach war. Wer würde nicht akzeptieren, dass das Erschlagen anderer Menschen verboten sei? Wer nicht, dass man seine Eltern ehren soll? Aber dass wir nur einen, nämlich ihren Gott verehren sollten, dass wir uns mit Frauen, die uns gefielen, nicht einfach vereinigen durften, dass sogar Frauen sich nicht Männer auswählen durften, das war nicht nachvollziehbar.
Und doch, was sollte ich tun? Ich bekannte mich zu ihrem Gott Jahwe, ich gab vor, ihre Gesetze heilig zu halten, und heimlich opferte ich weiter unseren Göttern, wenn mir eine Frau gefiel, fragte sich sie, ob ich ihr auch gefiele. Wenn sie zustimmte, liebten wir uns, ohne dass ich diese Abenteuer etwa den Israeliten oder ihren Priestern erzählte. So galt ich bei den israelitischen Besatzern und ihrem obersten Propheten, Josua, als frommer Mann und so war Josua auf mich verfallen, als er seine Geschichte aufgeschrieben haben wollte.
Geizig war er. Ich forderte fünf Schekel für die Arbeit einer Woche. Allein vier Tage feilschten wir um diesen Preis, er bot zuerst nur einen Schekel und nach vier Tagen einigten wir uns auf drei Schekel.
„Aber dann ist das Papyrus im Preis inbegriffen“, forderte er mit seiner vor Alter knarrenden, befehlsgewohnten Stimme.
„Großer Prophet“, antwortete ich, „kennst du die Preise von Papyrus? Wenn das Material in den drei Schekeln enthalten sein soll, zahle ich noch aus eigenen Mitteln dazu, denn das Papyrus kostet sicher mehr als diese drei Schekel, und meine Mittel sind knapp.“
Und das Feilschen begann von vorn, nach weiteren zwei Tagen hatte ich mich auf zweieinhalb Schekel herunterhandeln lassen, aber er bezahlte Papyrus, Feder und Tinte.
Heute nun sollte die Arbeit beginnen, heute bei Sonnenaufgang und hier war ich.
2.
„Es ist eine eigenartige Geschichte um Moses, er war einer der gottestreuesten Menschen, die ich gekannt habe“, sagte Josua nachdenklich und sah mit seinen blinden Augen auf die Berge, die nun in sattem Grün strahlten. Die Regenwolken hatten sich vorerst verzogen, aber es wehte immer noch ein kühler Westwind, so dass wir uns beide fester in unsere Umhänge wickelten, „so gottestreu wie er war, hat Jahwe ihm doch nicht gestattet, die Früchte seiner Arbeit zu sehen und ihn zu seinen Vätern versammelt, ohne dass er je nach Kanaan kommen durfte. Ich durfte sein Werk vollenden.“ Er schwieg.
Ich saß neben ihm und verfolgte, wie die Sonne am Himmel immer höher stieg, wie sie trotz der Jahreszeit zu wärmen anfing und legte nach einiger Zeit meinen Wollumhang ab. Josua schien sich dagegen noch fester zu umwickeln. Ich nahm ein leichtes Frösteln an ihm wahr.
„Das Alter zieht mir die Wärme aus dem Körper“, murmelte er, „Jahwe, du tätest vielleicht besser daran, mich auch sterben zu lassen. Das Leben weicht mit der Wärme aus mir.“
Wieder schwieg er.
Ich fing an, mir Sorgen zu machen. Er begann nicht mit der Erzählung, die ich aufschreiben sollte. Wollte er nicht oder war sein Geist nicht mehr bei ihm? Vorsichtig wollte ich ihn auf die Spur bringen.
„Warst du von Anfang an dabei?“, fragte ich leise.
„Wo ist Gott?“, begann er, als hätte er mich nicht gehört, „er war bei mir, als ich Moses aus der Gefangenschaft in Pitom befreite, als ich mit ihm nach Theben ging. Zum letzten Male hörte ich ihn, als wir Jericho eroberten, auf diese kuriose und unmögliche Art. Direkt in meinem Kopf war er, wie auch vorher schon. Ich solle Kundschafter nach Jericho schicken, wies er mich an.
Wir standen, unser dreißigtausend, davon fünftausend meiner Krieger, die ich gut ausgebildet hatte, am anderen Jordanufer und sahen auf das gelobte Land und auf die erste Stadt in diesem Land, Jericho. Eine Stadt war das, von starken Mauern umgeben, und die Mauern, wir konnten das von der anderen Seite des Flusses sehen, mit starken Kräften besetzt. Während des ganzen Marsches unseres Volkes habe ich immer darauf geachtet, meine Armee zu vergrößern. Hatte ich beim Auszug aus Ägypten noch kümmerliche tausend Mann unter meinem Kommando, die auch noch gar nicht oder schlecht bewaffnet waren, so war meine Armee auf fünftausend Mann angestiegen, als wir Jericho sahen, alle gut bewaffnet und ausgebildet. Ich war immer der Macher gewesen unter Moses Führung und so wollte ich auch, als Moses gestorben war, Jericho mit meiner Armee erobern. Stürmen, war die Devise, die Mauern erstürmen und die Stadt einnehmen. Das würde schwer werden, das war mir klar, wir hatten keinerlei Belagerungswerkzeug, mit dem wir den Mauern etwas anhaben konnten.
Aber Jahwe verbot das Stürmen. Drei Kundschafter solle ich in die Stadt schicken, die von ihm, Jahwe, künden sollten und die Behörden auffordern, uns einzulassen. Ich schüttelte zwar insgeheim den Kopf, aber wer war ich, Jahwe zu widersprechen, also schickte ich die Kundschafter.
Mit Schimpf und Schande seien sie aus der Stadt getrieben worden, mit Hohngelächter, berichteten sie, kaum dass sie ihr Leben retten und flüchten konnten und hier seien sie nun.
Gut, so Jahwe in meinem Kopf, dann sammle mein Volk Israel, alles, was gehen kann, die ganzen dreißigtausend Menschen, mit all ihrem Hab und Gut und setze auf die andere Jordanseite.“
„Aber dann ist doch das ganze Volk gefährdet, wenn sie einen Ausfall machen und die Menschen angreifen, die nicht kämpfen können“, wandte ich in meinem Kopf ein. Das bekam mir aber nicht gut.
„Setze mein Volk über“, kam die knappe Anweisung, ein Befehl, nicht etwas, was man diskutieren konnte.
Also setzte ich über den Jordan, eine schwierige Arbeit, alle Menschen, alles Vieh, ihr Hab und Gut, alles über den Strom, der glücklicherweise zu der Zeit nicht tief und reißend war, wie er es manchmal im Winter ist. Das dauerte fast zwei Tage und unablässig mussten wir den Spott der Kanaaniter aus Jericho ertragen.
„Nun ziehe um die Stadt, mit allem, mein ganzes Volk umkreise die Stadt, dreimal, ganz herum.“
Ich wagte nicht mehr, Jahwe zu widersprechen, zu klar waren seine Anweisungen. Also umkreiste ich dreimal die Stadt, wieder mit Sack und Pack und allen Menschen und allem Vieh. Von den Mauern sahen sie auf uns herab, die Einwohner, und höhnten, ob wir meinten, so die Stadt erobern zu können, sie warfen nicht einmal brennendes Pech auf uns, wir waren es ihnen wohl nicht wert. Nach diesem Marsch errichteten wir unser Lager am Ufer des Jordan und ich erwartete, nun den Befehl zum Sturm zu erhalten. Nein! Wieder sollten wir am nächsten Tag die Stadt umrunden, wieder dreimal! Ich kam mir vor wie ein kleines Kind, aber seltsamerweise murrte das Volk Israel nicht, es schien die Anordnungen Jahwes besser zu verstehen als ich.
„Und nun lasse alles Vieh, alles Hab und Gut im Lager zurück“, befahl Jahwe am dritten Tag. „Nur die Menschen lass die Stadt umkreisen, und deine Männer sollen ihre volle Bewaffnung tragen und die Hörner der Widder, die ihr mit euch führt für Signale, sollen sie während des ganzen Marsches um die Stadt mit voller Kraft blasen.“
Da lachten sie nicht mehr, die Einwohner, als sie die Menschen sahen, meine Krieger und das Volk und als sie die Hörner hörten, da gefror ihnen das Blut in den Adern und es war, als stürzten die Mauern von Jericho ein, so schnell öffneten sie die Tore, als wir die Stadt einmal umrundet hatten.“
„Mein Herr und Prophet Josua, soll ich das alles mitschreiben? Ist es nicht besser, von vorne zu beginnen?“, fragte ich noch einmal vorsichtig.
Wieder war es, als hätte ich nichts gesagt.
„Danach hat er nicht mehr mit mir gesprochen, es war das letzte Mal. Und dabei begann doch jetzt erst die schwere Zeit, wir mussten das Land erobern, das Jahwe uns versprochen hatte.“
Auch hier ersparte ich mir den Kommentar. Ich hatte die Geschichten von den Hebräern gehört, die aus Ägypten abgezogen waren, ein zerlumpter Haufe ungesunder Menschen, unterdrückt von den Ägyptern und rechtlos.
Was hier in Kanaan nach langer Zeit ankam, das war ein diszipliniertes, gesundes und kräftiges Nomadenvolk, voller Glauben an seinen Gott und voller Eroberungslust. Man hätte meinen können, die Hebräer hätten Erinnerungen gehabt an die Zeit, als sie selbst unterdrückt waren und hätten die geschont, die in dem Land lebten, in das sie einfielen. Aber weit gefehlt! Als sie uns besiegt hatten, stellten sie uns vor die Wahl, uns ihrem Gott anzuschließen oder das Land zu verlassen. Aber auch uns, die wir uns zu ihrem Gott bekannten, betrachteten sie als Menschen zweiter Klasse. Ein Israelit von Geburt zu sein, von dem Volk Abrahams, das betrachten sie als eine Art Adel.
Aber auch diese Gedanken durfte ich ihrem obersten Propheten nicht sagen.
„Wann beginnen wir denn mit den Aufzeichnungen, großer Prophet?“, fragte ich zum dritten Mal und diesmal hörte er mich.
„Richtig, die Aufzeichnungen. Hepa, hast du Feder, Tinte und Papyrus mitgebracht, dann beginnen wir jetzt.“
„Hier habe ich alles“, und ich deutete auf meinen Leinensack, in dem ich mein Schreibwerkzeug untergebracht hatte, „wie möchtest du die Geschichte aufgeschrieben haben, o Josua, willst du selbst als Erzähler genannt werden, so dass wir in der Ichform schreiben oder soll ich auch von dir als einer fremden Person schreiben?“
„Natürlich schreibst du so, dass nicht ich das alles erzähle, sondern als ob ein Fremder schreibt.“
„Wenn du beginnst, werde ich Stichworte schreiben und am Abend eine Reinschrift fertigen, die ich dir am nächsten Morgen vorlese, findet das deine Billigung?“
„Mach es so, wie du meinst, Hepa“, er zeigte sogar die Andeutung eines Lächelns, „aber du brauchst es mir nicht jeden Tag vorzulesen, das dauert zu lange und dein Honorar wird unendlich sein.“
„Gut, Herr, willst du dann beginnen?“
Josua begann nachdenklich, mit langsamer Stimme, zu erzählen:
II. Die Suche
1.
Moses hatte sich vor der Hitze des Tages in das Schilfhaus zurückgezogen, das für ihn am Heck des Schiffes aufgebaut worden war. Dort saß er, kühlte sich den Kopf mit Wasser, das ihm ein Diener von Zeit zu Zeit aus dem Nil brachte. Nicht, dass das Wasser kalt war. Jetzt, im Hochsommer, war auch der Nil warm, fast zu warm, um darin zu schwimmen, selbst wenn er das gewollt hätte. Aber wenn er ein Tuch in das Wasser tauchte, kühlte es, um den Kopf gewunden, einige Zeit. So saß er in dem Schilfhaus, hörte den monotonen und rhythmischen Gesang der Ruderer, die das Schiff gegen den Wind, aber mit dem Strom nach Norden trieben, dem Delta zu.
Langsam passierten sie die Dörfer, die längs des Flusses wie Perlen aufgereiht lagen. Jetzt, um die Mittagszeit, wirkten sie wie ausgestorben, kein neugieriges Kind schaute ihnen zu, wie sie den Nil entlang fuhren, nicht einmal ein Hund oder eine Katze war auf den Wegen zu sehen. Einzig die Palmen, die am Ufer standen, regten ihre Wedel ganz leicht in dem leisen Nordwind, und erzeugten zusammen mit den Papyrusstauden, die in Feldern am Ufer standen, ein leise raschelndes und klatschendes Geräusch. Allerlei schwimmende Fahrzeuge fuhren mit ihnen, in die gleiche Richtung, langsamer als die „Barke des Südens“, so hieß das Schiff, das Moses trug. Sie transportierten, anders als die „Barke des Südens“, Lasten in den Norden, vor allem Baumaterialien, die Pharao im Delta des Flusses benötigte, um seine neue Stadt zu erbauen, andere kamen ihnen entgegen, teils Lasten tragend, Waren, die für den Süden bestimmt waren, teils Passagiere befördernd, die ebenfalls in Schilfhütten versorgt waren und sich neugierig nach der „Barke des Südens“, die als Königsschiff gekennzeichnet war, umsahen.
Sie fuhren nur Moses wegen nach Norden. Er war ein junger Mann, kaum fünfzehn, nach Art der vornehmen Ägypter in weißes sehr dünnes, kühlendes Leinen gekleidet, ein Schurz um die Hüften und ein Tuch um die Brust geworfen, die linke Schulter frei lassend. Für seine jungen Jahre war Moses groß, kräftig gebaut, mit großen Händen, breiten Handgelenken und starken Oberarmen und Beinen. Seine Haut war deutlich heller als die Haut der Schiffsbesatzung, die dunkelbraun war, die Moses war bronzefarben, noch weich, mit schwarzen Haaren bewachsen. Moses Gesicht war noch unfertig, das Gesicht eines jungen Mannes, mit schwarzem Schatten an Kinn und Wangen, der von dem starken Bartwuchs herrührte, der Moses von allen vornehmen Ägyptern unterschied, die bartlos waren. Moses säuberte sich morgens und abends von dem Bart. Seine Augen waren schwarz, energisch, er konnte diese Augen konzentrieren, auf einen Punkt, so dass sie zwingend wirkten. Über den Augen wuchsen schwarze Brauen, in der Mitte über der Nase sich treffend, kaum gebogen, die seinem Gesicht einen finsteren Eindruck verliehen. Die Nase war gerade, kräftig, fleischig und der Mund unter der etwas zu langen Oberlippe schön geschwungen, voll. Sein Kinn war stark ausgebildet, in der Mitte durch ein Grübchen gutmütig geteilt, was einen seltsamen Gegensatz zu den finsteren Brauen schaffte.
Eben jetzt überwog der finstere Ausdruck des Gesichtes, zumal Moses die Stirn in Gedanken zusammengezogen hatte und eine steile senkrechte Falte über der Nase bildete. Moses hatte keinen Blick für die Umgebung und kein Gehör für die Geräusche der Ruderer und das Wasser des Nils, das um das Schiff spülte. Er war von der Schule geflohen. Wieder einmal hatten ihn die Kameraden geärgert, mit seiner hellen Haut, seinem starken Bartwuchs und der Frage, ob er denn wisse, wer seine Mutter sei, eine Prinzessin, die es mit einem Hebräer getrieben habe. Vor allem Chamat, der Sohn des königlichen Wesirs des Südens und eines Einzigen Freundes des Königs, hatte ihn beim Schwertkampf zum Wahnsinn getrieben.
„Hier, der Hieb ist für die Prinzessin, der ist für den Hebräer und der ist für alle, die nicht wissen, woher sie kommen“, und hatte Moses mit seinen Streichen durch den Übungsraum getrieben. Das Schlimmste dabei war, dass Moses ihn mit einem Hieb zur Ruhe hätte bringen können, Chamat war ihm im Schwertkampf nicht annähernd gewachsen. Aber sein Erzieher hatte ihn gemahnt, einmal, immer wieder. „Sei vorsichtig mit dem Sohn des Wesirs, sein Vater ist mächtig, du bist zwar stärker als er und auch geschickter, aber er ist mächtiger.“ Und so hatte Moses die Streiche und die Sprüche des anderen ertragen, hatte auch das Gelächter der anderen, die mit Chamat sympathisierten, ausgehalten. Aber dass sein Freund Setaou, der Sohn eines Palastbeamten, mit den anderen gelacht und sich über ihn lustig gemacht hatte, hatte ihn erbost und traurig gleichzeitig gestimmt. Warum konnte nicht wenigstens Setaou zu ihm halten, wenn schon die anderen ihn verachteten?
Moses war nach der Stunde zu seinem Erzieher gelaufen.
„Was ist es nur, was sie an mir stört? Kann ich nicht mindestens genauso gut lesen wie sie, bin ich ihnen nicht im Schwertkampf sogar überlegen?“ hatte er gefragt.
„Moses, mein Kind“, Acha, der Lehrer, sah ihn mitleidig an, „deine Altersgenossen stören sich an allem, was anders ist. Sie haben noch nicht gelernt, dass Andersartigkeit das Leben bereichert, es macht ihnen Angst. Und du, lass es mich dir sagen, machst ihnen Angst. Niemand weiß genau, wer deine Mutter und wer dein Vater ist. Chamat kennt Mutter und Vater, Setaou auch, du nicht. Alle wissen nur, dass deine Mutter wahrscheinlich die Tochter Pharaos ist, deshalb müssen sie dich in der Schule und als Kameraden achten. Wer dein Vater ist, ist vollständig unbekannt, er wird, so glauben alle, ein Hebräer gewesen sein. Du weißt, wer Hebräer sind?“
Moses nickte. Acha hatte ihnen erzählt von dem Volk, das oben im Norden, in Gosen, lebte, in Armut und Schmutz, zu nichts nutze, als für Pharao auf den Baustellen zu arbeiten. Moses hatte, als er zum ersten Male davon erfuhr, sein Vater sei wohl ein Hebräer, nach solchen Hebräern gesucht. Hier unten im Süden, in Theben, war das nicht ganz einfach, aber Acha hatte ihm erzählt, dass am Fluss, da, wo die Dämme errichtet und erhöht wurden, Hebräer arbeiteten. Moses hatte sich hingeschlichen. Er hatte sie von ferne gesehen und beobachtet, wie sie arbeiteten, in Lumpen gehüllt, fast nackt, ausgemergelte schmutzstarrende Männer, die unter den Peitschenhieben der ägyptischen Aufseher litten und Dämme aufwarfen, die die Stadt vor dem Fluss schützen sollte, wenn er über die Ufer trat. Moses hatte es vor Ekel geschüttelt. Und einer von denen sollte sein Vater sein? Hilflos war er zu Acha zurückgekehrt. „Ich kann nicht glauben, dass ich zu diesem Volk gehöre.“
Aber seitdem hatten ihn die Hänseleien seiner Kameraden noch mehr, tiefer getroffen. Wie sehnlich hatte er gewünscht, eine makellose Abstammung zu haben wie Chamat oder auch nur sein Freund Setaou. Ihm hätte es schon gereicht, der Sohn eines einfachen Palastbeamten zu sein, aber nein, seine Abstammung war höchst zweifelhaft, verwerflich sogar. Und er musste wehrlos die Verachtung der anderen ertragen.
Vor zwei Wochen war er zu Acha gegangen. „Ich will nach Norden reisen, zu dem Volk der Hebräer. Thermutis, die Tochter Pharaos, hat mir Namen genannt. Ich sei als Kind von einer hebräischen Amme, die Jochebed hieß, gesäugt worden, die mit ihrem Mann Amram damals hier in Theben gelebt und gearbeitet haben. Ich will in das Delta reisen, zu der neuen Stadt Pharaos, Pitom, die dort gebaut wird, und sehen, ob ich da mehr über meine Herkunft erfahren kann.“
„Du wirst tun, was du willst, Moses“, Acha kannte seinen Schüler und seine Sturheit, „aber findest du es wirklich klug, diese Dinge nicht auf sich beruhen zu lassen? Was willst du denn wissen? Stell dir vor, wie dein Leben weitergehen wird, wenn du wirklich ein Hebräer bist. Du wirst kaum hier am Hofe bleiben können, sondern dann bei ihnen leben müssen, einer von ihnen, ebenso unkultiviert, schmutzig und zur körperlichen Arbeit verdammt wie sie.“
Aber Acha kannte Moses. Wenn der sich einmal etwas in den Kopf gesetzt hatte, setzte er das durch. Und so war Moses zu Thermutis gegangen, die er „Tante“ nannte und die er bat, bei Pharao die Genehmigung zu dieser Reise durchzusetzen. Thermutis konnte Moses nichts abschlagen, das wusste er aus Erfahrung und tatsächlich war eine Woche später der Bescheid gekommen, Moses werde mit der „Barke des Südens“ nach Norden fahren, um auf Befehl des Königs die Baustellen in Pharaos neuer Stadt Pitom zu inspizieren.
Und so saß er hier auf dem Schiff, finster grübelnd, warum die königliche Familie, wenn er denn von ihr abstammte, sich nur halbherzig zu ihm bekannte, oder, wenn er Hebräer war, ihn so bevorzugt behandelte. Langsam schüttelte Moses den Kopf, um sich von diesen Gedanken zu befreien.
Die Barke war immer weiter nach Norden gefahren, hatte Dorf um Dorf passiert. Jetzt, am späten Nachmittag, wurde es merklich kühler, der Nordwind frischte auf und fächelte leicht in die Schilfhütte. Moses schüttelte alle Gedanken ab und beschloss, trotz allem die Reise zu genießen. Zur Linken stand die Sonne tief am Himmel, ihre Strahlen sengten nicht mehr.
Gegen die Sonne konnte Moses riesige dreieckige Gebäude sehen, die Pyramiden, uralte Zeugen einer Vergangenheit, die so weit zurück lag, dass niemand auch nur ansatzweise ermessen konnte, wie alt sie waren. Nach diesen Mustern ließ die königliche Familie ihre Gräber im Westen von Theben errichten, ebenfalls von riesigen Ausmaßen, damit sie einst, nach ihrem Tode, darin wohnen konnten. So jung Moses war, konnte er doch scharfsichtig hinter den Gebäuden die Angst der Menschen vor dem Tode erkennen und die Hoffnung, nach ihrem Tode weiter leben zu können. Jetzt schob sich die größte der Pyramiden langsam vor den glutroten Sonnenball, mit ihm eine geheimnisvolle geometrische Figur bildend und sich wieder trennend. Die Sonnenscheibe reiste mit ihnen, die Pyramide blieb dahinter zurück.
„Wir müssen bald zur Nacht einen Platz am Ufer suchen, Herr“, meldete sich der Schiffsführer, „da vorne, nur wenig flussabwärts gibt es ein kleines Dorf, mit einer Anlegestelle, in dem wir übernachten und unsere Vorräte auffüllen können. Befiehlst du, anzulegen?“
Und Moses, der von der Führung eines Schiffes nichts verstand, der nur wusste, es sei lebensgefährlich, des Nachts auf dem Fluss weiter zu reisen, stimmte zu, obwohl er ungeduldig war, sein Ziel zu erreichen. Langsam ruderten die Männer das Schiff auf einen kleinen Holzsteg zu, auf dem neugierige Dorfbewohner dem Manöver zusahen und an dem die Barke jetzt mit einem kleinen Stoß anstieß, Leinen wurden an Land geworfen und von den Zuschauern fest gemacht, Dorfhunde bellten das fremde Schiff und die Männer an, die jetzt, wo das Schiff still lag, an Land sprangen. Der Schiffsführer verhandelte schon mit einem einfach gekleideten Ägypter, offenbar ein Händler aus dem Dorf, über den Kauf von Vorräten, Wein, Früchte und Fleisch.
Langsam erhob sich Moses in seiner Schilfhütte, streckte die zu lange ruhig gewesenen Glieder und ging langsam und würdevoll, wie es seiner Stellung entsprach, an die Reling und sprang ebenfalls an Land.
„Im Namen Pharaos“, sprach er den Kaufmann an, „ich werde diesen Ort inspizieren. Wo ist der Vorsteher?“
„Ich bin es selbst, Herr“, antwortete der Ägypter, „du bist willkommen hier, nimm was du brauchst, was wir haben, ist dein.“
„Ich werde dir zwei Mann Eskorte mitgeben“, bot der Schiffsführer an und rief zum Schiff hinüber „Ahmad und Ej, begleitet den Herrn.“
Zwei der Ruderer sprangen vom Schiff und gingen mit zwei Schritten Abstand hinter Moses her, der langsam auf die Siedlung zuschritt, gefolgt von bellenden Hunden und einer Kinderschar, die laut diese aufregenden Ereignisse kommentierten.
Moses ging auf einem sorgfältig geharkten Sandweg zu der Ansammlung von kleinen Häusern, die von einem hohen Damm umgeben waren und ihrerseits auf kleinen aufgeworfenen Hügeln erbaut waren. Nur ein Gebäude ragte in seiner Größe über die anderen hinweg, Moses erriet, das war der Besitz des Dorfvorstehers und Kaufmannes. Am Wegesrand saßen Frauen und plauderten in der Abendsonne, Männer waren nicht zu sehen, Moses vermutete, dass sie jetzt auf den Feldern arbeiteten. Die Überschwemmung des Nils stand unmittelbar bevor, die Priester hatten reiches Wasser versprochen, das Segen brachte, aber eben auch die Gefahr, dass die Häuser überschwemmt wurden. Dämme und Hügel wurden daher regelmäßig vor der Flut ausgebessert und erhöht.
Moses wurde freundlich begrüßt, niemand störte sich hier an seiner hellen Haut, keiner wusste über seine zweifelhafte Herkunft. Leutselig grüßte er zurück, stellte sich wohl auch einmal neben eine Gruppe von plaudernden Frauen, die die Ereignisse des Tages besprachen und was es heute Abend zu essen geben würde. Sie wirkten zufrieden, fragten ihn nach dem woher und wohin, überall hatte sich herumgesprochen, eine Barke des Königs habe angelegt, alle waren neugierig, was der Abgesandte des Königs hier wohl wollte. Moses fiel auf, dass sie nicht unterwürfig waren, sondern freundlich, aufgeschlossen und frei mit ihm redeten. „Wer so in einem kleinen Dorf leben könnte, mit sich selbst im Reinen, klare Vergangenheit, klare Gegenwart und klare Zukunft“, schoss es ihm durch den Kopf, aber dann schüttelte er sich, lächelte und wusste, dass er für dieses Leben verdorben war, er hatte den Reichtum an Pharaos Hof kennen gelernt. „Lieber an Pharaos Hof mit zweifelhafter Herkunft leben als in diesem Dorf der Vorsteher sein“, dachte er und schritt langsam und nachdenklich zurück zum Schiff, wo er sich nach einem leichten Mahl schlafen legte.
Am nächsten Morgen setzte die Barke, reichlich mit neuen Vorräten beladen, die gemächliche Reise fort, Moses war nun an die tägliche Routine gewöhnt, morgens ging er in der Morgenbrise auf dem Deck auf und ab, genoss die wechselnde Aussicht, beobachtete die Tiere, die im Wasser schwammen, riesige Nilpferde, am Ufer auch Krokodile und legte sich dann, wenn die Sonne den Aufenthalt an Deck unerträglich machte, in die Schilfhütte, das Tuch mit Wasser kühlend. Abends, wenn der Kapitän angelegt hatte, wanderte er durch die Dörfer. Ganz allmählich beruhigte sich auch sein Geist mit dem langsamen Vorankommen, nur eine leise Neugierde auf das Volk der Hebräer verließ ihn nicht.
Nach einer Woche geruhsamer Fahrt wurde das Leben auf dem Fluss und an den Ufern lebhafter, der Verkehr deutlich dichter, lauter, immer mehr Lastkähne, schwer mit Steinen beladen, versperrten ihnen, die schneller fahren konnten, den Weg, immer mehr Schiffe kamen ihnen entgegen. Moses bemerkte, dass sein Kapitän jetzt ständig am Bug der Barke stand und den Verkehr beobachtete, seinem Rudergänger laute Befehle zurief, sich auch schreiend mit den Führern anderer Fahrzeuge verständigte über die Manöver, die zum Ausweichen erforderlich waren. Auch die Ufer waren dichter bevölkert. Hatte sich vorher manchmal stundenlang kein Dorf gezeigt, so war jetzt das Land eng besiedelt, Menschen säumten den Fluss, rufend, laufend, schleppend und arbeitend. Karawanen aus Kamelen und Menschen wanderten mit ihnen am Rande des Flusses, kamen ihnen entgegen, auch sie laut, und führten Waren von Süden nach Norden und umgekehrt, alle auf den Wegen, die entlang beider Nilufer führten.
Am Abend dieses Tages kam der Schiffsführer zu Moses in die Schilfhütte.
„Herr, heute Abend legen wir an im Hafen von Pitom, unserem Ziel. Befiehlst du, dass ich dir in der Herberge der Stadt eine Unterkunft schaffe?“
„Nein, ich werde heute noch auf dem Schiff übernachten, morgen werde ich dann die Stadt besichtigen und die Behörden aufsuchen.“
Moses schlief schlecht in dieser Nacht. Das lag zum einen daran, dass er aufgeregt war. Morgen würde er erst mit den Ägyptern Kontakt aufnehmen und sich dann in die hebräischen Dörfer führen lassen, um sie zu besichtigen, wie Pharao es ihm aufgetragen hatte. Zum anderen ruhten in Pitom aber auch nachts die Arbeiten nicht. War das ein Hämmern, Rufen, Schlagen und Knarren in der Dunkelheit. Moses hatte schon gehört, dass die Arbeiten an der neuen Stadt Pharaos mit großem Druck vorangetrieben wurde, er hatte auch gehört, dass an den Baustellen Tag und Nacht gearbeitet wurde. Aber so hatte er sich das nicht vorgestellt. Eine Stadt, in der Tags und nachts keine Ruhe herrschte, die immer geschäftig war. Und konnten die Menschen das aushalten? Schließlich fiel er in einen unruhigen Schlaf.
2.
Am nächsten Morgen verließ er nur halb ausgeruht und schlecht gelaunt das Schiff, wieder begleitet von zwei Ruderern als Eskorte. Er gab sich Mühe, den würdevollen Gang, den er sich während der Reise angewöhnt hatte und der seine Wichtigkeit unterstreichen sollte, beizubehalten. Langsam fragte er sich durch zu dem Obersten Würdenträger der Stadt, einem Mann namens Ptoma, wie ihm berichtet wurde. Er fand den Palast Ptomas in der Mitte der großen Baustelle, die Pitom noch darstellte. Und was war das für eine Baustelle! Ausgedehnte Prachtgebäude, noch unfertig, säumten das Ufer des Nils, errichtet auf großen Steinhügeln, zu denen gepflasterte Straßen hinauf führten. Die Rohbauten bestanden aus riesigen Quadersteinen, die tief aus dem Süden des Landes herangeschafft waren. Und noch in der Uferzone, aber etwas zur Stadt versetzt, der größte Palast, offenbar für den König geplant, von unübersehbaren Ausmaßen, größer als ganze Dörfer, die Moses unterwegs gesehen hatte, von der Uferstraße getrennt durch einen parkähnlichen Garten, der schon fertig war, mit hochgewachsenen, schlanken, alten Dattelpalmen, die offenbar, obwohl mehr als vierzig Jahre alt, noch versetzt worden waren. Dazwischen waren blühende Gärten angelegt, mit Beeten von Rosen, von Strelitzien, Tulpen, Lilien und anderen blühenden Pflanzen, die Moses, eigentlich an Prunk gewöhnt, noch nie gesehen hatte. Dahinter der Palast, noch nicht fertig, nur erst in den Ausmaßen zu sehen, weil die Wände schon standen, auch diese errichtet von den Quadern, die aus dem Süden kamen. Moses blieb stehen, um den Arbeiten zuzusehen. Jetzt gerade wurde ein Stein nach oben gehoben. Moses sah, wie zehn kräftige Männer Seile um den Stein banden, wie oben auf der Mauer weitere zehn Männer standen, oben waren Seile mit Rollen an einem fest verankerten Gestell angebracht und jetzt zogen die unten stehenden Männer mit aller Kraft an, der Stein hob sich und schwebte langsam, sehr langsam, nach oben, wo er von den Arbeitern in Empfang genommen und, noch schwebend, in die richtige Richtung und an den Platz dirigiert wurde.
Langsam löste sich Moses von dem Anblick und ging sinnend weiter. Die Männer hatten kräftig ausgesehen, nicht so ausgemergelt wie die Hebräer im Süden, ob das hier auch Hebräer gewesen waren?
Er verließ hinter der Baustelle das Ufer und ging auf einer gepflasterten Straße in die Stadt, weg vom Fluss, auf einen Palast zu, einer der wenigen Gebäude, die fertig waren.
„Melde mich deinem Herrn, dem Statthalter von Pitom; ich bin Moses, der Bote Pharaos, der den Fortgang der Arbeiten inspizieren soll.“ Eilfertig entfernte sich der Wächter, um Moses zu melden, und kam nach wenigen Augenblicken zurück. „Mein Gebieter lässt dich bitten.“
Moses trat durch das Tor in einen Garten, der ebenfalls groß angelegt, aber nicht von solchen Ausmaßen wie der des Königspalastes war. Hier waren die Springbrunnen schon mit Wasser gefüllt, sie plätscherten inmitten der Beete, durch den Hauptweg ging er, geführt von der Wache, auf das Gebäude zu, in dem Ptoma residierte, trat in einen Flur, der schattig war, eine Wohltat nach der sengenden Sonne, die schon jetzt, am Vormittag, die Hitze fast unerträglich machte. Die Balustrade war mit Malereien geschmückt und nach Süden und Norden mit Öffnungen versehen, die den Nordwind einließen, der jetzt noch linde wehte, aber ab Mittag die Hitze nur verstärken würde. Durch den Gang gelangten sie in einen Raum, der ebenfalls nach Süden und Norden offen war, mit Wänden aus reinem Marmor, über den kühlendes Wasser lief, gleichzeitig die Atmosphäre erfrischend und Farne wässernd, die von der Decke und an den Wänden hingen. Auch in der Mitte des Saales waren Springbrunnen und Wasserspiele eingelassen, die beruhigend plätscherten. Am Nordende war eine Sitzgruppe aufgestellt, von der sich drei vornehme Ägypter erhoben, als Moses eintrat. Der Älteste und Würdigste von ihnen war vielleicht vierzig Jahre alt, von gewaltiger Statur, mit einem kantigen Kopf, braunen, durchdringenden Augen und einem kräftigen Kinn unter dem schmalen Mund.
„Ich bin Ptoma, Statthalter Pharaos in der Baustelle Pitom“, begann er mit volltönender Bassstimme, „dies hier sind die Oberaufseher über die Arbeiten, Chenar und Hermet. Wir heißen dich, den Boten Pharaos, der die Bauten inspizieren soll, herzlich willkommen.“
„Ich danke dir, Ptoma, für deine freundlichen Worte“, erwiderte Moses, „aber die Bauten inspizieren, die unter deiner Aufsicht und der deiner Begleiter entstehen, das kann ich nicht. Pharao schickt mich nicht, euch zu kontrollieren. Wie ihr aber wisst, ist unser großer König Sethos an dem Fortgang der Arbeiten persönlich interessiert, ist doch diese Stadt seine zukünftige Hauptstadt. Er möchte sich durch mich von dem Fortgang der Arbeiten informieren, er wäre brennend gern selbst gekommen, wenn ihm seine Zeit das erlaubte.“
Ptomas Miene hatte sich bei den Worten Moses etwas aufgehellt. Er hatte sich schon gefragt, warum Pharao es für nötig hielt, die Arbeiten zusätzlich zu beaufsichtigen, wo doch er, Ptoma, die Leitung hatte. Und dann hatte er diesen hellhäutigen Grünschnabel gesehen, den der König schickte und sich noch mehr verwundert, was Pharao wollte. Aber die Worte Moses hatten seinem Erscheinen den Stachel genommen. Pharao war ungeduldig, das wussten alle im Reich, und ungeduldig erst recht, was seine Stadt Pitom anging. Moses sollte nicht beaufsichtigen, sondern über den Fortgang der Arbeiten berichten, nun gut, die Arbeiten schritten zügig voran, mochte der Bote das nach Theben berichten.
„Es ist gut, Moses, morgen zeige ich dir die Baustellen, aber auf jeden Fall bist du mein Gast, und zwar während deines ganzen Aufenthaltes hier, ich bitte dich, und heute Abend werden wir gemeinsam speisen“
Moses dankte ihm nickend und so rief Ptoma einen Diener und gab ihm den Auftrag, Moses die Gastgemächer zu zeigen. Moses schickte seine bisherigen Begleiter zum Schiff zurück, sie sollten dem Schiffsführer ausrichten, morgen früh erhielte er neue Befehle.
Ptoma bewirtete den hohen Gast aus Theben am Abend mit ausgesuchter Höflichkeit, die Zimmer, die er Moses zugewiesen hatte, waren weitläufig, elegant und kühl, so dass Moses am nächsten Morgen ausgeruht Ptoma bat, nun mit ihm in die Stadt zu gehen. Der Statthalter ließ es sich nicht nehmen, seinen Gast selbst zu begleiten, mit einem stattlichen Gefolge. Auf Bitten Moses besichtigten sie zuerst den zukünftigen Königspalast, den Moses schon gestern bewundert hatte. Als sie auf das Gebäude zugingen, fiel Moses geschäftiges Treiben am Ufer des Nil auf.
„Wir müssen die Baustelle gegen die Fluten des Flusses schützen“, erklärte Ptoma, „der Nil steigt, die Priester erwarten eine sehr hohe Flut, wir haben Dämme gebaut, damit das Wasser nicht die Baustellen behindert, aber mein Oberaufseher hat versäumt, auch hier rechtzeitig den Damm zu errichten. Das wird jetzt nachgeholt.“
Hunderte von Menschen schufteten am Ufer, Moses nahm sie zunächst nur als sinnloses Gewimmel wahr. Als er näher hinsah, bemerkte er die unterschiedlichen Tätigkeiten: Die einen waren damit beschäftigt, unermüdlich kleine Kiesel und Erde herbei zu schaffen. Andere schichteten die Steine und bildeten damit das Fundament für den Damm, der dann aus einem Lehmgemisch, durch Mauern verstärkt, um das Fundament errichtet wurde. Von beiden Seiten wurde gearbeitet, Moses konnte den Damm fast wachsen sehen. Er sah allerdings auch, wie nahe der Nil schon an der Uferkrone stand, es fehlte nicht viel und er würde sein Flussbett verlassen und die Stadt überschwemmen.
„Wie lange brauchen sie denn, um den Damm fertig zu stellen?“, fragte er neugierig.
„Wenn sie in diesem Tempo weitermachen, bis heute Abend, und vor morgen oder übermorgen steigt der Nil nicht so hoch, wir werden rechtzeitig fertig, um den Bau und vor allem den Garten zu schützen“, beruhigte ihn Ptoma.
„Und das sind Hebräer, die da arbeiten?“ Moses sah nun Einzelheiten. Er betrachtete die unterschiedlichen am Bau beschäftigten Menschen. Da waren Ägypter, in Arbeitsleinen gekleidet, die offenbar lediglich Anweisungen gaben, unter ihnen einige, die mit langen Peitschen bewaffnet waren, von denen sie ohne weiteres Gebrauch machten, und zwar auf den Rücken der Arbeiter. Diese hatten durchweg hellere Haut als die Aufseher, so hell etwa wie die Moses. Einige von ihnen hatten dunkelblondes Haar, eine Farbe, die bei den Ägyptern so gut wie nie vorkam. Unter ihnen gab es junge Burschen, stämmig, mit starken Muskeln bepackt, die die großen Karrenwagen mit Steinen beladen zogen, andere schleppten das Material von den Karren zur Baustelle. Die meisten wirkten allerdings nicht kräftig, es waren Männer aller Altersgruppen, auch ganz alte, ausgemergelte dabei. Alle trugen sie lediglich einen Schurz aus Leder um die Hüften, die Rücken waren bloß, den Peitschenhieben der Aufseher wehrlos ausgesetzt. Als Moses noch genauer hinsah, ging es ihm wie ein Stich durch das Herz. Die hebräischen Männer waren schmutzig, so schmutzig, wie Moses sich das bisher nicht hatte vorstellen können. Die Rücken waren voll Staub, mit Blut aus den Hieben gemischt, schweißnass, und jetzt, als sie näher kamen, hörten sie das unterdrückte und zum Teil laute Stöhnen und Jammern, unter dem die Männer ihre Arbeit verrichteten.
„Musst du sie denn schlagen lassen?“, fragte Moses erbittert. Ptoma schaute auf. Er war verwundert, dass der königliche Bote sich für die hebräischen Sklaven interessierte. Er, Ptoma, hatte noch nie einen Gedanken an sie verschwendet. Klar, wenn sie so hart heran genommen wurden, starben sie, vor allem die Alten und die, die nicht so stark waren. Aber was lag daran? Wenn sie starben, wurden sie durch andere ersetzt, die Dörfer der Hebräer in der Nähe waren voll von ihnen, ein unerschöpfliches Reservoir, darüber brauchte man sich nun wirklich keine Gedanken zu machen. Aber Moses ließ nicht locker:
„Arbeiten sie denn nicht besser, wenn sie nicht geschlagen werden?“
„Nein, sie sind das gewöhnt. Wenn man nicht auf sie aufpasst, werden sie langsam und schaffen ihr vorgeschriebenes Pensum nicht. Und dann ziehen wir die Aufseher zur Verantwortung. Und die meinen, dass die Hebräer ohne Schläge gar nicht richtig arbeiten können. Sie brauchen das. Überhaupt, was machst du dir eigentlich so viel Sorgen um diese hebräischen Sklaven? Sie vermehren sich in ihren Dörfern so schnell, dass wir froh sind, wenn sie bei der Arbeit sterben. Wenn sie nicht in Schranken gehalten werden, sind sie bald mehr als wir Ägypter, und dann verlassen sie ihr Reservat, das ihnen in Gosen zugewiesen ist. Und wenn du schon mit ihnen Mitleid hast, solltest du mal eines ihrer Dörfer besuchen“, Ptoma schüttelte sich vor Ekel, „schmutzstarrend, voller Gewalttätigkeit, kein Ägypter, der bei Verstand ist, geht auch nur tagsüber in ihre Dörfer.“
„Aber ich gedenke, eines ihrer Dörfer zu besuchen, ein Dorf nämlich, in dem ein Mann namens Amram wohnt, mit seiner Frau Jochebed.“
Ungläubig starrte Ptoma seinen Gast an.
„Du willst in eines ihrer Dörfer gehen? Bist du lebensmüde oder willst du dich verkleiden? Du bist noch jung, lass dich von mir beraten, Moses, geh da nicht hin, du wirst erschlagen werden und, wenn nicht, dich zu Tode ekeln.“
Aber Mosche war entschlossen, und er gab Ptoma keine weiteren Erklärungen ab. Ptoma betrachtete ihn neugierig. Er sah diesen jungen Mann mit den merkwürdigen Wünschen, der das Siegel des Königs trug, aber eine Haut, die ihn, Ptoma, auf den Gedanken brachte, ob er den Hebräern nicht näher stand, als er zugab. Aber einen Mann namens Amram finden? In welchem Dorf denn? Wenn man einen bestimmten Hebräer suchte, schickte man hebräische Kundschafter in die Dörfer und befahl ihnen, nach diesem Menschen zu suchen und ihn her zu bringen, in den Palast.
„Du hast also hebräische Kundschafter?“, war alles, was Moses auf den Redeschwall seines Gastgebers antwortete, „dann möchte ich, dass zwei von ihnen mich morgen begleiten, damit ich Amram und seine Frau finde.“
Und langsam gingen sie weiter, zur nächsten Baustelle. Es war inzwischen Mittag geworden, die Sonne brannte unbarmherzig auf die Arbeiter herab und selbst Ptoma und Moses, die im Schatten von dichten Palmen standen, wurde es zu heiß. Dennoch arbeiteten die Sklaven ohne Pause weiter, ihre Arbeit nur unterbrechend, wenn sie vor Durst zusammen zu brechen drohten. Moses konnte kaum an sich halten, als er einen ägyptischen Aufseher sah, wie er auf einen alten Mann, der offenbar vor Durst und Erschöpfung nicht mehr weiter arbeiten konnte, so lange einschlug, bis der Sklave leblos auf dem Weg liegen blieb. Der Ägypter rief zwei andere Sklaven, die den alten Mann weg trugen, Moses war sich sicher, dass er unter den Schlägen gestorben war. Sein Herz krampfte sich vor Mitleid zusammen, aber er sah, wie Ptoma die Szene beifällig betrachtete, wollte ihn nicht weiter verärgern und fügte sich, als Ptoma ihn bat, zum Palast zurück zu kehren.
3.
Moses Herkunft war unbekannt und wurde verschwiegen, ihm und allen anderen, zu seiner Verzweiflung. Seine helle Haut und seine hohe und breite Gestalt ließen alle Menschen seiner Umgebung vermuten, er sei Hebräer, Angehöriger dieses verachteten Sklavenvolkes, das im Norden des Landes unter der Knute schuftete und von dem nur Einzelne in der Stadt Frondienst taten, in der Moses aufwuchs, der Königsstadt Theben. Aber wenn er Hebräer war, so fragte er sich und so fragten sich natürlich auch alle anderen, warum ging er in die Schule der Vornehmen, der Söhne der Palastbeamten und tat nicht Frondienst in Theben oder wurde sogar nach Norden geschickt, um unter der Aufsicht der Beamten zu arbeiten? Stattdessen wurde er ausgebildet und erzogen, als ob er der Sohn eines Vornehmen war, hatte sogar zum Palast des Pharao Zutritt, wie nur wenigen Menschen vergönnt war.
Hässliche Gerüchte begleiteten ihn, so lange er denken konnte, selten wurden sie ihm ins Gesicht gesagt, und wenn, dann nur als eine der üblichen Beleidigungen, wie sie unter den jungen Menschen nach dem Unterricht an der Tagesordnung waren. Hinter seinem Rücken aber und nicht nur über ihn wurden schlimme Geschichten erzählt. Ein Früchtchen sei er, Frucht einer kurzen leidenschaftlichen Verbindung zwischen der Prinzessin Thermutis, der Tochter Pharaos, und einem hebräischen Sklaven. Sie habe ihn arbeiten gesehen im Palaste in der Nähe ihrer Gemächer, wie er mit nacktem, verschwitztem Oberkörper Steine behauen habe, habe auf ihrem Balkon gesessen, den süßen Saft der Mango getrunken und habe das Spiel seiner starken Muskeln beobachtet, bis sie, von der Hitze und dem Anblick angestachelt, nicht habe an sich halten können und den Sklaven in ihr Schlafzimmer befohlen habe. Dort habe sie sich ihm ergeben, einen Nachmittag und eine Nacht lang, bis sie ihn, erschöpft von dem Liebesspiel, von sich geschickt habe. Ihre Leibwächter aber, denen ihr Schutz auferlegt gewesen sei, hätten die Begegnung erst zu verhindern gesucht, dann aber geschehen lassen. Um aber sicher zu gehen, dass von dieser Nachlässigkeit und dem Vergehen der Prinzessin niemand Kunde erhalte, hätten sie den Hebräer direkt nach dem Verlassen des Palastes getötet und verscharrt.
Niemand, so wurde gemunkelt, habe von diesem Vorfall etwas mitbekommen, weil die Leibwächter schon zu ihrem eigenen Schutz eisern geschwiegen hätten. Nach fünf Monaten sei es aber nicht zu verheimlichen gewesen, Thermutis sei schwanger gewesen, rund wölbte sich schon ihr Bauch unter dem leichten Leinen, das sie in Zeremonien tragen musste. Sie habe sich dann ihrem Bruder Ramses offenbart, der sehr erbost gewesen sei, aber doch seine Schwester zu sehr liebte. Er habe eine Geburt im Verborgenen organisiert und das Früchtchen seiner Schwester, seinen Neffen, zu Hebräern in Pflege gegeben, bis zum fünften Lebensjahr, danach sei das Kind „Sohn“, eben Moses, genannt und in den Palast genommen worden, wo er bei ägyptischen Pflegeeltern aufgenommen wurde und aufwuchs.
Moses also war, wenn das alles richtig hinter den Rücken der Herrscher und der Betroffenen erzählt wurde, von einer Herkunft, die vornehmer nicht sein konnte, aber eben auch der Sohn eines Hebräersklaven, niedrig von Geburt.
Am Hofe begegnete ihm die Königsfamilie mit Freundlichkeit, Thermutis besonders hatte sich seiner angenommen, ohne aber jemals über das hinaus zu gehen, was sie anderen Günstlingen auch gewährte. Einerseits war Moses stolz auf die Gerüchte, die ihm Verwandtschaft zur königlichen Familie nachsagten, stolz auch darauf, dass er jederzeit Zugang zum königlichen Plast hatte, andererseits verzweifelt über die Unklarheit seiner Herkunft. Wie klar und geregelt waren doch Vergangenheit und Zukunft seiner Kameraden, wie ungewiss seine eigene Zukunft. Früh lernte Moses, für sich allein zu sein, weil in den Gesichtern der anderen die leise Frage nach seiner Existenz zu lesen glaubte. Nur mit Setaou verband ihn eine enge Freundschaft, zu der sich aber Setaou nicht bekannte, wenn sie sich im Kreise ihrer Altersgenossen bewegten. Moses hätte sich gewünscht, sein Freund würde offen zu ihm stehen, auch unter den anderen, dieser Wunsch war aber nicht zu erfüllen.
4.
Und nun war er hier, in Pitom, auf der Suche nach seinen Pflegeeltern, die irgendwann von Theben nach hier geschickt worden waren, ohne dass Moses das mitbekommen hatte und auf der Suche nach seinem Volk, seinen Vätern und war bereit, das Befremden in den Gesichtern der königlichen Beamten zu ertragen.
Moses ging langsam, würdevoll, in Begleitung der zwei hebräischen Kundschafter und zweier Soldaten des Königs, auf denen Ptoma zu seinem Schutz bestanden hatte, aus der Stadt, nach Osten, auf der Suche nach den hebräischen Dörfern. Zwei Stunden waren sie jetzt in der Sonne unterwegs, die, sie waren am frühen Morgen losgegangen, jetzt schon mit unbarmherziger Glut auf sie herunter brannte. Sie trugen das weiße Leinen, das die Sonne und das Ungeziefer von der Haut fernhielt, sie hatten leichte Perücken aufgesetzt, die den Kopf vor der Glut schützten, und dennoch war der Gang fast unerträglich, Moses wurde ausschließlich von seinem Willen, auf die Suche nach den Pflegeeltern zu gehen, angetrieben, seine Begleiter von seinem Befehl. Kein Baum, kein Schatten, nichts milderte die Hitze der Sonne ab, die auf sie hinab strahlte. Endlich, nach einer weiteren halben Stunde, sahen sie eine Ansammlung von Palmen und Bäumen am Rande des Wegs, schattenwerfende Pflanzen, an denen, wie sie aus der Ferne erkannten, eine Gruppe Menschen lagerten. Moses beschleunigte seine Schritte, in der Hoffnung auf eine Ruhepause und auf einen Schluck Wasser, der sich dort finden würde.
Schon von weitem erkannte er, dass er sich einer Wasserstelle näherte, an der ägyptische Soldaten lagerten und in einiger Entfernung eine weitere Gruppe, offenbar hebräische Arbeiter. Ein einzelner Mann kam von den Hebräern auf Moses zu, der nun seinen Leibwächtern und den hebräischen Kundschaftern weit vorausgeeilt war.
Moses erschrak, als er dem Ankommenden entgegen ging und ihn aus der Nähe ansehen konnte. Leicht gebückt ging der Hebräer und humpelte. Die Gestalt war gewissermaßen zusammengezogen, ein riesiger Buckel wuchs aus seinem Rücken und krümmte den Oberkörper und verursachte das Humpeln der im Verhältnis zu dem Oberkörper zu kurzen krummen Beine. Den Kopf hielt der Hebräer schief und sah so, von unten und der Seite hinauf Moses an.
„Woher kommst du, edler Herr?“, fragte er und seine Stimme war heiser, der kriecherische und schmeichlerische Eindruck der Stimme wurde verstärkt dadurch, dass er sich zu verbeugen schien.
„Ich bin Moses und von Pharao geschickt, um ihm über den Fortgang der Arbeiten hier zu unterrichten“, Moses richtete sich innerlich auf und die Antwort fiel arroganter aus als er eigentlich wollte, so, wie ein ägyptischer Edler mit einem buckligen Hebräer eben üblicherweise redete.
„Ich suche in den Hebräerdörfern ein Ehepaar, sie heißen Amram und Jochebed, kennst du sie?“
Der Mund in dem hässlichen Gesicht des Hebräers verzog sich zu einem süßlichen Grinsen.
„Amram suchst du, edler Herr? Amram, lass mich nachdenken“, und der Hebräer legte seine Stirn in angestrengte Falten, um zu zeigen, wie sehr er nachdachte, „Ja, Amram kenne ich, er wohnt in einem der nächsten Dörfer dort drüben“, er machte eine unbestimmte Bewegung mit seinem schlenkernden Arm nach Osten, „du kannst sie von hier aus nicht sehen, aber ich kann dich hinbringen und mit Amram bekannt machen, was willst du denn von ihm?“ Neugierig sah ihn der Hebräer an.
„Was ich von ihm will, fragst du? Geht dich das wohl etwas an?“ Moses hob die Stimme, „wie heißt du, Mann? Soll ich dich an die Soldaten übergeben?“
Erschrocken verbeugte sich der Hebräer nun wirklich trotz seiner Behinderung sehr tief.
„Reuben heiße ich, Herr, und warum du Amram suchst, nein, das geht mich nichts an, wirklich, willst du, dass ich dich hinführe?“
Moses nickte. „Wie lange brauchen wir, um hin zu kommen?“
„Wohl zwei Stunden, wenn wir berücksichtigen, dass ich nicht so schnell gehen kann wie du.“
„Und hast du sonst nichts zu tun? Wieso kannst du hier an der Wasserstelle herumlungern und arbeitest nicht?“
„Herr, meine Arbeit würde wohl niemandem nutzen, ich bin schwach, ich kann kaum etwas tragen, gehen kann ich auch nicht, und so begleite ich manchmal Ägypter, wenn sie sich in den Dörfern meines Volkes nicht auskennen.“
„Gut, Reuben, dann wollen wir an der Wasserstelle etwas trinken und dann gehen wir los.“
Mittlerweile waren die Begleiter Moses herangekommen und sahen ihn mit dem Buckligen stehen und hörten, dass Moses mit ihm allein weiter gehen wollte. Die hebräischen Kundschafter nahmen das teilnahmslos hin, sie waren gewohnt, die Entscheidungen ihrer ägyptischen Herren zu akzeptieren, ohne nach Sinn und Verstand zu fragen, die Leibwächter, die Ptoma Moses mitgegeben hatte, protestierten.
„Allein willst du in das Hebräerdorf gehen, Herr?“, fragte der eine, „weißt du nicht, wie es dort zu geht? Schmutzig, krank sind sie, die Hebräer, du holst dir leicht eine Seuche in deren Dörfern, und dann sind sie ein Volk von Kriminellen, ein Menschenleben bedeutet ihnen nichts, wie leicht kann dir da etwas geschehen.“