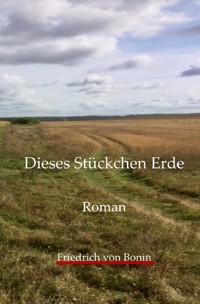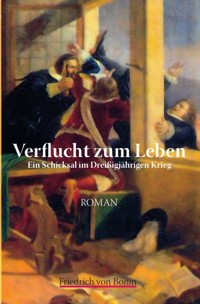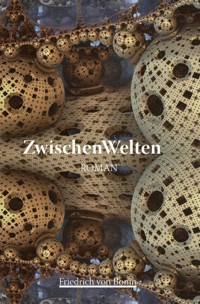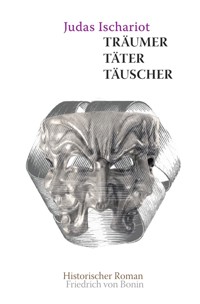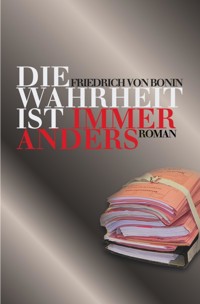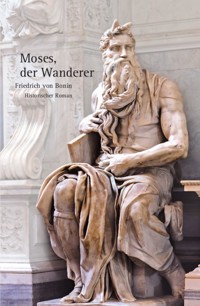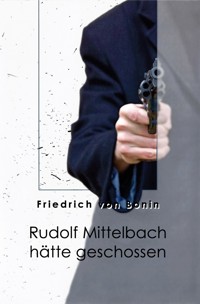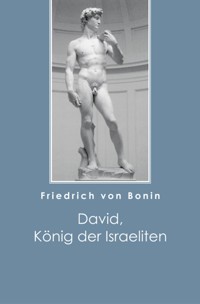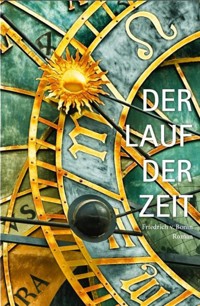
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Du hattest die Kreuz Dame!", rief Heinrich Kanne aus, und satt zufrieden lachte Bruno von Halcan. "Natürlich ich, wer denn sonst?" Sie spielten Doppelkopf und Bruno hatte die ganze Runde, alle drei Freunde, bis zur letzten Karte über sein Blatt im Unklaren gelassen. Er hatte erst zuletzt die zweite Kreuz Dame ausgespielt, dadurch die Gegenpartei irritiert, ein paar schöne Punkte gemacht und das Spiel gewonnen. Seit seiner Schülerzeit liebt der schüchterne Bruno von Halcan Margarete Leuchtenfeld. In den fünfziger und sechziger Jahren geht er zur Schule, studiert in den Achtundsechzigern und wird Anwalt. Als er Erfolg hat, verlässt ihn Margarete. . . Neben der bildhaften Beschreibung einer Jugend in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts erzählt der Roman von der Karriere seines Protagonisten und seinem Scheitern. Und von der hinreißenden Liebesgeschichte zwischen Bruno von Halcan und Margarete Leuchtenfeld.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 462
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Buch:
Seit seiner Schülerzeit liebt der schüchterne Bruno von Halcan Margarete Leuchtenfeld. In den fünfziger und sechziger Jahren geht er zur Schule, studiert in den Achtundsechzigern und wird Anwalt. Als er Erfolg hat, verlässt ihn Margarete. . .
Neben der bildhaften Beschreibung einer Jugend in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts erzählt der Roman von der Karriere seines Protagonisten und seinem Scheitern.
Und von der hinreißenden Liebesgeschichte zwischen Bruno von Halcan und Margarete Leuchtenfeld.
Der Autor:
Geboren 18.08.1946 aufgewachsen in Emlichheim, Grafschaft Bentheim, Niedersachsen. Gymnasium in Nordhorn, 1966 Abitur.
Studium der Rechtswissenschaft in Göttingen, 2. Juristische Staatsprüfung in Hamburg 1976.
Seit 1979 selbständiger Rechtsanwalt, seit 1983 auch Notar, in Bremerhaven.
Er lebt in Bremerhaven, ist verheiratet und hat keine Kinder.
Anfänge schriftstellerischer Tätigkeit etwa 2004.
Bisher sind von ihm erschienen:
„Rudolf Mittelbach hätte geschossen“ (2012)
Impressum
©Friedrich von Bonin 2014
Verlag: epubli GmbH. Berlin, www.epubli.de
Friedrich von Bonin
Und es handelt sich darum, alles zu leben
Leben Sie jetzt die Fragen,
vielleicht leben Sie dann allmählich
ohne es zu merken
eines fernen Tages
in die Antworten hinein.
I. Spiel
„Du hattest die Kreuz Dame!“, rief Heinrich Kanne aus, und zufrieden lachte Bruno von Halcan. „Natürlich ich, wer denn sonst?“ Sie spielten Doppelkopf und Bruno hatte die ganze Runde, alle drei Freunde, bis zur letzten Karte über sein Blatt im Unklaren gelassen. Er hatte erst zuletzt die zweite Kreuz Dame ausgespielt, dadurch die Gegenpartei irritiert, ein paar schöne Punkte gemacht und das Spiel gewonnen.
Behaglich saß er zusammen mit seinen Freunden am Tisch. Das war Heinrich Kanne, sein alter Kommilitone aus Studientagen, jetzt Vorsitzender Richter am Landgericht, und immer noch, mit seinen mehr als fünfundvierzig Jahren blond, fast ohne graues Haar, das Gesicht schief und bartlos, schief deshalb, weil seine Nase sich zur einen Seite bog, während sein Mundwinkel auf der anderen Seite etwas nach oben gezogen war, als lächele er ständig. Die blauen, intelligenten und neugierigen Augen waren nicht mehr von der dicken Brille verdeckt, seit Heinrich Kontaktlinsen trug. Sie blitzten jetzt fröhlich, natürlich, denn er war Brunos Partner in diesem Spiel gewesen und heimste jetzt mit ihm gemeinsam die Punkte ein.
Der Dritte in der Runde war Albert Praus. Auch ihn kannte Bruno seit den Studententagen. Albert hatte sich damals Bruno und Heinrich angeschlossen, klein, unscheinbar, mit einem blassen schmalen Gesicht und graubraun gesprenkelten Augen, die immer etwas furchtsam blickten und mit braunen Haaren. Albert war von Natur aus ängstlich und hatte gerne um die arroganten und selbstbewussten Kommilitonen geworben, bis sie ihn als Dritten akzeptierten. Inzwischen war er Direktor der örtlichen Sparkasse, war in diese Position gewissermaßen natürlich hineingewachsen, hatte doch schon sein Vater eine gleiche Stelle in einer Stadt in Süddeutschland bis zu seiner Pensionierung innegehabt. Schlank und schmal saß er da und sah seinen Partner, Guido Hamer, betroffen an. Sie hatten in diesem Spiel kräftig Punkte abgeben müssen.
Guido Hamer war der Einzige unter den Freunden, den sie nicht aus den Zeiten des Studiums kannten, Architekt von Beruf, lang und hochgewachsen, mit kurzen schwarzen Haaren und dröhnendem Lachen war er eines Tages in das Büro Bruno von Halcans gekommen und hatte verlangt, dass Bruno ihn in einem Haftpflichtprozess vertrete. Er kannte Margarete, Brunos Frau, von früher und hatte deshalb Bruno besucht. Bruno hatte von Baurecht keine Ahnung und empfahl Guido einen Spezialisten, der ihn vertreten könnte. Sie waren aber dennoch ins Gespräch gekommen, hatten aneinander Gefallen gefunden und sich danach ab und zu getroffen, vor allem, weil Guido und Margarete sich gut verstanden. Als ein Mitspieler die alte Doppelkopfrunde verließ, schlug Bruno Guido vor und so trafen sie sich einmal im Monat. Margarete hatte der Verabredung gerne zugestimmt, war auch einverstanden, dass sie ab und zu in ihrem Hause spielten, bevorzugte es aber, an diesen Abenden auszugehen, so dass auch heute die Vier unter sich waren.
Bruno war ebenfalls mehr als Mitte vierzig, mit viel Anteil an grauen Haaren. „Ich arbeite eben mehr und habe mehr Sorgen als ihr“, erklärte er den Freunden, die ihn damit aufzogen. Er hatte immer noch ein scharf geschnittenes Gesicht, das zwar leichte Ansätze zu einem Doppelkinn zeigte, ansonsten aber noch nicht von der Gewichtszunahme erfasst war, über die Bruno sich Sorgen machte. Erst kürzlich hatte er festgestellt, dass ihm seine Hosen nicht mehr passten. Im Gesicht gab es hiervon kaum Spuren, ein rechteckiges Gesicht war das, mit hoher, gefalteter Stirn, strahlenden grün braunen Augen, von geraden Brauen beschattet, schmalen Wangen, einem vollen Mund. An den äußeren Augenwinkeln zeugten inzwischen tiefe Lachfalten davon, dass er gut und gern lachte.
Behaglich sah er sich um. Hinter ihm knisterte im Kamin ein leichtes Feuer, das er angezündet hatte, weil es zwar nach dem Kalender schon Frühling war, nicht aber der Temperatur nach. Brunos Blick wanderte von seinen Mitspielern vor ihm hinaus auf die Terrasse, die jetzt im Dunkeln lag, den leicht abfallenden Garten, die Stadt, deren Lichter warm aus der Senke leuchteten. Er kehrte zurück in die Runde, in der Heinrich zum nächsten Spiel die Karten mischte und austeilte. Auf den Tisch, an dem sie spielten, war Bruno besonders stolz; halbhoch, stand er auf vier elegant geschwungenen Beinen, die in löwenköpfigen Füßen endeten, mit einer Platte, die aus dunklem Rosenholz gefertigt war, mit helleren Intarsien aus Nussbaum und sehr glatt. Die Platte hatte einige Gebrauchsspuren, die Bruno aber nicht im Geringsten störten, im Gegenteil, sie drückten die Nützlichkeit dieses Möbels aus, wie er zu sagen pflegte. Um den Tisch standen bequeme Stühle mit geschwungenen Holzrahmen, Lederbezügen auf den Sitzflächen und am Rücken und breiten Armlehnen. Jeder Spieler hatte vor sich ein Glas mit Rotwein, alle tranken sehr mäßig, und Wassergläser, die Bruno aus einer geschliffenen Karaffe füllte, die mit Silber beschlagen war. Bruno freute sich in der Spielpause, in der Heinrich die Karten austeilte, des Eindruckes von solidem Komfort, den er um sich gesammelt hatte und heute Abend mit den Freunden teilte.
Bis spät in die Nacht ging das Spiel, wie immer, wenn sie sich trafen, und mit viel Gelächter. Sie hatten eine ganz eigene Art entwickelt, Doppelkopf zu spielen, sie redeten ununterbrochen, auch über die Blätter, die sie hatten. Ein beliebtes Spiel war es, zu stöhnen, wenn man schlechte Karten hatte, aber auch, wenn sie gut waren. Offen wurde darüber geredet, wenn einer die Kreuz Dame hatte: „Wie gut, dann spielen wir ja zusammen!“. Jeder ernsthafte Doppelkopfspieler hätte sich furchtbar aufgeregt, der den Regeln getreu niemals über seine Karten redete, bis er gemerkt hätte, dass sie nichts über ihr wirkliches Blatt preisgaben, sondern dass die Aussagen zum Vexierspiel und zur Täuschung dienten. Niemand konnte sich darauf verlassen, welche Aussagen wahr waren. Sie hätten den fröhlichen Austausch von Informationen auch sein lassen können, aber um schweigend zu spielen, waren sie zu lebhaft, dann hätten sie lieber nicht gespielt.
Ausgelassen verabschiedeten sie sich weit nach Mitternacht, laut hallten ihre Abschiedsworte durch die stille Nacht, und dann waren sie weg. Bruno nahm im Licht der Außenbeleuchtung beiläufig den ersten grünen Flaum auf der Birke vor dem Haus wahr. Noch lächelnd über die letzten Sprüche, die hin und her geflogen waren, räumte er die Flaschen und die Gläser weg und ging ins Schlafzimmer.
Das Zimmer war dunkel. Er hatte nicht gehört, dass Margarete nach Hause gekommen war. Sie ging immer, wenn sie spielten, ins Bett, ohne sie zu begrüßen. Sie liebte es nicht, wenn er Licht machte, während sie schon schlief, also kleidete Bruno sich im Dunkeln aus, als er auf einmal wahrnahm, dass Margarete nicht im Zimmer war, dass er ihren Atem nicht hörte. Behutsam ging er auf ihre Seite, fühlte nach ihr, das Bett war leer, bis auf ein Papier, das unter seinen Händen knisterte. Alarmiert schaltete er die Nachtischlampe ein: Margarete hatte ihm einen Brief geschrieben. Bruno war auf einen Schlag hellwach. Er und Margarete hatten sich am Anfang ihres Zusammenlebens kleine Notizen hinterlassen, sie in ihrer zierlichen Schrift, Notizen mit alltäglichen Mitteilungen, immer begleitet von einer kleinen Liebeserklärung. Seit Jahren hatte er keine solche Notiz von ihr mehr erhalten. Kaum mochte er den Blick auf das Papier richten, die Hände zitterten ihm. Was konnte sie ihm mitteilen wollen und warum war sie nicht da? Jetzt endlich senkte er den Blick:
„Lieber Bruno, mein Ehemann und Geliebter“, schrieb Margarete, „ich verlasse Dich, heute Abend, jetzt. Ich verlasse Dich weinend, weil ich Dich immer noch liebe. Trotzdem verlasse ich Dich, weil mein Leben neben Dir nicht mehr mein Leben ist. Du weißt, wie ich immer Angst vor Deiner Skepsis hatte, wie ich aber gelernt habe, mit ihr zu leben. Du weißt aber auch, wie ich mich gewehrt habe, gegen die Wendung, die Du in Deinem Beruf gemacht hast, gegen den Reichtum. Du weißt, wie gerne ich in diesem Haus gelebt habe, aber auch das Haus ist Ausdruck des Lebens, das Du und auch ich zu führen begonnen haben. Alles in mir sträubt sich gegen eine Existenz als Ehefrau des prominenten und reichen Anwaltes. Mir ist klar geworden, dass ich dieses Leben nicht mit Dir teilen will, und deshalb gehe ich. Forsche nicht nach mir, Du wirst mich nicht finden. Lebe wohl.“
Bruno fühlte, wie sich ganz langsam sein Magen zusammenkrampfte, wie sein Mund sich verzog, wie ihm die Tränen in die Augen stiegen und zum ersten Mal seit ungezählten Jahren weinte er, lange, tief schluchzend, bitter. Er warf sich auf das Bett, wühlte sich in die Bettwäsche, weinte, minuten-, stundenlang, bis er vor Erschöpfung einschlief. Am nächsten Morgen wusste er sofort, als er aufwachte, was ihm geschehen war, Und wenn er sie suchte? Wenn er ihr nachforschte, sie fand, und sie bat, zu ihm zurückzukehren? Aber er wusste, das würde er nicht tun. Bruno war kein Kämpfer, schon einmal hatte Margarete ihn verlassen, ihm zu verstehen gegeben, dass sie mit ihm nichts mehr zu tun haben wolle. Und dann war sie zurückgekommen, auch damals hatte er nicht nach ihr gesucht.
Bilder hatte er von ihr in sich, Bilder, wie er sie das erste Mal sah, wie er sie das erste Mal küsste, wie sie in dieses Haus gezogen waren und sie sich gefreut hatten. Bilder aber auch von ihren Streitereien der letzten Tage, Wochen, Monate. Immer hatte sie ihm deutlich gesagt, dass er sich gewandelt habe und sie das Leben, das sie führten, nicht akzeptieren wolle.
Bruno sah sie deutlich vor sich, wie er sie das erste Mal gesehen hatte, ein junges Mädchen, das er vorher nicht beachtet hatte, über den Schulhof gehend, er erinnerte sich an das Gefühl, das ihn damals überfallen hatte. Er hatte sich verliebt in Margarete, ein Gefühl, das bis heute nicht erloschen war.
Still, bitter, jetzt tränenlos, saß Bruno auf dem Bett. Sie hatte ihn verlassen, heute Nacht, zum zweiten Mal, aber warum?
Bruno erinnerte sich an Splitter ihres gemeinsamen Lebens. „Nimmst Du denn gar nichts ernst?“ hatte sie ihn oft gefragt, wenn er sich lustig machte, über ihre Kollegen, seinen Beruf, über Mandanten, über politische Entwicklungen. Er hatte ihr zu erklären versucht, wie sehr Skepsis Teil seiner Existenz sei, wie er sie als Schutzschild gegen das Leben brauche und warum. Und sie war damals zu ihm zurückgekommen.
Über Geld hatten sie zuletzt gestritten, nicht, weil sie zu wenig hatten, sondern zu viel und weil, wie sie sagte, ihm Geld zu wichtig sei. Hatte er sich so sehr verändert, oder war er immer der Gleiche geblieben, hier in Göttingen, vorher in Göttingen als Student oder noch früher, in Neuburgheim, als Kind?
Bruno sah Bilder von sich als Kind, als Schüler, sich selbst mit seinen Eltern und Geschwistern in Neuburgheim, und begann, sich zu erinnern. Keinen Augenblick würde er Margarete vergessen, er trauerte um das Leben mit ihr, das jetzt vorbei war, und er wusste, noch lange würde er trauern.
Sie war es, die ihn in der Schule angesprochen hatte, er war noch nicht siebzehn Jahre alt, sie standen mit Klassenkameraden vor einem Bild mit einsamer Heidelandschaft im Klassenzimmer.
„Nun, Bruno“, hatte sie ihn angelächelt, „denkst Du da nicht an schöne Stunden?“
Bruno war vollkommen in ihren Anblick vertieft gewesen und schrak hoch. Sie hatte ihn angesprochen, ihn, Bruno. Unter Tränen lächelte Bruno, als er daran dachte, wie ungeschickt er gewesen war, aufgeschreckt und an seinen Platz geflüchtet war er, eine Arbeit vorschützend. Tagelang hatte er sich nicht getraut, sie auch nur anzusehen. Das war in Hermstadt gewesen, der Stadt, in der er in das Gymnasium ging.
II. Jugend
1.
Bruno von Halcan wurde ein Jahr nach dem Weltkrieg geboren. Das sagt sich leicht, war aber Mitte des 20. Jahrhunderts schon interpretationsfähig: nach welchem Krieg? Die Weltkriege zeichneten das Jahrhundert aus. Obwohl die Europäer schon immer miteinander Kriege geführt hatten, wurden diese beiden als Weltkriege bezeichnet, weil praktisch die ganze Welt darin verflochten war oder jedenfalls das, was die Europäer, die die Welt immer noch aus dem Blickwinkel Mitteleuropas sahen, dafür hielten. Bruno jedenfalls wurde nach dem zweiten Weltkrieg geboren.
Er gehörte der zweiten Löwengeneration nach dem Krieg an, für diejenigen, die Astrologie mögen. Als Löwe im Aszendenten des Löwen geboren. Und die den Löwen nachgesagten Eigenschaften würden ihn, ob man an die Interpretationen der Sternzeichen glaubte oder nicht, sein Leben lang begleiten: Gutartiges Angebertum, Großzügigkeit, Neugier und ein sonniges Gemüt.
Seine ersten Lebensjahre verbrachte Bruno in einer Nissenhütte am Rande eines winzigen Dorfes, Neuburgheim, im westlichsten Westdeutschland. Seine Eltern waren Kriegsverlierer, wie es auch Kriegsgewinner gab, sein Vater war der Erbe eines kleinen Gutes jenseits der Oder-Neiße-Linie gewesen, wie man die Grenze zwischen Polen und Deutschland damals nannte. Klein war das Gut nur nach jenen Maßstäben gewesen, mit denen man in dieser Gegend vor dem Kriege maß, kleine 6.000 Morgen, davon 4.000 Morgen Wald und 2.000 Morgen Ackerland, insgesamt 1.500 Hektar. Das nächstgrößere Gut hatte ungefähr 10.000 Morgen gehabt, auch das war noch ein kleines Gut nach den dort geltenden Verhältnissen. In Neuburgheim, wo Bruno aufwuchs, hatte der Großbauer, wie er genannt wurde, 80 Morgen, deshalb konnte sich Bruno zeitlebens an die Größenordnungen, in denen seine Eltern dachten, nicht gewöhnen.
Brunos Vater war im Krieg gewesen, als die Russen in die Nähe des väterlichen Gutes kamen; seine Mutter floh, das war 1945, mit einem kleinen Sohn und schwanger mit Brunos Schwester, sie floh aber nicht, bevor sie nicht das Familiensilber mit „Mamsell“, der vertrauten langjährigen Köchin des Gutes, im Garten vergraben hatte. Die Herrschaft der russischen Armee konnte ja nicht von langer Dauer sein, dachten sie, dann kam man wieder und hatte das Silber gerettet.
Die Qualen seiner Eltern in dieser Zeit hat Bruno sich nie vorstellen können. Seine Mutter, hochschwanger, im Ungewissen über das Schicksal ihres Ehemannes im Krieg, machte sich auf den Weg nach Westen, immer vor der russischen Armee her. Aber die Verkehrsmittel, Bahn und Pferdefuhrwerk, hatten nicht gerade auf Brunos Mutter gewartet, sondern wurden dazu eingesetzt, die geschlagene deutsche Armee nach Westen zu bringen, man hatte keinen Platz für alleine fliehende Frauen.
„Da kam mir zugute, dass ich schwanger war und die Regierung die Förderung arischen Nachwuchses immer noch auf ihrem Programm hatte“, erzählte sie später immer und immer wieder, „die Offiziere, die ich um Hilfe bat, ließen mich in den Armeezügen mitfahren, aber nie gerade nach Westen, sondern immer dahin, wo die Armee sich gerade hinbewegte. So kam ich dann im Februar nach Neustrelitz, in der Nähe von Rostock, da wurde deine Schwester geboren, auf dem Bahnhof.“
Als Bruno diese Geschichte zum ersten Mal hörte, war sie eine Geschichte wie jede andere auch. Erst als junger Mann verstand er die Bedeutung des Programms „Förderung des arischen Nachwuchses“ , noch später sah er die Bilder von Flüchtlingen, die zu Fuß, mit Karren, über die vereiste Ostsee flohen und wie sie reihenweise starben und begriff das unendliche Leiden, aber immer mit dem Gedanken, dass das Volk litt, das Wind gesät hatte und nun den Sturm erntete. Viel Lebenszeit war nochmal erforderlich, um menschliches Leid unabhängig von Schuld zu sehen und es mitempfinden zu können.
Das Leiden seines Vaters war subtiler, schuldbeladener und möglicherweise brutaler, wenn ein solcher Vergleich überhaupt möglich ist, ein Leiden, das er nie zeigte. Er war von seinem 22. bis zum 28. Lebensjahr als Offizier im Krieg gewesen, trug mit Stolz ein Ritterkreuz, hatte den Krieg vielleicht, so jedenfalls nach Brunos späterem Eindruck, als Möglichkeit zum Abenteuer begrüßt, aber dann offenbar doch zu viel gesehen. Er versuchte sich die Schmerzen von der Seele zu reden, indem er seine Heldentaten aus dem Krieg erzählte, die aber wollte nach kurzer Zeit keiner in seiner Umgebung mehr hören, da vergrub er sie. Nur in der Nacht stöhnte, schluchzte und schrie der Mann, der seine Leiden, die Leiden der anderen, die Bilder des Krieges nicht loswerden konnte. Bruno lernte, als er heranwuchs, einen Soldaten aus dem Weltkrieg kennen, der in Russland in Gefangenschaft gewesen war, spät und todkrank zurückkehrte und nie über den Krieg redete, er sprach eigentlich gar nicht mehr. Der, so hatte Bruno jahrzehntelang gedacht, hatte wirklich gelitten, war das Opfer seines Vaters gewesen, der ja nur Heldentaten erlebt hatte. Auch diesmal brauchte es wieder viel mehr Lebenszeit, um beide Männer als Leidende zu erkennen.
2.
Die Nissenhütte war beengt: zwei Räume unter einem rund geformten Wellblechdach, ohne Isolierung, mit einem Ofen in einem der Räume, der andere bitterkalt im Winter, beide heiß in warmen Sommern. Auf der einen Seite ein Kanal, der zwei Flüsse miteinander verband, aber nur selten von Schiffen befahren wurde, auf der anderen unkultiviertes Moor. Hierhin hatten sich die Eltern aus „Angst vor den Russen“ geflüchtet, wie sie jedenfalls Bruno und seinen Geschwistern erzählten, deren es bald drei gab: der ältere Bruder, der die Flucht mitgemacht hatte, war kurz nach Geburt der Schwester gestorben, Bruno erinnerte sich nicht an ihn. Die Schwester, Hanna genannt und ein Jahr älter als Bruno, war schon da. Es kamen noch zwei Brüder, Malte, zwei Jahre jünger und Hendrik, drei Jahre jünger als Bruno.
So wuchs er mit seinen Geschwistern heran. Sein Vater betrieb neben der Nissenhütte eine Gärtnerei, deren Produkte er in einem winzigen Bretterladen im Dorf verkaufte. Dorthin kam er mit dem Motorrad, Gangschaltung am Tank. Bruno wusste die Marke nicht mehr. Auf diesen Fahrten durfte er vorne auf dem Tank sitzen, zwischen den starken Armen des Vaters, die den Lenker hielten. Ein Gefühl der Geborgenheit überkam ihn jedes Mal, ihm konnte nichts passieren, die Welt war außen, er innen. Aber dann wurde sein Bruder Malte alt genug, um auch auf dem Motorrad mitgenommen zu werden. Der Platz auf dem Tank gehörte ab sofort dem Bruder. Bruno durfte auch mitfahren, allerdings hinter dem Vater auf dem Soziussitz. Er fühlte sich nicht mehr geschützt vor der Welt, sie konnte ihn erreichen. Eifersucht auf den Bruder mischte sich mit Stolz, dass sein Vater ihn wohl für groß genug hielt, auf dem Sozius zu sitzen.
3.
Neuburgheim hieß das kleine Dorf, das in der Nähe lag. Es war wie viele andere auch nach dem Krieg rasend schnell gewachsen, wegen der Flüchtlinge, die gleich seinen Eltern vor den Russen so weit wie möglich nach Westen geflohen waren. 2.500 Einwohner zählte die kleine Ortschaft, als alle Flüchtlinge angekommen waren.
Von der Nissenhütte führten zwei Anfahrten dahin, einer rechts und einer links neben dem Kanal, Vater und Mutter nahmen immer den linken, keiner wusste, warum, beide waren mit dickem Sand belegen, für die Pferdefuhrwerke, die Hauptwege von den Fuhrwerken tief ausgefahren, in zwei Spuren. Wenn man mit dem Fahrrad oder Motorrad in eine dieser tiefen Furchen kam, stürzte man unweigerlich, es schlingerte so lange, bis man lag. Deshalb gab es daneben schmale Spuren für Fahrrad und Motorrad, zwar auch Sand, aber immerhin fester und ohne tiefe Rillen.
Zwischen dem Damm für die Fuhrwerke und der Spur für Fahrräder war eine kleine Hecke aus Buschwerk, rechts neben dem Fahrradweg begann das undurchdringliche Schilf, das bis hinunter zum Kanal wuchs.
Jenseits der breiteren Strecke gab es eine erneute Böschung, diesmal aufwärts, etwa fünf Meter, die gesamte Erhöhung war mit Kiefern und Birken bestanden, unten mit Buschwerk, durch das man sich zwängen musste, wollte man auf den Hügel klettern. Alles stand auf losem sandigem Boden. Im Sommer gaben Büsche und Bäume starken Schatten, man fuhr nie in der prallen Sonne. Das Dickicht lebte: Es gab Vögel aller Art, Amseln, Lerchen, Stare, Spatzen natürlich, und nachts Nachtigallen, dann Kaninchen, Hasen, Mäuse, Ratten und Schlangen.
Der Kanal war voll mit Fischen. Obwohl sauber, war das Wasser nie klar, weil es mitten im Moor lag.
Einsam, mit nach innen gerichtetem Blick, saß der verlassene Bruno an dem Esstisch in seiner Villa in Göttingen und erinnerte sich. Erinnerte sich des kleinen Jungen hinter dem Vater auf dem Soziussitz und weinte vor Einsamkeit und Mitleid mit diesem kleinen Jungen und seinem einsamen Sitz auf dem Motorrad, während die starken schützenden Arme des Vaters vor ihm seinen Bruder hielten, nicht ihn.
Und indem er merkte, dass er in dem kleinen Jungen sich selbst betrauerte, sah Bruno klar und deutlich die Wagenspuren auf dem trockenen Sand des Kanalweges, sah sie, wie sie aufeinander zuliefen, sich vereinigten und sich wieder trennten, aber immer auf dem gleichen Weg blieben und verstand in plötzlicher Klarheit, wie die Spuren seinem Leben glichen, das seine Spur zog, er Margarete begegnete, sich von ihr trennte, ihr erneut begegnete. Immer wieder hatte er in seinem Leben gewonnen und verloren, wie im Spiel, nur, dass es mehr schmerzte als ein Spiel.
Zwei Brücken führten über den Kanal. Von der Nissenhütte benutzte man die erste, um in das Dorf zu kommen, das auf der anderen Seite des Kanals lag. Sie waren beweglich, man konnte sie mit einer Kurbel anheben und dann zur Seite schieben, so dass Schiffe hindurch fahren konnten. An beiden Übergängen gab es Bauern, die den Mechanismus bedienten. Wenn Bruno über den Kanal musste, ging er absichtlich langsam. Immer hoffte er, es würde ein Schiff kommen und der Brückenwärter die Brücke öffnen.
Im Winter war der Kanal zugefroren, helles Eis lud zum Begehen ein, im Sommer war er eine stille Idylle, freundlich und warm.
Auf der anderen Seite der Hütte, vom Dorf weg gelegen, begann unendliches Moor, von kleinen Ansammlungen von Kiefern, Birken, wohl auch Erlen, unterbrochen. In diesen Wäldchen gab es mehr Wild. Das Sumpfgebiet selbst war gefährlich und unheimlich, Hochmoor, nicht kultiviert, mit Löchern, die tief waren, so tief, dass man drin ertrinken konnte. Die konnte man aber sehen, gefährlicher waren die unsichtbaren und unsicheren Stellen, die erst dann in unergründliche Tiefen absanken, wenn man darauf trat und sie mit Gewicht belastete. Dunkel war es hier und unheimlich, selbst im Sommer. Manchmal, wenn man auf den sicheren Stellen ein Wasserloch passierte, blubberte es heraus, als wenn dort ein Lebewesen Luft abblies. Im Dunkeln waren oft Lichter im Moor zu sehen. Bruno fürchtete sich vor dem ganzen Gebiet, es war nicht daran zu denken, im Dunkel, oder auch nur in der Dämmerung da hineinzugehen.
An den trockenen Stellen des Moores wuchs Heide, Wollgras, es gab auch Stellen mit bloßem Sand, der dunkelgrau war. Wenn auf diesen Stellen im Sommer ein Stück Holz lag, war es manchmal kein Holz, sondern eine giftige Kreuzotter, der man besser aus dem Wege ging, oder eine Ringelnatter, die war aber ungefährlich. Im Sommer gab es viele Schlangen im Moor und auf der Heide.
Die Nissenhütte selbst lag auf einem kahlen Platz. Wenn man vom Weg her hin wollte, lag links vom Platz die Hütte selbst, rechts daneben hatte der Vater für sein Gemüse die Gewächshäuser aus Glas errichtet. Es gab ein Bild, auf dem seine Eltern mit ihm, seiner Schwester Hanna, und seinem Bruder Malte zu sehen sind. Seine Mutter saß, eine schlanke, schwarzhaarige Frau, mit gerader Nase und einem geschwungenen Mund, eine schöne Frau, sein Vater stand daneben, hochgewachsen, ebenfalls schlank, mit Hut, der Offizier war vor allem aus seinem strengen Mund zu erkennen, beide mit ernsten aristokratischen Gesichtern vor der ärmlichen Nissenhütte, in die ein grausames Schicksal sie verbannt hatte.
4.
Als Bruno fünf Jahre war, zogen seine Eltern mit der ganzen Familie um. Mittlerweile war ein weiterer Bruder, Hendrik, dazugekommen, Die Eltern wohnten nun mit vier Kindern in dem Dorf, in einem Haus, das der Vater selbst hatte bauen lassen. Dieses Haus lag nicht mitten im Dorf, sondern am Rande, immerhin waren es nur noch fünf Minuten zu Fuß zum Kaufmann, ebenso viel zur Kirche.
Zu dem Haus gehörte ein großes Grundstück. Der Vater hatte um dieses Grundstück im Abstand von zwei Metern Pappeln gepflanzt, um seinen Besitz zu begrenzen. Mit Zäunen grenzten nur Kleinbürger ihren Besitz ein, pflegte er zu sagen, Pappeln wüchsen schnell, dann hätten sie ein kleines Anwesen und nicht nur ein großes Grundstück. Bruno erinnerte sich, dass seine Schwester, kurz nachdem sie umgezogen waren, in die Schule kam, Bruno selbst war zu dieser Zeit damit beschäftigt, Fahrrad fahren zu lernen. Die Familie war zu arm, um den Kindern Räder kaufen zu können, so lernte Bruno auf dem Herrenrad des Vaters. Oberhalb der Stange auf dem Sattel sitzend, konnte Bruno nicht treten, die Beine waren zu kurz, und so hielt er das Fahrrad sehr schräg und lernte fahren, indem er unterhalb der Stange die Pedale trat. Das erleichterte das Lernen nicht eben, auch nicht, dass zu dem Haus ein Schlackenweg führte, immer wieder fiel Bruno hin und schlug sich die Knie auf.
Das Haus selbst war klein, ein Siedlungshaus; es hatte unten ein Wohnzimmer, durch eine Schiebetür teilbar, ein kleines Badezimmer und eine Küche. Oben waren zwei Zimmer, eines teilten sich anfangs die Eltern, in dem anderen schliefen die vier Kinder. Dies wurde nach und nach schwierig, die Eigenheiten der Kinder fingen an, sich herauszubilden. Malte „rollte“. Nachts konnte er nicht ruhig liegen, sondern rollte stets von der rechten zur linken Seite und zurück. Dies hinderte die anderen Geschwister am Schlafen. Mutter nahm Malte mit ins elterliche Schlafzimmer, wo das Rollen aufhörte. Allerdings zog die Mutter kurz danach in den unteren hinteren Teil des Wohnzimmers. Sie konnte nicht mehr beim Vater schlafen, wie sie sagte, da er schnarche. Das klang für Bruno damals plausibel.
In diesem Haus spielte sich jetzt Brunos Leben ab. Es war klein, der Garten riesig, die Pappeln, von Vater gepflanzt, regten zum Klettern an, aber wehe, man ließ sich dabei erwischen: Dann legte sein Vater ihn übers Knie und dann gab es „das Jack voll“, wie er das nannte, der alte Halcan konnte fürchterlich hauen, das tat weh, aber noch mehr schmerzte die Missbilligung, die in der Prügel zum Ausdruck kam. Hinter dem Garten war zwar das heimische Grundstück zu Ende, nicht aber die Welt: Von der Grundstücksgrenze gelangte man nach hinten auf eine Weide von riesigen Ausmaßen, auf denen die Pferde eines Bauern standen. Sie war auf allen Seiten von hohen Hecken umstanden, die immer ein bisschen im Wind rauschten. Rechts daneben, hinter dichtem Gebüsch, lag ein Kolk, ein kleiner See, in dem Fische und Frösche lebten. Die Eltern hatten die Kinder in ernstem Ton vor dem Wasser gewarnt: er ist sehr tief, hatten sie gesagt, unten in der Tiefe auch geheimnisvoll, Kinder ertrinken darin, wenn sie zu nah heran gehen.
Hinter der Wiese mit den Tieren der Fluss, damals klein und schnell fließend, mit Weiden und Pappeln an seinem Ufer, auf der anderen Seite wieder Weiden und Felder.
Das war aber nur der Garten nach hinten. Links vom Haus war ein Feld, das alle paar Jahre mit Roggen bestellt war. Im Spätsommer kamen die Bauern mit Sensen und schnitten das reife Getreide, bündelten es und stellten es zu kleinen Hütten auf. Während der Ernte durften sich Bruno und die Geschwister besser nicht am Feld sehen lassen. Es gab nämlich Spuren, flach getrampelte Pfade im Feld; natürlich hatten die Kinder die hochstehenden Pflanzen benutzt, um Verstecken zu spielen, was neben dem Reiz des Spieles auch den Reiz der Gefahr hatte: Wurde man vom Bauern erwischt, gab es eine kräftige Tracht Prügel. Natürlich war das Verhältnis zu dem Bauern zur Linken nicht sehr freundschaftlich, dafür ging Bruno häufig auf den Hof, zu dem die Koppel nach hinten gehörte. Der Hof selbst lag im Dorf, zum Ackern benutzten die Bauern drei Pferde, die zu Feierabend auf die Weide getrieben und morgens geholt wurden. Der Altbauer war damals schon über 60 Jahre, er hatte zwei Söhne, mit denen er den Hof betrieb. War das eine warme Küche im Bauernhaus, in dem Frau Hinners, die Bäuerin, stand, das frisch gebackene Brot an ihren Busen presste und Scheiben abschnitt! Diese Scheiben wurden dick mit Margarine bestrichen und mit Zucker bestreut, ein Leckerbissen.
Der Alte nahm Bruno, den er besonders ins Herz geschlossen hatte, ab und zu beiseite und sang ihm, flüsternd, heimlich Lieder:
„Wir wollen unsern alten Kaiser Wilhelm wiederham“,
und, einen halben Ton höher, die gleiche Zeile nochmal:
„Wir wollen unsern alten Kaiser Wilhelm wiederham“.
Oder:
„Und unsre Fahne, die ist schwarz-weiß-rot“.
Bruno hatte keine Ahnung, was der Alte ihm da vorsang. Er wusste nichts von Kaisern, von Wilhelm oder Fahnen, aber er nahm das, was der alte Hinners ihm da vorsang und dazu erzählte, sehr ernst. Es musste ja ernst sein, sonst hätte der Alte kaum von seinem gewohnten Plattdeutsch in das ihm beschwerliche Hochdeutsch gewechselt.
Tief in seine Erinnerungen versunken, saß Bruno an seinem Fenster in Göttingen und sah mit blinden Augen hinaus. Nie mehr hatte er an den Garten seines Vaters in Neuburgheim gedacht, nie hatte er registriert, wie genau sich der Anblick der Bäume, der Blumen und der Umgebung dieses Hauses in Neuburgheim in ihm festgesetzt hatten, selbst die Gerüche hatte er heute noch in der Nase. Gerüche! Sehr genau erinnerte er sich, wie die Kinder in der ersten Klasse der Schule rochen, nach Land, nach Tieren und ein bisschen nach saurer Milch.
5.
Zuerst kam seine Schwester Hanna in die Volksschule, da war Bruno noch nicht fünf Jahre alt. Unterrichtet wurde in einem Gebäude mit zwei Zimmern für die evangelischen Kinder, die katholischen Kinder hatten ihre eigenen Lehrer.
Bruno begleitete seine Schwester jeden Morgen um kurz vor acht Uhr zur Schule und holte sie nach Ende wieder ab. Seine Eltern waren gerührt: „Seht doch, wie Bruno an seiner Schwester hängt, jedes Mal bringt er sie hin und holt sie ab.“ Aber Bruno war nicht anhänglich, nicht darum begleitete er seine Schwester. Er brachte Hanna zur Schule und holte sie ab, weil er sich alt genug fand und sobald wie möglich auch lernen wollte.
Seine Eltern hatten mit der Lehrerin gemeinsam ein Einsehen, als Bruno noch nicht 6 Jahre alt war. Zu Ostern, vor seinem sechsten Geburtstag, kam er in die Schule.
Lehrerin war Fräulein Ralle, ungefähr 60 Jahre alt. Wenn Bruno heute an sie dachte, hatte er für ihr Aussehen nur ein Wort: gemütlich. Sie hatte eine dunkle, sonore Stimme, war nicht sonderlich streng. Fräulein Ralle war zunächst die einzige Lehrerin für evangelische Kinder am Ort. Sie musste daher alle acht Klassen gemeinsam unterrichten. Von Nachteil dabei war, dass sie den Unterricht in Hochdeutsch abhalten musste, das von den ungefähr achtzig Kindern nur 10 verstanden. Sie wechselte daher häufig ins Plattdeutsch, um etwas zu erklären. Sie musste alle fünf Minuten von einem Zimmer ins andere gehen, weil sie sich ja um beide Klassen kümmern musste, was nicht zur Disziplin im anderen Zimmer beitrug.
Von Vorteil war, dass es nicht so sehr darauf ankam. Die meisten Schüler kamen von den Bauernhöfen, deren Eltern sowieso nicht recht einsahen, wieso ihre Kinder zur Schule mussten; sie brauchten sie als Arbeitskräfte auf den Höfen. Ein Junge musste rechnen können und ein Mädchen nähen und kochen, was der übrige Unsinn sollte, war unverständlich. Fräulein Ralle trug das alles mit einer unendlichen Geduld. So war ein heulender Junge der zweiten Klasse nicht zu beruhigen. Der Vater war mit Pferden und Leiterwagen in der Pause an der Schule vorbeigefahren, der Junge wollte mit. Fräulein Ralle ließ ihn und erntete Dankbarkeit bei Vater und Sohn.
In der Kirche gab es den alten Kantor Wührmann, der nur acht Finger hatte und damit die Orgel spielte, ungefähr 70 Jahre alt. Ein Schüler der 4. Klasse hatte gerechnet: Kantor Wührmann 70 Jahre, unverheiratet und Fräulein Ralle 60 Jahre, unverheiratet. Das Ergebnis kleidete er in eine Frage, vor der Klasse gestellt: „Fräulein Ralle, warum heiratest du nicht Kantor Wührmann?“ Mit fester Stimme antwortete sie: „Jetzt nicht, Hinderk, wie viel ist 2 und 3?“ Und erreichte, dass Hinderk seine Finger nahm und rechnete.
6.
Jetzt zeigte sich, wie gut es war, dass die Eltern in das Dorf gezogen waren. Bruno brauchte, um in die Schule zu kommen, nur fünf Minuten zu gehen.
Aber was gab es im Dorf nicht alles zu sehen.
Da waren zunächst die seltenen Lastkraftwagen. Bruno war Sachverständiger für Lastkraftwagen, hatte doch sein Vater auch einen und fuhr damit in die weite Welt. Noch beim Erinnern wurde Bruno warm. Er schlief. Auf einmal, es mochte vier Uhr morgens sein, stand sein Vater, noch im Nachthemd, vor seinem Bett, flüsternd: „Bruno wach auf!“ und nach einer Weile: „Bruno, wach auf, willst du mit nach Ibbenbüren fahren?“ Und ob Bruno wollte! Er wusste, um Schule musste er sich nicht kümmern an solchen Tagen, sein Vater würde in seiner unleserlichen Handschrift eine Entschuldigung schreiben. Blitzschnell erwachte er, sprang auf, zog sich an, wusch sich, während sein Vater schon aus dem Hause ging, und folgte dem Vater. Er stieg in den Lkw, einen Mercedes mit ganz langer Schnauze, mit Anhänger und Plane, und sie fuhren los. Auf diese Weise nach Ibbenbüren, Bruno wusste nicht, was sie da holten, nach Lengerich, da holten sie Zement. Immer ging es am Rande des Teutoburger Waldes entlang und sogar hinein. Sie waren den ganzen Tag unterwegs.
Wie sollte Bruno da nicht Sachverständiger sein. Auf dem Hof der Gaststätte Gruber machten viele Lkw-Fahrer Pause, darunter manchmal Holländer, und Bruno stellte sich zu ihnen und träumte davon, einer von ihnen zu sein oder mindestens zu werden.
Bei Gruber war noch mehr los. Immer sonntags, um halb zehn, kamen die Kutschen angefahren, von zwei, manchmal vier Pferden gezogen, schwarze, weich gefederte, geschlossene Kutschen, innen luxuriös gepolstert, gefahren von Kutschern, die bäuerlich gekleidet waren. Die Ankunft einer Kutsche kündigte sich durch den Hufschlag der Pferde auf dem Kopfsteinpflaster und durch das Rollen der Räder an. Hielten die Kutschen, entstiegen ihnen die Großbauern aus der Umgebung, die in ihren schwarzen Anzügen zur Kirche gingen, und zwar zur reformierten. Ernst, schwer und im Bewusstsein ihrer Würde verließen sie ihre Wagen und wandelten würdig zur Kirche, und zwar Sonntag für Sonntag, indes die Kutscher die Pferde abspannten und in der Remise bei Gruber unterstellten. Je älter Bruno wurde, desto öfter folgte er ihnen in die Kirche und zum Gottesdienst. Sie fasste ungefähr 400 Menschen und war jeden Sonntag bis auf den letzten Platz gefüllt, die Männer links von der Kanzel, die Frauen rechts davon, die nicht konfirmierten Kinder bei den Frauen. Hier hielt Pastor Ammermeier jeden Sonntag seine Predigt, ein donnernder Redner, der den Zuhörern die Lehren Jeremias, Jesajas, Amos und all der anderen finsteren Propheten des Alten Testaments um die Ohren schlug, der aber weder mit Text noch mit finsteren Drohungen noch mit Lautstärke verhindern konnte, dass die Besucher, von der harten Arbeit der Woche ermüdet, im warmen, von Menschendunst erfüllten Kirchenschiff den Kampf mit dem süßen Schlaf verloren. Besonders erbittert war der Pfarrer, dass auch die Kirchenältesten, auf Ehrenplätzen für alle sichtbar, den Verlockungen des Schlafes an den meisten Sonntagen nicht widerstehen konnten.
Nach der Kirche und dem Segen traf man sich auf dem Kirchplatz, wo wichtige Landgeschäfte mit Handschlag abgeschlossen, Schweinepreise diskutiert und gegenseitige Besuche verabredet wurden.
Das war Brunos Welt in dieser Zeit. Immer kam er von seinen Erlebnissen nach Hause zu seinen Eltern, zu seinen Geschwistern, in eine vertraute Welt.
7.
Bruno stand, achtjährig, vor dem Verkaufstresen des Lebensmittelgeschäftes, hinter dem die Besitzerin, Frau Koopmann, bediente. Gleich würde er dran sein, würde Frau Koopmann ihn nach seinen Wünschen fragen. Bruno hielt in der kleinen verschwitzten Hand den Einkaufszettel, den seine Mutter ihm mit gegeben hatte. Bruno fühlte, wie der Kloß in seinem Hals immer größer wurde, und jetzt richtete sich der Blick der Besitzerin auf ihn.
„Nun, Bruno, was solls denn heute sein, “ fragte sie nicht unfreundlich.
„Ein Kilo Weizenmehl,“ las Bruno den ersten Posten auf der Liste vor und Frau Koopmann wendete sich zu der großen Schrankanlage hinter ihrem Rücken und füllte aus einer Schublade ein Kilo ab, stellte die Tüte auf den Tresen und fragte nach den nächsten Wünschen. Eine lange Liste hatte seine Mutter ihm mitgegeben, hinter ihm sammelten sich neu hinzugekommene Kunden, die Schlange wurde immer größer und der Kloß in Brunos Hals immer dicker.
„Sonst noch was?“ fragte Frau Koopmann hinter den Tüten auf dem Tresen und sah Bruno an.
„Nein danke“, presste er hervor und Frau Koopmann begann mit ihrem Bleistift auf einem Block zu rechen.
„Dreiundzwanzig Mark sechzig“, sagte sie dann und sah ihn an.
„Anschreiben lassen“, Bruno bemühte sich, seiner Stimme einen tiefen Klang zu geben, das gelang ihm aber nicht, stattdessen wurde sie noch piepsiger als zuvor.
Und dann kam, was er befürchtet hatte, seit die Mutter ihn zum Einkaufen losgeschickt hatte.
„Hör mal, Bruno, das geht aber nicht so weiter, weißt du eigentlich, wie viel ich schon angeschrieben habe?“ fragte Frau Koopmann ihn mit energischer Stimme, „hier stehen schon über hundert Mark, wann will deine Mutter das denn eigentlich alles bezahlen?“
Am liebsten hätte Bruno sie gebeten, leiser zu sprechen, damit die wartenden Kunden nicht mitbekamen, dass er kein Geld hatte, um zu bezahlen, aber das ging wohl nicht an. Er zuckte die Schultern, den Tränen nahe.
„Ich weiß nicht, meine Mutter hat gesagt, ich soll anschreiben lassen“, flüsterte er heiser und verstummte.
„Na gut, diesmal noch, aber sag deiner Mutter einen schönen Gruß, das geht nicht mehr so weiter,“ und Frau Koopmann packte die Tüten in die Tasche, die er ihr zum Tresen hochreichte, und mit hochrotem Kopf ging Bruno aus dem Laden, froh, dass Frau Koopmann diesmal nur geschimpft, aber nicht die Waren wieder zurückgestellt hatte, so dass er mit leerer Tasche aus dem Laden hätte gehen müssen.
Seit sie nicht mehr in der Nissenhütte wohnten, waren sie dem Dorf näher gerückt. In der Hütte war die Familie unter sich, Bruno kannte kein anderes Leben als das in der Familie. Erst als sie in das Dorf zogen, kam er mit den anderen Menschen in Berührung wie mit Frau Koopmann und ihren Kunden. Bruno merkte, sie waren arm, bettelarm.
Nicht nur, dass er bei Frau Koopmann das gefürchtete „anschreiben lassen“ aussprechen musste, Bruno hatte nie neue Sachen, keine Hosen, keine Schuhe, keine Hemden. Immer musste er die Sachen von seiner Schwester Hanna auftragen, „Mädchensachen“ wie er nicht nur einmal in der Schule gehänselt wurde. Am Anfang, als es nur zwei Klassen gab, fiel das nicht so auf, die Bauernkinder waren nicht besser angezogen. Später, in der neuen Schule, gewannen allmählich die Bürgerkinder die Überzahl. Die Bauern gingen nach wie vor ärmlich gekleidet, aber zu denen gehörte Bruno ja nicht. Er gehörte zu den Flüchtlingen, gekleidet war er aber wie ein Bauernkind.
Am schlimmsten waren aber die Kaufleute wie Frau Koopmann, die er hasste, übrigens auch Frau Harmsen, die Fleischersfrau oder Herrn Gerdes, den Inhaber von Kaiser´s Kaffee, wo er auch „anschreiben lassen“ sagen musste.
Ging nichts mehr, war überall die Liste der Schulden zu lang, musste er zu Fransen. Hier kaufte man nicht gerne ein, der war katholisch. Und außerdem hatte er, beklagte sich die Mutter, nichts Frisches. Herr Fransen hatte eine ruhige, besonnene Art, die Sachen wieder wegzupacken, wenn er nicht anschreiben wollte. Meistens wollte er aber, dann schrieb er auf, ohne aber Bruno zu demütigen. Bruno fand Katholische nicht so schlimm, Herrn Fransen jedenfalls nicht.
8.
Je älter Bruno wurde, desto mehr veränderten sich seine Freundschaften. Immer weniger ließ er sich bei dem Bauern Hinners sehen. Der Alte war gestorben und die Söhne hatten wenig Zeit für die Kinder.
Dafür gab es andere Bekanntschaften. Da war zum einen Dieter. Dieter war auch ein Flüchtlingsjunge, seine Eltern allerdings nicht arm wie Brunos Eltern. Der Vater arbeitete bei der Wohlmann AG, einer Ölförderfirma, bei der die meisten Flüchtlinge Arbeit gefunden hatten und gutes Geld verdienten. Dieter war immer gut gekleidet, er redete die gleiche Sprache wie Bruno und seine Eltern. Dieter war so, wie Bruno gerne sein wollte. Nur teilte er die Freundschaft nicht, die Bruno ihm entgegen brachte. Er verschwand nach einem Jahr, Bruno hörte die Lehrerin sagen, sein Vater sei „versetzt“ worden, in einen anderen Ort.
Im Norden des Hauses, in dem Bruno wohnte, hatte sich zum Dorf hin eine kleine Siedlung gebildet. Dort zog eine Familie Klanders mit ihrem Sohn Karl ein, der ein Jahr älter als Bruno war und den Bruno und seine Brüder Kalle nannten. Kalle war ein Freund der drei Brüder, nicht unbedingt ein Freund von Bruno. Die Unterscheidung war deshalb von Bedeutung, weil sich unter den drei Brüdern ein wechselndes Verhältnis entwickelte. Bruno war der Älteste und hätte auch der Stärkste sein sollen. Nach ihm kam Malte, nur ein Jahr jünger und fast gleichstark, aber was Malte schwächer war, machte er durch größeren Mut wett: Er kletterte auf die höchsten Bäume, übersprang die weitesten Gräben. Bruno gab sich natürlich mutiger. Ohne den Ansporn seines jüngeren Bruders hätte er viele Abenteuer nicht auf sich genommen.
Hendrik, der Jüngste, hatte gegen Malte keine Chance und gegen Bruno noch weniger. Er war rettungslos verloren, wenn Bruno und Malte sich gegen ihn verbündeten. Andererseits war Bruno unterlegen, wenn sich seine beiden jüngeren Brüder gegen ihn zusammen taten. Bruno hatte noch immer Narben am Bein, die ihn an einen solchen Pakt seiner Brüder erinnerten. Diese Bündnisse wurden immer nur für kurze Zeit geschlossen, sie zerbrachen schnell und neue wurden geschlossen, In diesen Kämpfen ging es oft um Kalle, den Ältesten und Stärksten und seine Freundschaft. Im Wetteifer der Brüder um diese Freundschaft, der durch den täglichen Verteilungskampf der Geschwister beim Esstisch verstärkt wurde, sammelte sich so viel Zündstoff auf, dass die Brüder sich selten sehr lange vertrugen.
So war das Leben in dieser Zeit in Brunos Erinnerung geprägt von Kämpfen, Bündnissen, Verletzungen, in dieser Zeit lernte er, mit anderen zu paktieren, rechtzeitig nachzugeben und zu wissen, wann er angreifen konnte.
9.
In der vierten Klasse hatten Bruno und seine Mitschüler Unterricht bei Fräulein Blume. Sie wusste den Heimatkundeunterricht besonders spannend zu gestalten und versuchte, den Kindern auch erste Nachrichten vom politischen Geschehen zu vermitteln. So erzählte sie den Viertklässlern eines Tages von der Atombombe.
„Im Krieg gab es Bomben, die waren nichts gegen die neuen Atombomben, die die Russen jetzt haben. Eine solche Atombombe ist so groß wie eine Streichholzschachtel. Wenn die explodiert, ist von hier bis Hermstadt alles verbrannt und kaputt. Alles Menschen sind dann tot.“
Von den Russen hatte Bruno schon gehört. „Die Sowjets“, wie sein Vater sie nannte, oder „die Russkis“, von denen Anni, ihr Kindermädchen zu berichten wusste, konnte man leicht erkennen. Sie wuschen sich nicht zwischen den Fingern. Anni brachte das besonders gerne an, wenn Bruno und seine Geschwister sich nicht ordentlich die Hände wuschen.
Was half es aber, so fragte sich Bruno, wenn man sie erkennen konnte, aber nicht wusste, ob sie eine Streichholzschachtel bei sich hatten, die sich als Atombombe entpuppte? Jahrelang hatte er Alpträume, in denen solche Bomben, getarnt als Streichholzschachtel, explodierten.
Fräulein Blume war aus Sicht des 8 jährigen Bruno alt, so 30 oder 35 und lebte in Neuburgheim. Hanna traute sich, sie ging zu Fräulein Blume, ließ sich wie andere Mädchen Häkeln beibringen und lauschte ihren Geschichten. Bruno traute sich nicht und war also auf die Erzählungen in den Schulstunden angewiesen. Man lebte in einer Demokratie, das sollte eine feine Sache sein, weil das Volk herrschte. Das Volk, so begriff es Bruno, hieß Adenauer, weil der der Chef von Deutschland war. Auch Adenauer hatte mit den Russen zu tun. Eines Tages erzählten Fräulein Blume und die Eltern zu Hause, Adenauer habe ganz viele Gefangene von den Russen nach Hause geholt. Es gab Bilder in den Zeitungen, die Bruno noch nicht lesen konnte, auf denen ein uralter Mann mit zerknittertem Gesicht neben ausgemergelten jüngeren Männern mit Soldatenmützen zu sehen war.
Sein Vater mochte, im Gegensatz zu Fräulein Blume, Adenauer nicht, wie er zum Besten gab. Es gab einen zweiten Mann, Strauß hieß er, den mochte der Vater schon eher. Der konnte sich aber nicht richtig durchsetzen, weswegen der Vater auch eine andere Partei wählte. Was das alles bedeuten sollte, wusste Bruno nicht. Er glaubte jedenfalls fest an Adenauer, weil der den Russen die Gefangenen weggenommen hatte. Fräulein Blume versuchte dann noch, den Viertklässlern beizubringen, was ein Parlament war und wie Regierung funktionierte, aber da hörte selbst Bruno nicht hin. Fräulein Blume sah ihm das nach und gab es auf, davon zu erzählen. Sie hatte andere Sorgen. Neben Bruno saß Henrik Hanken, der schon drei Mal sitzen geblieben war, ein kräftiger Junge, über zwölf Jahre alt, der alle in der Klasse hätte verhauen können. Die Stärke nutzte ihm aber nichts, weil er nach den Maßstäben von Fräulein Blume der Schwächste war. Henrik konnte nicht einmal das Wort „König“ lesen. Wurde er hierzu aufgefordert, buchstabierte er jeden Buchstaben laut „ K-ö-n-i-g“, konnte die Buchstaben erkennen, wusste aber nicht, was die Zusammensetzung bedeuten sollte. Wurde Henrik aufgefordert, 3 und 6 zusammenzuzählen, nahm er seine Finger zur Hilfe, 3 und 6 gab 9, das war in Ordnung, fragte ihn aber jemand nach 6 und 7, reichten die Finger nicht aus. Henrik sah zu Bruno auf, er war zwar weit stärker, aber Bruno war ohne jeden Zweifel und mit weitem Abstand der beste Schüler in der Klasse. Er konnte König lesen und 3 mal 7 ausrechnen. Bruno hatte auf dem Zeugnis lauter Einsen, Henrik lauter fünfen, eine sechs gab es damals noch nicht.
10.
Brunos Großmutter mütterlicherseits, von den Kindern Mum genannt, lebte in Hannover. Bruno, knapp 10 Jahre alt, durfte mit seinen Eltern, ohne Geschwister, nach Hannover fahren, Mum besuchen. Nie hatte Bruno sich geborgener gefühlt, hinten sitzend in dem VW Käfer des Vaters, der Vater fuhr, die Eltern plauderten vorne, Bruno konnte nicht verstehen, was, wollte aber auch nicht zuhören, er fühlte sich einfach nur von den Eltern beschützt.
Die Fahrt war endlos. Kurz vor Hannover wendete sich der Vater zu Bruno um und sprach ihn an.
„Bruno, wenn wir gleich zu Mum kommen, ist da eine Dame, ungefähr so alt wie Mama. Das ist Tante Kathrin, die Schwester Deiner Mutter. Du weißt doch noch, wie ich dir den Handkuss beigebracht habe? Tante Kathrin ist eine Dame, der man den Handkuss gibt. Also nicht vergessen: Benimm dich anständig und küss ihr zur Begrüßung die Hand!“
„Ja, Papa.“
Bruno erinnerte sich, wie sein Vater angefangen hatte, ihm das beizubringen, was er für gutes Benehmen hielt. Schrieb man, nach Weihnachten, Dankesbriefe an Onkel und Tanten, hatten diese unterschrieben zu sein mit „Dein sehr ergebener Neffe Bruno“, begegnete man einer Dame, so hatte man ihr die Hand zu küssen, so: Papa nahm die Hand seiner Ehefrau, beugte sich darüber und hauchte einen Kuss darüber, ohne sie mit dem Mund zu berühren. Bruno machte es nach, die Mutter lachte: „Nein, nicht knutschen, nur leicht andeuten.“ Sie übten so lange, bis er es konnte. „Muss ich nun auch Frau Koopmann die Hand küssen, wenn ich bei ihr einkaufe?“ Beide Eltern lachten noch lauter: „Nein, der selbstverständlich nicht, die ist eine einfache Frau, da macht man das nicht.“ Bruno verstand das nicht, bei Frau Koopmann musste man immerhin anschreiben, da wäre man doch vernünftigerweise besonders höflich. Er hatte aber, weil in Neuburgheim nach Auffassung der Eltern nur einfache Frauen wohnten, den Handkuss noch nie probiert. Nun kam also die Probe aufs Exempel.
Mum wohnte im 7. Stock, bis dahin musste man zu Fuß hochgehen. In der Tür stand Mum, die Bruno sehr liebte, und begrüßte sie, vor allem Bruno, mit einem Kuss. Hinter ihr, im Flur, stand eine Dame, dick, ungefähr so alt wie die Mutter. Artig ging Bruno auf sie zu, nahm die Hand der verblüfften Frau und hauchte einen formvollendeten Handkuss darüber. Alle Erwachsenen brachen in infernalisches Gelächter aus, Bruno floh ins nächste Zimmer und erfuhr daher später den Grund der Heiterkeit: Er hatte der Putzfrau von Mum die Hand geküsst, Tante Kathrin war noch nicht da. Bruno schämte sich sehr.
Am nächsten Tag ging er allein mit der Mutter in die Stadt, die man von der Wohnung Mums zu Fuß erreichen konnte. War das eine Riesenstadt! Bruno kannte bisher nur Neuburgheim. Klar, auch da gab es eine Hauptstraße, ein Kino, Schuhladen, Zahnarzt und Kneipe. Aber weniger Menschen. Hier dagegen wimmelte es von Menschen. Um sie herum hasteten sie, liefen, verzweigten sich, trafen sich, redeten, machten Krach. Und Häuser! Häuser, die so hoch waren, dass sie in den Himmel ragten. In Neuburgheim war der Schuhladen das höchste Haus, drei Etagen hatte es. Bruno musste den Kopf schon sehr in den Nacken legen, ehe er das Dach sehen konnte. Aber hier? Hoch, hoch waren sie, es half nichts, den Kopf in den Nacken zu legen, er konnte das Dach nicht sehen. Zwischen den Häusern von der Straße aus konnte er ein kleines Stück Himmel sehen, nicht mehr. Und wo waren bloß die Wiesen zwischen den Häusern? Wiesen, die grün waren mit Kühen drauf, die einen anguckten. Hier gab es weder Kühe noch Wiesen, keine Pausen zwischen den Häusern und Menschen. Bruno stand, staunte, guckte und fürchtete sich ein bisschen. Aber die Mutter war da und beschützte ihn. Sie kannte die Stadt, sie wusste schon, wie er sich benehmen musste und wie sie wieder nach Hause, nach Neuburgheim, kamen. Ganz leise tastete seine Hand nach der Mutter. Aber seine Mutter war nicht da!
Gerade lief sie noch neben ihm! Wo ist sie? Er ist stehen geblieben, ist sie vielleicht weiter gelaufen? Entsetzt und gehetzt sieht sich Bruno um. Keine Mutter. Auch nicht da, wo sie vielleicht weiter gelaufen sein könnte. Keine Mutter, nur riesengroße Häuser und Menschen, Menschen, aber keine Mutter. Die Menschen erscheinen ihm auf einmal immer größer, sie laufen schneller, immer schneller dreht sich um den Jungen der Kreisel der Stadt, der riesengroßen Stadt. Bruno steht und fürchtet sich. Ganz langsam füllen sich die Augen mit Tränen: Nein, nur jetzt nicht weinen, das macht es nur noch schlimmer. Aber die Tränen kommen, sie kommen immer höher, egal ob er will oder nicht. Ganz langsam, Bruno steht inmitten der Häuser und Menschen, verzieht sich sein Mund, er kann es spüren, wie sein Mund breiter wird, wie gleichzeitig mit den Tränen sein Mund beginnt zu weinen, und dann weint der ganze Junge, er kann es nicht aufhalten, Schluchzen schüttelt ihn und nun weint auch seine Stimme. Er hat den Bissen vom Brötchen, das ihm seine Mutter gekauft hat, noch im Mund, der ihm gerade noch so gut geschmeckt hat und den er jetzt vor Kummer und automatisch weiter kaut. Bruno steht mitten auf dem Bürgersteig in Hannover, von hastenden Menschen umgeben, mutterseelenallein und kaut und schluchzt und weint zum Gotterbarmen. Nie wieder wird er aufhören können zu weinen, seine Mutter ist weg, nie wird sie wiederkommen, sie wird ihn hier allein lassen, mit den Fremden, den Unmenschlichen, den Riesen, und er steht allein und schluchzt und weint und beißt vor lauter Verzweiflung noch mal in sein Brötchen und kaut und weint und in seinem Mund vermischen sich Brötchen, Tränen und Schnodder.
Menschen stehen um ihn herum: „Was hat der Junge bloß? Warum weint er denn so?“ Er kann ihnen nicht antworten, er schluchzt und weint und ist zu verzweifelt, um sie zu hören. Sein ganzer kleiner, fast zehn Jahre alter Körper bebt unter dem Schluchzen und dem Leid, dass seine Mutter weg ist. „Mama“ schluchzt er, mit der Betonung auf der letzten Silbe.
Eine ganz weiche, liebevolle Stimme spricht neben ihm. Er kennt sie nicht, aber sie ist vertrauenserweckend und ihm zugeneigt: „Wo ist denn deine Mama?“, fragt sie und so, als ob sie ihm helfen will. „Weiheiß nihicht“, schluchzt er und versucht, die anzusehen, deren Stimme er vertraute. Er sieht eine Frau in der Hocke neben ihm. „Wollen wir sie nicht suchen gehen?“, fragt sie. Bruno nickt.
Sie richtet sich auf und nimmt seine Hand. „Wo hast du deine Mama denn zuletzt gesehen?“ Er blickt zu ihr auf „Hier“, antwortet er. Sie steht etwas unentschlossen da. „Vielleicht ist es das Beste, wenn wir hier einen Moment warten, vielleicht kommt sie dich holen“, schlägt sie vor. „Aber Du gehst nicht weg?“, fragt er angstvoll. Da hört er plötzlich eine vertraute Stimme „Bruno, wo bist du denn?“, Er reißt sich los und rennt auf die Stimme zu „Mama! Mama! Hier bin ich!“, und schließt seine Mutter in den Arm und lässt sich von ihr hoch heben. Die junge Frau nähert sich: „Na also, habe ich mir doch gedacht, dass Deine Mutter nicht weit sein kann. Also dann Tschüs, Junge, und verlauf Dich nicht wieder.“ Sie verabschiedet sich, nachdem die Mutter ihr herzlich gedankt hat.
Wieder kamen Bruno vierzig Jahre später die Tränen, als er an den kleinen einsamen Jungen in Hannover dachte. Wie einsam war er damals gewesen, wie oft ist er seitdem verlassen worden und wie einsam ist er jetzt. Ablenken wollte er sich von Margarete und tauchte wieder ein in die Erinnerungen, auf der Suche nach seiner Geschichte.
11.
In Neuburgheim zurück standen große Veränderungen an. Bruno sollte zum Gymnasium. Das war in der ungefähr 30 Kilometer entfernten Kreishauptstadt Hermstadt gelegen. Hanna war schon ein Jahr früher dorthin gegangen, deshalb wusste Bruno, was ihn erwartete: Jeden Morgen um 6 Uhr aufstehen und mit dem Zug eine Stunde bis nach Hermstadt fahren.
Und es gab viele aufregende Neuigkeiten!
Eine Sensation war am Bahnhof in Hermstadt der Bildzeitungsverkäufer. Der schrie die Schlagzeilen aus und machte bei den Arbeitern, die nach Hermstadt zur Arbeit fuhren, ein blendendes Geschäft. Bruno war wie seine Mitschüler fasziniert über die Laute, mit denen der Verkäufer die Schlagzeilen ausschrie. Die Schlagzeile etwa „Adenauer: Wir brauchen das Militär“ kam so: „A!“ Luft holen „Nauer!“ Luft holen „Mi!“ Luft holen „tär!“ Der Ausruf „Strauß!“ Luft holen „Krieg!“ kündigte beim näheren Hinsehen die Schlagzeile an „Strauß: Nie wieder Krieg!“ Bruno und seine Kameraden pflegten später Wetten abzuschließen, wer am besten von den Lauten auf die dazugehörige Schlagzeile schließen konnte.
Das Gymnasium machte Bruno ebenso viel Spaß wie die Volksschule. Er hatte nicht den Eindruck, dass sich viel geändert hatte. Er merkte nur, dass sein Ansehen weder bei den Lehrern noch bei den Schülern so hoch war wie in Neuburgheim. Im Gegenteil, sein einziger Mitschüler aus Neuburgheim, Gunther, wollte mit ihm nicht so viel zu tun haben. Gunther war 2 Jahre älter und sprach von Bruno immer nur als Kleiner.
Die Überraschung kam nach ungefähr einem Monat: Ziemlich schnell hatten sie eine Klassenarbeit in Deutsch geschrieben, Bruno hatte in seiner gewohnten Art eine Geschichte erzählt. Er bekam eine 5! Bruno verstand die Welt nicht mehr. Warum denn so schlecht? Und kurz darauf bekam er die erste Arbeit in Mathematik, wie jetzt das Rechnen hieß, zurück. Eine 5! Bruno war verzweifelt. Seine Eltern wussten ebenfalls keinen Rat. Sie fuhren zum Klassenlehrer nach Hermstadt, der zuckte die Achseln: „Ja, ich weiß, welche Zensuren Ihr Sohn in der Volksschule hatte, aber hier jedenfalls reichen seine Leistungen keinesfalls aus.“