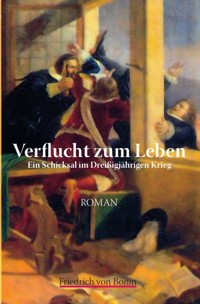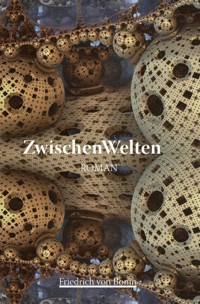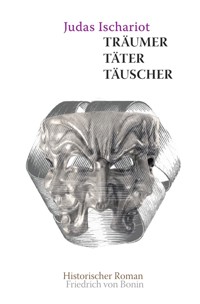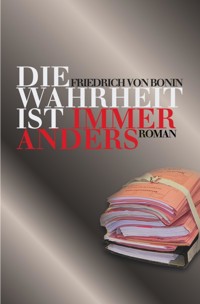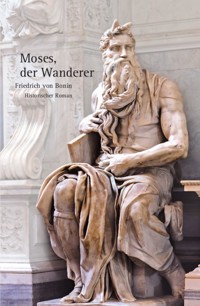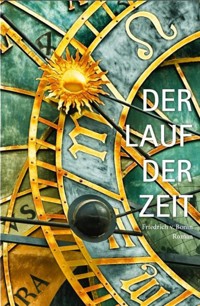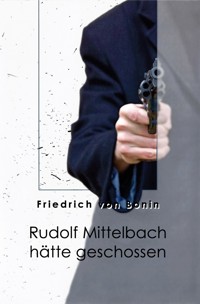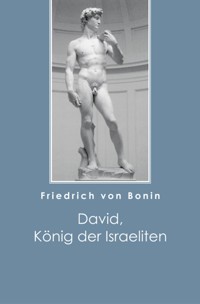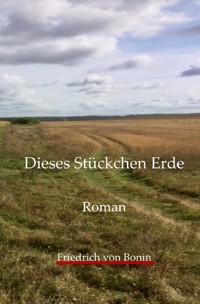
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wer waren unsere Väter? Wo sind wir zu Hause? Wo ist unsere Heimat? Albrecht von Wernow ist mit der Aussage seiner Eltern aufgewachsen, er sei nicht in dem kleinen Ort in Westdeutschland zu Hause, in den seine Eltern nach dem zweiten Weltkrieg geflohen sind. Seine Heimat sei das Rittergut des Vaters östlich der Oder. Die Suche nach einem Gefühl für seine, des Sohnes, Heimat gerät ihm zur Suche nach dem Leben seiner Eltern, seines Vaters. Gutsbesitzer, Soldat, Kriegsteilnehmer, Ritterkreuzträger, wer war sein Vater? Und war er Nazi? Und wenn er kein Nazi war, war er an den Gräueltaten der Wehrmacht beteiligt? Albrecht von Wernow forscht im Leben seines Vaters und schreibt auf, was er gefunden hat. Seine Schilderung beschreibt die letzten Schleier, die über dem Leben seines Vaters im Krieg bleiben. Der Roman zeichnet gleichzeitig ein empathisches Bild von Glück und Leiden der Kriegsteilnehmer- und Flüchtlinge und von den Barrieren, die der Aufnahme eines bürgerlichen Lebens nach Kriegsende entgegenstanden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 464
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DIESES STÜCKCHEN ERDE
Roman
Friedrich von Bonin
___________________________2025___
IMPRESSUM
©Copyright 2025:
Friedrich von Bonin
Bremerhaven
Druck:
Epubli Verlag, Berlin
Umschlagfoto und Foto Autor:
Gundula Ott-von Bonin
1.Ausgabe 2025
INHALTSVERZEICHNIS
Der Erbe, Teil eins9
DER AHN PETZ VON WERNOW19
Der Erbe, Teil zwei55
DER VATER HEINRICH VON WERNOW83
I KINDER (1923) 83
Der Erbe, Teil drei123
II DER ERNSTDES LEBENS (1932) 127
III LIEBEUND POLITIK (1935) 149
IV KRIEG! (1939) 201
V. DAS ENDE (1943) 258
Der Erbe Teil vier289
VI. VERWIRRUNG (1947) 301
Der Erbe Teil fünf331
VII AUFBAUEN (1952) 337
Der Erbe Teil sechs359
VIII BÜRGERLEBEN (1953) 367
Der Erbe, letzter Teil399
Das Buch:
DER ERBE, TEIL EINS
1Radelitz ist der Name für ein kleines Stückchen Erde, für einen Ort, bescheiden, unbedeutend, unbekannt. Ein armes Dorf, von vielleicht fünfhundert Seelen bewohnt, in Polen gelegen, östlich der Oder, in einer sanft hügeligen Landschaft mit weiten Feldern, nicht von Zäunen geteilt, und ausgedehnten Wäldern, Kiefern, Fichten, Eichen, Buchen und viel Unterholz. Ein Kritiker würde vielleicht bemängeln, dass die Felder, wie in fast allen Ländern der europäischen Union, unter der Monokultur des Maisanbaus leiden und immer unfruchtbarer werden.
Aber es kommt kein Kritiker. Fremde kommen überhaupt sehr selten und wenn, dann nur, um hindurch zu reisen. Niemand kennt Radelitz, dieses kleine polnische Dorf im Grenzgebiet zu Deutschland.
2Niemand? Nicht ganz.
Blicklos saß Albrecht von Wernow in dem Arbeitszimmer im Landgericht, das man ihm trotz beengter Verhältnisse im Gerichtsgebäude zugestanden hatte, als er vor vier Jahren Vorsitzender einer Strafkammer wurde.
Er sollte den Urteilsentwurf absegnen, den ihm seine Beisitzerin hereingereicht hatte. Er hatte sich ausgebeten, dass jedes Urteil, das in seiner Kammer verkündet werden sollte, ihm vorgelegt wurde.
Scheußlicher Fall, diese beiden jungen Männer, die mit einer seltenen Brutalität eine Bar überfallen und deren Kasse erbeutet hatten. Wernow hatte während der Hauptverhandlung manchmal den Eindruck gehabt, die Angeklagten hätten überhaupt nicht begriffen, was sie den beiden jungen Mitarbeiterinnen in der Bar und den Besuchern angetan, welches Trauma sie bei denen hinterlassen hatten, als sie mit ihren Pistolen um sich schossen.
Wieder wanderten seine Gedanken vom Fall ab.
Radelitz.
Und ob er es kannte. Nicht die Landschaft, auch den Ort nicht, aber den Namen.
Mit der Muttermilch hatte er diese drei Silben eingesogen: Radelitz.
Da waren wir zu Hause, so hörte er von Kind an, nicht in diesem jämmerlichen Dorf im äußersten Westen des restlichen Deutschlands, in Radelitz waren wir zu Hause und mit jeder Faser ihres Lebens hatten seine Eltern dem Augenblick entgegengefiebert, in dem sie in ihre Heimat zurückkehren konnten.
Radelitz. Sein Vater war Herr auf Radelitz, so lernte er als Kind, und wenn er stürbe, würde er, Albrecht von Wernow, der nächste Herr auf Radelitz. Er hatte das hingenommen, gleichgültig, Herr auf Radelitz, er konnte nichts damit anfangen. Sie lebten hier im äußersten Westen, in diesem kleinen Dorf, in Hinnerskamp, da war er zu Hause, so hätte er als Kind jedem erzählt. Aber Heimat, das musste etwas anderes sein, was genau, wusste er nicht, aber es hing mit diesem Radelitz zusammen.
Er sah den grauen Zeigefinger seines Vaters vor sich, wie er über die Landkarte fuhr, von Berlin, wo er einen kurzen Moment verhielt, wandte er sich nach Osten, nach Frankfurt, das an der Oder lag und dann ging es nach Nordosten, aber nicht mehr weit: Da lag es, dieses Dorf, die Heimat, mit der es sein merkwürdiges und unverständliches Bewenden hatte.
Auch mit seinen Freunden war das so eine Sache. Er hatte vor allem zwei: Dieter und Hans Geert, mit denen ging er zur Schule.
Aber: Er solle nicht zu eng mit ihnen werden, lehrten ihn die Eltern, das seien Kinder einfacher Leute, mit denen könne man verkehren, aber enge Freundschaften, die habe man nur mit Menschen »aus unserer Kiste«.
Albrecht in seinem Arbeitszimmer lächelte vor sich hin. Was hatte er sich darunter vorgestellt! Offenbar gab es Leute, die in einer Kiste lebten, dennoch aber vornehmer waren als Dieter, dessen Eltern in einem eigenen Haus lebten. Was die Eltern eigentlich unter »ihrer Kiste«, nämlich ihrer Klasse und damit meinten sie adelige Familien, verstanden, begriff er viel später.
Schnell wurde sein Gesicht ernst.
Er war aufgewachsen mit den Widersprüchen, die zwischen dem Namen Radelitz und was die Eltern darüber erzählten, und seiner Existenz in dem kleinen Hinnerskamp, in dem er aufwuchs, bestanden hatten.
Albrecht wurde älter und wurde klüger und lernte in der Schule, dass Radelitz nicht zu unserem Staat gehörte, es sei Land, von Russland und Polen besetzt und später wurde ihm klar, jetzt gehöre das Dorf wie alles Land östlich der Oder zu Polen.
Dennoch sprachen die Eltern weiter über Radelitz als ihre Heimat, in die sie in nicht allzu ferner Zukunft zurückkehren würden.
Albrecht hörte ihnen zu, hörte seine Lehrer über die aktuelle Lage in Deutschland sprechen. Und irgendwann überwog in ihm der Drang, die Widersprüche zwischen den Lehren der Eltern und der Umwelt aufzuklären. Er stellte seinen Vater zum ersten Mal zur Rede, da war er siebzehn Jahre alt, viel zu spät, wie er sich eingestand. Aber jedenfalls starb sein Vater ein paar Jahre später nach einer kurzen und heftigen Krankheit, ohne ihm die Antworten zu geben, nach denen es den jungen Mann verlangte.
3Bis heute hatte er die Antworten nicht. Er war nach dem Abitur aus dem Elternhaus ausgezogen und hatte seinen Weg ohne große Erinnerungen oder Gedanken an dieses kleine Dorf und das Rittergut, dessen Herr er ja nach dem Tode seines Vaters sein sollte, gemacht.
Einmal noch hörte er von dem Gut Radelitz. Die Familie von Wernow hielt jährlich eine Versammlung ab, die sie »Familientag« nannten, auf der sich Menschen mit dem Namen von Wernow trafen.
Der Vorsitzende des Familienverbandes, ein hoher Offizier aus dem zweiten Weltkrieg, hielt eine eindrückliche und engagierte Rede über die Rolle der Adelsfamilien im Allgemeinen und der Familie von Wernow im Besonderen in unserer heutigen Zeit. Und ohne jede Bedenklichkeit forderte er, der Adel müsse wieder die führende Rolle in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft einnehmen, die sie vor dem Krieg innehatte.
Albrecht von Wernow hatte inzwischen im Studium seine Kenntnisse über die Zeit vor und im zweiten Weltkrieg, die in der Schule nur sehr spärlich vermittelt worden waren, vertieft. Er hatte Fotografien der aus den Konzentrationslagern befreiten Gefangenen gesehen, reine Skelette waren damals den alliierten Soldaten entgegen gewankt. Er hatte vom Überfall des deutschen Reiches auf Polen, auf Frankreich, Belgien, Luxemburg und die Niederlande und schließlich auf die Sowjetunion gelesen. Alle Berichte waren für einen jungen Deutschen mit halbwegs intaktem Gewissen niederschmetternd und Albrecht begann sich zu fragen, wer das gewesen war. Viele adelige Namen waren unter den Tätern zu finden und so fand Albrecht die Rede des Verwandten auf dem Familientag falsch, unangemessen, und grotesk bis zur Absurdität. Er floh von dem festlichen Ereignis der Familie und mied seitdem den Kontakt mit seinen Verwandten einschließlich seiner Geschwister.
Aber nun war vor vier Jahren überraschend seine Mutter gestorben, Albrecht hatte seine Geschwister an ihrem Sarg wiedergesehen.
Schon seit langem hatte seine Frau Josefa ihn bedrängt, er solle ihr doch seine Verwandten vorstellen, das seien doch so viele und sie habe gar keine Familie. Immer habe sie sich danach gesehnt.
Und so hatte er den Begegnungen mit seinen Geschwistern und deren Familien zugestimmt und zugesehen, wie Josefa sich mit seiner älteren Schwester anfreundete und auch zu seiner jüngeren Schwester und den Brüdern Kontakt hielt.
Für ihn waren das furchtbare Treffen.
Plötzlich war Radelitz wieder da. Vor allem seine ältere Schwester und seine Brüder erwiesen sich als traditionsbewusst und adelsstolz und keine kritische Frage konnte ihre Haltung auch nur ansatzweise erschüttern. Allerdings ließ Albrecht, wie Josefa etwas ironisch anmerkte, ebenfalls nicht von seinen Standpunkten.
Und so stritten die Geschwister wie eh und je in ihrer Kindheit und konnten sich über die Bedeutung ihres Vaters, des Rittergutes und der Familie nicht einigen.
4Immerhin hatte die erneute Begegnung mit den Geschwistern die Folge, dass Albrecht anfing, sich für die Familie derer von Wernow zu interessieren. Schon immer war seine Neugier auf ausgesuchte Phasen der Geschichte ausgeprägt gewesen: Er hatte sehr viel über die Französische Revolution und die anschließende Kaiserzeit unter Napoleon gelesen. Regelrecht fasziniert hatte er die Ereignisse der zweiten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts erforscht, eine Zeit, in der in Mitteleuropa die Auseinandersetzung über die neue Religion Luthers und Calvins in Frankreich einem Höhepunkt zustrebte. Und ausgerechnet in dieser Zeit, der Hochphase langandauernden Patriarchats, waren überraschend zwei Frauen in bestimmende Funktionen gerückt: Katharina von Medici als die Mutter der schwachen Könige bestimmte die Linien der französischen Politik, Elisabeth die Erste von England setzte sich gegen aussichtsreiche Prätendenten auf den englischen Thron und regierte mit Energie das mächtige England.
Und jetzt hatte die Geschichte seiner eigenen Familie Albrechts Interesse geweckt. Er suchte, wie er sich selbst und seiner Frau eingestand, nach Schatten auf dem Familiennamen. Gab es vielleicht auch schwarze Schafe unter diesen Vorfahren, auf die sie so stolz waren? Ganz sicher, es galt nur, sie zu finden.
Albrecht von Wernow forschte nach allem, was über die Familie von Wernow aufgeschrieben worden war, und er suchte nach Geschichten, die es über Radelitz gab.
Die Tochter eines Landrates, der nach dem ersten Weltkrieg den Landkreis regierte, in dem Radelitz lag und die, so schrieb sie, als häufiger Gast in dem Rittergut das Anwesen Radelitz und die Familie von Wernow lieben gelernt hatte, hatte in den frühen dreißiger Jahren die Urkunden des Dorfes und des Landkreises durchleuchtet. Was sie gefunden hatte, hatte sie in einer Monografie niedergelegt. Albrecht las den Text mit großer Langeweile.
Penibel hatte die Landratstochter Namen über Namen zusammengetragen, hatte im Mittelalter begonnen, die Bürgermeister des Dorfes aufzuzählen, Geburten und Todesfälle zu benennen und eine Genealogie der Familie erstellt.
Albrecht wollte dieses Zeugnis eines merkwürdigen und ihm fremden Fleißes schon weglegen, aber was war das?
Sie schrieb über Begebenheiten aus den Jahren 1390 bis ungefähr 1404.
Ein Ritter namens Petz von Wernow, so las Albrecht mit wachsendem Erstaunen, hätte mit seinen Söhnen auf der Landstraße zwischen Frankfurt und Warschau Kaufmannszüge beobachtet, sie überfallen und ausgeraubt. Petz von Wernow habe auf Radelitz residiert, sein Herrenhaus sei aus Rache von den Kaufleuten verheert worden.
Bei ihr klang das so:
»Von alters her führte eine Handelsstraße, die Frankfurt und Posen verband, durch Radelitz. Petz von Wernow und seine Söhne beobachteten die Kaufmannszüge auf dieser Straße, überfielen sie und raubten sie aus. Ihr Rittersitz, der vermutlich auf einem Werder in Radelitz lag, bot ihnen sicheren Schutz. Durch die Wegelagerei schädigten die von Wernow die Kaufleute in Berlin, Frankfurt und Crossen und verunsicherten das ganze Land. Infolge der Unordnung unter dem Regiment der Luxemburger in der Mark konnten die Kaufleute auf keine landesherrliche Abhilfe hoffen. So entschlossen sich die drei Städte Berlin, Frankfurt und Crossen zu einer Heerfahrt nach Radelitz und eroberten und zerstörten dabei 1401 bis 1403 mit großer Wahrscheinlichkeit zweimal den Raubrittersitz. Jedenfalls kam es 1402 zwischen Petz von Wernow und seinen Söhnen Balzer und Siegfried einerseits und den Städten Berlin, Frankfurt und Crossen andererseits zu einer Aussöhnung, wobei die Ersteren versprachen, niemand in den Frankfurter Landen wegen des Vorgefallenen in Anspruch zu nehmen oder sich zu rächen, auch das Schloss in Radelitz nicht wieder zu erbauen, es sei denn, mit Genehmigung der Städte Berlin, Frankfurt und Crossen.«
Ein schwarzes Schaf unter den Altvorderen dieser so hochedlen Familie, aber Einzelheiten über diesen würdigen Ahnen waren nicht herauszufinden.
Und Albrecht von Wernow hatte aus dem wenigen, das er wusste, die Geschichte seines Vorfahren aufzuschreiben begonnen.
DER AHN PETZ VON WERNOW
1Das Wetter konnte nicht besser sein: Sturm peitschte die Pappeln, die am Rande des Weges standen, Regenwolken flogen in Fetzen über den dunklen Himmel und verhinderten, dass die Sterne in der Neumondnacht ihr Licht entfalten und irgendetwas an Helligkeit bringen konnten.
Irgendwo in der Nähe heulte ein Hund auf, drei weitere fielen ein, das Heulen schwoll an und verklang in müdem Bellen, dann war wieder nur das Geräusch des starken Windes in den Bäumen zu hören.
Petz von Wernow zog den schweren Mantel enger um sich, er fröstelte. Er lag zwischen seinen Söhnen Balzer und Siegfried am Rande der Straße, die sich als Band von Westen nach Osten zog. Sie achteten nicht darauf, dass sie im Gras der Böschung nach kurzer Zeit bis auf die Haut durchnässt waren, sie sprachen nicht, sondern lauschten angestrengt, ob sie über dem Wind nicht die ersten Wagengeräusche hörten.
Alle drei waren in dicke Wollmäntel gehüllt, darüber trugen sie die Westen aus festem Leder, die sie eng geschnürt hatten. Sie waren gut bewaffnet, jeder hatte einen starken Bogen neben sich gelegt, die Söhne umklammerten mit der linken Hand die Hellebarden, während der Vater den altmodischen Spieß in der Hand hatte. Die Schwerter waren an ihre Gürtel gehängt, die würden sie erst später brauchen.
Jetzt regte sich Balzer rechts neben dem Vater.
»Hoffentlich kommen sie noch, es ist schon viel später, als sie angekündigt waren.« Balzer von Wernow flüsterte direkt am Ohr des Vaters, als ob in dem Aufruhr von Wind und Regen ein gesprochenes Wort weiter als einen Meter zu hören gewesen wäre.
»Jaja, mein ungeduldiger Sohn!«, antwortete der Alte, ebenfalls flüsternd, »warte nur ab, sie kommen schon noch.«
Und als hätten seine Worte magische Kräfte, war nun tatsächlich das Geräusch von rollenden Rädern zu hören, Stimmen trieben die Zugtiere so laut an, dass sie Sturm und Regen übertönten. Jetzt wurden auch die Fackeln sichtbar, die den Zug begleiteten.
»Seht ihr? Wie ich gesagt habe«, murmelte der Alte jetzt, »drei Wagen, vier Reiter und die Kutscher. Für uns eine Kleinigkeit. Seht zu, dass ihr mit den Bogen die Kutscher trefft, jeder einen, und dann mit den Lanzen drauf auf die Reiter.«
»Ja, Vater«, antwortete Balzer etwas ungeduldig, »wir haben das schon oft besprochen, wir machen es wie immer.«
Langsam näherten sich die Wagen, neben denen sich die Reiter hielten, die die Wagen beschützen sollten, aufmerksam die Straße und die Böschung beobachtend.
Der vorderste Kutscher fluchte: »Verdammt nochmal, mussten wir denn wirklich heute losfahren, wo wir wussten, dass wir in dieses Wetter geraten würden.«
»Sei ganz ruhig, Heinz«, antwortete der Reiter neben ihm, der Kaufmann Rainer Melchior aus Berlin, »du weißt genau, warum wir fahren mussten, die Ware muss pünktlich in Warschau sein und bei dem Wetter wird sich kein Räuber auf die Straße trauen.«
»Ja, wenn es um die Räuber geht, mögen Sie Recht haben, aber schnell ankommen werden wir nicht. Sehen Sie mal, die Straße ist kaum noch zu erkennen. Ja, wenn sich unser Brandenburger Sand mit Regen vermischt, dann kommt Matsche raus. Noch einen halben Fuß tiefer und die Ochsen können die Wagen nicht mehr ziehen.«
Der Reiter kam nicht dazu, dem Kutscher zu antworten. Er hörte ein pfeifendes Zischen und sah, wie der Mann auf seinem Bock in sich zusammensank. Im Nu hatte er das Schwert gezogen und blickte sich um. Ein weiterer Kutscher hing leblos auf seinem Wagen, der dritte war abgesprungen und hatte den Dolch gezogen.
»Wo kamen die Pfeile her?«, schrie er und blickte mit wild rollenden Augen um sich.
Melchior fühlte sich am Fuß gefasst und vom Pferd gezogen. Die schwere Rüstung, Brust- und Rückenharnisch und die metallenen Beinschienen, machten ihn schwerfällig und unbeweglich. Halb betäubt lag er auf dem Boden, während Petz von Wernow, der ihn geworfen hatte, den nächsten Reiter, der vor Überraschung regungslos auf dem Pferd saß, packte und zu Boden riss.
Sein ältester Sohn hatte die zwei anderen Reiter ebenso schnell und präzise besiegt, Siegfried von Wernow stand dem Kutscher gegenüber, die ihm trotzig den Dolch entgegenstreckte.
»Komm mir nicht zu nahe«, drohte er, »ich bring euch alle um.«
Aber Siegfried dachte nicht daran, in die Nähe des Dolches zu kommen. Er stach mit der Hellebarde nach dem Kutscher, täuschte dann eine Finte an und rammte ihm die Waffe in die Brust.
»So, der ist erledigt«, brummte er und wendete sich seinem Vater zu.
»Haben wir sie alle?«, fragte er.
»Ja, aber nicht mehr lange, wenn wir sie nicht binden«, erwiderte der Alte, »komm und hilf mir die Reiter fesseln, das sind vornehme Herren, die uns gerne ein Lösegeld zahlen werden. Aber sieh zu, dass sie nicht fliehen können, wenn sie aufwachen.«
2Die Wagen waren für die Firma Melchior und Rabe, Im- und Export, Berlin, unterwegs gewesen. Die Reise war dringend, sie hatten sie nicht aufschieben können, selbst als sich der aufkommende Sturm abzeichnete. Der Seniorpartner Rainer Melchior wollte den Zug mit seinem jüngeren Sohn begleiten, sein Kompagnon Herbert Rabe hatte ebenfalls einen Sohn mitgeschickt und ihnen außerdem einen Soldaten mitgegeben, Ritter von Herzfeld, einen schwerbewaffneten Kämpfer.
Alle hatten sie ihm von dem Unternehmen abgeraten.
»Du wirst doch jetzt nicht im Herbst bei Regen und Kälte und Sturm da raus wollen«, hatte ihm sein bester Freund, der Stadtschreiber Karsten Nolte, vorgehalten. »Du holst dir doch den Tod, Lungenentzündung und was weiß ich. Und bist du denn sicher, dass sie dich nicht überfallen? Denk doch nur daran, wie viele Züge unsere Kaufleute schon an Räuber verloren haben.«
Aber Rainer Melchior war unerbittlich.
»Die Waren müssen jetzt raus, meine Kunden in Warschau warten auf den Wein aus Frankreich, auf den Tabak. Und ich muss noch vor dem Winter dahin, ich muss meine Vorräte an Tuch bei meinen Geschäftsfreunden in Polen auffüllen, sonst kann ich zum Jahreswechsel meinen Laden dichtmachen. An keinen Schneider könnte ich dann Stoff liefern. Nein, das geht nicht.«
»Aber Rainer«, widersprach nun auch Theodor Kneiser, der Weinhändler, »dann musst du doch wenigstens nicht selbst mitreiten. Bleib du nur schön still in deinem Kontor, das Reisen ist für die anderen da, die dafür bezahlt werden.«
»Und was ist das für ein Unsinn«, sagte ein Dritter, »dass du nicht nur selbst mitfahren, sondern auch noch deinen Jüngsten mitnehmen willst? Und dann noch den jungen Rabe dazu? Da ist die Firma fast ganz entblößt.«
»Nein«, beruhigte Melchior seine Freunde, »nein, die Firma wird von Ruppert geleitet, mein ältester Sohn ist jetzt so lange in der Firma, dass ich ihm die Leitung ruhig übertragen kann.«
Ruppert Melchior hatte in letzter Zeit öfter seinen Vater zu diesem Stammtisch der Kaufleute begleitet, damit der Alte ihn dort einführte. Er hatte bis jetzt der Diskussion schweigend gelauscht, aber jetzt griff er doch ein.
»Siehst du, Vater, habe ich doch immer gesagt. Wir müssen fahren, klar, aber reite du doch nicht selbst mit. Natürlich kann ich die Firma führen, aber darum geht es nicht. Die Fahrt ist höchst gefährlich, ich sage es dir nochmal, vor allem, weil du so viel Geld mitnehmen willst.«
»Viel Geld? Das auch noch?«, fragte der Stadtschreiber ungläubig, »aber dann redet nicht so laut, das soll nicht jeder hören.«
»Tatsächlich«, flüsterte nun Rainer Melchior so leise, dass nur die drei Freunde es hörten, »ich muss doch Geld haben, wenn ich bei den Polen in Warschau einkaufen will. Die geben den Stoff nicht umsonst her oder auf Kredit. Also habe ich Gold in ausreichender Menge mit.«
»Also Rainer«, Theodor Kneiser richtete sich jetzt auf, »so geht das nicht. Du kannst doch nicht mit einem Haufen Gold, mit Waren und deinem Sohn und Rabes Sohn den Wegelagerern direkt vor der Nase rumtanzen. Denk doch nur an diesen furchtbaren Wernow, der soll wieder in der Nähe von Radelitz sein Unwesen treiben. Und wenn du dem entgehst, kommen die Ordensritter kurz vor Warschau und nehmen den Rest. Nein, Rainer, kommt nicht in Frage, dass du reitest.«
Die anderen lachten über die autoritäre Art, mit der Kneisel seinem Freund etwas verbieten wollte.
Rainer Melchior lächelte dünn. Er war ein hochgewachsener und kräftiger Mann, selbst im Sitzen konnte man die Statur erkennen. Sein Gesicht begann die Spuren des Alters zu zeigen, es war von tiefen Falten durchzogen, die Haare und der kurz gestutzte Vollbart waren fast weiß. Letzterer verbarg, dass Melchior allmählich zum Doppelkinn neigte, das gute Leben, der Wein und die ausgiebigen Mahlzeiten hatten die vorher hagere Gestalt rundlicher geformt.
Aber immer noch scharf kalkulierend blickten graue, kühle Augen den Betrachter an, ein Blick in dieses Gesicht zeigte, dass man mit Rainer Melchior in Geschäften immer noch rechnen musste.
Und jetzt war er entschlossen, zu reisen. Wem sonst hätte er eine so große Summe Geld anvertrauen können?
3Die große Handelsstraße von Berlin über Frankfurt nach Warschau war viel befahren. Die Behörden hatten sie verbreitert, hatten Wagengeleise in den Sandboden gepresst, um so zwei Spuren für Verkehr und Gegenverkehr zu gewinnen. Dennoch blieb die Strecke eigentlich ein reiner Sommerweg. Wenn im Herbst starke Regenfälle niedergingen, verwandelte sich der Sand in Schlamm, und nur Fuhrwerke mit ausreichend Zugtieren konnten sich darauf bewegen. Noch schlimmer wurde es, wenn sich im Winter der Schnee mit dem Schlamm vermischte und gefror. Dann war das keine Straße mehr, sondern ein unkalkulierbares Durcheinander von Spuren, die hart gefroren waren und den Weg zu einer unpassierbaren Holperstrecke machten.
Die Straße war nicht umsonst so wenig ausgebaut und gepflegt.
Es fehlte im Land Brandenburg diesseits und jenseits der Oder an allem, es war von der Natur nicht übermäßig gesegnet, keine Bodenschätze, die man aus dem Grund hätte reißen können, die Äcker mager, Sand, auf dem allenfalls Futterrüben, Roggen und Kiefern wuchsen.
Der Staat wurde von seiner Hauptstadt Berlin aus regiert, aber damit ist schon zu viel gesagt. Das den Brandenburgern von früher angestammte Herrschergeschlecht war seit langem ausgestorben, niemand machte sich ernsthaft Mühe, den mageren Streifen Land von der Ostsee bis nach Sachsen regieren zu wollen.
Es gab eine Staatsmacht, die wurde nominell von dem deutschen Kaiser Heinrich IV. ausgeübt, obwohl dieser Kaiser weit weg residierte und sich um sein Brandenburg nicht kümmerte.
Auch als Heinrich seinen Söhnen Jobst von Mähren und Wenzel, den sie später den Faulen nannte, Brandenburg übertrug, änderte sich an der Herrschaftslosigkeit nichts. Weder Jobst noch Wenzel bemühten sich, ihr neues Land zu besuchen, keiner von ihnen hat je Brandenburg betreten oder gar den Versuch unternommen, es zu regieren.
Seit Jahren wurde Rainer Melchior bei den in Berlin ansässigen Behörden, erst des Kaisers und dann seiner Söhne, vorstellig.
Es sei kein sicheres Reisen möglich in diesem Teil des Reiches, klagte er, sie, die Kaufleute, könnten es sich nicht leisten, ganze Armeen zum Schutz ihrer Güter zu bezahlen. Der Verkehr solcher Waren sei fast zum Erliegen gekommen, die Kaufleute würden lieber gar nicht arbeiten als sich den Ertrag ihrer Arbeiten von Raubrittern am Weg entreißen zu lassen. Die Banden lagen an allen größeren Ausfallstraßen von Berlin, vor allem der nach Osten, wo zuweilen reich ausgestattete Kaufmannszüge fuhren. Aber auch die Strecken nach Leipzig und Dresden waren ein beliebtes Angriffsziel der raublustigen Adeligen, ebenso die nach Rostock, nach Schwerin, überhaupt alle größeren Handelswege.
Wenn der Kaiser aus Brandenburg Steuern ziehen wolle, wenn sie ihre Kirche weiter unterhalten sollten, müsse er zunächst eine Armee schicken, die die Raubnester ausräuchere. Erst dann sei in Brandenburg eine wirtschaftliche Blüte erreichbar.
Aber er biss auf Granit. Die kaiserlichen Beamten, wenig an der Zahl, die die Steuern in Brandenburg eintreiben und die Ordnung im Land aufrecht erhalten sollten, lächelten höflich und zuckten bedauernd die Achseln.
Nein, an kaiserliche Truppen sei gar nicht zu denken. Melchior solle doch nicht annehmen, dass die kaiserliche Kasse für ein so armes Land wie Brandenburg auch noch Geld opfere. Nein, sie, die Beamten, hätten Unterstützung angefordert, aber die Antwortschreiben der kaiserlichen Schreibstube seien niederschmetternd gewesen. Brandenburg müsse sich selbst ernähren und halten, so sei da die Auffassung. Wenn das nicht möglich sei, müsse man das Land eben sich selbst überlassen.
Und so litt der arme Landstrich weiter unter der ungezügelten Gier seiner außer Rand und Band geratenen Ritter, nichts und niemand war vor ihren Überfällen sicher und am schlimmsten gebärdeten sich einige Herren von Rittergütern diesseits und jenseits der Oder.
Einzig der Initiative und der Tapferkeit einer Handvoll Berliner und Frankfurter Kaufleute wie Rainer Melchior war es zu verdanken, dass zwischen Berlin, Frankfurt und Warschau der Handel nicht ganz zum Erliegen kam und sogar Waren zwischen den Städten hin und her geschickt werden konnten.
Und nun war Melchior in einen Überfall geraten.
4Petz von Wernow, Herr auf Radelitz, frohlockte: Da hatten sie einen guten Fang gemacht. Er und seine Söhne hatten sich der Wagen bemächtigt, die Gefangenen auf die Ladeflächen gehoben und waren nach Radelitz zurückgefahren.
Bis dahin hatten sie vom Ort des Überfalles ungefähr fünf Kilometer zurückzulegen. Sie bogen in die Seitenstraße, durchquerten das Dorf und fuhren in Sturm, Regen und Dunkelheit auf das Rondell vor dem Schloss.
»Abladen«, befahl der Alte seinen Söhnen, »die Gefangenen bringt mir in die Halle, die Waren in den Seitentrakt, und seht zu, dass ihr bald fertig werdet. Ich kümmere mich um das erbeutete Geld.«
Petz von Wernow betrat das Haus. Ein Schloss wurde es nur von den Familienmitgliedern genannt, das Herrenhaus des Gutes Radelitz war eher ein, allerdings geräumiges, Wohnhaus mit einer großen Halle, der Küche und dem Arbeitszimmer im Erdgeschoss und darüber Schlafzimmer mit den entsprechenden Wascheinrichtungen.
»Puh«, machte er, wischte sich mit dem Ärmel den Regen vom Gesicht und zog Lederkollier und den schweren Mantel aus.
»Das ist ein Wetterchen da draußen, gut für uns, aber ungemütlich ist es.« Seine Frau Hildegard war ihm entgegen gekommen und hatte ihn mit einem Kuss begrüßt.
»Und habt ihr Erfolg gehabt?«, fragte sie ängstlich, »sind alle gesund wieder zu Hause?«
»Unsere schon«, antwortete ihr Mann kurz angebunden, »aber die Kutscher nicht. Frau, wir haben vier Gäste mitgebracht, die müssen essen und trinken, kannst du das zum Frühstück organisieren?«
»Gäste?«, fragte sie entrüstet zurück, »du hast Gäste mitgebracht? Warum fragst du mich nicht vorher? Wo sollen die denn schlafen, wer soll Betten für sie machen, wie hast du dir das denn vorgestellt?«
»Hildegard, meine Liebe«, lachte jetzt Petz, »das mit den Gästen war ironisch gemeint, wir haben Gefangene gemacht, für die wollen wir ein kräftiges Lösegeld haben. Und sieh mal hier, diese beiden Säcke, wohl voll mit Geld, ich habe sie mir noch nicht angesehen.«
Jetzt, als Wernow seinen Mantel ausgezogen hatte, konnte man seine Gestalt sehen. Er war ein kleiner Mann, kaum größer als ein Meter siebzig, aber vierschrötig, breit, mit einem immer etwas geröteten Stiernacken. Den untersetzten Rumpf trugen stämmige Beine, die fest mit dem Boden verwachsen schienen, wenn er wie jetzt stand. Er mochte knapp sechzig Jahre alt sein, mit langen, silberweißen Lockenhaaren und einem ebenso weißen langen Bart. Unter der niedrigen Stirn blitzten harte, flinke, blaue Augen, eine große Nase, ein breiter Mund mit einem kräftigen Kinn vervollständigten das Gesicht, das wie der ganze Mann Kraft und Energie ausstrahlte.
Hildegard von Wernow sah ihn liebevoll an. Sie waren jetzt zwanzig Jahre verheiratet und sie beglückwünschte sich immer noch zu der Wahl dieses Ehemannes, den nicht sie, sondern ihre Eltern für sie ausgesucht hatten. Nicht alle ihre Freundinnen und Nachbarinnen hatten es so gut getroffen wie sie. Hübsch war ihr Petz weiß Gott nicht, zu klein, zu stämmig und gedrungen, aber zu ihr war er liebevoll und verlässlich
Aber dann verfinsterte sich ihr Gesicht.
»Ihr wart also wieder auf Raubzug aus? Habe ich mir schon gedacht. Petz, du wolltest das doch ganz lassen, du weißt, auf den Reichtümern, die du so erwirbst, ruht kein Segen.«
»Lass man, Hildegard, ich weiß, dass du dagegen bist, aber wie sollen wir das Gut denn erhalten, wenn wir nicht manchmal ein bisschen dazu stehlen? Wir verdienen nicht genug mit der Bewirtschaftung.«
»Und wenn du Wald schlägst und Holz verkaufst?«
»Auch darüber haben wir schon diskutiert, das hilft nichts. Kein Mensch zahlt heute für Holz, nachdem es aus Polen in Massen kommt und billig verhökert wird. Alles, was wir dafür kriegen, müssen wir in die Aufforstung stecken, nein, das Gut kann sich nicht selbst ernähren, sich nicht und uns nicht und nicht die Leute, die hier arbeiten. Und deshalb brauchen wir den Nebenverdienst.«
»Aber du hast doch sicher wieder meine Söhne angestiftet, die Begleitung umzubringen, oder?«
»Ja, liebste Hildegard, wo man was verdienen will, da müssen andere dran glauben. Diesmal hat es nur die Kutscher erwischt, die Ritter bringen Balzer und Siegfried als Gefangene ins Haus. Ich will rauskriegen, wer das ist, vielleicht gibt es aus Berlin sogar noch Lösegeld.«
Damit beendete Petz von Wernow die Auseinandersetzung, nahm die schweren Säcke auf die Schultern und ging in sein Arbeitszimmer.
Dort gingen ihm die Augen über, als er die Taschen öffnete. Deswegen waren sie so schwer gewesen: Sie waren vollgestopft mit Gulden, hauptsächlich mit Lübecker und Florentiner Gulden, gute Goldstücke, mit denen er jederzeit Waren aller Art kaufen konnte und mit Silber, weniger wertvoll, aber ebenso gut als Zahlungsmittel. Mit einem einzigen Fischzug hatte er sich das nötige Bargeld verschafft, um das Rittergut mindestens ein Jahr weiter bewirtschaften zu können. Langsam begann er, die Münzen zu ordnen und zu zählen.
Rainer Melchior hatten sie gefangen, alle drei männlichen Mitglieder der Familie Wernow strahlten vor Freude, sie kannten den Namen. Von einem der Begleiter, die neben Melchior im Keller lagen, hatten sie erfahren, dass sie auch noch den jungen Melchior und den jungen Rabe gefangen hatten. Das waren Namen, die in Brandenburg jedes Kind kannte: Die Firma Melchior und Rabe war als wohlhabend und zahlungskräftig bekannt, da würde ein gutes Lösegeld herausspringen.
»Und der Dritte ist der Ritter von Herzfeld«, triumphierte sein Sohn Siegfried, »der bringt doch auch ziemlich viel, so ein Ritter aus vornehmer Familie.«
»Du musst noch viel lernen, mein Sohn«, belehrte ihn der Alte, »diese Kämpfer, die sich als Begleiter für Geld anbieten, haben nichts. Und sie sind in ihren Familien nicht so angesehen, dass sich irgendeiner finden würde, für ihn Lösegeld zu zahlen, ganz einfach, weil sie meistens selbst nichts haben. Land ja, Geld nein, so wie wir. Deshalb schlag dir den Herzberg aus dem Kopf, den werden wir als Boten benutzen.«
»Als Boten? Wieso?«, fragte seine Frau.
Die Familie hatte sich am nächsten Morgen zu einem ausgiebigen Frühstück zusammengesetzt, Hildegard von Wernow hatte sich mit dem Raubzug versöhnt, nachdem ihr Mann ihr erzählt hatte, wieviel sie erbeutet hatten und dass die Wirtschaft auf dem Gut für einige Zeit gesichert sei. Und nun war sie wie die anderen an einem möglichst hohen Lösegeld interessiert.
»Na, als Boten nach Berlin, zur Firma Melchior und Rabe«, erklärte ihr Mann, »ich nehme an, dass der älteste Sohn unseres Melchior die Firma führt, er muss doch wissen, dass wir seinen Vater haben und dass wir ihn nur gegen Geld wieder rausgeben.«
»Natürlich, daran hätte ich auch denken können. Wieviel willst du denn für ihn verlangen?«
»Hunderttausend Goldgulden«, rief Siegfried, ihr Jüngster, dazwischen.
»Jugendlicher Übermut«, der Alte lächelte, »aber so Unrecht hat er gar nicht. Sieh mal, wenn wir hunderttausend verlangen, kriegen wir vielleicht die Hälfte. Und mit fünfzigtausend Gulden sind wir für die lange Zeit unsere Geldsorgen los, wenn ich Goldstücke einrechne, die wir erbeutet haben.«
5Rainer Melchior schnaubte in seinen Fesseln, als Petz von Wernow ihm sein Abendessen brachte.
»Keinen Taler werden sie euch Schurken zahlen«, knirschte er, »ihr werdet es sowieso nicht wagen, mich umzubringen, mein Sohn wird das als leere Drohung verstehen und nichts zahlen.«
»Gut«, antwortete Wernow scheinbar gleichmütig, »mir soll es egal sein, wenn wir von der Firma nichts bekommen, ich habe gute Verbindungen zu den Russen, spätestens die werden mir Geld für solche wertvollen Sklaven geben.«
Melchior erblasste, obwohl er sich nichts anmerken ließ. Die Russen waren berüchtigt, es gab schlimme Geschichten über Banden dort im Land. Sie kauften Menschen, hieß es und verkauften sie weiter an Asiaten, Chinesen, Tartaren, Mongolen und andere Stämme, für die ein weißer Sklave als besonders wertvoll galt. Nach Russland verkauft zu werden, war in Berlin in Kaufmannskreisen gleichbedeutend mit einem erniedrigenden Schicksal, das mit einem qualvollen Tod endete. Melchior selbst hatte diese Gerüchte nie geglaubt, handelte er doch selbst über seine Warschauer Geschäftsfreunde mit russischen Kaufleuten, die ebenso zivilisiert waren wie er selbst. Aber gegen die Angst, die ihn bei Wernows Drohung packte, halfen die Überlegungen wenig.
»Wie dem auch sei«, beendete Wernow das Gespräch, »wir haben den Herzfeld nach Berlin zu Ihrem Sohn geschickt, der soll das Geld bringen, danach lassen wir Sie und Ihre Begleiter frei.«
»Ich warne Sie, Wernow«, drohte jetzt Melchior beherzt, »lassen Sie mich lieber jetzt gehen, das kann Sie teuer zu stehen kommen, mich hier einfach zu überfallen und Lösegeld zu erpressen. Die Truppen des Kaisers werden Ihrem Treiben bald ein Ende machen.«
Roh lachte Petz von Wernow auf:
»Klar, die Truppen des Kaisers, sehen Sie mal, wie ich mich fürchte, meine Hand zittert vor Angst vor den Truppen«, er hielt Melchior seine Hand vor die Augen, eine breite, ruhige Hand, die keineswegs zitterte.
»Der Kaiser interessiert sich nicht für Brandenburg, nicht für Radelitz und meine Familie, und für Ihre Geschäfte schon gar nicht.«
Melchior wusste es wohl. Selbst wenn der Kaiser sich plötzlich entschließen sollte, in Brandenburg für Ordnung zu sorgen, er und seine Berater, ohne Ausnahme von hohem Adel, kümmerten sich nicht um die Geschäfte der Kaufleute, auf die sie herabsahen. Es war bekannt, dass auch im Reich im Westen, da, wo Ordnung herrschte, die Kaufleute sich um ihre Sicherheit selbst sorgen mussten. Er schwieg daher und Wernow verließ ihn, sollte Melchior doch reden. Morgen würde er wieder nach ihm sehen.
Mehr als vier Wochen vergingen unter den Verhandlungen. Boten ritten von Berlin nach Radelitz, tausend Gulden würden sie allenfalls zahlen, ließ die Familie ihn wissen, aber auch nur dann, wenn der Handel sofort abgeschlossen und der Senior mit seinen Begleitern unverzüglich auf freien Fuß gesetzt würden.
Das sei lächerlich, ließ Wernow ihnen ausrichten, wenn die Zahlung sofort ohne weiteres Zögern erfolgte, könnte er die tausend Gulden von seiner Forderung ablassen, aber wenn sie nicht sofort einwilligten, würden seine Gefangenen an die Russen verkauft werden.
Er solle doch die albernen Drohungen mit den Russen lassen, jeder wisse doch, dass das reines Geschwätz sei, richtete Herzfeld aus, den die Berliner erneut geschickt hatten, aber gut, die Firma sei bereit, ihr Angebot von Lösegeld auf dreißigtausend Gulden zu erhöhen.
»Seht ihr«, krähte triumphierend Siegfried, als sie das Angebot erhielten, »sie fürchten sich, sie wollen zahlen, und das ist bestimmt nicht ihr letztes Wort.«
Tatsächlich näherten sich die Parteien langwierig und zäh feilschend aneinander an, bis zuletzt die Firma Melchior und Rabe sechzigtausend Gulden anbot, um die Sache zu beenden. Dieses Angebot nahm Petz von Wernow an.
Es war ein Zug von zwei Bauernkarren, der Rainer Melchior, seinen Sohn und den jungen Rabe zum Treffpunkt brachte, etwa in der Mitte zwischen Berlin und Radelitz gelegen. Ihm kamen zwei Kutschen entgegen, die jeweils von einem Ritter in Waffen begleitet wurden, in denen die Gefangenen nach Hause gebracht werden sollten.
Mit steifen Beinen ging Petz von Wernow auf die Ritter zu und besichtigte die drei Säcke mit Goldstücken, die sie ihm anboten. Seinen Söhnen hatte er eingeschärft, an den Wagen stehen zu bleiben und die Pfeile in die Bögen zu legen.
Aber die Ritter ließen ihn mit dem Gold gehen und warteten ruhig auf Melchior und seine Begleiter, die Wernow freiließ. Dann trennten sich die Wagen.
6Niemals hättet ihr zahlen dürfen, nicht einen Taler«, wütete Rainer Melchior, als er in Berlin ankam und dort von seinem Sohn Ruppert und seinem Partner Herbert Rabe empfangen wurde. »Sie hätten es sowieso nicht gewagt, mich umzubringen oder an die Russen zu verschachern. Glaubt mir, das mit den Russen ist reines Geschwätz, nie hätte uns einer von ihnen gekauft.«
»Aber Vater«, verteidigte sich Ruppert, »was hätten wir denn tun sollen? Was hätten wir meiner Mutter erzählen können, wo ihr Mann und ihr Sohn bleiben? Nein, das konnten wir nicht riskieren, da ist es besser, wir haben bezahlt, das Geld kriegen wir schon wieder rein.«
»Ja, Rainer«, bestätigte sein Kompagnon, »mach dir um das Geld keine Sorgen, unsere Geschäfte laufen sehr gut, wir können die Summe schon verschmerzen.«
»Aber darum geht es doch gar nicht«, immer noch war der alte Melchior nicht zu beruhigen. »Seht ihr denn nicht, dass wir diese Wegelagerer nur ermutigen? Jetzt können wir weitermachen, werden sie sagen, wir fangen euch und holen Lösegeld, ein prima Geschäftsmodell.«
»Rainer, geh erst mal nach Hause, beruhige deine Frau, ruh dich aus und mach morgen einen Tag frei. Übermorgen sehen wir uns in alter Frische morgens um sechs im Kontor, dann reden wir weiter.«
Rainer Melchior fügte sich, tatsächlich machte er am nächsten Tag frei, um nachzudenken, wie er sagte.
»Sagt allen Freunden Bescheid«, verlangte er dann von seinem ältesten Sohn, »wir treffen uns morgen Abend beim Stammtisch, es sollen alle kommen, ich habe euch Vorschläge zu machen wegen der Räubereien auf den Straßen.«
Tatsächlich war am nächsten Tag die Runde der Kaufleute vollständig, natürlich kamen seine engen Freunde, aber auch alle anderen, die höchstens sporadisch an diesen Treffen teilnahmen. Sie waren neugierig, was der alte Melchior ihnen wohl zu sagen haben würde.
Der Winter hatte in diesem Jahr erst spät angefangen, sich im Januar aber mit Frost und Schnee in Erinnerung gebracht. Die Teilnehmer waren in dicke Pelze gehüllt, als sie in dem Sitzungszimmer in ihrem Stammlokal, einer gutbürgerlichen Gaststätte, ankamen. Im Kamin prasselte ein lebhaftes Feuer und wärmte den Raum, Kerzen waren auf den Tischen aufgestellt und in Haltern an den Wänden in großer Zahl angezündet worden, so dass der Saal hell erleuchtet war. Nach kurzer Zeit hüllte ein warmer Dunst die Männer ein, der Geruch nach dem Cognac, den sie tranken, vermischte sich mit dem Pfeifenqualm und den Ausdünstungen der dichten, feuchten Pelze, die am Eingang hingen. Gespannt warteten die Männer, was der Senior der Firma Melchior und Rabe ihnen sagen wollte
Rainer Melchior hatte sich gut vorbereitet.
»Meine Firma hat viel Geld verloren an diesen Raubritter in Radelitz, diesen Wernow. Wir alle wissen, dass er die Straße hinter Frankfurt unsicher macht, niemand kann nach Osten, niemand hierher mit Waren reisen, ohne dass er in Gefahr ist, von diesem Räuber ausgeplündert zu werden. Das kann so nicht weiter gehen.«
»Richtig«, rief ein junger Mann dazwischen, Kurt Kramer, der Holzhändler, der seit einigen Jahren die Firma von seinem Vater übernommen hatte. »Mein Holz können sie ja nicht stehlen, das ist ihnen zu schwer, aber sie haben meine Firma auch schon überfallen und das Geld geraubt.«
»Siehst du«, fuhr Melchior fort, als hätte Kramer nichts gesagt, »und deswegen müssen wir dem ein Ende bereiten.«
»Ja sofort, aber wie?«, unterbrach ihn Heinrich Wiedebusch, der Goldhändler, »wie oft waren wir schon beim kaiserlichen Gouverneur, wie oft hat der uns schon abblitzen lassen. Nein, niemand hilft uns, gegen die Raubritter ist kein Kraut gewachsen.«
»Eben nicht«, widersprach Melchior, »hört zu, ich habe mich mit ein paar Rittern unterhalten, die hier in der Stadt wohnen, unter anderem mit Siegfried von Herzfeld, der ist noch richtig geladen, dass der Wernow uns überfallen und ihn gezwungen hat, für ihn den Boten zu spielen. Herzfeld meint, dass es möglich ist, mit einer verhältnismäßig kleinen Anzahl von Kämpfern das Gut Radelitz zu überfallen, die Bewohner auszuschalten und die Gebäude dem Erdboden gleich zu machen. Das Herrenhaus sei zwar befestigt, aber sie würden die Mauern überwinden können. Er bot an, so eine Truppe zusammenzustellen, die Männer anzuführen und nach Radelitz zu reiten.«
»Bewohner ausschalten?«, fragte der Stadtschreiber, »heißt das, du willst die Familie umbringen lassen?«
»Das würde ich am liebsten«, antwortete der Kaufmann und knirschte hörbar mit den Zähnen, »ich habe eine solche Wut auf sie, mir wäre es recht, wenn sie alle unter der Erde lägen. Aber das ist mit Herzfeld nicht zu machen. Der hat Angst, dass er es ernsthaft mit dem Kaiser zu tun kriegt, wenn er eine ganze Familie von Adeligen umbringt, seien sie auch noch so unwichtig. Nein, Herzfeld würde nur die Gebäude vernichten und die Mauern schleifen, dann könnten sie dort nicht mehr wohnen und wirtschaften und vor allem, uns nicht mehr überfallen.«
»Die Idee ist nicht schlecht«, bemerkte der Weinhändler, »aber erstens, was ist mit den anderen, denen auf der Straße nach Dresden zum Beispiel?«
»Darum sollen sich die kümmern, die in Dresden Interessen haben«, antwortete Melchior.
»Und zum zweiten«, fuhr der Weinhändler fort, »die Ritter werden doch nicht unentgeltlich für uns reiten und kämpfen. Was kostet das und wer soll das bezahlen?«
»Wir«, antwortete Melchior schroff, »eigentlich ist das eine Aufgabe des Kaisers, aber der tut ja nichts und sein Statthalter hier hat nicht genug Mittel, also bleiben nur noch wir hier, die Berliner Kaufleute.«
Aufgeregt schwirrten die Stimmen durcheinander.
»Wir sollen für unseren Schutz zahlen?« »Warum zahlen wir denn Steuern?« »Frechheit, aus unserer eigenen Kasse!«
Melchior nahm einen tiefen Zug aus seinem Weinpokal.
»Kollegen, hört zu, ihr habt ja Recht, warum sollten wir Kämpfer bezahlen, damit die die Arbeit des Kaisers tun. Aber überlegt doch, was bleibt uns denn sonst übrig? Anders ist keine Abhilfe möglich.«
»Na gut, lasst uns überlegen«, das war die ruhige Stimme des Stadtschreibers, »aber dazu müssen wir zuerst wissen, was kostet das denn?«
»Ich habe mit Herzfeld gesprochen. Er braucht fünfzig Reiter und er glaubt, dass sie mit einem Lohn von täglich einem Gulden zufrieden sind. Aber sie müssten einen Monat Zeit haben, darunter ginge es kaum zu machen.«
»Fünfzig Reiter für einen Gulden, das sind fünfzig Gulden pro Tag, für dreißig Tage, tausendfünfhundert Gulden«, Kramer rechnete blitzschnell, wurde aber von Wiedebusch unterbrochen:
»Seid ihr wahnsinnig? Wir sind hier dreißig Kaufleute, das wären ja für jeden«,
»fünfzig Gulden«, unterbrach ihn Kramer.
»Genau, fünfzig Gulden soll ich ausgeben für Reiter, die nichts gelernt haben als zu kämpfen? Wahnsinn!«
»Aber fünfzig Gulden dafür, dass die Straße nach Warschau wieder sicher ist, ich glaube, das ist nicht zu viel dafür«, entgegnete der Weinhändler, »ich bin dabei.«
»Aber ich noch nicht«, Kramer hob die Hand, »meine Firma hat Interesse daran, dass die Straße nach Osten frei wird, aber wir haben das gleiche Problem nach Dresden, auch da müssten wir die Ritter hinschicken und nach Hannover, da gibt es gleich zwei Banden, die am Weg lauern. Und dafür soll ich jedes Mal fünfzig Gulden hinlegen?«
»Eine gute Idee, Kramer«, mischte sich Melchior wieder ein, »lass uns doch zusammentun, wir geben jeder mehr als fünfzig Gulden, mal hören, was die Ritter verlangen, wenn sie mehr als nur ein Räubernest ausheben sollen, dafür aber länger gesicherten Lohn erhalten. Wir können dann eine Gemeinschaft bilden für die Sicherheit der Straßen in Brandenburg, was haltet ihr davon?«
Er sah in nachdenkliche Gesichter. Fünfzig Gulden nur für die Straße nach Warschau, das erschien vielen von ihnen zu viel, aber ein Mehrfaches dafür, dass die Straßen in Brandenburg insgesamt sicher wurden? Darüber konnte man nachdenken.
7Siegfried von Herzfeld hob den Arm. Sie waren bis auf fünf Kilometer an das Dorf Radelitz herangeritten. Schwer war der Weg gewesen, sie hatten sich gegen stürmischen Wind aus Osten vorankämpfen müssen, dichte Wolkenberge türmten sich über ihnen auf, die manchmal Schnee brachten.
Zwar hätten sie nach dem Kalender, der Frühling war nahe, wärmere Temperaturen erwarten können, sie waren aber enttäuscht worden. Nachdem Anfang März die Sonne sich in Brandenburg durchgesetzt und den Schnee weggetaut hatte, hatte es Ende des Monats wieder niedrigere Temperaturen gegeben, in der vorigen Nacht hatte Frost den weichen Schlamm des Weges erneut in scharfkantige Spuren verwandelt, die den Pferden zu schaffen machte. Sie kamen nur langsam voran.
Sie hatten sich sich finster in ihre dicken Wollmäntel gehüllt, darüber hatten sie die eisernen Rüstungen geschnallt, trotzdem war es kalt, sobald sie stehen blieben.
»Genau das richtige Wetter für so einen Überfall«, hatte Herzfeld seinen Männern gesagt, die seine Sicherheitstruppe bildeten und die jetzt auf dem Weg nach Radelitz waren, um Melchiors Auftrag auszuführen.
»Macht das Gut dem Erdboden gleich, brennt es ab, mit allen Vorräten, mit allem, was darin ist. Vermeidet nach Möglichkeit, Menschen zu töten, aber wenn sie sich wehren, setzt euch auf jeden Fall durch, schlimmstenfalls auch in Kämpfen, wenn dabei einer stirbt, macht nichts. Nur unter den Frauen und Kindern darf es keine Toten geben.«
Heute Morgen waren sie losgeritten, immer gegen den kalten Sturm aus Ost, fluchend, aber schließlich, kämpfen war ihr Beruf.
Auf das Zeichen ihres Anführers bildeten sie einen Kreis, die Pferde stampften unruhig den gefrorenen Boden, immer wieder von ihren Reitern gezügelt.
Herzberg hatte seine Leute in fünf Gruppen geteilt mit je einem Anführer.
»Wir haben es mit ungefähr dreißig Menschen zu tun«, flüsterte jetzt Herzfeld, als ob man ihn von hier aus auf Radelitz hören konnte, kaum waren seine Worte im Wind zu verstehen.
»Von diesen dreißig müssen wir damit rechnen, dass die Hälfte bewaffnet ist, die müssen unschädlich gemacht werden. Zuerst Petz von Wernow und seine beiden Söhne Balzer und Siegfried. Die müssen wir möglichst sofort entwaffnen und fesseln. Im Haus selbst sind sonst nur noch Diener und Frauen, die werden sich kaum wehren. Die anderen Bewaffneten sind in den Nebengebäuden bei den Pferdeställen untergebracht. Die erste Abteilung geht zu diesen Nebengebäuden, ihr treibt die Bewohner hinaus, wenn sie sich wehren, notfalls auch mit Waffen, aber seht zu, dass keiner stirbt. Die zweite Abteilung treibt die Tiere aus den Ställen, ihr seid dafür verantwortlich, dass keine Menschen und Tiere in den Gebäuden sind, bevor ihr Feuer legt.
Wir anderen gehen ins Herrenhaus, die dritte Abteilung«, er deutete auf die entsprechenden Ritter, »geht mit mir nach oben durch die Schlafzimmer, da werden wir die Familie Wernow finden. Auch die jagen wir hinaus, wenn sie sich wehren, auch hier mit Gewalt. Aber seht um Himmels willen zu, dass ihr niemanden tötet, das hat unser Auftraggeber ausdrücklich verboten. Töten nur in Notwehr, hat er gesagt. Die beiden letzten Abteilungen«, er deutete auf die verbliebenen zwei Anführer, »kommen mit ins Herrenhaus und räumen das Erdgeschoss von Dienern. Schmeißt sie alle raus, ihr müsst sicher sein, dass da keiner mehr drin ist. Wir sind keine Mordbrenner, es soll niemand im Haus verbrennen. Und wenn wir alle haben und sie im Garten sind, zünde ich das Herrenhaus an. Meine Abteilung hilft mir dabei. Wir werden Öl genug in der Küche finden, Zündstein habe ich mit.
Ist das alles klar?«
Ja«, brummten die Männer mürrisch und einer fuhr fort, »das haben wir doch schon besprochen, lasst uns endlich losreiten und es zu Ende bringen.«
Im Galopp ritten die Ritter wie ein Sturmwind eine halbe Stunde später vor die hohen Umfassungen des Rittergutes Radelitz, stellten sich auf ihre Sättel und erklommen die Mauern. Eine Zeit lang war nichts zu hören als das angestrengte Stöhnen der Männer, die mit ihren schweren Rüstungen klettern mussten. Als alle innerhalb des Hofes waren, rannte Herzfeld mit seinen Begleitern auf das große Eingangstor zu und trat mit dem Fuß dagegen. Als die Tür nicht zerbrach, stemmten sich drei andere mit voller Kraft gegen die Flügel, mit einem durchdringenden Krach splitterte das Holz, sie stürzten in die große Halle. Herzberg stürmte sofort mit seinen Begleitern die weite Treppe hinauf auf den Flur. Eine Tür nach der anderen zerbrach unter ihren Fußtritten, bis sie im dritten Zimmer den jungen Siegfried von Wernow fanden, der verwirrt mit schlaftrunkenen Augen auf die Männer starrte.
»Wer seid ihr und was wollt ihr?«, fragte er, da war er schon gefesselt, einer blieb als Wache zurück.
Petz von Wernow fanden sie hinter der gegenüberliegenden Tür, er war der Einzige, der den Krach am Tor gehört und die richtigen Schlüsse gezogen hatte: Radelitz wurde überfallen! Er bewaffnete sich und trat den vier Reitern, die mit blankem Schwert in das Zimmer kamen, entgegen.
»Was wollt ihr«, herrschte er Herzfeld an.
»Dich aus dem Haus schmeißen«, antwortete der Ritter barsch, unterlief das Schwert des Alten, gelangte hinter ihn und hieb ihm den Messergriff an den Kopf, so dass er bewusstlos zu Boden sank. Seine Frau hatte zitternd im Bett den Ausbruch der Gewalt in ihrem Schlafzimmer beobachtet, sie folgte den Anweisungen Herzfelds, zog sich an und verließ das Haus.
Siegfried von Herzfeld schleppte Petz von Wernow, der immer noch bewusstlos war, auf den Rasen vor dem Herrenhaus, mehrere andere Kämpfer brachten Siegfried und Balzer von Wernow, die beide keine Schwierigkeiten gemacht hatten.
Und dann stolperten die Diener, die Köchin, die Mägde heraus, vorwärts getrieben von zehn Reitern und sammelten sich angstvoll neben ihrer Herrschaft.
Sie alle hörten für einen kurzen Moment durch den Sturm die Geräusche, die die aus den Ställen gejagten Tiere machten: Angstvoll wieherten die Pferde, die Schafe blökten, ein Schwein quiekte auf, dann übertönte wieder eine kräftige Bö alle anderen Laute.
Siegfried von Herzberg war mit vier Kämpfern im Haus geblieben, sie untersuchten fieberhaft alle Räume, kein Mensch war mehr hier. In der Küche nahm der Ritter einen Kanister Lampenöl, goss ihn über den noch glimmenden Herd und schlug Funken mit dem Feuerstein.
Eine Flamme loderte auf und schon brannten die kleinen Äste und das Papier, das die Köchin neben dem Herd lagerte, um ihn anzuzünden. Als nächstes fing das Brennholz Feuer, ebenfalls neben dem Herd, dann brannten die grob gehauenen Dielen des Fußbodens, schließlich entzündeten sich die Möbel, das Feuer breitete sich aus, fing sich in den Vorhängen vor den Fenstern, loderte in die Halle und erfasste dort alles, was brennbar war. Herzfeld zog sich aus dem Haus zurück, auf dem Rasen stehend sah er, wie jetzt das Feuer in das erste Geschoss übergriff, zuerst brannten hier die Vorhänge vor den Fenstern, das Glas brach, der Sturm fachte die Flammen an, lodernd wuchsen sie jetzt bis unter das Dach, mit einem explosionsartigen Knall brachen die Sparren und jetzt brannte das ganze Herrenhaus lichterloh. Befriedigt sah Herzfeld Petz von Wernow an, der mittlerweile wach geworden und gefesselt worden war und der jetzt mit Entsetzen auf die Flammen starrte, in denen sein Besitz aufging.
»Du Mörderbube wirst keine friedlichen Kaufleute mehr überfallen«, dröhnte er und wurde übertönt von dem Geprassel hinter ihm: Dort gingen die Nebengebäude ebenso in Flammen auf wie das Herrenhaus.
»Selbst, wenn du zwanzig Leute zum Löschen hättest«, höhnte er, »sie würden das Feuer jetzt nicht mehr bändigen können. Radelitz ist verbrannt, es gibt kein Gut Radelitz mehr. Kommt, Leute«, rief er seinen Rittern zu, die zu ihren Pferden liefen, die sie auf seinen Befehl außerhalb der Mauern gut angebunden hatten.
Die Pferde wären geflohen, sie bäumten sich an ihren Stricken auf, beruhigten sich aber halbwegs, als ihre Reiter zu ihnen traten.
Sie saßen auf und ritten ebenso stürmisch davon, wie sie gekommen waren.
8Niemand sprach. Wortlos sahen sie dem Feuer zu, das sich immer weiter durch die Gebäude fraß, alles zerstörend, was immer ihm als Nahrung dienen konnte, zurück blieben nach Stunden nur noch in die Himmel ragende Sparren des Daches und glühend heiße Metallteile, die einmal als Gerüst für Möbel und Hausrat gedient hatten.
Irgendwann übertönte der immer noch anhaltende Sturm das nachlassende Geprassel des Feuers.
»Verdammte Brandstifter«, brummte Petz von Wernow, der als erster Worte fand und zog die Wolldecke, die sie ihm gelassen hatten, enger um den Leib, »das werden sie mir büßen. Habt ihr jemanden erkannt?«
Sie alle, Wernow, seine Frau, seine Söhne und die Diener standen vor den Ruinen des Hauses, in denen es noch immer ab und zu aufglimmte.
»Ja«, brummte Siegfried, »einer war der Ritter von Herzberg, den wir gefangen hatten, von dem ihr gesagt habt, das wäre ein armer Schlucker. Der war dabei.«
»Herzberg«, murmelte Petz von Wernow vor sich hin, »den haben bestimmt die Kaufleute geschickt, für die wir Lösegeld erhalten haben, Na warte, denen werden wirs zeigen.«
Aber seine Frau unterbrach ihn:
»Petz, willst du das denn jetzt nicht mal sein lassen? Du siehst doch, da ruht kein Segen drauf, was wir von denen erpresst haben. Jetzt haben wir zwar Geld, aber kein Haus mehr. Wo sollen wir denn wohnen? Darüber solltest du dir Gedanken machen, anstatt auf Rache zu sinnen.«
»Das Geld«, flüsterte der Alte und schlug sich an den Kopf, verstummte aber sofort, die Diener waren in der Nähe und konnten mithören. Wenn sie erfuhren, dass er Geld im Haus versteckt hatte, würden sie danach suchen und möglicherweise etwas finden. Deshalb kein Wort davon. Man musste abwarten, bis sich alles abgekühlt hat, dann würde man sehen, was von dem Gold noch übrig war. Er sah seine Söhne und seine Frau scharf an und legte den Finger auf den Mund, sie nickten.
Petz von Wernow schickte alle Diener weg, er würde sie nicht mehr bezahlen können, sagte er ihnen, das Dienstverhältnis sei deshalb beendet. Widerspruchslos verließen sie den Hof.
Die Reiter hatten ein kleines Gartenhaus am Rande des Gemüsegartens nicht angezündet, Wernow war unklar, ob sie es übersehen oder ihnen absichtlich als Unterkunft gelassen hatten. Dort quartierte sich die Familie ein, das Haus hatte drei Zimmer, eines für die Eltern, eines für die Söhne und ein drittes konnten sie als Küche nutzen. Zum Glück war die Hütte mit einem Ofen ausgestattet, so dass sie sich wärmen konnten.
In dem dritten Zimmer saßen Petz von Wernow, seine Frau und seine beiden Söhne und beratschlagten, was zu tun sei.
»Radelitz ist zerstört«, jammerte Hildegard von Wernow, »wir können hier doch auf die Dauer nicht wohnen, das ist zu klein für uns und vor allem, wovon sollen wir leben?«
»Ist gut, Hildegard, beruhige dich erst mal, wir bauen das Haus wieder auf, das dauert wohl einige Zeit, aber bis dahin können wir doch gut hier leben?«
»Nein, kommt überhaupt nicht in Frage, das ist zu klein, sieh doch mal, alles ist dreckig, wir haben hier nicht mal einen Fußboden, der Grund ist einfach nur festgestampfter Sand, wie soll ich hier wohl Ordnung halten? Und dann, drei Zimmer, Petz, ich bitte dich, das geht doch nicht. Sieh mal, wie dünn diese Wände sind«, sie klopfte gegen die Holzwand, die dieses Zimmer von den anderen teilte. »Ich habe dir von Anfang an gesagt, dass ich gegen diese Räubereien bin, und jetzt hast du die Antwort darauf. Wie konntest du nur annehmen, dass die Kaufleute sich nicht wehren?«
»Mama, lass man«, Balzer mischte sich in die Unterhaltung seiner Eltern ein, bevor sie zum Streit wurde, »wir haben doch gut gelebt davon, wir alle, und wir haben das gemeinsam gemacht. Wir kommen schon damit zurecht, für eine kurze Zeit.«
»Für eine kurze Zeit«, äffte ihn seine Mutter nach, »das hat dein Vater auch gesagt, aber hier in diesem Gartenhaus bleibe ich nicht, eher gehe ich zu meinen Verwandten nach Frankfurt.«
Hildegard von Wernow war eine geborene Gräfin Westinhaus und sie war stolz auf ihre Herkunft aus dem höheren Adel. Fast immer, wenn sie Auseinandersetzungen mit ihrem Mann hatte, drohte sie an, sie würde zu ihren reichen und vornehmen Verwandten in Frankfurt gehen, aber niemand nahm das sonderlich ernst, sie wussten, sie würde ihren Petz kaum verlassen.