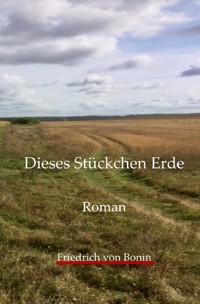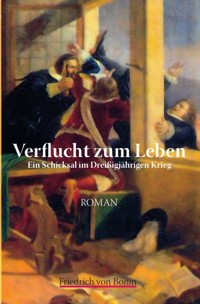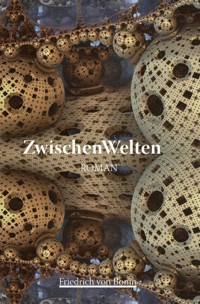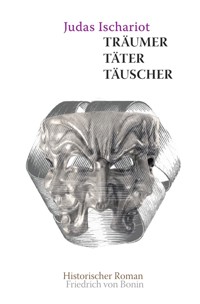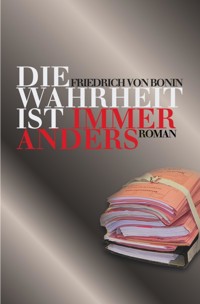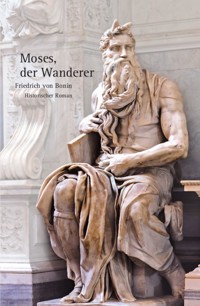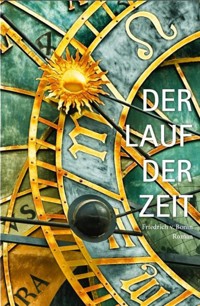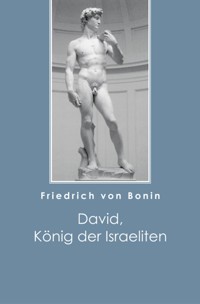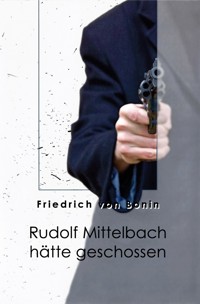
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Rudolf Mittelbach ist Staatsanwalt in Hamburg und erzählt die Geschichte seines Freundes Heinrich Görgen. Der hat sich aus ärmlichen Verhältnissen zu einer gesicherten Existenz hochgearbeitet, bevor die Finanzkrise und hartherzige Bankiers seine Existenz bedrohen. Mit kühler und knapper Sprache, ohne Larmoyanz beschreibt der Autor die Mechanismen der bis heute andauernden Finanzkrise und ihre Auswirkungen auf einzelne Menschen. "Erstaunlich, wie anschaulich hier die gefährlichen Manipulationen der Hochfinanz in einen spannenden Roman verpackt werden", schrieb ein Kritiker.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 388
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum
Epubli Verlag, Berlin
Copyright © Friedrich von Bonin 2011
ISBN 978-3-7375-4198-5
Zu lang schon waltest über dem Haupte mir,
Du in der dunklen Wolke, du Gott der Zeit!
Zu wild, zu bang ist´s ringsum, und es
Trümmert und wankt ja, wohin ich blicke.
2010
1.
Die gegenwärtige Krise zeigt uns deutlich, wohin Gier, übersteigertes Gewinnstreben und Maßlosigkeit von uns normalen Menschen, aber vor allem von Bankiers, und dem akkumulierenden Kapital führen kann. Alles ist durch die Krise ins Wanken geraten. Man verzeihe mir diese rebellisch anmutenden Sätze, die mir in meiner Funktion nicht wohl anständen, aber das Ausmaß der derzeitigen Krise, die Politiker und Bankmanager dazu führt, eine Milliarde Euro gewissermaßen als kleinste kalkulatorische Einheit zu behandeln und mit dieser Betrachtungsweise einfache sterbliche Menschen wie mich anzustecken, hat mich durch ihre Größenordnung, die sozialen Gefahren für unser Gemeinwesen und die Kosten, die sie verursacht, aus meinen gewohnten Denkbahnen geworfen.
Ich bin Staatsanwalt in Hamburg, Rudolf Mittelbach ist mein Name, und ich sitze über der Leichenakte Heinrich Görgen.
Draußen tobt der erste Sturm dieses Herbstes mit einer ungewöhnlichen Heftigkeit, der Wetterbericht hat Sturmböen in Orkanstärke vorausgesagt, und die spärlichen Bäume auf dem Gorch Fock Wall, an dem meine Behörde residiert, biegen sich unter der Naturgewalt, ihre Blätter, die noch kaum gelb geworden sind, dem Sturm preisgebend. Immer wieder prasseln Regenschauer, ebenfalls vom Sturm getrieben, fast waagerecht gegen meine Fenster, es ist mit einem Schlage kalt geworden. Haben gestern die Menschen noch, nur mit Hemd und Hose bekleidet, bei zwanzig Grad vor den Kaffeehäusern gesessen, so herrschen jetzt allenfalls sieben Grad, die wenigen Menschen, die durch die Stadt hasten, sind dick gegen Regen und Sturm vermummt, Regenschirme sieht man nicht, sie würden in dem Sturm auch nur verbogen.
Die Akte Heinrich Görgen ist eine Leichenakte, so werden die Akten genannt, die über einen Toten handeln, dessen Tod nicht durch natürliche Umstände herbeigeführt wurde, sondern in irgendeiner Weise den Verdacht erregt, er könne gewaltsam oder mindestens unnatürlich sein. Gier und gewaltsamer Tod, nicht umsonst verbinden meine Gedanken diese beiden Erscheinungen, zeigt doch die Habgier in ihrer übersteigerten Form möglicherweise das ungeschminkte Wesen des Mannes, sein Böses, seine Wildheit, seine Gewaltbereitschaft, die allerdings durch die Zivilisation gezähmt wurde und durch Gewinnsucht sublimiert wird. Sagte ich das Wesen des Mannes, das Böse im Mann? Ich muss mich da versprochen haben, ich meinte natürlich das Wesen des Menschen, es wird erfasst von der Begehrlichkeit, strebend nach immer mehr und immer Größerem und immer Neuerem, in zunehmendem Masse beteiligen sich auch Frauen an der Jagd nach dem Geld und bereichern sie mit Ideen, die sich in der Krise als ebenso gefährlich herausgestellt haben wie die ihrer männlichen Kollegen. Auch sie sind unentbehrlicher Teil in diesem Mechanismus geworden. Dennoch: Wildheit und Gewalt sind männliche Eigenschaften, die Frauen wohl auch haben können, aber dann eher ausnahmsweise, wie es Männer gibt, die diese Wildheit nicht haben, sie in fast weibischer Weise entbehren. Ich zum Beispiel, Staatsanwalt in Hamburg, Oberstaatsanwalt, bekenne mich offen dazu: Ich bin nicht gewalttätig, Zeit meines Lebens bin ich der körperlichen Gewalt und überhaupt Auseinandersetzungen mit Erfolg ausgewichen. Ich gehöre zu den glücklichen Menschen, Männern, die nie in einen Krieg verwickelt waren, in dem sich die bösesten Urtriebe der Männer und der Menschen so schrecklich entlarven, in dem sich die Zivilisation, auf die ich besonders stolz bin, als dünne Decke um den Urmenschen erweist, die sofort bricht, wenn es Gewalttaten gilt.
Insoweit ist mit der Gier, die eine Form kultivierter Gewalttätigkeit ist, sogar gut leben, ist sie doch Ausdruck einer Zivilisation, die so weit als möglich friedlich, keinesfalls jedenfalls kriegerisch ist. Dieser Satz kann nicht unbedingt stehen bleiben, was nämlich, wenn die Habgier in einer Krise mündet, die soziale Verwerfungen zeitigt, Unruhen, die wiederum Gewalt produzieren und dann die Gewalttätigkeit des Menschen nackt und bloß legt. Was diese Krise noch hervorbringt, ist für uns Zeitgenossen am heutigen Tage nicht vorhersehbar, wir werden die Folgen jedenfalls alle zu tragen haben, der eine mehr, der andere weniger. Wenn es stimmt, was einer der bedeutenden zeitgenössischen Wirtschafts“wissenschaftler“ sagt, der die Habsucht verteidigt mit der Erwägung, sie sei in der Geschichte der Menschheit stets treibende Kraft für Kreativität und Fortschritt gewesen, dann wird dies nicht die letzte Krise dieser Art gewesen sein und sich eher noch verschärfen.
Vor mir liegt die Leichenakte Heinrich Görgen, ich sollte die Akte nach Frankfurt zurückgeben, ich habe sie mir kommen lassen, um die Einzelheiten seines Todes für mich zu klären. Ich habe Heinrich Görgen gekannt, ja, zeitweise war er mir ein guter Freund. Schließlich taten sich aber unüberwindliche Gräben zwischen uns auf, seine Eltern waren arm, meine wohlhabend. Bis zuletzt habe ich, von meinen Eltern behütet erzogen, das Problem nicht erkannt, es auch vielleicht nicht sehen wollen. Nun gut, es gab vielleicht andere Gründe für unsere Entfremdung, aber die wären nicht unüberwindlich gewesen.
2.
Aufgewachsen bin ich am Rande des inneren Straßenringes, der das Zentrum meiner Heimatstadt Eimstadt umgibt, in einem dieser Bürgerhäuser, die in den dreißiger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts gebaut worden sind, prächtig, aber nicht zu prächtig, mit zwei Stockwerken, groß genug, damit meine Eltern, mein Vater ist Vorsitzender Richter am Landgericht meiner Heimatstadt gewesen, ihre drei Kinder, mich, den Ältesten, und meine zwei Schwestern darin großziehen konnten. An das Haus schloss sich ein kleiner Garten, gerade groß genug, damit wir darin tollen konnten, nicht zu groß, damit er von meiner Mutter noch gepflegt werden konnte. Die Villa lag noch zentral in dieser mittelalterlichen Stadt in der Nähe von Hamburg, die früher einmal Hansestadt gewesen war, jetzt aber diesen Titel nicht mehr führte. Unser Haus war geräumig, im Erdgeschoß befand sich hinter der Haustür und dem Windfang ein riesiges Wohnzimmer, das Platz bot für eine Sitzecke, wie meine Eltern sie nannten, einem niedrigen Tischchen mit drei bequemen Ledersesseln und einem ausladenden Sofa darum und, in der Nähe der bis auf den Boden reichenden Gartenfenster, den Esstisch mit zwölf Stühlen davor, aus Eiche der Tisch und die Stühle, deren Sitzfläche mit schwarzem Leder bezogen waren. Neben dem Wohnzimmer befand sich eine Küche, die groß genug war, um der Familie Alltags zu den Mahlzeiten an einem Tisch Platz zu bieten, im Übrigen mit Herd, Kühlschrank und Waschmaschine ausgestattet. Hier nahmen wir Kinder das Frühstück ein, die wir früh aufstehen und aus dem Haus zur Schule mussten, das Mittagessen ebenfalls getrennt, mein Vater kam an Sitzungstagen unregelmäßig nach Hause, das Abendbrot versammelte die ganze Familie pünktlich um ein halb acht in der Küche, sonntags im Wohnzimmer. Diese Mahlzeit war es auch, vor der mein Vater die Hände faltete, wartete, bis auch die Familie die Hände gefaltet und die Köpfe gesenkt hatte, dann ebenfalls den Kopf senkte und das Gebet sprach „Komm Herr Jesus, sei du unser Gast, und segne, was du uns aus Gnaden bescheret hast. Amen.“
Erst dann war es erlaubt, die Mahlzeit zu beginnen, es gab abends Brot mit Aufstrich zu essen und Tee zu trinken, für meinen Vater sonntags einen weißen Wein.
Mein Vater war ein ehrfurchtgebietender Mann, nicht über ein mittleres Maß groß, aber mit einem bedeutenden Kopf, mächtig, kantig, mit einer breiten und hohen Stirn unter schlohweißem Haar, ich kann mich nicht erinnern, ihn mit braunem Haar gesehen zu haben. Unter der Stirn und den buschigen, ebenfalls weißen Augenbrauen hatte er bemerkenswert klare blaugraue Augen, mit denen er über den Tisch sah und die einen trafen, wenn man etwas falsch gemacht hatte. Keiner von uns Kindern mochte es gerne wagen, diesen Blick auf sich zu ziehen. Eine schmale Nase und ebenso schmale Lippen bildeten einen bemerkenswerten Gegensatz zu der großen Stirn, das Gesicht wurde nach unten durch ein kräftiges Kinn abgeschlossen. Seine linke Wange verunzierte ein großes rotes Feuermal, das sich, geriet mein Vater ausnahmsweise einmal in Zorn, tiefer rötete und den furchterregenden Eindruck des Gesichtes verstärkte. Ich habe meinen Vater selten ohne Anzug, weißes Hemd und Krawatte gesehen. Meine Mutter wirkte sich dagegen bescheiden aus, schmal, mit einem gütigen Gesicht, blickte sie unter braunen Haaren aus ebenso braunen Augen traurig auf uns herab, wenn wir Dummheiten gemacht hatten.
Seit ich denken kann, war ich mit Dietrich Alpmer und Malte Matter befreundet, der erste der Sohn unseres Hausarztes, der zweite aus dem Hause des Rechtsanwaltes Matter stammend, der eines der angesehensten Anwaltsbüros in unserer Stadt betrieb. Oft habe ich meinen Vater achtungsvoll über diesen Rechtsanwalt erzählen hören, der als exzellenter Jurist, dazu als fleißig und beständig galt.
Mit beiden Freunden streifte ich seit unserer frühen Kindheit durch Eimstadt. Als kleine Kinder spielten wir in den jeweiligen Gärten unserer Elternhäuser, die in erreichbarer Nähe lagen, seit wir in die Schule gingen, hatten wir unseren Radius erweitert und stöberten durch die Straßen unserer Stadt. Was gab es da zu entdecken. Da war zunächst der Stadtstreicher Heini, wie alle Welt ihn nannte, den wir verfolgten, wenn er durch die Straßen ging und ihm „Heini, Heini“, hinterherriefen. Das machte gleichzeitig Spaß und war furchterregend, weil die Passanten, die Heini und uns sahen, beifällig lachten und uns sogar anspornten, furchterregend wurde es, wenn Heini sich plötzlich umdrehte und drohte, uns zu verprügelten, wenn wir nicht von ihm abließen. Einmal erschreckte er mich tatsächlich beinahe zu Tode, weil er nach einer solchen Drohung sich nicht wieder abwandte, sondern tatsächlich hinter uns, die wir in alle Richtungen auseinanderstoben, herlief und sich ausgerechnet entschied, mich zu verfolgen. Ich rannte, was ich konnte, suchte verzweifelt ein Geschäft, in das ich flüchten konnte und in das er mir nicht folgen würde. Ich war aber aus Versehen in eine stille Straße ohne Geschäfte gelaufen und hörte, wie er, der schneller laufen konnte als ich, mir immer näher kam, bis ich eine Straße mit Geschäften erreichte und in den nächsten Laden stürmte, ein Herrenbekleidungsgeschäft, in das er mir nicht folgte. Völlig außer Atem lehnte ich mich gegen den Verkaufstresen, um mich auszuruhen, wurde aber von dem Verkäufer angesprochen, der den Achtjährigen, der japsend an seinem Tresen stand, als störend empfand und hinausjagte. Vorsichtig steckte ich die Nase auf die Straße, aber Heini war verschwunden und blieb es auch, als ich im Trab nach Hause lief. Am gleichen Nachmittag vergewisserte ich mich, dass auch Dietrich und Malte entkommen waren.
Durch die Stadt floss die Scharte, ein kleiner Fluss, der in früheren Jahren, so hatten meine Eltern erzählt, völlig verseucht worden war durch Abwässer, Dünger aus der Landwirtschaft und alles, was man sonst hineingeworfen hatte. In der Altstadt machte der Fluss immer noch einen sehr verdreckten Eindruck, vor der Stadt aber war er inzwischen so weit geklärt, dass wir ohne Bedenken darin schwimmen konnten. Im Ort selbst lagen in einem kleinen Hafen die Segelboote, die Eigentümern aus der Umgebung gehörten, vertäut. Wir konnten stundenlang am Ufer des Flusses sitzen und uns erträumen, wohin wir segeln würden, wenn wir groß wären. Dietrich kannte sich mit Booten aus, er wusste, wohin man von hier aus segeln konnte, gehörte doch eines der am Steg vertäuten Segelboote seinem Vater, der uns allerdings strengstens verboten hatte, es in seiner Abwesenheit zu betreten. Wir durften einmal mitfahren, aber nur aus dem Hafen heraus und an das Ufer des Flusses. Nicht nur Segelboote lagen im Hafen, auch Binnenschiffe, die ihre Fracht in unsere Stadt trugen und wieder beladen wurden. Das waren lange Schiffe, mit richtigen Wohnungen in den hinteren Bereichen, in denen auch die Steuerhäuser lagen, und einer kleinen Wohnung im vorderen Teil für den Bootsmann. Ein Schiff, das immer wieder kam, hieß Line und mit seinem Bootsmann, Richard, freundeten wir uns an. Er hatte uns gefragt, ob wir nicht einmal seine Kajüte sehen wollten und neugierig hatten wir zugestimmt. Wir waren auf das Schiff geklettert, achtern, wie er sagte, und waren den schmalen Laufgang an der Ladefläche vorbei nach vorne gegangen und dort über eine steile Leiter nach unten gestiegen, in sein Reich, wie er es nannte. Winzig war die Kajüte, nur mit einer schmalen Koje ausgestattet, mit einer kleinen Kochecke und, verschämt hatten wir die Köpfe gewendet, mit Zeitungsausschnitten mit nackten Mädchen über der Koje. An der Wand gegenüber aber waren Postkarten aufgeklebt, Karten von den Städten, wo sie mit Line schon überall gewesen waren. Hamburg, das war klar, aber dann die Elbe hinauf, durch den Mittelandkanal und auf den Rhein, bis nach Koblenz, dann wieder zurück, den Main bis Frankfurt, weiter über den Main aufwärts bis zur Donau und ins Ausland, bis Budapest, so zeigten die Karten, war die Line gekommen. Monatelang nach diesem Besuch antwortete ich auf die Frage, was ich werden wolle, „Bootsmann auf der Line.“
Mit sechs Jahren lernten wir Fahrrad fahren und fuhren hinaus aus der Stadt, im Sommer die zur Scharte, bis zu einer Stelle, an der man ungefährdet in den Fluss kommen konnte, um zu baden. Die Scharte war hier vielleicht vierzig Meter breit, tief allerdings, und floss nur träge. Wir drei Freunde konnten anfangs nicht schwimmen und planschten am Ufer im Wasser, bis Dietrich anfing, zu tauchen.
„Wetten, dass ich ohne schwimmen zu können, über die Scharte komme?“ Ein leichter Schauer packte mich, als Dietrich das triumphierend fragte. Ich wusste, wenn Dietrich heil an das andere Ufer kam, was da unerreichbar vierzig Meter weit entfernt lag, dann schwamm auch Malte hinüber und dann musste auch ich, koste es was es wolle, den Versuch wagen. Also tat ich so, als hätte ich die Frage nicht gehört, vergeblich allerdings, denn Malte ging sofort darauf ein.
„Schaffst du nie, du ersäufst, lass es lieber, sonst kriegen wir mit deinen Eltern Ärger.“
Aber Dietrich hatte darauf nur gewartet, er sprang vom Ufer mit dem Kopf zuerst in das Wasser, blieb unter der Oberfläche unsichtbar, weil die Scharte Moorwasser führte, zwar sauber, aber dunkel. Nach bangen Sekunden tauchte er auf, er hatte ein Viertel des Flusses hinter sich, schnaufte, prustete und ging wieder unter Wasser. Wieder vergingen Sekunden und wieder kam er hoch, schnaubend, ächzend und tauchte erneut unter. Dann war er auf der anderen Seite zu sehen, stehend im seichten Wasser und triumphierend wie ein Sieger die Arme hochreißend. „Es ist ganz einfach“, schrie er, „macht das mal nach!“
Wie ich es geahnt hatte, ließ sich Malte das nicht zweimal sagen, sprang ebenfalls in den Fluss, auch er kam nach drei Gängen auf der anderen Seite an, ebenfalls die Arme hochreißend. Was blieb mir zu tun? Ich sprang in den Fluss, tauchte unter und schwamm unter Wasser aus Leibeskräften, immer in die Richtung, in der ich das andere Ufer vermutete. Als mir die Luft ausging, tauchte ich auf, schnappte verzweifelt nach Luft, sah, dass ich in die richtige Richtung geschwommen war und tauchte wieder unter, mit vollen Kräften schwimmend. Nach einem weiteren Auftauchen und erneutem Schwimmen und einem dritten Auftauchen hatte auch ich das Ufer erreicht, wo ich mich erschöpft, aber zufrieden auf dem Gras niederließ, das an diesem Ufer wuchs.
Ich erinnere mich genau an diesen Sommertag, als ich auf dem duftenden Gras lag, auf dem Rücken, in den Himmel blickend, die Sonne strahlte auf meinen Körper, der nach dem kühlen Wasser die warmen Strahlen genoss, hörte mit halbem Ohr die Prahlerei meiner beiden Freunde, an denen ich mich aber nicht beteiligte, wusste ich doch, dass ich allein nie auf den Gedanken gekommen wäre, den Fluss zu durchschwimmen. Statt dessen fühlte ich es unter mir im Grase krabbeln, Ameisen und Käfer trieben da wohl ihr Unwesen, hörte über und neben mir Spatzen tschilpen, die sich um eine Stück Futter zankten, beobachtete eine Lerche, die sich singend in den Himmel schraubte. Von fern hörte ich auf der anderen Seite des Flusses das Badeleben, Frauenstimmen, die ihre Kinder riefen, Männer, die sich unterhielten und Gleichaltrige, die am Ufer spielten. Ich war matt, zufrieden und zum ersten Mal in meinem jungen Leben bewusst glücklich.
„Was habt ihr denn heute gemacht?“ fragte meine Mutter am Abend bei der Mahlzeit und ich erzählte ihr von meiner Heldentat.
„Mein Junge, Rudolf“, die Stimme meines Vaters hatte einen ernsten Unterton, ohne dass sie böse klang, „ich möchte nicht, dass du das noch einmal machst, das ist zu gefährlich. Aber ich merke, dass du schwimmen lernen willst, morgen früh gleich darfst du dich in der Badeanstalt zum Schwimmlehrgang anmelden, da ist Herr Hülsen, der Bademeister, melde dich bei ihm und sag, dass ich dich schicke und er soll dir das Schwimmen beibringen.“
Und tatsächlich ging ich mich, und Dietrich und Malte folgten mir, zum Schwimmunterricht, den wir nach nur drei Tagen mit dem Freischwimmer beendeten. „Die können doch schwimmen, “ erzählte Herr Hülsen meinem Vater, „die brauchten bloß die Finger nicht zu spreizen, sondern zusammen zu legen, und dann schwammen sie los.“
Im Jahr darauf kamen wir drei, Dietrich, Malte und ich, auf das Gymnasium.
3.
Zum ersten Mal sah ich Görgen in der zehnten Klasse des Gymnasiums. Görgen stieß zu uns von einer Realschule, er war von Anfang an Außenseiter. Wir, das war eine Klassengemeinschaft von vielleicht zwanzig Schülern, davon zwölf Jungen und acht Mädchen, halbwüchsig, vierzehn, fünfzehn, einige sechzehn Jahre alt.
Görgen war schön, ich nicht, noch heute bin ich nicht schön, etwas zu schwammig, nicht etwa fett, oh nein, aber eben auch nicht schlank, mit etwas Bauch, mit leicht angedeutetem Doppelkinn, blasser Hautfarbe, blonden Haaren, die unmerklich in grau übergehen und schütter werden. Schwammig war ich schon damals und neidisch auf die durchtrainierten Körper meiner Freunde. Obwohl ich, blass und blond, heimgesucht von einer entsetzlichen Pickelplage bis zum Abitur war, tat das meinem Ansehen unter den Freunden keinen Abbruch, alle hatten Pickel, also konnte der ebenfalls pickelbehaftete Jüngling nicht abseits gedrängt werden.
Heinrich Görgen dagegen, der war Außenseiter, auch vermöge seines Aussehens. Kleiner als wir, und weniger entwickelt, hatte er feine, fast mädchenhafte Züge. Unter einer Stirn, die für sein Alter viel zu hoch war, hatte er weit auseinander stehende langgestreckte braune Augen, die schmal geschnitten waren und einen bestimmten Ausdruck hatten, der noch dadurch verstärkt war, dass er so gut wie keine Lider hatte, Schlupflider, wie wir sie bei asiatischen Menschen kennen, und tatsächlich hatte sein Gesicht etwas asiatisch fremdartiges mit der flachen kleinen Nase, die auf einen vollen roten Mund fiel, der den Eindruck des Mädchenhaften verstärkte, wenn nicht eigentlich hervorbrachte. Deutlicher wurde dieses Empfinden, wenn Görgen zu sprechen anfing, er war der einzige in der Klasse, dessen Stimme noch nicht gebrochen war, noch nicht einmal zu brechen angefangen hatte. Mit einem klaren Knabensopran brachte er seine Antworten vor, wenn er von Lehrern gefragt wurde, Antworten, die in aller Regel richtig waren und ihm das Lob der Lehrer nach kurzer Zeit einbrachten. War er Außenseiter schon aufgrund seines Aussehens, wurde er es noch mehr, weil er die Anerkennung der Lehrer erwarb und bald Primus der Klasse wurde. Der eigentliche und entscheidende Grund für seine Abgesondertheit war aber seine gesellschaftliche Herkunft. Wir alle, die wir in die zehnte Klasse gingen, waren Bürgerkinder, mein Freund Dietrich etwa kam aus einem Arzthaushalt, wir gingen zusammen mit Veronika über den Schulhof, der Tochter eines angesehenen Im- und Exportkaufmanns. Kinder von Rechtsanwälten, Apothekern, Ärzten und Handelsleuten waren wir, alle erzogen in dem Bewusstsein einer behäbigen Wohlhabenheit. Unsere Stadt war in den Jahren nach dem Krieg zunehmend verfallen, mit einer Altstadt, in denen Fachwerk der vorherrschende Baustil war. Fachwerk, das verfiel und demnächst hätte abgerissen werden müssen, hätten es nicht vorausplanende Stadtväter verstanden, einiges an Industrie in die Randbezirke der Stadt zu ziehen, in die umliegenden Dörfer, diese dann einzugemeinden und mit der von den Industriefirmen eingezogenen Gewerbesteuer eine Sanierung der Altstadt zu beginnen. Wir als Bürgerkinder hatten sogar die Freiheit, uns den Versammlungen von jungen Menschen anzuschließen, die sich gegen die Industrieansiedlungen am Rande der Stadt, besonders gegen ein Atomkraftwerk, das gebaut wurde, zu wehren.
Ganz anders das Leben unseres Schulkameraden Heinrich Görgen, der in einem der umliegenden kleinen Bauerndörfer auf einem Hofe wohnte, den Hof zu nennen wegen der Kleinheit, der Vater hatte einige dreißig Morgen Land, fast schon vermessen war. Der nächst größere Hof hatte etwa achtzig Morgen. Görgen hatte nach ungefähr einem Jahr, kurz vor Ende des Schuljahres, etwas Vertrauen zu mir gefasst, warum er mich auserwählt hatte, war mir nicht erklärlich. Anfangs wehrte ich mich gegen seine Nähe, brachte sie mir doch den Spott meiner anderen Mitschüler ein, andererseits rührte mich seine schüchterne Anhänglichkeit und so folgte ich eines Tages seiner mehrfach vorgebrachten Einladung und fuhr an einem Sommertag mit dem Fahrrad hinaus auf das Land und in das Dorf, an dessen Rand Görgen wohnte. Ein winziges Bauernhaus erwartete mich da, umgeben von einer Wiese, auf der einige Schweine und Kühe ihr Wesen trieben, zwischen ihnen suchte ein kleines Hühnervolk sein Futter. Über dem Hof und dem Dorf war ein leichter Geruch nach Land, nach den Schweinen und den Hühnern, den ich aus der Stadt nicht gewohnt war. Görgen erwartete mich schon am Hoftor, begrüßte mich mit einem erfreuten Lächeln und führte mich in das Haus. Über eine Diele, an die die Ställe für die Kühe anschlossen waren, ging es in die Wohnräume, winzig, allerdings mit einer riesigen Küche, in der mich Görgens Mutter begrüßte. Sie war eine dralle, große Frau mit riesigen Brüsten, einem rotem Gesicht, in dessen derben Zügen ich die eleganten Züge meines Kameraden wiederzuerkennen suchte, vergebens. Auch der Vater, der den Hof zusammen mit zwei anderen Söhnen bewirtschaftete, hatte keinerlei Ähnlichkeit mit meinem Schulkameraden, vierschrötig, kantig, stapfte er mit schweren Schritten in die Küche, begrüßte mit einer lauten Stimme zuerst seine Frau, die er hungrig nach dem Mahl fragte, dann seinen Sohn Heinrich und schließlich mich. Auch dieser mächtige Bauer hatte mit seinem Sohn keine Gemeinsamkeit, ebenso wenig wie die beiden Brüder, die weder die Feinheit ihres Bruders hatten noch Anzeichen der Intelligenz zeigten, die ich bei Heinrich mit der Zeit zu schätzen gelernt hatte. Später vertraute er mir einmal an, in seinem Dorf und in der Familie sei sein Aussehen häufig besprochen worden. Er komme wohl, so sagte seine Mutter, nach einer Tante von ihr, die ihr Onkel aus der Stadt geheiratet hatte und die ähnlich fein gebaut gewesen sein sollte.
Im Kreise seiner Familie nahm ich den Kaffee ein, bekam von dem Kuchen zu schmecken, den die Bauersfrau selbst gebacken hatte und versuchte, dem Gespräch der Familie zu folgen, was mir Schwierigkeiten bereitete, sprachen doch der Bauer und seine Söhne plattdeutsch, das ich nur mäßig beherrschte und über Gegenstände der Landwirtschaft, von denen ich nichts wusste. Sie begegneten ihrem Sohn und Bruder mit einer achtungsvollen Höflichkeit, die seine Ausnahmestellung in der Familie noch betonte.
Heinrich beobachtete mich aufmerksam, bemerkte wohl auch mein Unbehagen, jedenfalls lud er mich nicht noch einmal ein. Öfter aber folgte er mir nach der Schule in mein elterliches Haus, um an unserem Mittagessen teilzunehmen und besonders meinen Vater, je älter wir wurden, mit der Klugheit seiner Bemerkungen zu verwundern. Ich gebe zu, in den Stolz auf meinen Freund mischte sich dann und wann mit Neid. Gerne hätte ich von meinem Vater annähernd wohlwollende Worte gehört wie die, die er an Heinrich richtete.
Es blieb eine schüchterne und scheue Freundschaft, die uns beide Jungen verband, die aber immerhin dazu führte, dass er als mein Freund an Zirkeln der Achtzehnjährigen teilnahm, denen ich angehörte und in denen wir anfingen, uns mit politischen Themen zu beschäftigen, mit Lyrik der anderen Art, die wir in der Schule nicht zu lesen bekamen. Francois Villon lasen und kommentierten wir, Baudelaire und Charles Bukowski, deren Gedichtbände jedenfalls meine Eltern lieber nicht in meinem Zimmer finden sollten. Auch nahmen wir an Versammlungen teil, die über das eben erbaute Atomkraftwerk handelten und die Technik der Herstellung von Strom durch Atomspaltung heftig kritisierten. Auch die Entscheidung der Stadtväter beanstandeten wir, chemische Industrie an den Rand der Stadt zu lassen, nur um Geldströme in die Stadt zu leiten, um die heimische Bauindustrie zu fördern, indem sie die alten Fachwerkhäuser wieder herstellen ließen. Vor allem in den Versammlungen fiel Heinrich zunehmend auf, wenn er schüchterne Redebeiträge von erstaunlicher Klugheit von sich gab. Heinrichs Stimme quietschte in der Übergangszeit vom Knabensopran zum sanften Bariton etwas, er gewann aber danach trotz seiner Schüchternheit eine Autorität unter uns, weil uns der tiefe Ernst, mit dem er sprach imponierte.
4.
Wir küssten in dieser Zeit das erste Mal ein Mädchen. Dietrich, Malte und ich hatten uns am Fluss verabredet und dort drei Mädchen aus unserer Klasse getroffen. Nebeneinander lagen wir auf unseren Handtüchern auf dem Gras, als Dietrich die Sprache auf Mädchen und Jungen brachte und Veronicas Freundin, Hanna, am Arm streichelte. Hanna reagierte hierauf, indem sie näher an Dietrich heranrückte und ihm ihrerseits über den Rücken fuhr. Wir anderen beobachteten die beiden, ich merkte, wie mir ein seltsames Gefühl durch den Körper ging, ein Gefühl, das ich häufig hatte, wenn ich allein war und an Mädchen dachte. Ich sah Veronica an und merkte, dass sie mir ebenfalls näher gerückt war. Wir waren allein am Ufer des Flusses, drei Jungen und drei Mädchen, alle anderen waren gegangen. Veronica beugte sich zu mir hinüber und küsste mich ohne weitere Worte auf den Mund, ein Kuss, den ich erwiderte, wobei ich meine Hände über ihren Rücken gleiten ließ, hinauf bis zu den Schultern und hinunter bis zu ihrem Po. Ich geriet in große Aufregung, hörte, wie auch die anderen sich küssten, als sich Veronica, ich hatte meine Hände langsam auf ihre Brüste gleiten lassen, plötzlich von mir löste und sagte: „Mehr geht jetzt nicht.“ Auch die anderen trennten sich, wir Jungen verbargen unsere erregten Geschlechter, indem wir uns mit unschuldigen Mienen auf den Bauch legten. Veronica hat mich danach nicht wieder geküsst, nichts folgte darauf, ebenso wenig wie bei Dietrich und Malte.
Diese Geschehnisse beschäftigten unsere jungen Gemüter. Nichts wussten wir wirklich von der Welt, wohl sahen wir die Bilder der Not in Afrika, in Asien in unseren Fernsehgeräten, dieses Unglück war von unserer Wirklichkeit aber zu weit entfernt, als dass es uns ernsthaft betroffen hätte. Vater erzählte von seinen Fällen, die von Bedrängnis und Armut handelten, wir Kinder nahmen diese Erzählungen als Ereignisse in einer fremden Welt an, die mit der unseren nichts zu tun hatte.
Heinrich Görgen, der wusste von dieser anderen Welt, lebte er doch darin, aber er ließ uns andere nicht teilhaben an seiner Armut, an seinem Neid auf die Unbeschwertheit der anderen. Allein kam er in die Schule, mit dem Fahrrad, ob Sommer oder Winter, in der Hitze und in klirrender Kälte, mit einem dünnen Mantel bekleidet, ohne Taschengeld, über das wir anderen in ausreichender Menge verfügten. Jeden Morgen fuhr er hin, 14 Kilometer, und jeden Mittag zurück, wieder 14 Kilometer, ohne auch nur ein einziges Mal zu klagen. Ja, Heinrich Görgen erfuhr früh den Unterschied zwischen arm und reich, und wie es ist, zu den Armen zu gehören.
5.
Nach dem Abitur zögerte Heinrich keinen Moment, er schrieb sich an der Universität in Göttingen für das Fach Jura ein.
„Warum Jura“, fragte ich ihn erstaunt, als er mir seinen Entschluss mitteilte. Bei mir wäre der Wunsch verständlich, war doch mein Vater schon Jurist gewesen und vor ihm mein Großvater.
„Das müsstest du doch inzwischen gemerkt haben“, gab Heinrich zurück, „ich kann Ungerechtigkeit nicht aushalten, ich möchte Jura studieren, Rechtsanwalt werden und dann dazu beitragen, dass mehr Gerechtigkeit in der Welt herrscht, und zwar für alle.“
Richtig, ich erinnerte mich, er hatte mir eine Geschichte von zu Hause erzählt.
„Ich habe Vaters Fahrrad ausgeliehen, um damit fahren zu lernen, ein großes schweres Fahrrad mit einer Herrenstange. Damit bin ich auf den Weg gegangen und habe versucht, zu fahren. Natürlich bin ich hingefallen, nicht einmal, viele Male, dabei ist der Lenker und der Gepäckträger verbogen worden.“
Der Vater, nach Hause gekommen, habe seinen älteren Bruder Karl - Heinz verdächtigt, ihn kurzerhand aus der Küche in die Diele gezogen, ihm den Hintern stramm gezogen, übers Knie gelegt und verhauen. Heinrich sei hinterher gelaufen, habe heulend an der Jacke des Vaters gehangen und immer wieder gerufen, er sei es gewesen, er, Heinrich, der Vater möge doch ihn bestrafen. Aber sei es, weil der Vater ihn nicht gehört habe, sei es, weil er den schwachen und empfindlichen Heinrich nicht habe schlagen wollen, der Bruder habe die ganze Wut abbekommen. Noch tagelang habe Heinrich sich nicht beruhigen können über diese Ungerechtigkeit
Und noch etwas fiel mir ein. Heinrich Görgen war in der Klasse unbeliebt, weil er als Petzer galt. Diesen Ruf hatte er, weil er zwei Mal Lehrern, die einen falschen Delinquenten bestrafen wollten, den richtigen Täter benannt hatte. Einmal, wir waren in der zwölften Klasse, hatte ein Mitschüler namens Jan in dem Klassenraum geraucht und den Aschenbecher meinem Freund Dietrich unter den Tisch geschoben, wo der Lehrer, den Rauch riechend, ihn fand und Dietrich bestrafen wollte. „Dietrich war es nicht, er hat nicht geraucht, Jan hat ihm den Aschenbecher untergeschoben“, hatte Heinrich dem Lehrer gepetzt, nachdem er gewartet hatte, ob Jan sich melden würde.
„Ich finde, Jan hätte sich melden müssen, als Dietrich erwischt worden ist,“ hatte er sich gegen Angriffe, er sei ein Petzer, verteidigt, und tatsächlich, Dietrich und ich waren der gleichen Meinung, aber der Rest der Klasse fand, das hätten dann Dietrich und Jan miteinander ausmachen müssen, dem Lehrer dürfe man nichts sagen.
Ich verstand, warum Heinrich Görgen sich für Jura entschied, obwohl ich nach den Erzählungen meines Vaters von der Justiz Zweifel hatte, wie viel Jura und Gerechtigkeit miteinander zu tun haben mochten.
Mein Berufswunsch dagegen war immer noch unklar, ich würde wohl, das war mir von väterlicher Seite gewissermaßen in die Wiege gelegt worden, auch Jura studieren, an welcher Universität, das überließen meine Eltern mir.
Heinrich war anhänglich geblieben, bis zum Abitur und darüber hinaus, während des Studiums, was umso erstaunlicher war, als er mir an Intelligenz weit überlegen war. Ich bekenne, ich bin von eher durchschnittlichem Verstand, natürlich, ich habe meine Aufgaben in Deutsch und Mathematik, Latein und Englisch, immer erledigen können, mit mittelmäßigem Erfolg, wie meine Lehrer mir bescheinigten, es reichte auch später, um die Anforderungen des Studiums der Rechte und des Refendariats zu erfüllen, ja, ich habe sogar Köpfe von weitaus geringerer Begabung die beiden juristischen Examen ablegen sehen. Nur eben gegen Heinrich Görgen kam ich mir immer simpel vor, von beschränkter Auffassung, die darüber hinaus auch langsam war gegen seine blitzschnellen Schlüsse, gegen seine brillanten Arbeiten.
Dennoch, er blieb anhänglich und bekundete lebhaftes Bedauern, als ich ihm eröffnete, ich könne jetzt noch nicht mit dem Studium beginnen, müsse vielmehr erst meine Pflicht gegen das Land erfüllen und den Dienst an der Waffe ableisten, von dem er aus mir nicht bekannten Gründen befreit war. Den Waffendienst leistete ich ohne Begeisterung ab und schloss mich nach seiner Beendigung Heinrich an, der in Göttingen schon heimisch geworden war. Vier Jahre verbrachten wir gemeinsam in der Universitätsstadt, hier lernte ich meine erste Freundin Mathilde kennen, die Deutsch und Geschichte studierte und Lehrerin werden wollte. Mathilde war eine gutmütige junge Frau, mir gleichaltrig, aber in der Liebe schon viel erfahrener als ich, mit ihr hatte ich meine ersten Liebeserlebnisse, wobei sie mich eher unterwies als dass ich sie verführte.
Wir saßen in dem Seminargebäude für Juristen, einem schmucklosen Bau, der in den sechziger Jahren hochgezogen worden war, als der Platzbedarf wegen der rapide steigenden Zahl der Studenten plötzlich groß wurde. Heinrich hatte mich überredet, mit ihm an einem Seminar zur Rechtsphilosophie teilzunehmen, das weder examensrelevant, wie er zugab, noch meinem Semester angemessen war. Dennoch, auch mich zog das Thema an, und der Assistent, der das Seminar leitete, Dr. Assmeier, war mir aus einer Vorlesung über bürgerliches Recht bekannt und sympathisch. Hufeisenförmig waren die Tische gestellt, am inneren Ende des Hufeisens der Assistent, ich ihm zu Rechten, Heinrich neben mir und neben ihm Charlotte Hausmann, eine Studentin in Heinrichs Semester, die heute das erste Mal dieses Seminar besuchte. Ich merkte, wie Heinrichs Interesse an dem Stoff immer weiter nachließ, und verstand ihm, hatte er mich doch schon mehrfach auf die Kommilitonin aufmerksam gemacht. Nach seiner Meinung war sie die schönste Frau, die er je gesehen hatte. Schlank, schwarzhaarig, mit dunkelbraunen, schrägstehenden, lachenden Augen, runden gleichmäßigen Augenbrauen darüber und einer breiten hohen Stirn, fast zu breit war die Stirn für das Gesicht, das im Übrigen, ebenso wie der ganze Kopf, vollendet geformt war, noch betont durch das gegen alle Mode sehr kurzgeschorene Haar. Charlotte war nicht sehr groß, mit langen Beinen und schlank, einer guten Figur, die sie allerdings mehr ahnen ließ als zeigte, trug sie doch fast immer sehr weite lange Kleider.
Heinrich Görgen richtete seine Aufmerksamkeit in dieser Stunde mehr auf seine Nachbarin als auf den Stoff des Seminars und fragte sie am Ende, fast stotternd, ob er sie zu einer Tasse Tee einladen dürfe. Es gab eine Kneipe in dieser Zeit in der Nähe des Seminars, in der ausschließlich Tee serviert und klassische Musik gespielt wurde. Gegen alle Erwartungen sagte Charlotte mit einem freundlichen Lächeln zu und Heinrich verschwand mit ihr, ohne mir auch nur noch einen Blick zu gönnen. Ich sah ihn drei Tage nicht, nach drei Tagen kam er mich in meinem Studentenzimmer besuchen.
„Rudolf, ich bin verliebt“, trällerte er fast, mit seiner weichen Stimme, „ich habe jetzt drei Tage mit Charlotte zugebracht, ich bin sehr in sie verliebt, und sie sagt, sie liebt mich auch. Ich habe ihr von dir erzählt, sie will mit uns und Mathilde essen gehen, was hältst du davon?“
Ich freute mich ehrlich für ihn, Heinrich Görgen war ein eher ernster und verschlossener Mensch, es tat mir gut, ihn glücklich und vor allem so fröhlich zu sehen. Wir gingen daher am Abend zu viert essen und danach immer wieder, ich sah ihn allerdings während der Seminare und Vorlesungen kaum noch, so sehr war er entweder mit Lernen, mit Charlotte oder mit beidem beschäftigt. Ich bekam allerdings mit, dass er immer öfter von politischen Versammlungen erzählte, die er besuchte, Versammlungen, die sich mit der Wirtschaftspolitik im Allgemeinen beschäftigten, mit der zunehmenden Konzentration in der Wirtschaft und der Globalisierung. Ich selbst habe ihn dahin nie begleitet, hielt ich doch mich selbst und die Jura für völlig unpolitisch und meinte, das müssten wir auch sein, über den Parteien stehend. So lehrten es uns unsere Professoren und so glaubte ich es, kam doch diese Meinung meiner Bequemlichkeit im Denken sehr entgegen. Häufiger sahen wir uns ab jetzt zu viert, Mathilde und Charlotte, Heinrich und ich.
6.
„Störe ich?“, schüchtern stand Charlotte Hausmann in der Eingangstür. Es hatte geklingelt und halb erleichtert, halb ärgerlich stand ich von meiner Arbeit auf. Natürlich hatte der Professor im bürgerlichen Recht eine Hausarbeit erfunden, die sich mit dem Eigentümer-Besitzer-Verhältnis der §§ 987 folgende BGB beschäftigte, einer Vorschriftenreihe, mit der schon ganze Studentengenerationen in die Verzweiflung getrieben worden waren und nun war ich ausersehen, mich in diese Reihe einzugliedern. Nur Heinrich Görgen, der hatte mit seinem blitzschnellen und ausgeprägten Verstand das System durchschaut und beantwortete aus dem Stegreif jede Frage, die dem Professor zu stellen einfiel. Nur kranke Juristengehirne konnten ein solches Denkungetüm erfinden und damit Studenten quälen.
„Nein, du störst kein bisschen, komm rein, ich mache uns einen Tee“, antwortete ich deshalb wahrheitsgemäß und zog Charlotte in meine Wohnung. Die bestand zu der Zeit aus zwei kleinen Zimmern in einer ruhigen Nebenstraße, sie lag in einem Häuschen mit Flachdach, das offensichtlich einmal den reichen Eigentümern des Haupthauses als Gartenhaus gedient hatte, jetzt aber zwei Studentenwohnungen enthielt.
„Ich weiß, das ist ungewöhnlich, dass ich dich besuche, unangemeldet und dann auch noch allein, aber ich möchte gerne mit dir reden.“ Charlottes Stimme klang unsicher, als sie mir in die Kochecke des ersten Zimmers, das ich als Wohn- und Arbeitszimmer benutzte, folgte.
„Ich koche uns erst einmal einen Tee, dann erzählst du mir in aller Ruhe, was du auf dem Herzen hast.“ Ich versuchte, möglichst ruhig, beruhigend und vertrauenerweckend zu sprechen, gespannt, was sie wohl bewogen haben könnte, mich zu besuchen.
„Rudolf“, begann sie, als wir es uns bequem gemacht hatten, „ich mache mir Sorgen um Heinrich, und du bist, soweit ich das sehe, sein bester Freund, deshalb komme ich zu dir.“
„Wieso“, fragte ich erschrocken, „ist mit Heinrich etwas nicht in Ordnung?“
„Doch, alles ist in Ordnung, und dann auch wieder nichts. Du weißt, dass er sich zum Examen gemeldet hat, gleichzeitig mit mir. Aber schon vor der Meldung hatte ich Sorgen. Heinrich wird immer politischer, das ist eigentlich ganz in Ordnung, aber was mich beunruhigt, ist die Radikalität, mit der er Politik angeht, Jura, sein Examen und überhaupt alles, was er beginnt. Nichts nimmt er gelassen hin, alles, was nicht in sein Konzept passt, interessiert ihn nicht, kümmert ihn nicht.“ Traurig sah sie vor sich hin.
„Aber was meinst du? Wir sind gemeinsam auf der Demonstration gegen die Studienbedingungen gewesen, das war doch nicht weiter schlimm? Und was meinst du mit ihn kümmert nichts, was nicht in sein Konzept passt?“
„Neulich waren meine Eltern in Göttingen, um uns zu besuchen. Du weißt ja, wie er über meine Eltern redet, Bankiers, sagt er spöttisch, wenn er gut gelaunt ist, Bankiers sind der Abschaum der Gesellschaft, Kapitalisten pur, sie gehören abgeschafft. Und du weißt ja, ich habe wirklich ein nicht sonderlich gutes Verhältnis zu meinem Vater, aber höflich kann er doch mindestens bleiben.“
„Und, was hat er gemacht?“
„Das ist es ja, er ist für zwei Tage weggewesen, so lange, bis meine Eltern abgereist sind. Nicht einmal begrüßt hat er sie.“
„Aber Charlotte, du bist doch nicht gekommen, weil Heinrich sich schlecht benimmt, das ist doch schon öfter geschehen.“
„Nein, das eigentliche Problem sind seine Freunde. Neuerdings besuchen uns Studenten, die mir nicht recht gefallen wollen. Sie nennen sich „Gruppe zur Wiederbelebung des bewaffneten Kampfes“ und führen extrem radikale Reden über die Möglichkeiten, sich zu bewaffnen und das System nach Art der Rote Armee Fraktion zu bekämpfen.“
Alarmiert sah ich sie an. „Bist du sicher? Heinrich will sich ihnen anschließen? Ich glaube, ich rede tatsächlich mal mit ihm.“
„Würdest du das tun?“, Charlotte strahlte mich an, sie war atemberaubend schön, wie sie da saß und mich mit erst traurigen, jetzt strahlenden Augen ansah.
„Natürlich, ich treffe ihn morgen im Seminar, da verabrede ich mich mit ihm, wir haben uns sowieso lange nicht gesehen, ich schlage mich ziemlich mit meiner Hausarbeit herum, vielleicht kann ich ihn dabei einige Dinge fragen.“
„Deine Hausarbeit? Kann ich dir nicht auch etwas helfen?“
Charlotte galt wie Heinrich als überdurchschnittliche Studentin, die einen guten juristischen Verstand hatte und innerhalb des Systems denken konnte. Erleichtert schilderte ich ihr das Problem, mit dem ich mich herumschlug und tatsächlich öffnete sie mir den Blick für die Lösung des Falles.
7.
„Charlotte hat was?“, entgeistert sah Heinrich Görgen mich an. Auch als erwachsener Student war er ein schöner Mann, der Eindruck des Asiatischen in seinem Gesicht hatte sich eher verstärkt, hohe Wangenknochen, weit auseinanderstehende Augen, die mich jetzt ansahen, unter der hohen Stirn, die die ersten tiefen Falten aufwies.
„Charlotte hat mir von deinen Freunden erzählt, die den bewaffneten Kampf wieder aufnehmen wollen“, antwortete ich so harmlos wie möglich und beobachtete, wie in seinem Gesicht der Ärger mit einer ungeheuren Belustigung kämpfte, die aber schließlich die Oberhand gewann. Görgen brach in sein schallendes Gelächter aus.
„Ja, Rudolf“, noch immer kicherte er und fing zwischendurch immer wieder zu lachen an, „da seid ihr beide aber ganz schön auf dem Holzweg. Die waren tatsächlich mal bei mir zu Besuch, sie hatten mich gefragt, ob wir sprechen könnten, da habe ich sie eingeladen. Aber nein, das sind vollkommene Spinner, die wollen die Welt mit Kampf verändern, das geht doch nie. Ich habe sie nach Hause geschickt.“ Heinrich wurde nun ernst und sah mich finster an:
„Und meine Verbissenheit beim Studium, wie ihr das nennt, gut, da muss ich euch ein paar Sachen sagen. Ihr mit euren reichen Eltern, ihr könnt euch das leisten, mal hier ein Semester in Lausanne, mal da ein bisschen bummeln, ich kann das nicht, ich bekomme Ausbildungsförderung, da sieht man darauf, dass man mir nicht ein Semester zu viel finanziert. Ich muss wohl etwas energischer studieren als ihr.“
Heinrich sprach auf ein halbes Jahr an, das ich in Lausanne verbracht hatte, im dritten Semester, ich hatte mich dort an der juristischen Fakultät eingeschrieben. Mein Vater hatte mich etwas kritisch angesehen, als ich ihm diesen Plan eröffnete, letztlich aber eingewilligt. Klar, das war ein Luxussemester gewesen und klar, Heinrich Görgen hätte das nicht gekonnt. Etwas betreten schwieg ich.
„Und dann, Rudolf, in einem hat Charlotte natürlich recht. Ich interessiere mich schon für die Unterschiede von Gut und Böse, Arm und Reich, Recht und Unrecht. Wie oft haben wir darüber diskutiert, was die Achtundsechziger uns angetan haben. Alles haben sie vorweggenommen, die Moral haben sie abgeschafft und jetzt sitzen wir hier und müssen uns unser eigenes System zurechtzimmern, nach dem wir zwischen richtig und falsch unterscheiden, zwischen Gut und Böse und zwischen das macht man nicht und das ist in Ordnung. Du selbst hast mich angesprochen auf die zweifelhaften Besuche der neuen Terroristen. Mit denen will ich, ich habe dir das gesagt, nichts zu tun haben. Das ändert aber nichts daran, dass wir uns mit Politik beschäftigen müssen, damit, wie wir in unserer Gesellschaft miteinander leben können. Eines ist sicher: Es kann nicht sein, dass Menschen wie Charlottes Eltern oder auch dein Vater die Spielregeln allein bestimmen und wir nur noch ausführen, was sie sagen. Diese Fragen kosten mich sehr viel Energie, da kann ich mich nicht noch mit den Empfindlichkeiten ausgerechnet von Charlottes Eltern abgeben. Denn dass die zu der Frage, wie ich leben will, nicht viel beitragen können, darin bin ich mir mit Charlotte einig.“
„Heinrich, ich habe keinerlei Widerspruch zu dem, was du sagst, aber wir müssen die Welt ja nicht gleich heute und alleine ändern.“
„Das verstehst du genauso wenig wie Charlotte. Ich kann diesen Fragen nie so ruhig und gelassen gegenüberstehen wie ihr, andererseits wirst du auch nie verstehen, warum ich so kämpfe. Du hast ja auch mehr zu verlieren als ich und bist wohl auch von Natur vorsichtiger.“
Er sagte vorsichtiger, aber ich hatte ihn im Stillen in Verdacht, dass er mich feige und faul fand.
8.
Heinrich Görgen sagte es nie, aber die Tatsache, dass Charlotte zu mir gekommen und mir ihre Sorgen über ihn erzählt hatte, kränkte ihn mehr als er zugab. Er hatte mir nicht wörtlich, aber dafür deutlich zu verstehen gegeben, dass sich hier Klassengegensätze trafen und dass letztlich Charlotte und ich einer Klasse angehörten, er einer anderen. Wenn wir uns trafen, gingen wir freundlich miteinander um, die Treffen waren harmonisch, dennoch fragte mich Mathilde eines Tages, nachdem wir am Abend vorher erst ins Kino und dann essen gegangen waren, was denn mit Heinrich sei. Ich konnte es ihr nicht sagen, wusste ich doch selbst nicht genau, wie er dachte. Zunehmend wurde er zu einem Rätsel, auf alle meine Fragen antwortete er nur kurz, er konzentriere sich mit aller Kraft auf sein Examen, andere Dinge müssten warten, bis diese Hürde genommen sei. Immer öfter kam nun Charlotte zu mir, manchmal wurde sie von Mathilde und mir getröstet, manchmal kam sie, wenn ich allein war, obwohl auch sie mitten in ihren Examensvorbereitungen steckte, aber das, so sagte sie, könne warten.
„Er redet nicht einmal mit mir“, klagte sie, sie saß auf meinem Sessel mir gegenüber, „er berührt mich nicht, er nimmt nicht meine Hand, wenn wir spazieren gehen, er küsst mich nicht, er hat auf alles nur immer die eine Antwort, lass mich erst mein Examen machen, dann wird alles besser.“
Ein sehr heißer Sommer war es geworden, jetzt, im August, waren es gegen Abend immer noch mehr als dreißig Grad, nur erträglich, weil ich alle Fenster weit geöffnet hatte und ein leichter Zug durch den Raum strich, die trockene Luft leicht kühlend.
Ich betrachtete Charlotte, sie war immer noch eine Schönheit, wenn sie auch in letzter Zeit zunehmend weniger lachte und ihr Gesicht melancholischer wurde. Aufmerksam betrachtete ich die halbmondförmigen Augenbrauen unter der hohen breiten Stirn, die weit auseinander stehenden braunen Augen, die mich traurig ansahen und den Mund, rot, mit vollen Lippen, die jetzt dem Weinen nahe waren. Ich sah auch die langen schlanken Beine, die sie untergeschlagen hatte, wie sie auf dem Sessel saß. Ich sah die leichte Bluse im Wind sich bewegen und gestand mir mit Schrecken ein, dass ich gerade dabei war, mich in sie zu verlieben. Ich verbot mir, weiter zu denken, ich konnte die Situation nicht so ausnutzen, da stand sie auf und kam zu dem Sofa, auf dem ich saß und setzte sich neben mich: „Kannst du mich nicht wenigstens einen Augenblick in den Arm nehmen, damit ich wieder weiß, wie sich das anfühlt?“, flüsterte sie und ehe ich antworten konnte, war sie mir näher gerückt und hatte meinen Arm um sich gelegt. Ich schlang auch den anderen Arm um sie und so saßen wir, in der leichten Sommerbrise, schwiegen und spürten einer den anderen. Nach einiger Zeit regte sie sich, seufzte und sah mich an. Ich beugte meinen Kopf zu ihr und küsste sie leicht auf die Wange, noch einmal und noch einmal, bis sie den Kopf zu mir drehte und mich auf den Mund küsste, erst leicht und spielerisch, dann heftig und fordernd, um sich gleich darauf abzuwenden und zu seufzen. „Wie gut das tut“, sagte sie leise und lag wieder ruhig in meinem Arm, während ein Sturm durch mein Herz tobte. Ich war verliebt in Charlotte, die Freundin meines besten Freundes, und meine Freundin Mathilde wartete heute Abend auf mich, wir waren verabredet. Durfte ich das tun, was ich tat? Aber ich war so verliebt, und was fragt ein Verliebter danach, was er tun darf. Erneut drückte ich Charlotte an mich, wieder wandte sie mir den Mund zu und wieder ertranken wir in einem heftigen Kuss, die Körper drückten sich aneinander, die Lippen lagen aufeinander, die Zungen trafen sich, ich fühlte ihre Hände auf meinem Rücken, an meinen Wangen, ich fühlte ihren Körper unter der hauchdünnen Sommerbluse, ich fühlte ihr Gesicht unter meinen Händen, langsam fingen wir an, einer den anderen zu entkleiden und dann waren wir nackt auf dem Sofa und liebten uns in einem ersten, heftigen und leidenschaftlichen Liebesspiel.
Langsam lösten sich unsere verschwitzten Körper voneinander. Wir sahen uns an, ohne Worte, lange studierte sie aus ihren braunen Augen mein Gesicht, Stirn, Augen, Nase Mund und Kinn, langsam, Millimeter für Millimeter, sorgfältig, als wollte sie sich das alles für ihr Leben einprägen. Ich beobachtete sie, sah nur ihre Augen, immer wieder diese Augen, bis sie mich schließlich an der Hand nahm.
„Und was soll nun werden?“, fragte sie tonlos.
„Ich weiß nicht“, flüsterte ich zurück, „nichts ist so wie es war, ich kann nicht mehr zurück zu dem alten Leben. Ich weiß jetzt, dass ich dich schon seit langem liebe, ich wusste es nur bis heute nicht.“
„Rudolf, ich werde Heinrich verlassen, so oder so, ich kann das nicht aushalten, einem Mann dabei zuzusehen, wie er sich immer mehr von allem entfernt, von mir, von dir, von dem Leben, das ich führen will.“
„Ich werde heute Abend Mathilde treffen und ihr sagen, dass ich dich liebe, gleich, wie du dich entscheidest, ich will mit dir leben oder allein.“