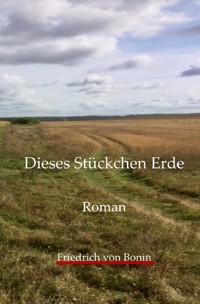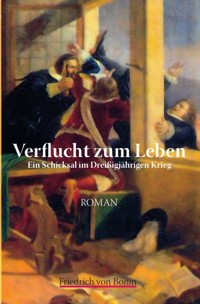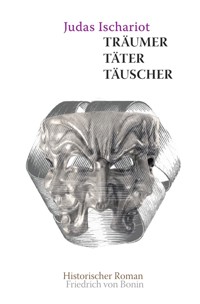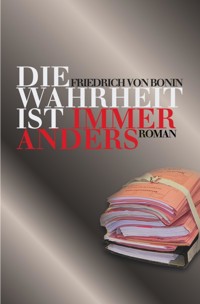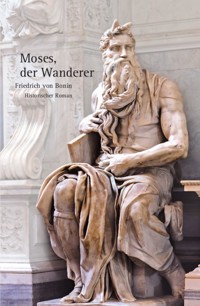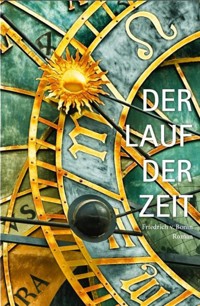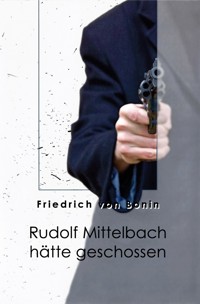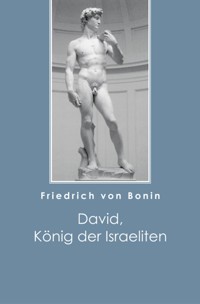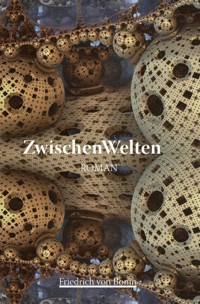
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
ZwischenWelten, der Roman, in dem Jakob Rheidt seine Erlebnisse erzählt. Aber wer ist dieser Jakob Rheidt, diese geheimnisumwitterte Gestalt? Unnahbar und vereinzelt geht er durch die Jahrhunderte, zuerst als Schreiber Wallensteins im 30-jährigen Krieg, danach als Ratgeber Friedrichs des Großen in den Kriegen gegen die Österreicher. Und schließlich wirkt er in unserer Zeit als Manager in der Pharmaindustrie. Sein Auftrag: Fördere den Hang der Menschen zur Selbstzerstörung. Doch dann verliebt er sich in eine Menschenfrau… Der neue Roman von Friedrich von Bonin ist eine faszinierende Reise durch die Neuzeit bis in unsere Gegenwart und ein Appell an menschliche Ethik und Verantwortung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 500
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Friedrich von Bonin
ZwischenWelten
Roman
©Friedrich von Bonin 2013
Epubli Verlag GmbH, Berlin
Das Buch
Ein Roman über menschliche Geld- und Ruhmsucht, gezeigt an drei Episoden aus der deutschen Geschichte der Neuzeit und an drei Gestalten mit gleichem Namen, Jakob Rheidt.
Im ersten Teil begegnet er uns als Vertrauter Wallensteins, mit dem zusammen er die Finanzierung des 30-jährigen Krieges perfektioniert, indem er die eroberten Länder systematisch zugunsten seiner Kriegskasse ausplündert.
Als Graf von Rheidt und Wellhausen berät er den Preußenkönig Friedrich den Großen, der ohne Anlass das österreichische Schlesien erobert und seinem Preußen einverleibt. Der siebenjährige Krieg zwischen Österreich und Preußen mit vielen Toten ist die Folge und danach eine europäische Wirtschaftskrise.
Der dritte Teil des Romanes schildert die verbotene Liebe Jakob Rheidts zur Journalistin Johanna Brückner. Sie verfasst für ihre Zeitung eine Artikelserie zu einer modernen Finanzkrise und begegnet Rheidt als Vorstandsmitglied einer großen Gesellschaft der Pharmaindustrie, die sich illegal mit der Entwicklung der Nanotechnik befasst. Als diese Versuche der Kontrolle entgleiten und die ersten Todesopfer fordern, wird Johanna der wahre Charakter des Jakob Rheidt offenbar.
Der Autor
Geboren 1946, aufgewachsen in Emlichheim, Grafschaft Bentheim, Niedersachsen. Gymnasium in Nordhorn, 1966 Abitur. Studium der Rechtswissenschaft in Göttingen, 2. Juristische Staatsprüfung in Hamburg 1976. Von 1976 bis 2017 Rechtsanwalt, selbständig in Bremerhaven, wo er auch lebt. Seit 2017 freier Schriftsteller. Er ist verheiratet und hat keine Kinder.
Bisher sind folgende Romane erschienen:
„Rudolf Mittelbach hätte geschossen“ (2012)
„David, König der Israeliten“ (2012)
„Der Lauf der Zeit“ (2014)
„Moses, der Wanderer“ (2016)
„Die Wahrheit ist immer anders“ (2018)
„Judas Ischariot, Träumer, Täter, Täuscher“ (2019)
Foto: Harry Zier | www.HarryFotografie.de
Inhalt
Vorspiel…………………………………… 7
1.Buch: Rat der Sieben………….……… 18
2. Buch: Wallenstein……….…………... 29
Zwischenbericht………………………… 110
3. Buch: Friedrich von Preußen…….. 116
Zweiter Zwischenbericht…...………… 221
4. Buch: Johanna Brückner…………… 226
Dritter Zwischenbericht………….……. 275
5. Buch: Zorn…………………………….. 446
Vorspiel
1.
Einmal während dieses Auftrags wollte ich teilnehmen, an ihrem Leben, an ihren Freuden, an ihren Qualen und Ängsten. Sein wie sie, obwohl das verboten war.
2.
Als Jakob Rheidt war ich zu ihnen geschickt worden. Nachdem ich mich eine Zeit als Kellner durchgeschlagen hatte, bewarb ich mich in Wasserburg, dieser großen Stadt am Strom mit den ausgedehnten Hafenanlagen am Nordende, bei der Sparkasse um eine Lehrstelle. Ihr Gebaren mit Geld wollte ich lernen, wie sie damit umgingen, mit denen, die ihnen ihr Vermögen anvertrauten und mit denen, denen sie Beträge in großer Höhe liehen. Drei Jahre lang arbeitete ich dort. Ich lernte, mit einem unleidlichen Ausbilder auszukommen, der mich ständig wegen der leichten Verwachsung an meinem linken Fuß aufzog, der mir jeden Tag mindestens dreimal erklärte, aus mir würde niemals ein ordentlicher Banker werden, ich würde es nie lernen. Allen seinen Unkenrufen zum Trotz konnte ich nach einem Jahr Kunden beraten in einer Weise, dass sie sich gut aufgehoben fühlten bei unserer Sparkasse und wir trotzdem an ihnen Geld verdienten. Nach der Hälfte des zweiten Lehrjahres hatte ich mindestens vier vermögende Stammkunden, die ausdrücklich nach mir verlangten, wenn sie in der Anlage von Geld beraten werden wollten.
Auch das brachte mir aber das Lob des Ausbilders nicht ein. „Sollten Sie ja wohl auch können, nach über zwei Jahren“, quetschte er aus dem Mundwinkel heraus und sah mich nicht an.
Überhaupt sah er mich nie an. Aufträge erteilte er mir, wenn überhaupt, abgewandten Gesichtes, meistens sogar ließ er mir meine Aufgaben über Dritte mitteilen, über die anderen Mitarbeiter unserer Abteilung etwa oder sogar über meine Lehrlingskollegen. Ahnte er etwas? Ich ließ es mich nicht anfechten und erledigte meine Arbeiten so gut ich konnte.
Ein halbes Jahr später bestand ich die Prüfung zum Bankkaufmann mit der Note „sehr gut“, widerstand aber dem Werben des Vorstandssprechers der Sparkasse, ich solle doch bleiben, die tarifliche Bezahlung sei doch beispielhaft, sie würden mir die Lehrgänge finanzieren, die ich für mein weiteres Fortkommen in der Bankenwelt brauchte. Ich wollte nicht das Geld der Bankkunden anlegen, ich wollte das Gefühl erleben, selbst ausreichend Geld zu haben.
3.
Ich habe wieder von ihr geträumt. Glauben Sie nicht, dass ich zu derlei Dingen nicht fähig bin, etwa, weil ich zu alt wäre, weil ich zu viel gesehen hätte, weil ich mittlerweile desillusioniert sein müsste. Natürlich trifft all das zu, aber ich habe wieder von ihr geträumt.
Ich weiß nicht, vor wie vielen Jahren ich ihr begegnet bin, wann ich zum ersten Mal dieses Gesicht gesehen habe, diese weich aufeinander liegenden Lippen, diese Augen, die dich anstrahlen, wenn sie lächelt. Ein Madonnengesicht, würde man in meinen Kreisen lästern, zu schön, um wahr zu sein, zu vollkommen, um noch schön zu sein, und was dergleichen abfällige Bemerkungen mehr sind. Aber ich bin kein Spötter. Ja, ich sehe schon die verblüfften Gesichter meiner Umgebung, wenn sie diesen Satz von mir hören, aber in dieser Frage: nein, ich bin kein Spötter.
Sie kam die Treppe hoch in meinem Traum, nachdem sie lange angekündigt war und ich mit einer Sehnsucht auf sie gewartet hatte, die mir selbst im Traum das Herz fast zerbrochen hätte, wenn ich denn eines in meiner Brust trüge. Und dann, nach dieser langen Wartezeit, kam sie herauf, immer noch mit diesem wiegenden Schritt, der künstlich wirken würde, wenn es nicht sie wäre. Eine Wendeltreppe war es, ich beobachtete sie schon, wie sie die erste Stufe betrat, unter mir, sie hatte mich noch nicht wahrgenommen. Sie kam langsam, der Drehung der Treppe folgend, hinauf, gewahrte mich, als sie die Hälfte erreicht hatte und wieder sah ich diesen zu mir gerichteten Blick. Ich sah, wie das Gesicht sich belebte, wie die Augen zu strahlen begannen, wie sie zuerst den Blick noch einmal senkte, um ihn dann umso strahlender auf mich zu richten, den vollen Mund mit den weichen Lippen zu einem liebevollen Lächeln geformt. Sie kam auf mich zu, immer weiter die Treppe hinauf, und zerschmolz dann wie im Traum, als der Traum, der sie war, und ich wachte auf.
Lange blieb ich so, verfangen in der Erinnerung, keine Aufgabe, die ich mir für den folgenden Tag gesetzt hatte, konnte mich ablenken, sie war es, die ich in mir trug, als ich aufstand, sie war es, die mich begleitete, als ich in die Sparkasse ging und sie schützte mich auch vor allen Anfeindungen, die der Ausbilder, dem ich jetzt noch für kurze Zeit dienen musste, für mich bereit hielt. Sie war in mir, mir konnte nichts geschehen.
Ich sah sie zum ersten Mal in dem Restaurant, in dem ich vor dem Beginn meiner Lehre bei der Sparkasse als Kellner bediente. Sie war da mit einer Frau, wohl einer Freundin, und sie aßen an einem meiner Tische fürstlich. Ich sah sie und war sofort verliebt wie ein Mensch in meinem Alter in seine erste Liebe. Sie saß da, sprach mit ihrer wohlklingenden Altstimme, lachte und plauderte mit ihrer Freundin und lächelte mich an, als ich ihr die Speisekarte reichte mit der vollendeten Freundlichkeit, die ich bevorzugten Gästen zuteil werden ließ. Immer wieder suchte sie den Blickkontakt, als ich die Bestellung aufnahm, als ich ihr die Vorspeise servierte, den Wein dazu einschenkte, den Hauptgang servierte und danach das Dessert. Ich bediente nur sie, ihre Freundin und die Gäste an meinen anderen Tischen liefen nebenher, sie wurden zuvorkommend behandelt, keine Frage, aber bedient habe ich an diesem Abend nur sie, und sie hat es mir mit ihrem immer wiederkehrenden Lächeln gedankt.
War ich es, dessentwegen sie von diesem Abend an Stammkundin in dem Restaurant wurde? War es Zufall, dass sie immer, wenn sie bei uns Gast war, an einem meiner Tische saß?
Ich jedenfalls ging von diesem Abend an mit einer erwartungsvollen Freude zur Arbeit. Würde sie heute wieder da sein? Durfte ich sie heute bedienen? Und oft genug durfte ich.
Heute Nacht habe ich von ihr geträumt.
4.
„Gut, also dann können wir morgen zum Notar gehen und das alles beurkunden lassen?“
Fragend sah ich zwei Jahre nach meinem Ausscheiden bei der Sparkasse meinen Besucher an. Herr Gaibrich war mir von einem der bundesweit tätigen Makler in mein Büro geschickt worden, die ich angerufen und um ihre Vermittlungsdienste gebeten hatte. Das Geschäft mit Immobilien in Wasserburg war in vollem Gange und auch Herr Gaibrich wollte teilnehmen. Er war ein großer, dicker Mann, gemütlich wirkte er mit seinem gutmütigen Gesicht, seinem breiten schwäbischen Akzent und seinem immer freundlichen Lachen. Mein Haus in der Hoffmannstraße wolle er erwerben, hatte er mir telefonisch als Anlass für seinen Besuch genannt, und ob ich ihm am Telefon schon einen Preis nennen könne. Das war ein schwieriger Moment gewesen, ich hatte das Objekt vor drei Monaten für hundertzwanzigtausend Mark erworben.
„Ja“, hatte ich gedehnt, während ich fieberhaft überlegte. Verlangte ich zu viel, sprang er ab, forderte ich zu wenig, hatte ich eine Chance vertan. „Sechshunderttausend Mark müsste ich schon haben“, sagte ich dann entschlossen.
Daraufhin war er angereist, wir hatten uns in meinem Büro getroffen.
„Sechshunderttausend Mark sind eine Menge Geld“, sagte er nach der Begrüßung.
„Natürlich“, antwortete ich, „aber das Objekt ist das auch wert, Sie müssten es sich ja sowieso ansehen. Wir sollten das vielleicht als erstes tun.“
Ich wusste, war er erst einmal dort, würde er den Preis immer noch herunterhandeln, aber das Haus war repräsentativ, mit einer klassischen Fassade, einem stabilen Windfang und die Wohnung, die ich ihm zeigen konnte, war solide hergerichtet. Er würde sich dann schon auf meine Größenordnung einlassen. Dass die Hoffmannstraße nicht in der besten Wohngegend Wasserburgs lag, konnte er als Fremder nicht sehen. Nun hatte er das Haus besichtigt, der lichte Frühlingstag hatte es im besten Licht erscheinen lassen. Es hatte ihm sehr gut gefallen und jetzt saßen wir wieder in meinem Büro.
„Ja, ich will den Vertrag abschließen“, antwortete Gaibrich auf meine Frage, „aber können wir nicht noch heute beim Notar beurkunden? Dann spare ich eine Übernachtung und kann heute noch nach Hause fahren, das wäre dann weniger lästig.“
Das war einer der Grundsätze in diesem Geschäft: Hast du den Kunden erst mal an der Angel, schlepp ihn sofort zum Notar, ehe er sich das anders überlegt. Aber auch: Lass ihn drängen, drängele nicht von dir aus. Und da hatte ich ihn nun.
„Ich weiß nicht“, sagte ich mit bedenklichem Gesicht, „dazu müsste ich einen Notar finden, der den Vertrag heute noch vorbereitet und dann auch beurkundet.“
„Kennen Sie denn hier nicht einen Notar, der das für uns machen würde?“ Breit lächelte Gaibrich mich bittend an. Ich griff zum Telefonhörer.
„Rheidt hier, Frau Gerber, ist der Notar da?“ Ich wartete.
„Guten Tag, Herr Dr. Manscher, ich habe einen Kunden, der möchte ein Haus von mir kaufen, er ist aus Stuttgart und möchte nach Möglichkeit heute noch zurück. Können wir den Vertrag im Laufe des Tages bei Ihnen beurkunden?“
„Ich weiß nicht, Herr Rheidt, dazu müssen wir doch den Vertrag erst noch entwerfen.“
„Deshalb rufe ich ja an, aber Herr Gaibrich, das ist der Käufer, würde gerne heute abschließen. Der Kaufpreis ist fünfhundertfünfzigtausend Mark.“
Ich wusste, das würde ihn reizen, seine Gebühren würden für Wasserburger Verhältnisse überdurchschnittlich sein.
„Ja, gut, geben Sie mir die Daten durch, dann können wir uns um sechs Uhr in meinem Büro sehen.“
Ich nannte ihm Käufer, Objekt und Kaufpreis.
„Das haben Sie ja toll hingekriegt“, strahlte Gaibrich, „dann gehe ich jetzt Kaffee trinken und um sechs treffen wir uns beim Notar.“
Herr Gaibrich war nicht der einzige. Ich hatte mich nach der Lehre und nachdem ich meinen Vertrag bei der Sparkasse gekündigt hatte, darauf spezialisiert, alte Mehrfamilienhäuser zu kaufen, so billig wie möglich, und sie dann mit einem kräftigen Aufschlag zu verkaufen, ohne daran etwas zu verändern.
Seit einiger Zeit dachte ich darüber nach, in die Häuser geringfügig zu investieren, um meine Gewinnspanne noch zu erhöhen, aber dieser Vertrag brachte mir erst einmal über vierhunderttausend Mark Gewinn, davon die Steuern ab, und ich konnte endgültig das Auto, das mir seit längerer Zeit ins Auge stach, kaufen und noch genug zurücklegen, um in ein neues Projekt zu investieren.
5.
Weitere zwei Jahre später hatte ich elf solcher Immobilien fertig gestellt. Mein Bankkonto wies ein Guthaben von etwas über eine Million Mark aus, das wären, die Währungsumstellung stand bevor, rund fünfhunderttausend Euro. Ich musste mich schon jetzt an den neuen Namen des Geldes gewöhnen. Der Euro sollte zwar erst in zwei Jahren eingeführt werden, aber Aktien wurden ab sofort in dieser Währung gehandelt und mit Aktien wollte ich mich in Zukunft beschäftigen. Seit einem Jahr verfolgte ich intensiv die Kurse, ständig lief in meinem Büro der Aktienticker von „ntv“ und informierte mich über Kursverläufe und die Nachrichten dazu. Die ersten Erfahrungen mit Aktien lagen hinter mir, sie stiegen und fielen sehr schnell. Verluste hatte ich hinnehmen müssen, hier zehntausend Euro, dort fünftausend. Einmal waren dreißigtausend Euro verloren. Aber die Börse versprach dafür horrende Gewinne, wenn man keine Fehler machte und etwas Glück hatte. Per Saldo war ich nach einem halben Jahr rund sechzigtausend Euro reicher, und zwar vorwiegend am sogenannten Neuen Markt. An der Börse wurden Firmen gehandelt, Aktiengesellschaften, die keinerlei Vermögen hatten, keinen Grund und Boden, keine Maschinen, nichts. Die Gesellschaften in diesem Bereich zeichneten sich dadurch aus, dass sie eine gute Idee aufzuweisen hatten, nicht nur eine, eine Fülle neuer Ideen wurden da an den Markt gebracht, alle beschäftigten sich mit den neuen Informationstechniken, manche mit Hardware, die meisten mit Software, aber alle im Zusammenhang mit den neuen Kommunikationsmöglichkeiten. Sie holten sich Geld an der Börse, gaben Aktien aus, um ihre Ideen zu finanzieren und mit diesen Aktien spekulierte ich. Vollkommen neue Begriffe entstanden, die „IT Branche“ wurde zu einem neuen Modewort, man investierte in „start up“ Unternehmen dieses Zweiges und hielt das für eine gute Idee und ich schloss mich an. Ich bat die Sparkasse Wasserburg um Kredite, um in diese Aktien zu investieren und die Sparkasse gab sie gern, nicht nur, weil sie mich ausgebildet hatten und mir daher trauten, sondern weil sie ein gutes Geschäft witterte. Auch sie waren angesteckt von dem Run auf die neuen Aktien, sie spekulierten selbst und finanzierten ihren guten Kunden jeden Betrag. Im April 2001 hielt ich ein Aktienpaket von rund sieben Millionen Euro, sicher hinterlegt auf einem Depot bei der Sparkasse Wasserburg. Der Kredit von etwa drei Millionen, den mir die Bank zur Finanzierung der Aktien gegeben hatte, beunruhigte weder mich noch den Vorstand der Sparkasse, bei dem Aktiendepot?
Im Juni 2001 begannen die Werte zu fallen, bis August summierten sich die Verluste auf neun Zehntel meines Vermögens.
Am 19. August 2001 hatte ich einen Termin bei dem Vorstand der Sparkasse, Herrn Hartmann.
„Herr Rheidt, Ihr Depot ist zusammengeschmolzen auf hundertfünfzigtausend Euro. Wir haben Ihre Kredite neu bewertet, die Sicherheiten reichen bei weitem nicht mehr aus für die ausgegebenen Summen.“
„Aber Herr Hartmann, warten Sie doch einfach noch einen kleinen Augenblick, die Aktien werden ihre früheren Werte mit Sicherheit wieder erreichen. Ich finde, wir sollten uns noch einen Monat geben. Sie wissen ja, ich bin insolvent, wenn ich die Aktien jetzt verkaufe.“
„Das mag sein, aber wir werden nicht weiter warten. Sie müssen jetzt die Aktien verkaufen, sonst werden wir die Kredite kündigen.“
Zum ersten Mal konnte ich die Angst nachvollziehen, die Menschen immer beschrieben, wenn sie pleitegingen. Die Angst, wie sie ihre Familien ernähren sollten, wie sie ihren Freunden und vor allem ihren Freundinnen beibringen sollten, dass sie kein Geld mehr hatten, wie sie den Abstieg verkraften sollten. Nun, ich hatte keine Familie, meine gesellschaftliche Stellung war mir egal, und so sagte ich:
„Gut, wenn Sie wollen, verkaufe ich, aber Ihr Geld werden Sie dann wohl auf keinen Fall wiederbekommen.“
Erstes Buch:
Der Rat der Sieben
1.
Fanfaren gleich strahlte der Ruf durch den schwarzen Raum, klingend, ein Ruf, fordernd, hell, triumphierend, Kommandos gebend selbst dem Unendlichen, in dessen Weiten ich mich fast verloren geglaubt hatte. Fanfaren auf der Erde bedeuteten Freude, begeisterter Aufruhr, Helligkeit. Für mich, hier im grenzenlos scheinenden Universum, bedeuteten sie nur eins:
Den Ruf nach Rückkehr, ohne Verzug, sofort, in die Zentrale.
Ich befand mich gerade im sechsten Bezirk, als er erklang, befehlend, jeden Widerspruch sofort ausschließend, die Töne durchdrangen mühelos die dichte Schwärze des Universums, versuchten, es aufzuhellen, ohne Erfolg indes. Mein Auftrag im sechsten Bezirk war nichts Aufregendes, eine Routineangelegenheit, und so ließ ich alles stehen und liegen, froh, der undurchdringlichen Schwärze entfliehen zu können, sei es auch nur, um im grellen Licht der Zentrale von ihm neue Befehle zu empfangen, zum Guten oder zum Schlechten, ich wusste es nicht.
Gedankenschnell war ich zurück, in dem großen Versammlungssaal, wo wir uns trafen, alle waren wir dem Ruf gefolgt, es gab keine andere Möglichkeit als die des absoluten Gehorsams. Und kaum war eine kleine Zeit vergangen in dem hellen, alles durchdringenden Licht der Zentrale, als ich mich schon wieder nach dem Dunkel sehnte, nach den unendlichen Sphären des Universums, in denen kein Raum und keine Zeit war, nur Schwärze, ich und mein Auftrag.
Aber jetzt war ich hier und gerade drei Wimpernschläge später waren wir vollzählig und warteten, aber nicht zu lange.
Er erschien, wie immer in den langen schwarzen Radmantel gehüllt, dem Mantel, der innen mit Seide gefüttert war, in Rot, einem Rot wie Menschenblut, und der in starkem Kontrast zu dem schneeweißen Gesicht stand. Glühende, kohlschwarze Augen starrten aus dunklen, tiefliegenden Höhlen, fixierten jeden Einzelnen von uns, lange, intensiv und angsteinflößend, wenn es uns denn gegeben wäre, Angst zu empfinden.
„Verehrte Kollegen!“ Wie lange hatte ich diese Stimme nicht mehr gehört, diese vollkommen farblose Stimme wie aus vergangenen und zukünftigen Zeitaltern, hohl wie aus einem tiefen Brunnen und ohne jede Emotion, selbst mich durchlief jedes Mal ein Schauer, fast wie menschliche Angst, wenn ich sie hörte. Und von wegen Kollegen. Er war der Fürst, er wusste es und wir wussten es, aber er nannte uns Kollegen.
„Verehrte Kollegen, es hat sich alles geändert. Wie Sie wissen, ist es uns verboten, den Menschen anzutasten, uns auch nur in seine Belange einzumischen. Wir sollen ihn gewähren lassen, so ist die Vorgabe der Schöpfenden Kraft. Diese Vorgabe hat sich geändert.
‚Tastet mir nicht das Menschengeschlecht an‘, so lautet nach wie vor die Maxime. ‚Tut ihnen nichts, aber jetzt: Geht zu ihnen, führt sie auf ihren eigenen Weg, beseitigt sie nicht, aber sie werden nicht mehr gehindert sein, ihren eigenen und Ihren Versuchungen zu folgen.‘ Also versucht sie.“
Er schwieg und fixierte uns mit den brennenden Augen.
„Probieren wir unsere Kräfte an ihnen aus. Sieben von Ihnen werden zu ihnen gehen und diesen Auftrag erfüllen. Gehen Sie zu den Menschen, führen Sie sie in Versuchung und stellen Sie sie auf die Probe, ob sie sich nicht selbst zerstören.“
Unruhe machte sich unter uns breit. Niemals hatten wir den Menschen ernsthaft auf unseren Weg der Zerstörung führen dürfen, dieses eigenartige Produkt der Mischung zwischen Tier und Engel, das der Schönheit der Schöpfung Hohn sprach, indem es sündigte, was das Zeug hielt, seit es das Böse erkannt hatte, das Böse, das notwendig zur Schöpfung gehörte.
Unser Fürst selbst hatte dessen Einführung vorgeschlagen, dort, wo alles entsteht. Die Welt sei unvollkommen, hatte er vorgebracht, wenn nicht das schlechthin Böse darin sei, da könne keine noch so allmächtige Weisheit etwas anderes ersinnen. Wenn keine Wahl bestehe, das Gute oder das Böse zu tun, könne es gar kein Gut geben, eben weil ja die Wahl nicht sei. Und bei allem Respekt für die allwissende Schöpfungsgewalt: Immer, wenn diese eine Welt denke und schöpfe, die nur aus dem Guten bestehe, lasse sich eine andere, vollkommenere, bessere denken, nämlich eine, die seinen Geschöpfen die Freiheit lasse, dem Willen des Allschaffenden eben nicht zu folgen, eine Welt, in der auch das Böse seinen Platz finde.
Lange hatte man sich besonnen, wohl bedenkend, dass unser Meister und seinesgleichen die andere Seite der Welt, die dunkle, die mordende, brennende, sengende, sofort für sich reklamieren und sie nach Kräften befördern würden, um dann, wenn dieser Teil überhandnahm, Zerstörung zu fordern, Vernichtung. Nicht mehr Schöpfung, sondern das Gegenteil, sondern Einsicht in Fehlentwicklungen. Um es rundheraus zu sagen: Irrtümer wollten wir zeigen, begangen von der Allwissenheit. Wie wollten wir triumphieren, welch schreiendes, allumfassendes Gelächter, wenn wir der allmächtigen Schöpfungskraft, die alles wusste, Fehler in der Schöpfung nachweisen konnten.
Welch seltener Widerspruch, welche Genugtuung bei uns!
Die schaffende Kraft musste das Böse in der Welt zulassen, klar erkennend, dass sie damit ihre eigene Schöpfung hässlich machte und gemein, aber eben auch einsehend, dass alles andere den Anspruch auf Vollkommenheit schlechterdings nicht mehr würde erheben können.
Und so setzten wir durch, dass mit dem Bösen in den schwächsten Teil der Schöpfung, den Menschen, erst die Todesangst gepflanzt wurde und dann alle die Eigenschaften, mit denen er sie bekämpfte, als da sind Gier, Allmachtsphantasien und Raub- und Mordlust. Ausgerechnet in den Menschen, den die Kraft schon gegen unseren Widerstand geschaffen hatte, ein Wesen, anders als die unfruchtbaren Engel fruchtbar und anders als die bewusstseinslosen Tiere mit Bewusstsein. Und zu unserer großen Freude und Befriedigung kam die allmächtige Weisheit auf die Idee, gerade dieser Mensch müsse das Bewusstsein nicht nur von sich selbst, sondern auch von seinem Wahlrecht bekommen, die Wahl kennen zwischen Gut und Böse und zu allem Überfluss in ihn den Wahn zu pflanzen, das Gute zu wollen.
Was für eine verquere Idee, die in uns Zweifel an der Allwissenheit nährte.
2.
Ich erinnere mich noch gut, wie unser Fürst dort, bei der Schöpfungsgewalt, den Anspruch auf Zerstörung geltend machte, forderte, dieses merkwürdige Wesen habe aus der Schöpfung zu verschwinden. Und dann plötzlich waren es nicht mehr wir, die Vernichtung forderten, sondern die schaffenden Kräfte selbst, die der Welt in ihrem Zorn über die unsäglichen Untaten der Menschen eine gewaltige Flut schickten, die über die bewohnten Teile der Erde floss. Erst im letzten Augenblick scheint man sich besonnen und einige wenige Exemplare der eigentlich zum Untergang verurteilten Geschöpfe gerettet zu haben. Und damit nahm die Geschichte ihren Lauf.
Zum letzten Mal hatten wir die Zerstörung gefordert, nachdem ein besonders entsetzliches Muster der Gattung Mensch im römischen Reich nicht nur eine ganze Stadt in Schutt und Asche gelegt, sondern auch Tausende Seinesgleichen mit verbrannt hatte.
Nero, der römische Kaiser, war ein selten verdorbenes Exemplar Mensch, selbst unter diesem grauenhaften Geschlecht. Ich war damals an seinen Hof geschickt worden und hatte mich zu seinem Berater hochgedient. Jakobus Rhitus war ich, hochdekorierter Senator und im Capitol so wie am Kaiserhof wohl gelitten.
Der Imperator Roms, wie der Kaiser sich nannte, fürchtete alles und jeden. Seine Frau Poppäa, eine bekannt schöne Frau, war ihm untreu, mit Senatoren, mit Sklaven, mit allem, was einen Schwanz trug und nur annähernd ansehnlich war. Sie betrog Nero, der nichts mehr fürchtete, als dass sie ihn betrog. Aber er wusste nichts davon. Alle seine Spione, alle seine Freunde, die er immer wieder aufforderte, seine Frau zu bewachen und ihm das geringste Augenzwinkern zu melden, das sie einem anderen Mann zuwarf, hinterging entweder Poppäa bei ihren Affären oder sie bestach sie. Ich zum Beispiel, Jakobus Rhitus, wusste von ihren Affären und sie wusste, dass ich ihre Liebhaber kannte. Sie war sehr klug und verstand es, mich zu bestechen, auf die einzige Art, in der ich zu bestechen bin. Erst versuchte sie, mich zu verführen, das verfing bei mir nie. Also lockte sie mich mit Geld, das ich gerne nahm, allerdings ohne ihr Treue zu versprechen. Und schließlich verfiel sie auf die Idee, mich bei ihrem Mann, dem Kaiser, hoch zu loben, bis er mich zu seinem ersten Berater ernannte und behielt. Dafür gelobte ich ihr Schweigen.
In kurzer Zeit als Berater bekam ich heraus, dass Nero nicht nur fürchtete, von seiner Frau betrogen zu werden. Hinter jedem Vorhang witterte er Verrat, vermutete er einen Mörder, er duldete daher keine Vorhänge in seinem Palast.
Und dann machten die Christen ihm zu schaffen. Das war eine neue Sekte, die seine Vorgänger energisch verfolgt hatten, weil sie der Meinung waren, eine neue Religion verderbe die Menschen, es gebe außer Jupiter, dem Staatsgott, nur noch den Imperator, den Kaiser, selbst gottgleich. Die Christen verstießen daher gegen die Staatsräson, sie wurden verfolgt und, wenn gefasst, hingerichtet.
Nero intensivierte die Verfolgung vor allem deshalb, weil er ihrer neuen Religion gegenüber unsicher war. Was denn, wenn sie Recht hätten, wenn es einen Gott gäbe, der die Taten der Menschen nach deren Tod beurteilte und strafte? Dann könnte Gott auch ihn nach seinem Tode richten. Ich nährte nach Kräften seine Zweifel an der Richtigkeit der christlichen Thesen und riet ihm, sie so grausam wie nie zuvor zu jagen.
Die Unnachsichtigkeit, mit der er meinem Rat folgte, entsprach nicht nur meinen Ratschlägen, sondern war auch Ausdruck der Rache an denen, die ihn verunsichert hatten. Er ließ sie in Massen hinrichten, in Felle wickeln und den wilden Tieren zum Fraß vorwerfen, ließ sie kreuzigen und so ihren Gott verhöhnen, der angeblich ebenfalls gekreuzigt worden war. Er trieb sie in Arenen zusammen, wo er sie wehrlos abschlachten ließ. Selbst das römische Volk, sonst eher nicht zimperlich im Ansehen von blutigen Hinrichtungen, opponierte mehr und mehr gegen diese Art der Verfolgung.
Deshalb verfiel Nero auf die Idee, sie für ein großes Unglück verantwortlich zu machen. Er verzog auf sein Landhaus, ungefähr fünfzig Kilometer von Rom entfernt und gab Sklaven den Auftrag, die Stadt in Brand zu setzen. Rom brannte, vier Tage und vier Nächte lang.
Die Stadt war in großen Teilen aus Holz gebaut, sie fiel in einem lodernden Feuer zusammen und in ihm verbrannten Tausende von Menschen, eingeschlossen in ihren Häusern.
Nach dem Brand in die Stadt zurückgekehrt, beschuldigte Nero die Christen dieses Verbrechens und intensivierte, jetzt mit Zustimmung des Volkes, die Verfolgung noch einmal.
3.
Nero sei nur ein Exemplar, allerdings ein besonders ekelhaftes, dieser Spezies, so brachten wir vor, einer Spezies, die von der Welt verschwinden müsse. Sie raube und morde und sündige, dass es nur so eine Art habe, nichts sei vor ihnen sicher, kein Mensch, kein Tier, nicht die Welt und nicht die Himmel. Sie müsse verschwinden, forderten wir von der schöpfenden Allmacht.
Man zögerte.
Allerdings sei dieser Kaiser und seien die Menschen eine besonders verurteilenswerte Erscheinung innerhalb der Schöpfung, aber eben immer noch Teil der Schöpfung und als solcher erhaltenswert. Und man könne nicht umhin, meiner Rolle bei den Taten des römischen Kaisers zu gedenken. Sei nicht ich es gewesen, der ihn beraten und zu den Taten getrieben habe, die jetzt beklagt würden. Sei nicht ich eigentlich der Urheber des ganzen Unglücks? Und dann, habe der Kaiser nicht begonnen, umfangreiche Aquädukte im römischen Reich zu bauen, eine dankenswerte Tat?
Immer wieder hatten wir Vernichtung gefordert, und immer wieder waren wir auf die Unantastbarkeit des Menschen hingewiesen worden.
Und nun plötzlich eine, wenn auch nur kleine, Sinnesänderung?
4.
„Wir werden die Änderung nutzen, und sei sie noch so klein, und nicht danach fragen, was sie verursacht hat. Dergleichen fragt man nicht“, wieder drang die kalte, scharfe Stimme des Fürsten durch den Saal. „Ich werde sieben Vertreter ernennen, die auf die Erde gehen und sie begleiten, sie beraten, die die eigenen Eigenschaften der Menschen fördern und stützen, so lange, bis sie sich selbst dem Untergang weihen.“
Er begann, die Sieben aufzurufen, die bei ihnen wirken sollten. Ich war unaufmerksam, kam ich selbst doch für solche Aufgaben nicht in Frage, seit ich als Berater bei Nero aufgefallen war.
„Jakob Rheidt“. Da fiel mein Name doch noch, als siebter in der Reihe. „Womit sind Sie gerade beschäftigt, Herr Rheidt?“
Wenn der Fürst das fragt, weiß man besser eine Antwort.
„Ich bin im sechsten Bezirk. Dort gibt es auf dem dritten Planeten kristalline Existenzen, von denen man vermutet, dass sie zu Leben erwachen könnten.“
„Unwichtig. Sie werden dem Rat der Sieben angehören. Sie werden im siebzehnten Jahrhundert als Sekretär Wallensteins wirken.“
Das war ja prächtig. Kein langweiliger Dienst mehr bei Kristallen, die, was mich anbetraf, niemals Leben entwickeln würden, stattdessen mitten auf der Erde. Ich dankte überschwänglich.
„Keine Zeit verlieren, meine Herren, bilden Sie den Rat und beginnen Sie ihre Tätigkeit.“
Mit diesem kalt und drohend ausgesprochenen Satz, der wie ein Fluch hängen blieb, war er verschwunden. Die Versammlung verstreute sich, nur wir sieben blieben noch einen kurzen Moment zusammen.
Zweites Buch:
Wallenstein
1625
1.
Langsam und gemessenen Schrittes ging ich über die große alte Stadtbrücke, die die Moldau überspannte, ich sah nicht die Figuren aus dem Zauberreich, die sie zierten, ich sah nicht das Wasser des Flusses, das unter mir mit stetem Gurgeln dahin strömte und ich achtete nicht auf die Menschen, die mir entgegenkamen. Fest hielt ich das Gesicht auf die andere Seite des Flusses gerichtet, auf die Kleinseite dieser großen Stadt Prag, wo gleich hinter dem Fluss der Palast des Generals Wallenstein lag, des großen Feldherrn Albrecht von Wallenstein, Herzog von Friedland. Zum Generalissimus war er vom Kaiser Ferdinand dem Zweiten in Wien ernannt worden, ein Titel, der allein ihm vorbehalten war.
Der Sommer dieses Jahres 1625 hatte viel Regen gebracht, Überflutungen sogar, aber jetzt strahlte die Sonne seit einer Woche mit großer Kraft, obwohl der September sich seinem Ende näherte. Die Bäume hatten wegen der vielen Niederschläge noch nicht einmal angefangen, ihre Blätter zu färben, dick belaubt und dunkelgrün spendeten sie Schatten, als ich jetzt die Brücke verließ und auf die Allee einbog, die zum Palast des Generalissimus führte. Beeindruckend lang und breit war sie, gerade auf den Haupteingang zulaufend, von riesenhaften Eichen gesäumt, unterbrochen allenfalls von ein paar Buchen und Tannen. Mit meinen dünnen Festtagsschuhen hatte ich Mühe, über das holperige Kopfsteinpflaster zu laufen, widerstand aber der Versuchung, neben der Straße auf dem Gras zu gehen, obwohl mein linker Fuß, der leicht behindert ist, mir erhebliche Schwierigkeiten bereitete. Ich wollte nicht gleich zu Beginn schlecht auffallen, war aber doch erleichtert, als ich hinter mir das laute Hufgeklapper von Pferden hörte, dem das Rollen des von ihnen gezogenen Wagens folgte. Erleichtert trat ich zur Seite auf das Gras und sah mich um. Eine prächtige Kutsche, von vier kohlschwarzen Wallachen gezogen, rollte an mir vorbei, dichte Vorhänge vor den Kutschfenstern verweigerten mir jeden neugierigen Blick auf die Insassen. Ich sah ihr einen Augenblick nach, wie sie über das raue Pflaster dahinglitt, wie die langen starken Federn des Wagens die Unebenheiten ausglichen und wie sie dann in einem schönen Bogen vor dem Haupteingang vorfuhr und hielt. Langsam nahm ich meinen Weg wieder auf und schritt auf das Schloss zu, um die Allee kurz vor dem Haupteingang des Palastes zu verlassen und in einen kleinen Weg nach rechts abzuzweigen, der, wie ich annahm, für die Dienstboten vorgesehen war. Bescheiden hielt ich mich am Rand des Weges, der nicht gepflastert war und ging auf die Nordecke des riesenhaften Gebäudes zu. Tatsächlich, an dieser Seite gab es eine kleine Tür, an die ich vorsichtig klopfte.
„Ja bitte?“ Ein alter Diener in der rotbraunen Livree des Herzogs lugte durch einen kleinen Spalt und sah mich an.
„Was wünschen Sie?“
„Ich heiße Jakob Rheidt und bin zu Seiner Fürstlichen Gnaden um vier Uhr bestellt, um mich als Schreiber zu bewerben.“
„Gut, kommen Sie herein, ich werde Sie dem Kammerdiener melden.“
Mit diesen Worten öffnete er die Tür ganz und ließ mich hinein, um mir gleich dahinter eine schmale Bank zu weisen, auf der ich warten sollte. Hier im Haus, auf dem dunklen Flur, war es angenehm kühl. Ich wusste, ich war zu früh, und richtete mich auf eine längere Wartezeit ein.
2.
Ich gab mich bescheidener als ich mich fühlte. Schließlich war ich vom Rat ausgewählt und abgesandt worden, um als Schreiber des Generals zu wirken.
„Setze sich der Herr und schreibe er, was ich ihm ansage“. Ich hatte nicht sehr lange warten müssen und stand zum ersten Mal vor dem berühmten General Albrecht von Wallenstein. Er war zu dieser Zeit von der Gicht, die ihn in späteren Jahren so plagte, noch nicht allzu sehr befallen, ein nicht großer, sehr vornehmer Herr mit braunen, alles durchdringenden Augen und dunklen Haaren. Sein an sich schon schmales Gesicht wirkte durch den Schnauzbart und den nach unten spitz zulaufendem Kinnbart, der neuerdings sehr in Mode war, noch länger, als es ohnehin schon war. Scharf fasste er mich ins Auge, bevor er mich an den Tisch befahl und mir irgendeinen unbedeutenden Text in die Feder diktierte.
„Der Herr hat eine sehr saubere Schrift“, lobte er mich. Zum ersten Mal hörte ich diese äußerst unpersönliche Anrede, die er auch gegen ihm sehr vertraute Personen gebrauchte.
„Wenn Eure Fürstliche Gnaden mich als Schreiber anstellte, könnte ich Ihre gesamte Korrespondenz führen“, so pries ich mich an, und tatsächlich rief er mich am nächsten Tag zu sich, um mir mitzuteilen, dass ich für ihn arbeiten solle.
Tag für Tag kam ich nun morgens um sechs Uhr pünktlich zu ihm in sein Schloss in Prag, wo er sich in diesem Winter aufhielt. So viel war zu schreiben, dass der General mir einen Monat später befahl, endgültig zu ihm zu übersiedeln, damit ich immer für ihn bereit sei.
Was gab es alles zu tun! Seit dem Frühjahr des Jahres war mein Gebieter als oberster General über das Heer des für die katholische Sache kämpfenden Kaisers eingesetzt und deshalb in lebhafter Korrespondenz mit dem Hof. Auch war er bestrebt, den Überblick über seine reichen Ländereien zu behalten. Zwar hatte er überall Verwalter eingesetzt, die sein Vertrauen genossen und die nach meinem Eindruck ihren Dienst auch vergleichsweise ehrlich verrichteten, aber der Generalissimus war ein pedantischer Wirtschafter, der alles bis in die kleinsten Anschaffungen für die Bediensteten kontrollierte und darüber ausgiebigen Briefwechsel führte, den ich zu erledigen hatte.
Und dann wollte die Armee, die er kurz nach meiner Einstellung aufzubauen begann, verwaltet werden. Auch da gab es zwar die Offiziere, die sich um ihre Bereiche kümmerten. Aber General Wallenstein war auch in militärischen Dingen äußerst penibel, keine Maßnahme durfte ohne Prüfung durch ihn und ohne seine Genehmigung durchgeführt werden.
Langsam arbeitete ich mich in die riesige Korrespondenz ein. Der Krieg, der seit 1618 immer wieder im deutschen Reich aufflammte, war 1625 fast ganz zum Erliegen gekommen. Alle Parteien schienen kriegsmüde, bis auf den Kaiser Ferdinand in Wien, der aber seine Kasse vollkommen verausgabt hatte und deshalb nicht in der Lage war, ein neues Heer aufzustellen. Dennoch wollte er keinen Frieden.
Dem an Bargeld armen, aber kriegslüsternen Kaiser war das Angebot Albrechts von Wallenstein daher hoch willkommen, für den Kaiser und die katholische Sache auf eigene Kosten ein Heer aufzubauen.
„Fünfzigtausend Mann will ich Eurer Majestät rekrutieren“, soll er geprahlt haben und auf die Frage, ob nicht auch zwanzigtausend ausreichend seien, geantwortet haben: „Je größer meine Armee ist, desto leichter schlage ich den Feind. Aber die Soldaten sollen die kaiserliche Schatulle kein Goldstück kosten. Ich bezahle sie allein.“
Das scheint dem Kaiser gefallen zu haben, besonders, dass der General sein Heer in protestantische Länder führen wollte, nicht in katholische, und so gab er nach monatelangen Verhandlungen Wallenstein alle Vollmachten, Soldaten zu werben, Steuern einzutreiben zu ihrer Unterhaltung und Krieg im Namen der katholischen Majestät zu führen. Dazu verlieh er dem Ehrgeizigen den Titel des Generalissimus, um den er gebeten hatte. Eine Armee von vierundzwanzigtausend Soldaten sollte er aufstellen dürfen.
Kurz nachdem ich sein Schreiber wurde, hatte Wallenstein mit dem Aufbau des Heeres begonnen. Als Sammelplatz hatte er die große Ebene fünfzig Kilometer nordwestlich von Prag ausersehen. Von da schwärmten Tausende Werber aus, die junge Männer suchten, die bereit waren, gegen ein Handgeld und das Versprechen eines anständigen und regelmäßig gezahlten Soldes für den Kaiser und den Generalissimus in den Krieg zu ziehen.
Und sie hatten Erfolg, die Werber Wallensteins. Sie waren von bewaffneten Trupps begleitet, deren Schutz sie nötig hatten, führten sie doch eine Menge Goldes bei sich. Jedem, der bereit war, den Fahnen des Generalissimus zu folgen, boten sie einen Monatssold von zwanzig Gulden an, pünktlich am Ende eines Monats zahlbar und ein sofortiges Handgeld von drei Monaten, also sechzig Gulden. Vor allem in den Städten hatten sie Erfolg, in denen sich junge Männer aus den unterschiedlichsten Gründen herumtrieben, Bauernsöhne, deren ältere Brüder den elterlichen Hof geerbt hatten und die in die Stadt geflohen waren auf der Suche nach Lohn und Brot, die sie zu Hause nicht finden konnten. Handwerksburschen ohne Arbeit, ausgespuckt von der vom jahrelangen Krieg zerstörten Wirtschaft und Kriminelle, die froh waren, den polizeilichen Nachforschungen zur Armee entfliehen zu können.
Aber auch auf dem Lande fanden sie bereitwillige junge Männer, die keine Arbeit hatten, weil sie keine fanden oder auch keine haben wollten, unglücklich Verliebte oder auch nur Abenteuerlustige, denen es in den Dörfern zu langweilig wurde. Sie alle nahmen gierig die sechzig Gulden und sammelten sich an den vorgegebenen Plätzen, um zur Armee zu stoßen.
Und da, wo sich freiwillig zu wenig Soldaten fanden, da fingen die Werbertrupps auch die Männer ein, junge und nicht so junge, und hielten sie mit Waffengewalt fest, drückten ihnen ihre sechzig Gulden in die Hand, fesselten sie dann und nahmen sie mit.
Als ich als Schreiber zu Wallenstein kam, hatte er auf diese Weise eine Armee von achtzehntausend Mann zusammengebracht, die im Nordwesten Böhmens auf den Abmarsch warteten.
Ich hatte sehr schnell das Vertrauen des sonst immer Misstrauischen gewonnen.
„Der Herr kennt meine Korrespondenz“, sagte er eines Tages, „lange kann ich die Armee nicht mehr unterhalten. De Witte, mein Bankier, macht immer mehr Schwierigkeiten, ich glaube, er bringt die Summen nicht mehr zustande.“
„Fürstliche Gnaden müssen ihm eben mehr Sicherheiten geben“, erwiderte ich, „Wenn de Witte seine Investoren überzeugen kann, dass er sein Geld von Euren Fürstlichen Gnaden zurückbekommt, wird er auch wieder Kredit nehmen können.“
„Wie das?“ fragte der Fürst und sah mich scharf an.
„Fürstliche Gnaden wird doch bald zu Ihrem Heer abreisen und dann in den Krieg ziehen?“, fragte ich.
„Natürlich, dazu habe ich sie ja ausgehoben, in zwei Monaten werden wir soweit sein.“
„Und wird Fürstliche Gnaden Ihren Soldaten das Plündern erlauben?“
Wieder musterte er mich erstaunt. „Natürlich, so ist es gutes Soldatenrecht.“
„Wenn aber Fürstliche Gnaden Ihren Soldaten das Plündern verbieten und stattdessen Kontributionen aus den Ländern nehmen, die Sie erobern, kommt das der fürstlichen Kasse zugute, nicht dem einzelnen Soldaten. Das fördert die Disziplin und Fürstliche Gnaden kann die Ausgaben des Heeres decken und dazu noch die Soldaten bezahlen.“
Ein Lächeln huschte über das sonst immer ernste Gesicht des Generals.
„Der Herr meint, wir tragen Krieg in die feindlichen Länder, die den Krieg dann bezahlen müssen?“
„Genauso.“
Für diesmal entließ er mich, aber nach einer Woche unterbrach er sein Diktat, sah mich scharf an und sagte:
„Woher kommt der Herr?“
Ich stellte mich unwissend.
„Wieso?“
„Der Herr hat mir davon gesprochen, dass der Krieg den Krieg finanziere. Die Idee ist neu und nicht alltäglich, hat der Herr sich das selbst ausgedacht?“
Ich wich der eigentlichen Frage aus.
„Haben Fürstliche Gnaden den Erfolg bei dem de Witte gehabt?“
„Ich habe mit de Witte gesprochen. Mein Kredit bei ihm ist nun unbegrenzt, weil er von seinen Banken freie Hand bekommen hat. Die Idee des Herrn hat den Geldleuten gut gefallen. Hat der Herr gut gemacht.“
Ich verbeugte mich schweigend. Das Wort „der Krieg finanziert den Krieg“ wurde fortan bei Wallenstein und seinen Generalen zum stehenden Spruch.
Am Ende dieses Sommers war die Werbung beendet, der General hatte vierzehn Regimenter unter seiner Fahne versammelt, dazu fünf aus Böhmen und weitere zehn, die dem General vom Kaiser übergeben worden waren, insgesamt etwas über zwanzigtausend Mann, zu Fuß und zu Pferd.
3.
Den ganzen nächsten Sommer über bis zur Abreise meines Herrn aus Prag hatte ich alle Hände voll zu tun und kaum Zeit, mich um meine Umgebung zu kümmern. Einzig zu dem Kammerdiener des Generals, Jean, einem älteren und würdigen Mann, hatte ich Kontakt. Wir saßen manchmal abends, wenn der Fürst uns nicht brauchte, in seinem kargen Zimmerchen zusammen, das er in dem Palais Wallenstein bewohnte. Er rief mich dann und fragte, ob ich ihm nicht ein bisschen Gesellschaft leisten wolle. Immer nahm er bei diesen Gelegenheiten eine Flasche des Weines aus dem Regal, der von den Gütern unseres Herrn stammte, und wir tranken den schweren weißen Tokaier, immer mäßig.
Jean war aus einer bürgerlichen Prager Familie, die in die Religionswirren geraten und aus der Stadt verbannt worden war. Einzig er, der dritte Sohn, war in Prag geblieben und hatte sich schon in jungen Jahren dem Herzog von Friedland angedient, als der diesen Titel noch gar nicht hatte. Jean hatte den Aufstieg seines Herrn miterlebt, der mit der reichen Heirat begonnen und nun mit seiner Ernennung zum kaiserlichen Oberbefehlshaber seinen vorläufigen Höhepunkt gefunden hatte.
„Aber einen besseren Herrn kann ich mir nicht vorstellen“; sagte er ruhig und ich betrachtete ihn. Er sah mit seinen weißen Haaren und dem sorgfältig gestutzten Vollbart aus wie der Inbegriff eines Dieners, ein Eindruck, der durch die grauweiß gestreifte Weste und die schwarze Hose noch betont wurde. Viel erzählte er mir von dem Leben in Prag vor dem großen Krieg, der mit dem Sturz kaiserlicher Diplomaten aus der Prager Burg begonnen hatte.
„Aber Krieg war schon vorher“, sagte er mit seinem ruhigen tiefen Bass, „schon bevor wir die unverschämten kaiserlichen Abgeordneten aus dem Fenster geworfen haben, schikanierten uns die Kaiserlichen, wo sie konnten.“
„Uns?“, fragte ich beiläufig.
„Ja, damals gehörte ich zu ihnen, wie alle anständigen Böhmen, schon von meiner Familie her, aber inzwischen bin ich nicht mehr interessiert. Ich habe mich beim General beworben und ihm meine Vergangenheit geschildert. Sie war ihm gleichgültig ebenso wie meine Religion, ich brauchte auch nicht zu konvertieren. Ich glaube, dem General sind Gottesfragen vollkommen egal, er glaubt an nichts als an seinen Erfolg.
Aber so habe ich bei ihm eine Arbeit, die ich gerne tue und bei der mich keiner nach meinem Glauben fragt. Das reicht mir.“
Oft saßen wir zusammen und immer wieder erzählte er mir von seinem Leben. Mir war er als Gesprächspartner lieb, weil er gerne redete und mich nicht nach meiner Vergangenheit fragte.
4.
„Der Herr wird mit mir reisen müssen, wenn er weiter für mich arbeiten will“, eröffnete mir der General im Herbst, „ich reise morgen früh ab und es wäre mir lieb, wenn der Herr mich als mein Schreiber begleiten würde. Auch im Felde wird es viel zu schreiben geben. Der Herr ist doch ungebunden?“
Wieder fasst er mich scharf ins Auge, als wolle er in mein Herz sehen. Ahnte er etwas von mir und meiner Existenz? Wieder wich ich aus.
„Aber werden Eure Fürstliche Gnaden denn die Reise aushalten können?“, fragte ich besorgt.
Eine düstere Wolke zog über sein Gesicht. Seit Anfang der letzten Woche hatte seine Krankheit ihn zu plagen begonnen. Jean hatte mir erzählt, dass sie ihn lähme, er sei dann schlecht gelaunt, könne sich kaum bewegen und schließe sich die meiste Zeit ein. Tatsächlich hatte ich in der letzten Woche wenig zu tun gehabt. Wallenstein war in seinen Gemächern geblieben und hatte niemanden um sich haben wollen als nur Jean und Seni, seinen Diener und den italienischen Leibarzt und Astrologen.
Heute Morgen aber hatte er mich sehr früh rufen lassen und mir eröffnet, dass er zur Armee abreisen und mich mitnehmen wolle.
„Es wird gehen müssen. Der Herr sieht ja, dass ich wieder aufstehen konnte, und die Sterne mögen mir helfen, jetzt werde ich ein, zwei Jahre Ruhe haben von dieser verfluchten Krankheit.“
Tatsächlich, so hatte Jean erzählt, suchte ihn die Lähmung in diesen Abständen heim.
Am nächsten Morgen zogen hunderte Kutschen aus dem Palais Wallenstein und aus der Stadt heraus nach Norden, wo die Regimenter lagerten und der Ankunft ihres Oberbefehlshabers harrten. Ich war mit meinem kleinen Gepäck in der dritten Kutsche untergekommen. Er hatte mich in seiner Nähe, wenn auch nicht in seinem Wagen haben wollen, damit, wie er sagte, er mich jederzeit finden und rufen könne. Wir zogen in Eilmärschen, begleitet von zwei Regimentern Reiterei, die uns an der Stadtgrenze erwarteten und erreichten nach zwei Tagen das riesige Gelände, auf dem Wallensteins Heer lagerte.
Ein ausgedehntes Lager war das, wir brauchten drei Stunden, bis wir die für uns reservierten Unterkünfte erreichten und hatten noch Glück, dass unsere Reiter uns den Weg bahnten. Durch den Tross kämpften wir uns, wo Essstände ihren Gestank nach altem Fett und gebratenem Fleisch verbreiteten, sahen an diesen Ständen reihenweise die Soldaten warten, bis sie ihre Ration kaufen konnten. Unrat lag zu Haufen um diese Stände herum, alle warfen weg, was sie nicht essen konnten oder wollten. Hunde stritten sich unter großem Gejaule um die Reste, Ratten wuselten zwischen ihnen umher, um das zu ergattern, was die Hunde ihnen überließen. Direkt daneben passierten wir die Bordelle, Zelte, vor denen Frauen saßen, Dürre, Fette, Alte, Junge, und immer wieder sahen wir, wie ein Soldat mit einer im Zelt verschwand. Jean, der neben mir im Wagen saß, wandte sich angeekelt ab.
„Ja, Jean“, lachte ich und tat erfahren, „auch das ist der Krieg, er ist nicht besonders appetitlich, schon bevor er angefangen hat, wie?“ Ich lachte, als ich sah, wie er seine Augen schloss und sich in die Wagenecke lehnte. Nach den Huren wurde es soldatischer. Hier saßen zehn Reiter mit ihrem Wachtmeister um ein Feuer herum, sie sangen, ich konnte es hören, zotige Texte oder auch Kriegslieder. Immer weiter rollten wir, manchmal durch einen Pulk Soldaten aufgehalten, die neugierig in die Wagen stierten, um zu sehen, wer da durchs Lager fuhr, sich aber zerstreuten, wenn sie hörten, es sei der Generalissimus selbst, der da anreiste. Jetzt kamen wir an einer Pferdekoppel vorbei, dort herrschte eine unsägliche Unordnung, ich fragte mich, wie ein Reiter hier wohl sein Pferd wiederfinden wollte. Offenbar herrschte aber doch eine gewisse Ordnung, nur den Reitern verständlich, denn plötzlich sah ich, wie zwölf Männer auf den Korral zu gingen und sich zielsicher Tiere herausfingen, sie sattelten und hinausritten. „Bestimmt Wachen, deren Dienst beginnt“, sagte ich zu Jean, der die Augen wieder geöffnet hatte und neugierig durch die Scheiben sah.
„Wenigstens hier, im inneren Lager, scheint einigermaßen Ordnung zu herrschen“, antwortete er.
Und schließlich langten wir im Zentrum des Lagers an. Ein kleines Dorf hatte man aufgebaut, die Unterkunft des Generals war deutlich zu erkennen, sie überragte alle anderen und schien groß genug, um Besprechungen mit Offizieren durchzuführen. Rund herum waren andere Zelte errichtet, offenbar größere für die höheren Offiziere, kleinere für uns, die wir Kammerdiener und Schreiber des Generals waren. Am Rande stand eine kleine Hütte, die man mir später als das Klosett der Offiziere benannte, das wir ebenfalls zu benutzen hatten.
Ich teilte mein Zelt mit dem Kammerdiener und kaum hatten wir es nur besichtigt, kam schon ein Bote.
„Schreiber Rheidt, zum Generalissimus befohlen“, rief er durch den offen stehenden Vorhang und ich konnte noch Jean bitten, auf mein Gepäck zu achten, da führte er mich schon zum General.
„Na, hat der Herr eine gute Reise gehabt?“, fragte er, und ich kannte ihn kaum wieder.
Sein Gesicht, sonst blass, war gerötet, die Augen blitzten, offenbar hatten ihm die Reise und der Anblick seines Heeres gutgetan.
„Ich hoffe, der Herr ist nicht zu durchgeschüttelt, um zu schreiben“, scherzte er, „ich habe den Befehl für den morgigen Tag zu diktieren. Setze sich der Herr und schreibe.“
Und Wallenstein diktierte mir seine Befehle für morgen. Die gesamte Armee hatte sich um sieben Uhr zum Abmarsch bereit zu machen. Es ging nach Norden, ins Deutsche Reich, so befahl er, gegen die Protestanten, gegen die Dänen, und die Soldaten, die ihren Sold von Wallenstein im Unterschied zu den anderen Heerführern, regelmäßig bekommen hatten, jubelten.
5.
Der dänische König Christian führte die protestantischen Waffen mit seiner Armee an, unterstützt von Christian von Braunschweig und dem Grafen von Mansfeld, einem Abenteurer, der mit einem von England und den Generalstaaten unterstützten Heer in die Kämpfe eingegriffen hatte.
Knapp eine Woche nach dem Aufbruch in Nordböhmen vereinte sich unsere Armee mit den Truppen des Grafen Tilly, der unter dem Befehl des bayerischen Kurfürsten Maximilian in Norddeutschland gegen die Protestanten kämpfte.
General Tilly hielt die Weser, während wir uns an der Elbe festgesetzt hatten. Der Stab des dänischen Königs war in Wolfenbüttel, er hatte Festungen in Minden, Northeim und Göttingen und ließ seine Armee bis tief nach Hessen streifen, Nahrung und Beute suchen, plündern, sengen und vergewaltigen. Niemand hielt sich freiwillig mehr in den Dörfern auf, im ganzen Herrschaftsbereich des dänischen Königs waren die Menschen auf der Flucht, hungernd, frierend, zitternd vor Furcht.
Wallenstein hatte sich im späten Herbst westlich der Elbe niedergelassen und seine Truppen, ebenso wie unser Verbündeter Tilly und die feindlichen Protestanten, in das Winterlager geschickt. Er hatte vorher einen Brückenkopf zu dem östlichen Ufer der Elbe gebildet, den er den ganzen Winter hindurch hielt. Es gab nur noch wenige Kampfhandlungen in diesem Jahr, nur Mansfeld beunruhigte immer wieder unsere Truppen östlich der Elbe, immer wieder griff er sie an, zog sich aber sofort wieder zurück. So verging der Winter.
Das änderte sich schlagartig mit der ersten Schneeschmelze des nächsten Jahres. Mansfeld drang nun energisch vor, unseren vorgeschobenen Posten an der Elbe zurückzudrängen, Wallenstein setzte, den Brückenkopf nutzend, so schnell wie möglich über den Strom. Es entwickelte sich eine wütende Schlacht, in der tausende von Soldaten starben. Wallenstein siegte, Mansfeld war geschlagen und auf der Flucht.
„Wir haben einen großartigen Sieg errungen“, musste ich an den Kaiser schreiben, „einen Sieg, von dem sich der Mansfeld auf Jahre hinaus nicht wird erholen können.“
Aus den Antworten des Kaisers wurde deutlich, dass auch andere ihn von der Schlacht unterrichtet hatten.
„Wir können nicht verstehen“, schrieb der Kaiser, „warum man den Mansfeld nicht verfolgt und bis auf den letzten Mann aufgerieben hat. Der Mansfeld hat uns große Ungemach bereitet, es wäre wünschenswert gewesen, ihn zu verfolgen und zu töten.“
Der Kaiser habe leicht reden, brummte Wallenstein, als ich ihm diesen Brief vorlas. Ich war mittlerweile zu seinem Vertrauten geworden. Der Kaiser habe ja für die Armee auch kein Goldstück dazugegeben. Er, Wallenstein, müsse noch sehen, wie er seine Leute ernähre.
Der Fürst hatte mich den Befehl schreiben lassen, es sei seinen Truppen die Plünderung streng verboten, wer dabei entdeckt würde, habe mit seiner Erschießung zu rechnen. Stattdessen forderte er nach seinem Ermessen Steuern ein von den Ländern, durch die er zog. Die Beute der Plünderungen wäre seinen Soldaten zugute gekommen, die Steuern flossen in seine Kasse.
6.
„Der Mansfeld ist östlich der Elbe nach Süden aufgebrochen. Er hat eine neue Armee aufgestellt, sich mit dem Herzog von Weimar verbündet und zieht nun zur Oder, von dort nach Schlesien und nach Mähren und Ungarn, wo er sich mit Gabriel Bethlen vereinigen will, um den Kaiser anzugreifen.“ Das war die Nachricht, die im Juli dieses Jahres meinen Herrn schlaflose Nächte kostete.
Er müsse sofort ebenfalls nach Süden aufbrechen, um den Kaiser und sein Wien zu schützen, sagte er in der Beratung der Generale.
Das könne er nicht, hielten die anderen dagegen, er sei bei Tilly im Wort, den dänischen König bis in sein Land zu verfolgen und ihn dort zu schlagen.
„Was hilft es, wenn wir den dänischen König besiegen und Mansfeld, Weimar und Bethlen erobern Wien?“ Wallenstein war ein ruhiger, vornehmer Herr, aber die Sorge und die Ungewissheit, was richtig sei, machten ihn zornig und aggressiv.
„Und wir werden doch nach Süden marschieren“, vertraute er mir an, der ich ihn schweigend unterstützte. Ich verstand seine Sorge: Wenn die Protestanten nach Süden zogen, bedrohten sie nicht nur Wien und den Kaiser, sondern auch und vor allem das Herzogtum Friedland. Daran wollte Wallenstein sie hindern und sie verfolgen.
Mitte August überschritten wir die Elbe unterhalb des Mündungsgebietes der Elster, Wallenstein hatte Marschbefehl gegeben, und zwar nach Süden, trotz der wütenden Protestschreiben Tillys, Maximilians von Bayern und des Kaisers.
Mansfeld und Weimar waren uns drei Wochen voraus. Wir kamen zehn Tage nach Überschreiten der Elbe an die Oder, auf deren anderer Seite Mansfeld passiert war.
„Der Krieg finanziert den Krieg“, war immer wieder die Maxime des Generalissimus auf die bangen Fragen seiner Generale, wie er denn seine gut zwanzigtausend Mann auf dem Marsch nach Süden, bis nach Mähren und Ungarn ernähren wolle. Und sie bekamen sehr schnell eine Lehrstunde, wie diese Finanzierung lief.
„Ich habe vom Kaiser die Erlaubnis erbeten, fünfzigtausend Mann auszuheben“, erklärte mir Wallenstein, „damit ich zwanzigtausend haben konnte. Mit weniger Truppen wäre ich nicht in der Lage, sie zu finanzieren. Aus eigenen Mitteln hätte ich das für zwei Monate gekonnt, mit der Hilfe des Bankiers de Witte ein Jahr, danach wäre die Armee aufgelöst worden. Aber der Herr hatte Recht, zwanzigtausend Mann sind eine Macht, die in der Lage ist, Kontributionen einzutreiben. Der Krieg finanziert eben den Krieg, wie der Herr gesagt hat.“
Wo immer wir auf unserem Marsch auf ein Dorf oder eine Stadt trafen, sandte Wallenstein eine Abordnung voraus, die als Steuer entweder die gesamte Jahresernte forderte oder den entsprechenden Betrag in Geld, damit er seine Truppen ernähren und ausrüsten konnte. In den meisten Fällen öffneten die ängstlichen Bürger ihre Scheunen und Schatzkammern und gaben, was er verlangte. In einigen Städten allerdings regte sich Widerstand.
„Wir werden ihm weder unsere Ernte noch unsere Schätze ausliefern“; ließen sie antworten.
Mit kaltem Blick wählte der General dann eine Truppe aus und ermächtigte sie, die Stadt zu überfallen, einzunehmen und zu plündern. Nur den fünften Teil dessen, was sie raubten, brauchten sie beim Heere abzuliefern, den Rest dürften sie behalten. Die Teilnahme an solchen Aufträgen war sehr beliebt, konnten die Soldaten doch ihre eigenen Säckel füllen.
Wir, die wir danach durch die überfallenen Städte zogen, sahen, dass sie nicht nur geplündert hatten. Sie hatten gemordet, vergewaltigt, gefoltert und wir konnten die Folgen ansehen. Leichen lagen auf den Straßen und Wegen, grässlich verstümmelt, hier und da lebten die Menschen noch, waren aber so gefoltert worden, dass sicher war, sie würden den Tag nicht überleben. Niemand kam auf die Idee, ihnen den Gnadenstoß zu geben.
7.
Ich war schon fast zwei Jahre Schreiber Wallensteins, als ich bei ihm zum ersten Mal seinen Bankier traf, den er „Hans de Witte von Lilienthal“ nannte. Sie führten geheimnisvolle Unterredungen, die ich zwar von da ab protokollieren, über die ich aber zu niemandem sprechen durfte.
Hans von Witte war Bankier mit weitreichenden Verbindungen von Prag in die großen Hauptstädte, nach Wien natürlich, nach Paris, London, Madrid, Rom und sogar in die frisch begründeten Kolonien. Reich war er, unermesslich reich, er bewohnte das prächtigste Palais in der ganzen Stadt Prag und kam, wenn er meinen Herrn besuchte, in einer Kutsche, die von vier der edelsten Pferde gezogen wurde, die ich je gesehen habe.
„Können wir nicht wieder das Konsortium begründen, das Münzen prägen darf?“, fragte bei einer solchen Konferenz Witte den Generalissimus.
„Nein, das werden wir beim Kaiser nicht noch einmal durchsetzen. Aber warum will der Herr das Recht zur Münzprägung wieder zurückhaben?“
„Eure Fürstlichen Gnaden haben wieder zwei Millionen Gulden für das kommende Jahr angefordert. Ich kann diese Summe zwar als Kredit bei den großen Bankhäusern Europas besorgen, aber Eure Fürstlichen Gnaden mögen bedenken, dass auch mein Kredit nicht unerschöpflich ist. Und da wäre es gut, wieder Silbermünzen zu prägen.“
De Witte und Wallenstein hatten in den vergangenen Jahren das Recht zur Prägung vom Kaiser in Wien für eine gewisse Zeit erhalten. Aus einem halben Pfund Silber waren von alters her neunzehn Silbergulden geprägt worden, was seit jeher dazu geführt hatte, dass der Ausgeber der Münzen die Wertdifferenz zwischen einem halben Pfund Silber und neunzehn Gulden als Gewinn einstreichen konnte. Kaum hatten allerdings mein Herr und der Bankier de Witt das Prägerecht, verminderten sie den Silbergehalt. Aus der gleichen Menge Silber prägten sie zuerst 27 Münzen, dann 39 und schließlich 47 Gulden und steigerten damit ihren Gewinn in das Unermessliche. Gleichzeitig überschwemmten sie Böhmen und Österreich mit immer mehr Münzen, sie kauften alles Silber ein, dessen sie habhaft werden konnten. Die folgende Inflation stürzte Böhmen und Österreich in eine dramatische Hungerkrise, weil die armen Leute die Brotpreise nicht mehr bezahlen konnten.
Mit den Gewinnen finanzierte Wallenstein die Bildung seiner Armee vor und verlangte von dem Bankier die Kreditierung weiterer Mittel mit dem Versprechen, sie zurückzuzahlen, sobald er mächtig genug sei, die Kontributionen einzutreiben.
„Nein“, erwiderte Wallenstein auf die Frage de Wittes, „der Kaiser wird die Münze nicht noch einmal verpachten, nicht einmal für sehr viel Geld. Zu hoch waren unsere Gewinne und der Kaiser oder seine Räte haben das erfahren. Nein, der Herr wird Geld aus Kredit schöpfen müssen, wenn die Armee des Kaisers nicht zerfallen soll.“
„Aber, Fürstliche Gnaden, wann werde ich die Kredite zurückzahlen können?“
„Der Herr beunruhige sich nicht, wir werden in Kürze marschieren, die Kontributionen werden fließen und der Herr wird sehen, alles wird auf Heller und Pfennig zurückgezahlt werden. Der Krieg finanziert den Krieg“
Besorgt wischte sich Hans de Witte die Stirn mit einem riesigen Seidentuch, das er immer bei sich trug. Er war wie immer sehr blass, aber heute schien er von Sorgen besonders gequält zu sein. Ich verstand ihn. Dem Vernehmen nach hatte er aus dem Münzgeschäft einunddreißig Millionen Gulden erlöst, aber das war vor sechs Jahren gewesen, 1623. Inzwischen hatte er diese Summe sicher an Wallenstein als Kredit gegeben, wie viel er zurückerhalten hatte, wusste ich nicht.
Aber eines war mir klar: Je länger der Krieg dauerte, desto schwerer war es, die Maxime, er finanziere sich selbst, aufrecht zu erhalten. Nichts mehr war aus dem ausgebluteten Land herauszuholen, viele Dörfer, durch die unser Heer zog, waren zwei,- drei- oder viermal geplündert worden. Für unser Heer war da nichts mehr, was der General hätte einziehen können.
Und so blieb der Generalissimus seinem Bankier eine große Summe schuldig, eine Summe, die sich jährlich steigerte, weil mein Herr immer mehr und mehr Geld verlangte. De Witte wurde immer blasser, immer dünner, immer drängender verlangte er die Rückzahlung.
Er müsse inzwischen für neue Kredite, die die alten verlängerten, Wucherzinsen zahlen, wenn Wallenstein ihm nicht größere Summen zurückzahlte, könne er, de Witte, das nicht überleben.
Wallenstein blieb hart. Er konnte kein Geld auftreiben, den Kaiser fragte niemand, jeder wusste von dem schlechten Zustand der kaiserlichen Kasse. Aber allen unsicheren Finanzierungen zum Trotz: Noch stand das Heer des Generalissimus.
8.
„Sie sollen zum General kommen, und zwar sofort.“ Wie immer korrekt gekleidet, stand Jean, die schwach leuchtende Laterne in der Hand, neben meinem Lager in der kleinen Kammer, die uns zugewiesen war in dem Dorf, in dem wir logierten. Mitternacht musste vorbei sein, ich hatte schon fest geschlafen. Die Kerze in der Lampe beleuchtete das Gesicht des Dieners von unten und gab ihm flackernd einen unheimlichen Schein. Die gerade Nase wurde durch den Schatten verlängert, die Wangen bekamen einen hageren Eindruck, das im Licht fahle Gesicht ließ an einen Totenkopf erinnern.
„Was will er denn?“, fragte ich, indem ich mich erhob und den ersten Schrecken überwand.
„Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, er ist mit Seni in der Astronomenkammer. Sie haben den ganzen Abend die Sterne betrachtet und nun hat er mich gerufen und verlangt, ich solle Sie bringen.“
Schnell kleidete ich mich in meine bescheidene schwarze Schreiberkluft und folgte dem Diener durch die nur schwach erleuchteten Gänge nach oben, wo unmittelbar unter dem Dach das von dem Gesinde „Astronomenkammer“ genannte Giebelzimmer lag, in dem Wallenstein mit seinem Astronomen und Leibarzt Seni seine Studien betrieb, wie man sich erzählte.
Kurz klopfte Jean an die Tür und öffnete sie nach einem herrisch gerufenen „Herein“, um mich in die Kammer zu schicken. Hinter mir schloss sich die Tür.
Das Zimmer war nur schwach erleuchtet, von zwei einfachen Kerzen, die an den gegenüberliegenden Wänden hingen, wie ich bei einem schnellen Rundblick bemerkte. Mitten im Zimmer stand ein Tisch mit einer schwarzen Decke, darauf stand eine einfache Karaffe, gefüllt mit einer durchsichtigen Flüssigkeit, und drei Gläsern. Mir gegenüber erkannte ich meinen General, neben ihm den schon damals berüchtigten und leise gefürchteten italienischen Leibarzt und Astronomen, Giovanni Battista Seni.