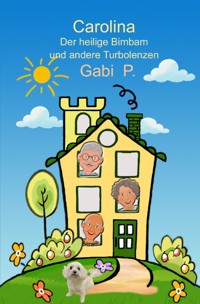Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Als Gabi dreieinhalb Jahre alt war, beschloss ihre Mutter die kleine beschauliche Heimatstadt zu verlassen, um in die Großstadt zu ziehen. Ohne ihre kleine Tochter. Für die kleine Gabi hatte sie vorgesehen, dass sie bei ihrer Oma und ihrem Opa bleiben sollte. - Schließlich war es ja auch viel einfacher, sich einen Mann zu angeln, wenn man keinen kleinen Sonnenschein im Schlepptau hatte. Natürlich versprach Gabis Mutter hoch und heilig, an den Wochenenden nach Hause zu kommen, um ihren Mutterpflichten liebevoll nachzukommen. – Aber wie das mit Versprechen manchmal so ist, werden sie oft nicht eingehalten. Und Gabis Mutter war eine Meisterin der Ausreden, Absagen und gebrochener Versprechen. Und das musste Gabi schon als ganz kleines Mädchen lernen …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 388
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über die Autorin
Gabi P. wurde 1958 in einer kleinen Stadt im Sauerland geboren. In den ersten Jahren ihrer Kindheit wuchs sie liebevoll behütet bei ihren Großeltern auf, bis sie durch den Egoismus und die Eitelkeit ihrer Mutter getrieben aus ihrer vertrauten Umgebung, ihrer Heimat und dem sozialen Umfeld herausgerissen wurde. Von einer Stadt in die andere, von einer Schule in die nächste verlief ihr junges Leben in höchst unruhigen Bahnen. Immer wieder fand sie jedoch Rückhalt im Hause ihrer Großeltern. Bei ihnen schaffte sie es schließlich, ihre innere Ruhe zu finden und zu einer fröhlichen jungen Frau heranzuwachsen.
Gabi P.
Mutti, warum hast du michnicht lieb?
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter dnb.dnb.de abrufbar.
Impressum
3. Auflage
©2025 Gabi P.
Herstellung und Verlag
epubli – ein Service der Neopubli GmbH, Berlin
Dieses Buch widme ich denbeiden liebsten und wichtigsten Menschen in meinem Leben:
Alfred & Hedwig Pape
Danke dass es Euch gab!
Vorwort
Als mein Zorn am größten war und meine Wunden am tiefsten, sagte einmal jemand zu mir: „Setz dich doch einfach mal hin und schreib alles auf. Das wird dir helfen, klarer zu sehen und mit allem besser fertig zu werden.“ Und nach einigem Nachdenken stand meine Entscheidung fest: ich schreibe alles auf. Von Anfang an. ALLES. Ich schreibe es aber nicht einfach nur auf. Ich schreibe ein Buch darüber. Und hier sind wir nun!
Und eines gleich vorweg: dies hier ist kein nettes Mutter / Tochterbuch. Es ist einfach nur eine Geschichte. Meine Geschichte.
Vor allem aber möchte ich mit diesem Buch DANKE sagen an meine Oma und meinen Opa, die mich ohne Wenn und Aber bei sich aufnahmen und mich mit unendlicher Liebe, Geduld und Fürsorge groß gezogen haben. Ihnen verdanke ich, dass ich heute der Mensch bin, der ich bin.
Alles begann in einer kalten und nebligen Novembernacht des Jahres 1958.
Ich war, so erzählte meine Oma mir später, ein ganz normaler kleiner Schreihals, als ich das Licht der Welt erblickte. – Höchstens etwas schwerer, als manch andere Babys, denn Mutti hatte während ihrer Schwangerschaft tüchtig für 2 gegessen und das Resultat war eben ich: ein kräftiger, süßer Wonneproppen.
Sie entschuldigte meinen Babyspeck und ihre Frühlingsrollen später immer mit den vorwurfsvollen Worten: „Ja ich musste doch so viel essen, weil du ständig Hunger hattest.“ Aha! – Diese warmen, liebevollen Worte möchte ich an dieser Stelle jedoch lieber nicht weiter kommentieren, denn ich war ja in Mutters Bauch und daher noch völlig wehrlos.
Aber Mutti verstand es von Anfang an, ihre eigenen Fehler geschickt zu verstecken, die von anderen aber vollmundig hervorzuheben. Das erwärmte so manches Herz eines (meist männlichen) Gesprächspartners zu ihren Gunsten. Eine Eigenschaft, die mir später leider noch oft begegnen sollte ...
Und dann war ich also da, und in der ersten Zeit sehr beschäftigt mit Essen, Schlafen, die Windeln vollmachen. Und natürlich mit der wichtigsten Aufgabe aller Babys: wonnig alle Herzen im Sturm zu erobern. Ja, es war eine Zeit, in der meine winzig kleine Welt in Ordnung war. Oder zumindest fast.
Denn eine Kleinigkeit unterschied unsere Familie von Anfang an von vielen anderen Familien in der damaligen Zeit:
Mutti und meine Winzigkeit lebten im Haushalt meiner Großeltern. Ohne meinen Vater. Denn dieses Vater-Ding war in meinem Falle etwas kompliziert und sorgte in unserer Familie noch für so mancherlei Wirbel ...
In der heutigen Zeit wäre so etwas kaum mehr ein Problem, damals jedoch, Ende der 50er und auch in den 60er und 70er Jahren war das bei der noch recht zugeknöpften Gesellschaft ein absolutes NO-GO!
Ja, es war sicher nicht einfach für Mutti, in dieser Zeit mit einer stets größer werdenden Kugel vor dem Bauch herumzulaufen. Es wurde hinter ihrem Rücken getuschelt und es gab schon die ein oder andere spitze Bemerkung hinsichtlich ihrer nach vorne wachsenden Größe. Und sowas ist zugegebenermaßen nie schön. Die Menschen waren damals oft prüde und erzkonservativ und eine junge schwangere Frau, unverheiratet, ohne den dazu gehörigen Vater, war schon ein richtiger Skandal.
Soweit verstehe ich das alles. Wofür ich kein Verständnis habe, ist die Tatsache, dass sie mich bei meinen Großeltern zurückließ und ihnen die komplette Verantwortung für mich überließ in Kombination mit den Auswirkungen des Skandals, dass ihre Tochter unverheiratet schwanger geworden war. Aber so war Mutti halt ...
Dazu kommen wir später auch noch etwas ausführlicher, denn dieser Umstand sollte für mich in meiner frühen Kindheit, wie gesagt, noch für eine Menge Unruhe und sogar Ärger sorgen.
Aber der Reihe nach: Wo war ich vorhin gleich stehen geblieben? Ach ja: Bei mir, dem süßen kleinen Sonnenschein.
Meine Anwesenheit erfreute ganz besonders meine Großeltern von Anfang an. Meine Mutter erfreute ich eher weniger. Sie hatte mich nun „am Hals“ wie sie das später oftmals solo liebevoll bezeichnete, da dies ihre nähere und fernere Zukunft empfindlich beeinflussen und sogar stören sollte.
Ihr wäre es sehr viel lieber gewesen, wenn ihre Versuche, das heranwachsende Wunder des Lebens wieder loszuwerden von Erfolg gekrönt gewesen wären (was sie später natürlich vehement bestritt). Autsch!! Das war jetzt gar nicht nett und töchterlich von mir, aber die Wahrheit war und ist nun mal nicht immer „nett“.
Mutti wollte das kleine Wunder des Lebens gar nicht haben. Sie wollte es loswerden. Es war ihr lästig. Dass das von Anfang an klar ist!
Sie fragen sich, woher ich das alles weiß? Ich sag’s mal so: Aus zum Teil nicht zu nennenden, aber absolut zuverlässigen Quellen. Sie verstehen schon: Recherche ist eben einfach alles. - Und vieles erfuhr ich natürlich von Oma und Opa.
Selbstverständlich sah „Mutti“ das alles stets ganz anders, wie sich sicher jeder vorstellen kann. Nach ihrer Auffassung hatte ich ja sowieso keine Ahnung was SIE wegen mir alles so hat durchmachen müssen damals ... SIE!! Man beachte die Einzahl in der SIE spricht, was dem ein- oder anderen Leser im weiteren Verlauf dieser Geschichte noch öfter auffallen wird. Sie hätte sich mir ja mitteilen können, so von Mutter zu Tochter, mir ihr Vertrauen schenken oder so ... aber nein ...
Natürlich weiß ich das Meiste aus meinen ersten 3 bis 4 Lebensjahren - wie bereits erwähnt - aus Erzählungen, vorwiegend von meiner Oma und meinem Opa, aber auch von anderen Verwandten und Menschen aus dem näheren Umfeld.
Meine Mutter durfte ich auf diese Thematik niemals ansprechen. Mein ganzes Leben lang nicht. Ich weiß nicht wie oft ich es in späteren Jahren wieder und wieder versucht habe ... Sie rastete dann jedes Mal komplett aus und meinte dann immer wieder auf meine bohrenden Nachfragen zu meiner Kindheit: „Das ist alles schon so lange her, das weiß ich heute nicht mehr… Und hör endlich mit der ständigen Fragerei nach der Vergangenheit auf! Dir ging es doch gut. Du hast immer alles gekriegt was du wolltest!“
Eine, wie ich bald lernen sollte, sehr gängige Standardantwort von ihr, um sich vor der Verantwortung einer ehrlichen Aussprache zu drücken und um mich abzuwimmeln. Ich wollte allerdings nicht nur einfach eine Aussprache für mich. Nein, ich wollte auch verstehen, wie es ihr damals ergangen war. Ich war schließlich ebenso betroffen wie sie.
Nun ja ... wie dem auch sei, Ehrlichkeit war ohnehin nie die Stärke meiner Mutter, jedenfalls nicht die Form von Ehrlichkeit wie man sie üblicherweise so kennt. Das sollte mir in späteren Jahren noch sehr oft zu schaffen machen.
Ehrlichkeit gab es in ihrem Wörterbuch nämlich nur sehr eingeschränkt. Sie log sich lieber das Leben schön und nannte das dann Ehrlichkeit. – Und beweise ihr mal einer das Gegenteil! Denn außer ihr sind alle anderen ja sowieso nur Lügner, die ihr ihre Schönheit und ihren Erfolg neiden, mmpf ... Welchen Erfolg eigentlich? Bis heute fehlen das Firmenimperium, der Fuhrpark nebst Chauffeur, die 12-Zimmer Villa und das Personal zu der prunkvollen Villa. – Erfolg, ja den hatte sie schon ... vor allem bei den Männern. Denn sie war, zugegeben, eine schöne, attraktive Frau, die es seit ihrer Teenagerzeit verstand, die Herren der Schöpfung um ihre gepflegten lackierten Finger zu wickeln. Ja, sie war hübsch. Aber etwas ganz Entscheidendes fehlte ihr: Das Herz. An dieser Stelle wohnte in ihrer Brust ein großer Eisklotz gepaart mit einer Riesenportion Egoismus!!
Bei meiner Oma war alles ganz anders. Sie war eine warmherzige und gütige Frau mit einem großen Herzen für jeden. Sie versuchte ihr ganzes Leben lang, es allen recht zu machen. Vor allem für ihre Kinder und Enkel tat sie, was sie konnte. Sie sorgte sich um jeden und wollte immer, dass es allen gut ging.
Für Oma war ich, so sagte sie mir immer wieder mit einem liebevollen Lächeln, wie ihr 8. Kind. Sie gab mir all ihre Liebe, Wärme und Geborgenheit. Sie war stets der Mittelpunkt meines Lebens, mein Fels in der Brandung, mein ruhender Pol und ich liebte sie sehr. Wann immer ich Kummer hatte, sie hörte aufmerksam zu, hatte stets ein offenes Ohr und wenn nötig, genau die richtigen tröstende Worte für mich. Sie gab mir immer das Gefühl die Welt wieder heile zu machen.
Dann war da natürlich auch noch mein Opa, den ich ebenfalls sehr liebte. Ich hatte aber auch großen Respekt vor ihm. Er war zwar manchmal etwas streng, aber oft auch sehr lustig. Und er hatte immer Zeit für mich, wenn er zu Hause war und sein Mittagsschläfchen beendet hatte, denn sein kleines Schläfchen wie er es immer nur liebevoll nannte, war ihm sein Leben lang heilig und jeder in unserer Familie wusste und respektierte das.
Und dann lebte in unserem Haushalt noch mein Onkel Horst. Er war das jüngste von Omas Kindern und er war seit frühester Kindheit blind. Aber trotz seiner Blindheit war er ein lebensfroher, lustiger Zeitgenosse, der für mich mehr ein großer Bruder als ein Onkel war. Er lachte und tobte viel mit mir und hatte immer einen lustigen Spruch auf Lager. Es gab immer Spaß mit ihm. Auch er spielte in meinem Leben eine sehr wichtige Rolle.
Jeder in unserer kleinen Siedlung kannte und mochte meinen Onkel und seine fröhliche Art. Zudem war er sehr hilfsbereit und was er trotz seiner Blindheit oft auf die Beine stellte, war bemerkenswert. Mein erster Roller, mein erstes kleines rotes Fahrrad und vieles mehr bekam ich von ihm und er freute sich jedes Mal wie ein kleines Kind, wenn ihm wieder einmal eine Überraschung gelungen war.
Oma und Opa hatten insgesamt 7 Kinder groß gezogen, die sie alle von Herzen liebten – sogar meine Mutter, die es einem mit ihrer Überheblichkeit und ihrer Besserwisserei oft nicht leicht machte, sie zu mögen.
Und meine Mutter? ... Die liebte vor allem sich selbst ... und irgendwie auch mich ... als Baby und Kleinkind zumindest. Ich war klein und niedlich wie alle Babys, mit dem so typischen Baby-Charme. Und die liebt man eben. – Vor allem liebte sie mich wahrscheinlich aber auch deshalb, weil ich ihr noch nicht widersprechen konnte. Und in dieser frühen Kinderzeit liebte auch ich meine Mutter sehr.
In den ersten 3 Lebensjahren war meine kleine Welt deshalb auch so ziemlich heil und in Ordnung. Meine Großeltern kümmerten sich tagsüber sehr liebevoll um mich, und wenn meine Mutter am Abend von der Arbeit nach Hause kam, dann kümmerte sie sich auch liebevoll um mich.
Ja und dann wäre da noch mein Vater, über den es das ein- oder andere zu sagen gäbe. - DAS ist jedoch eine ganz andere Geschichte, die ich hier natürlich nicht unerwähnt lassen möchte, denn es fragt sich sicher ohnehin schon jeder, wieso er sich nicht auch liebevoll um mich gekümmert hat, und das war so:
Vater, Mutter, Kind ...
Mutti hatte mit ‚ihm‘ wohl in der Karnevalszeit so richtig ihren Spaß gehabt. - Und im Spaß haben war sie schon immer richtig gut wie ich heute weiß. Man berücksichtige dabei bitte die Tatsache, dass wir das Jahr 1958 schrieben und da ich im November das Licht der Welt erblickte, muss es Anfang des Jahres bitter kalt gewesen sein für Schmetterlinge im Bauch ... und für die Freuden der heißen Liebe ... Also wo genau war es denn eigentlich passiert, das Wunder des Lebens? Auf der grünen Wiese? Wohl eher unwahrscheinlich bei den Temperaturen.
Die „Gehen wir zu dir oder zu mir“ Frage stellte sich natürlich ebenfalls nicht denn: Meine Großeltern hätten ihrer reizenden Tochter ganz sicher was anderes erzählt, wenn sie mal eben so ganz beiläufig mit „ihm“ nach Hause gekommen wäre und gesagt hätte: „‘Tach zusammen, das ist Heinz, und übrigens: er übernachtet heute bei mir.“ – Völlig undenkbar damals aber: Eine höchst interessante und amüsante Vorstellung, die mich irgendwie schmunzeln lässt.
Nun, da ich diese pikanten Details bis heute leider trotz eifrigster Recherchen nicht mehr klären konnte, überlasse ich diese Überlegungen mal dem Leser dieses Buches und seiner Fantasie ...
Und nach dem Spaß kam dann wohl der Ernst: Der Tag des bitteren Erwachens, an dem Mutti schockiert herausfand, dass „er“ sich ihr (angeblich) unter falschem Namen vorgestellt und bereits eine Ehefrau und 4 Kinder hatte. Oder waren es gar 5? Man vergebe mir, wenn ich DAS nicht so genau weiß, denn es wurde ja um alles, was meinen Vater betraf damals ein Riesengeheimnis mit viel Tam-Tam gemacht.
Als Mutti dann einige Zeit später entsetzt feststellte, dass sie schwanger war, versuchte sie, so erfuhr ich später, mit heißen Bädern und anderen haushaltsüblichen Mitteln alles, um die Schwangerschaft abzubrechen. Denn ein Kind passte weder in die prüde Zeit der 50er Jahre und schon überhaupt nicht in Mutters fantasievolle bunte Pläne von Wohlstand, Glanz, Klunkern und Reichtum. Und dann der Skandal ... Das wäre ein hässlicher Fleck auf ihrem Heiligenschein! Unvorstellbar in jeder Hinsicht!! Außerdem log es sich doch viel schöner wenn man keinen kleinen Sonnenschein wie mich hatte ...
Aber, da war wohl nichts mehr zu machen, ich hielt mich tapfer und hartnäckig in Muttis Bauch.
Das Schicksal hatte zugeschlagen und offensichtlich andere Pläne mit ihr und mir, und so erblickte ich dann also in einer nebligen, kalten Novembernacht 1958 nach einer nicht sehr einfachen Geburt (weil Mutti ja zu viel gefuttert hatte, und ich zu groß geworden war) das Licht der Welt. Wie ich später erfuhr, wollte sie mich nach der Geburt zuerst überhaupt nicht sehen. Ich hätte ihr nur Stress und Schmerzen bereitet, ihren Körper kaputt gemacht und deshalb lehnte sie das kleine süße Wunder des Lebens zuerst mal ab. Aber nach viel gutem Zuspruch von Ärzten, Schwestern und meinen Großeltern nahm sie mich dann doch endlich gnädig in die Arme.
Soweit also der Teil der Geschichte und der Legende über meine Entstehung und Anwesenheitsberechtigung….
Weiter geht’s aber jetzt erst mal mit der Papa-Geschichte:
Es gab da diesen einen wichtigen Punkt, der zu Mutters dramatischem Ammenmärchen, das sie sich zusammen spann, nicht so recht passen wollte.
Denn trotz der ständigen Behauptungen, dass mein Vater nichts taugen würde und sogar ein „böser Mann war“, wollte er ganz offensichtlich doch sowas wie Verantwortung für mich übernehmen. Immer wieder versuchte er, wenn auch vergeblich, mit meiner Mutter in Kontakt zu treten, um mit ihr über mich zu sprechen. Er wartete auf sie an der Bushaltestelle, wenn sie von der Arbeit nach Hause kam und er klingelte auch oftmals an der Wohnungstür meiner Großeltern, um mit ihnen zu reden - und auch um mich zu besuchen. Aber meine Mutter duldete das alles nicht, hetzte zuerst ihre Brüder auf ihn, die ihm mit eiserner Faust klarmachten, dass er sich von meiner Mutter und mir fernzuhalten hätte. Und dann erwirkte sie sogar eine Verfügung, die ihm verbot, sich ihr und vor allem mir zu nähern. Und somit nahm sie ihm und mir von Anfang an die Chance, jemals so etwas wie eine Vater-Tochter Beziehung aufzubauen, was mir bis heute die Zornesfalten ins Gesicht treibt.
Ist jemand, der trotz all dem versucht, mich zu besuchen wirklich böse? Ich bezweifele das bis heute.
Dieser Teil der „Papa-Legende“ wollte jedenfalls so gar nicht zu der Geschichte passen, die Muttern mir und dem Rest der Welt auch in späteren Jahren immer wieder versuchte aufzutischen.
Ok ... machen wir an dieser Stelle erst mal Schluss mit wilden Spekulationen und Erklärungsversuchen, überspringen die ersten 3 Jahre meines jungen Lebens und starten den weiteren Verlauf im Sommer meines 4. Lebensjahres, in dem meine kleine heile Welt ganz allmählich anfing zu bröckeln, ja, sich sogar entscheidend zu verändern. Denn das war die Zeit, in der meine Mutter beschloss, aus unserer wunderschönen kleinen Heimatstadt wegzuziehen, um sich in einer weit entfernten Großstadt eine Arbeit zu suchen.
Oder wie ich es bis heute liebevoll nenne: Um sich in der großen weiten Welt einen reichen Mann zu angeln, der ihr 24 Stunden huldigte, sie mit teurem Schmuck behängte und aus ihr „eine feine Dame von Welt“ machen sollte, denn für sie war das schon immer das Wichtigste gewesen. Ich würde sie dabei nur stören, denn wer nimmt schon eine Frau mit einem kleinen Kind? So sagte sie jedenfalls später immer wieder, wenn es darum ging einen neuen Fisch an Land zu ziehen.
Sie erklärte also meinen Großeltern eines schönen Tages kurz und knapp, dass es in unserer beschaulichen Heimatstadt leider keine passende Arbeit mehr für sie gäbe und sie deshalb ganz dringend in die weit entfernte Großstadt ziehen müsse, denn nur dort und nirgendwo anders könne sie was Passendes finden. – Und da fing es an: Sie begann sich das Leben schön zu lügen, Teil 1.
Nun könnte man eigentlich denken: Gut, sie will sich ein eigenes Leben in einer anderen Stadt mit ihrer kleinen Tochter aufbauen, für sie sorgen. So wie sich das gehört. Das ist doch sehr schön und völlig in Ordnung so. Oder? – Eine reizende aber völlig unzutreffende Traumvorstellung, wenn man meine Mutter kennt. Denn in der farbenfrohen Fantasiewelt meiner Frau Mama gab es bei all ihren schillernden Plänen nämlich einen ganz großen Störfaktor: MICH!!
Und deshalb sollte ich, so hatte es Mutti tatsächlich ganz allein beschlossen, bei meinen Großeltern bleiben, während sie die weite (und vor allem männliche) Welt entdeckte. Sie erklärte meinen Großeltern, sie müsse ja schließlich schwer und lange arbeiten und da hätte sie überhaupt keine Zeit, sich auch noch um ein kleines Kind zu kümmern. Und deshalb sei ich bei Oma und Opa viel besser aufgehoben! Vielleicht sollte ich noch eben kurz erwähnen, dass sie später in der großen Stadt in einem Café als Serviererin arbeitete ... eine schwere Arbeit die man selbstverständlich in unserer beschaulichen Heimatstadt nicht ausüben konnte ...
Heute kann ich nur sagen: Gott sei Dank gab es meine Großeltern, die nach Muttis damaliger Auffassung eben gut dafür geeignet waren, sich um mich zu kümmern, während sie in der weiten Welt die große Dame mimte.
Immerhin versprach sie meinen Großeltern hoch und heilig, sie wollte jedes Wochenende nach Hause kommen um mich zu besuchen ... und um dann natürlich höchstpersönlich und äußerst liebevoll ihren Mutterpflichten nachzukommen. - Und sie wollte außerdem auch jeden Monat das nötige Geld für meinen Unterhalt schicken.
Meine Großeltern fanden das alles natürlich zuerst überhaupt nicht so toll und es gab eine Menge hitziger Diskussionen, denn schließlich gehört eine Mutter zu ihrem Kind und nicht irgendwo in die Weltgeschichte. Aber davon wollte Mutti nichts wissen, denn wenn sie sich mal was in den Kopf gesetzt hatte, dann machte sie das auch, ohne auf irgendjemanden Rücksicht zu nehmen ... und schon gar nicht auf meine Großeltern oder auf mich.
Aber ich hatte ja richtig großes Glück: Sowohl meine Oma als auch mein Opa hatten mich längst in ihr Herz geschlossen und erklärten sich letztendlich gerne dazu bereit, sich um mich zu kümmern. „Wir haben 7 Kinder groß gezogen, da kriegen wir auch noch ein achtes groß“, sagte meine Oma mit einem Lächeln. - Und so fing eben alles an ...
Auf kleinen Füßen die große Welt entdecken ...
Und als ich dann 3 ½ Jahre alt war, machte meine Mutter ihr Vorhaben im Sommer wahr und zog in die große Stadt. Ich blieb, wie von Mutti beschlossen, bei meiner Oma und meinem Opa zurück. – Und genau damit fingen die Probleme an: Meine kleine heile Welt stand plötzlich kopf. Ich verstand überhaupt nicht, warum meine Mutti abends nicht mehr von der Arbeit nach Hause kam. Ich wartete Tag für Tag auf ihre Rückkehr, war verzweifelt, zornig und sehr traurig. Und irgendwie suchte ich die Schuld für ihr Fernbleiben immer wieder bei mir. Was machte ich denn nur falsch? Hatte sie mich denn ganz vergessen, mich gar nicht mehr lieb? Warum nur hatte sie mich allein gelassen?
Jedes Mal wenn es in der kommenden Zeit an der Türe klingelte, rannte ich sofort hin, um zu öffnen, denn schließlich könnte es ja doch Mutti sein, die endlich nach Hause kam. Aber sie kam natürlich nicht. Ich war völlig durcheinander und weinte viel, hatte nachts oft Albträume und bekam sogar Angstzustände. Meine Oma tat, was sie konnte, um mich zu beruhigen, zu trösten und auf andere Gedanken zu bringen.
Besonders schlimm war es immer, wenn es Abend wurde. Dann kamen sie immer, die Angstzustände. Die waren plötzlich da. Ganz ohne Vorwarnung, einfach so! Meine Oma kochte mir Beruhigungstee, ging sogar mit mir zum Arzt, als sie nicht mehr weiter wusste und auch um sicher zu gehen, dass ich nicht doch ernsthaft krank war.
Und es war außer den abendlichen Angstzuständen noch etwas anderes, was meinen Großeltern Sorge bereitete: Ich hatte keinen Appetit und wollte nichts mehr essen! Der Arzt untersuchte mich, stellte fest, dass mir körperlich nichts weiter fehlte, und verschrieb mir leichte Medikamente zur Beruhigung. Und auch etwas, das meinen Appetit anregen sollte. Dann gingen wir wieder nach Hause.
Noch heute danke ich Gott dafür, dass ich Oma und Opa hatte, die mir all das gaben, was eigentlich die Aufgabe meiner Mutter gewesen wäre: Liebe, Verständnis, Geborgenheit und in dieser für mich so schwierigen Zeit viel Trost.
Essen zählte in der kommenden Zeit nicht zu meinen großen Leidenschaften. Mein Frühstück bestand lediglich aus einer Tasse Kakao einer wohlbekannten Marke in gelber Dose.
Mittags schaffte es Oma mit Mühe und Not, mir ganz wenig von den leckeren Mahlzeiten einzuflößen, die sie gekocht hatte. Sie kochte sehr gut, aber ich hatte einfach keinen Appetit. Abends dann dasselbe Spiel. So ging das Tag für Tag, Woche für Woche und Monat für Monat.
Die Zeit verging und nach einer Weile fand ich ganz allmählich zurück in den Alltag. Ich wurde wieder etwas ruhiger und begann mich schließlich mit der Tatsache abzufinden, dass meine Mutter nun nicht mehr jeden Abend zu mir nach Hause kam und weit weg war, um dort zu arbeiten. - Nur essen wollte ich noch immer nichts ... oder nur nach vielen geduldigen Bitten und viel gutem Zureden meiner Großeltern das Allernötigste.
Schließlich begann ich zusammen mit Oma und Opa die Welt um mich herum zu entdecken. - Und da gab es eine Menge schöner, interessanter Dinge, die es zu erkunden galt.
Ich liebte es vor allem, draußen zu spielen, wie wohl die meisten Kinder. Die frische Luft, die Natur, die Tiere und die vielen Kinder in unserer Siedlung waren für mich schon immer schöner und interessanter, als in der Wohnung alleine zu spielen.
Hinter dem Haus gab es eine große Wiese und einen Sandkasten, in dem ich nachmittags oft unzählige „Sandkuchen“ backte und sie meiner Oma voller Stolz präsentierte. Sie saß am Rand des Sandkastens und sah mir lächelnd zu, oder half mir tatkräftig dabei „Kuchen“ zu backen. Es war herrlich mit Oma „Kuchen“ zu backen und überhaupt draußen zu sein. Wir waren jeden Nachmittag zusammen draußen. Oma sagte immer: „Kinder brauchen frische Luft und viel Bewegung!“ Recht hatte sie.
Zu der Wohnung meiner Großeltern gehörte außerdem auch ein hübscher kleiner Garten hinter dem Haus. Meine Oma hatte dort unter anderem ein kleines Blumenbeet angelegt, das sie stets liebevoll pflegte. Wann immer sie Zeit hatte und das Wetter es zuließ, verbrachten wir gemeinsam Zeit in dem kleinen Garten. Sie jätete Unkraut und bepflanzte ihr kleines Beet immer der Jahreszeit entsprechend mit den schönsten bunten Blumen. Es sah sehr hübsch aus und die Blumen dufteten herrlich, wenn sie blühten.
Wenn sie Unkraut zupfte, die Erde harkte und immer wieder neue Blumen pflanzte, hockte ich oft neben ihr und beobachtete sie sehr aufmerksam und interessiert dabei. Ich hatte stets unzählige Fragen zu allem, was sie tat. Dann lächelte sie und erklärte mir alles ganz genau und sehr geduldig, und mit der Zeit lernte ich all die vielen wunderschönen Blumen in unserem kleinen Garten kennen.
Dann war da auch noch ein herrlicher Rasen, übersät mit unzähligen Gänseblümchen und Butterblumen im Frühjahr und Sommer. Und auf dem Rasen stand genau in der Mitte ein kleines Fliederbäumchen. Den hatten mein Opa und mein Onkel zusammen extra für Oma dahin gepflanzt. Sie liebte ihren lila Flieder sehr. Oft stand sie oben in unserer Wohnung am Fenster und betrachtete das Bäumchen. Ganz besonders erfreute sie sich jedes Jahr im Mai an den wunderschönen Blüten. Dann schnitt sie lächelnd ein paar Zweige ab und stellte sie in die Vase. Der Flieder duftete dann herrlich in unserer ganzen Wohnung.
An der einen Begrenzungsseite des Gartens hatte meine Oma außerdem einige Sträucher mit Himbeeren, Brombeeren, Stachelbeeren und roten und schwarzen Johannisbeeren gepflanzt. Ich konnte es immer kaum abwarten, bis die Beeren reif waren. Dann pflückten wir sie gemeinsam und Oma machte leckeres Kompott, Kuchen und Marmelade daraus.
Natürlich durfte ich auch Beeren von den Sträuchern pflücken, die dann, Schwupps, in meinem Mund landeten.
Es war schön, im Sommer mit Oma im Garten zu sein. Es wurde für mich eine große bunte Decke auf dem Rasen ausgebreitet, auf der ich dann in der warmen Sommersonne spielen konnte. Das war herrlich. Ich liebte die warmen Strahlen der Sonne auf der Haut und die herrliche Sommerluft, die erfüllt war vom Summen der Bienen, dem Zwitschern der vielen Vögel, die aufgeregt von Baum zu Baum flogen und dem lieblichen Duft der unzähligen Blumen, Bäume und Sträucher. Aus der Ferne hörte man oft Stimmen und auch Kinderlachen, das aus den weit geöffneten Fenstern nach draußen drang. Alles wirkte so friedlich um einen herum ... es war eine kleine heile Welt. Meine kleine heile Welt.
Ja und dann, an einem wunderschönen Tag im Sommer gab es eine Überraschung für mich: Mein Opa hatte zusammen mit meinem Onkel im Garten eine Schaukel für mich aufgestellt. Meine eigene Schaukel, nur für mich allein! Meine Augen leuchteten, ich hüpfte aufgeregt von einem Bein aufs andere und ich strahlte übers ganze Gesicht. Das war wirklich das Größte. Ich war mächtig stolz und liebte meine neue Schaukel. Ich hatte auf ihr das Gefühl fast bis in den Himmel zu fliegen… unter den manchmal sehr besorgten Blicken meiner Oma: „Schaukel nicht so hoch, sonst fliegst du raus und tust dir weh!“ Sie war immer sehr fürsorglich und besorgt um mich. Und das gab mir stets ein wunderbares Gefühl der Geborgenheit. Und natürlich versprach ich ihr stets, auf mich aufzupassen.
Ich spielte aber nicht nur im Garten, sondern auch häufig vor dem Haus auf der Straße. Das war damals noch nicht so gefährlich wie heute, denn es gab ja noch nicht so viele Autos. Und da, wo wir wohnten, fuhren fast nur Autos von Leuten aus unserer Nachbarschaft vorbei. Es gab in unserer Siedlung keinerlei Industrie. Nur ein paar kleine Geschäfte, in denen wir immer einkaufen gingen. Da waren 2 kleine Lebensmittelläden, ein Schreibwarengeschäft, ein Metzger, ein Frisör, ein Café und sogar eine kleine Kneipe. Und jeden Morgen pünktlich um halb zehn kam der Milchmann mit seinem großen Wagen und hielt gegenüber von unserem Haus. Mit einer großen lauten Glocke verkündete er seine Anwesenheit. Dann kamen alle Frauen aus den umliegenden Häusern, um frische Milch, Eier, Joghurt, Quark und vieles mehr einzukaufen. Auch Oma und ich gingen mit der Milchkanne jeden Morgen, um frische Milch, Eier und andere Dinge einzukaufen, die Oma so brauchte. Für mich war es jeden Morgen ein Highlight, wenn der Milchmann kam. Ich stand dann neben meiner Oma und beobachtete ganz genau, was dort am Milchauto so alles vor sich ging.
Natürlich hatte ich auch viele Spielkameradinnen aus den Nachbarhäusern, mit denen ich draußen gerne und oft spielte und so war ich eigentlich fast nie alleine. Da gab es die schönsten Kinderspiele, die man auf der Straße spielen konnte. Wir spielten Hüpfkästchen, Gummitwist, Fangen, Verstecken, Seilspringen, viele lustige Ballspiele und manchmal saßen wir auch einfach nur mit unseren Puppen vor der Haustüre und spielten Vater, Mutter, Kind. Das war eines meiner Lieblingsspiele.
Auf jeden Fall hatten wir damals immer viel Spaß in unserer kleinen Siedlung am Rande der Stadt und ich hatte viel Glück, dort aufwachsen zu können.
Es gab auch einen schönen großen Spielplatz, direkt gegenüber der Schule, auf dem sich fast alle Kinder der kleinen Siedlung an den Nachmittagen trafen. Auch die Muttis und manchmal auch Omas der Kinder waren häufig mit dabei ... und natürlich auch hin und wieder meine Oma, wenn sie Zeit hatte. Sie saß dann auf der Bank im Schatten eines Baumes und sah mir beim Spielen zu. Dann unterhielt sie sich mit den Nachbarinnen, die sie kannte. Und wenn sich unsere Blicke manchmal trafen, lächelte sie, winkte mir zu und rief: „Spiel schön!“ Ich winkte zurück und freute mich einfach nur darüber, dass Oma da war und mir zuschaute. Oma hatte fast immer Zeit für mich. Ein schönes Gefühl.
Natürlich war Mutti niemals mit auf dem Spielplatz, um mich auf der Schaukel an zu schubsen, mit mir im Sand zu spielen, meine Turnübungen am Klettermaxe zu bewundern, oder mit mir auf meiner Lieblingswippe zu wippen, denn sie musste ja die große weite Welt entdecken und in der fernen Großstadt sehr hart arbeiten….
Aber Oma und Opa waren ja da… die besten Großeltern der Welt!
In der ersten Zeit nach Muttis Umzug in ihre Traumstadt kam sie auch tatsächlich noch jedes Wochenende nach Hause, um ihren Mutterpflichten nachzukommen. Doch irgendwann begannen die Abstände zwischen ihren Besuchen immer größer zu werden. Zuerst kam sie noch alle 14 Tage, und schließlich dann nur noch 1 Mal im Monat. Und dann nur noch zu Ostern, zu meinem Geburtstag und zu Weihnachten und ganz selten einmal im Sommer.
Sie versprach zwar immer wieder, dass sie zwischendurch auch mal für ein Wochenende kommen wollte, aber daraus wurde meistens leider nichts. Der Leser errät sicher schon warum: Richtig ... sie musste lange und schwer arbeiten, um viel Geld zu verdienen ... und sich einen, wenn möglich, reichen Mann angeln. Abends. Wenn sie fertig war mit der harten Arbeit im Café. – Ja, sie arbeitete, wie bereits erwähnt, tagsüber als Serviererin. Das hatte mir Oma erzählt, als ich sie irgendwann mal fragte, was denn meine Mutti in der großen fremden Stadt arbeitete.
Natürlich vergaß Mutti mich nicht so ganz, denn sie schickte mir hin und wieder kleine Pakete, in denen Spielsachen, Bücher, Süßigkeiten oder was zum Anziehen war. Natürlich nur teure Markenware. Alles schicke Sachen nach der neusten Kindermode. - Wohl um ihr schlechtes Gewissen zu beruhigen, nachdem Oma sie zum x-ten Male gebeten hatte, doch mal nach Hause zu kommen, um bei ihrer kleinen Tochter zu sein. Oma erzählte ihr, wie ich mich entwickelte, wie sehr ich sie vermisse und wie oft ich nach ihr fragte. Aber nichts davon konnte sie dazu bewegen auch mal außer der Reihe nach Hause zu kommen.
Ich hätte tatsächlich statt all der schönen Sachen viel lieber meine Mutti bei mir gehabt, aber davon wollte sie niemals was hören. Sie hatte immer neue Entschuldigungen dafür, nicht nach Hause kommen zu können. So ein hübsches Paket mit kleinen Überraschungen darin tut es doch schließlich auch. Oder nicht?
Selbstverständlich war da auch immer eine Karte oder ein kurzer Brief in den Päckchen, den mir Oma dann natürlich vorlas. Ich freute mich zunächst über diese kleinen Zwischengaben und ein Lebenszeichen von meiner Mutter. ‚Sie hat mich doch noch nicht ganz vergessen‘ dachte ich dann und freute mich. - Allerdings freute ich mich weniger über die „lieben“ bedauernden Worte, die sie mir dann immer am Schluss in diesen kurzen Karten und Briefen schrieb.
Ja so war das immer: Mit dem Eintreffen dieser Schlechtes-Gewissen-Gaben war leider auch ein sehr großes ABER verbunden. Es bedeutete, dass sie wieder einmal einen fest versprochenen Besuch absagte ... natürlich aus wichtigem Grund. – Nur milderte das meine Enttäuschung, Wut und Traurigkeit in keiner Weise. Dann liefen wieder die Tränen und Oma und Opa wischten sie fort und trösteten, so gut sie konnten.
Und all die schönen neuen Sachen, die sie mir schickte, blieben daher meistens kaum beachtet irgendwo in der Ecke liegen. Ich wollte sie gar nicht haben ... Ich wollte meine Mutti! Aber das interessierte sie schon damals nicht. Sie erwartete für ihre Geschenke mein Verständnis, meine Dankbarkeit und das fiel mir damals sehr schwer.
Und wieder einmal halfen mir meine Großeltern über meine Enttäuschung und Wut hinweg. Die hübschen neuen Sachen, die meine Mutter mir schickte, und die ich rundweg ablehnte, landeten meistens in Paketen, die meine Oma in die DDR schickte, wo einige ihrer Kinder mit ihren Familien lebten. Und deren Kinder freuten sich über die hübschen Sachen.
Wenn meine Mutter mich aber dann wirklich mal besuchte, kam sie freitags am Mittag an und fuhr sonntags am Nachmittag wieder weg.
Für mich war das jedes Mal gefühlsmäßig eine Achterbahnfahrt. An den Freitagen, an denen sie ankam, war ich oben, an den Sonntagen, wenn sie nachmittags wieder wegfuhr, war ich ganz unten.
Ich war an den Tagen, an denen sie kam, morgens schon nach dem Aufstehen so aufgeregt, dass ich kaum frühstücken konnte und auch sonst kaum zu bändigen war.
Und auch als ich etwas größer war und schon zur Schule ging, konnte ich mich an diesen Tagen nur schwer auf den Unterricht konzentrieren. Ich malte mir dann aus, wie sie nach der Schule draußen auf mich wartete um mich zu überraschen und mich abzuholen, und ich dann stolz jedem zeigen konnte, was für eine hübsche Mutti ich hatte, und dass sie sich doch um mich kümmerte. – Leider erfüllte sich dieser Wunsch nie.
Nach der Schule wartete ich dann voller Spannung vor dem Haus darauf, dass das Taxi, in dem meine Mutter saß, endlich die Straße herauf gefahren kam. Mit mir zusammen wartete fast immer Opa unten auf der Straße, machte einige seiner Späße, die ich so liebte und er brachte mich zum Lachen, um mich ein wenig abzulenken, denn meine Aufregung und Spannung bis Mutti kam, waren sehr groß.
War sie dann endlich da, war meine Freude grenzenlos und ich wollte den ganzen Tag nicht mehr von ihrer Seite weichen. Zuerst funktionierte das auch gut: Ich war ja klein und niedlich. Sie spielte mit mir, wir gingen zusammen mit meiner Oma spazieren oder fuhren mit dem Bus in die Stadt zum Einkaufen und Eis essen. Das waren richtig schöne Tage. Für eine kleine Weile war meine Welt wieder in Ordnung, und ich war glücklich. Mutti war da und das war das Allerwichtigste!
So hätte es weiter gehen können, doch leider blieb es nicht so…
Denn dann kamen die Sonntage, an denen es immer wieder hieß, Abschied zu nehmen, weil meine Mutter zurück in die Großstadt fuhr.
Und wenn es dann Zeit für sie war, sie Schuhe und Mantel anzog, wusste ich, gleich ist sie wieder weg und ich fing an zu weinen, klammerte mich an sie, so fest ich nur konnte, bettelte und schluchzte: „Bitte nimm mich doch mit Mutti, bitte nimm mich mit!“ Aber sie schüttelte nur den Kopf, seufzte und sagte: „Das geht nicht. Mutti muss doch arbeiten! Da habe ich gar keine Zeit, mich um dich zu kümmern, Kind. Ich komme doch bald wieder. Nun sei ein großes Mädchen, sei tapfer und hör auf so zu weinen. Weinen macht hässlich und du bekommst eine ganz schrumpelige Haut! Du möchtest doch später mal so hübsch werden wie die Mutti ... dann musst du auch aufhören zu weinen!“
Dann klingelte es an der Wohnungstür, das Taxi war da. Ich klammerte mich noch fester an meine Mutti, weinte bittere Tränen und sagte voller Verzweiflung: „Bitte nimm mich mit. Bitte! Ich bin doch auch ganz lieb!“ Aber sie schob mich nur ungeduldig von sich weg und sagte ziemlich ungehalten zu meiner Oma: „Jetzt halt doch mal das Kind fest, ich muss gehen, das Taxi wartet und die Uhr läuft!“
Dann drehte sie sich um, winkte mir zum Abschied noch einmal kurz zu, die Tür schloss sich hinter ihr, und weg war sie. Ich blieb zurück, sah auf die geschlossene Tür. Es tat so weh, dass sie mich wieder einmal nicht mitgenommen hatte. In diesen Momenten brach für mich jedes Mal aufs Neue meine kleine Welt zusammen, und mein Herz schien in eine Million Teile zu zerspringen. Ich verstand das einfach nicht, fühlte mich irgendwie schuldig. Wieso wollte sie mich denn bloß nicht bei sich haben? Ich saß da und weinte bitterlich, war kaum zu beruhigen. Immer wieder starrte ich auf die geschlossene Tür. „Mutti ... Mutti!!“
Überall in der Wohnung roch es noch nach ihrem Parfüm und nach ihrem Haarspray ... es roch nach Mutti. Ich umklammerte das Kissen auf dem Sofa, an das sie sich noch am Vormittag angelehnt hatte und das auch noch immer nach ihrem Parfüm roch. Tief atmete ich den Geruch des Kissens ein und hatte ein klein wenig das Gefühl, dass sie irgendwie noch da war.
Ich fühlte mich so verlassen. Sie war gegangen. Wieder einmal. Und wieder einmal ohne mich. Warum hatte sie denn nur keinen Platz und keine Zeit für mich in ihrem neuen Leben in der großen Stadt ... ‚Warum hast du mich nicht lieb Mutti?‘ dachte ich voller Schmerz und Verzweiflung. Eine Frage, die ich mir noch sehr oft stellen sollte in meinem Leben ... und die nie eine Antwort finden würde.
Meine Oma brauchte nach den Kurzbesuchen meiner Mutter immer lange, um mich einigermaßen zu beruhigen. Und so ging das jedes Mal, wenn meine Mutter „zu Besuch“ war. Himmel und Hölle. Berg und Talfahrt. Und jedes Mal zerbrach mein kleines Herz aufs Neue.
Die Tage nach ihrer Abreise vergingen sehr langsam. Aber dann gewann ich, wie jedes Mal, mein Gleichgewicht ganz allmählich wieder zurück. Das Leben ging weiter, dank meiner liebevollen Großeltern. (Gott segne alle Großeltern!) Sie schafften es immer wieder, meine kleine Welt zu reparieren, sie gerade zu rücken und heile zu machen ...
Aber Gott sei Dank gibt es ja die Zeit und mit jedem neuen Tag ging es mir dann wieder besser.
Ich war ein Kind, das kaum drinnen zu halten war. Ich wollte immer draußen sein, denn es gab stets was Spannendes zu entdecken in der Natur.
Wenn es nicht regnete, ging ich schon nach dem Frühstück raus auf die Straße zum Spielen und kam erst wieder zum Mittagessen nach Hause.
Und wenn dann um 6 Uhr am Abend die Kirchenglocke unserer kleinen Gemeinde läutete, war das für mich das Zeichen zum Abendessen nach Hause zu gehen, denn eines hatte Oma mir schon sehr früh beigebracht: „Wenn um 12:00 Uhr die Glocken läuten kommst du nach Hause zum Mittagessen und wenn du am Abend um sechs die Glocken läuten hörst kommst du zum Abendessen.“ - Das Leben in unserer kleinen Gemeinde am Rande unserer Heimatstadt war schön, gut und voller Regelmäßigkeit für mich ... eigentlich. Alles dort fühlte sich so richtig an.
Allerdings gab es da in meiner kleinen heilen Welt aber auch einige Ausnahmen, die mir das Leben so manches Mal ziemlich schwer machten und mit denen ich mich damals immer wieder auseinandersetzen musste. Dinge, von denen „Mutti“ nichts wusste und auch später nichts wissen wollte. Und die meine Großeltern ihr auch oftmals verschwiegen, weil sie die endlosen Diskussionen, Vorwürfe und Rechtfertigungen von ihr einfach nicht mehr hören wollten.
Außerdem: Sie konnte ohnehin in solchen Situationen nicht helfen, denn sie war ja weit weg und beschäftigt damit, den Herren der Schöpfung schöne Augen zu machen und den Kopf zu verdrehen. Entscheidungen für mich mussten stets allein meine Großeltern treffen. Und eigentlich war das auch ganz gut so.
Als ich mich meiner Mutter später, als ich schon fast erwachsen war, versuchte anzuvertrauen, ihr mein Herz ausschütten wollte, fiel sie mir stets ins Wort, lachte mich aus und meinte nur vorwurfsvoll und voller Verachtung: „Das hast du dir doch alles nur eingebildet oder ausgedacht. Du hattest schon immer viel zu viel Fantasie! Du warst damals noch viel zu klein. Außerdem ist das alles schon so lange her, das kannst du ja heute gar nicht mehr wissen! Was glaubst du wohl was ich alles mitmachen musste damals, wie schlecht es mir gegangen ist und wie schwer ich es hatte! Du bist ein richtig undankbares Kind!“ Und mit einer wegwischenden Handbewegung machte sie mir unmissverständlich klar, dass es für sie keine weitere Diskussion darüber gab. – Tja, so war und so ist halt „Mutti.“ Immer so einfühlsam, liebevoll und fürsorglich ... und so voller Verständnis!
Leider war das alles, was ich erlebte, jedoch keineswegs Einbildung, und auch nicht meine Fantasie. Da irrte sie sich gewaltig ... Aber das interessierte sie nicht. Nie und zu keiner Zeit.
Wir hatten ja damals, wie bereits erwähnt, die frühen 60er. Diese Zeit war bekanntlich sehr konservativ und die meisten Menschen waren sehr zugeknöpft. Zudem war unsere Gemeinde ziemlich klein und Jeder kannte Jeden. Und selbstverständlich kannte auch fast jeder meine Großeltern und meine Wenigkeit.
Für mich wirkte sich das in verschiedenster Weise aus, und das nicht immer nur im Guten. Viele Nachbarn waren stets freundlich zu mir, andere wiederum betrachteten mich mit Verachtung oder manche sogar mit richtigem Hass ... wieder andere betrachteten mich mitleidig.
So kam es oftmals vor, dass auch Kinder erst gar nicht mit mir spielen durften, weil ich ein uneheliches Kind war und einige Eltern wohl befürchteten, dass ich einen schlechten Einfluss auf ihre Kinder haben könnte. Ich spürte häufig die Reserviertheit und Kälte der Menschen mir gegenüber. Sie waren zwar nicht direkt unfreundlich, wimmelten mich aber stets ab, wenn ich an ihre Türen klingelte und fragte, ob ich mit ihren Töchtern spielen dürfe. – Ich verstand damals noch nicht, warum sie sich so verhielten. Ich spürte nur, dass es sich sehr unangenehm in meinem Bauch anfühlte, weh tat und es mir als sehr ungerecht erschien. Ich versuchte in solchen Fällen immer, Omas Rat zu beherzigen, und ging diesen Leuten so gut ich konnte aus dem Weg.
Aber das alles war noch das Harmloseste von allem. Denn da gab es einige ältere Kinder in unserer Siedlung die mich, wann immer sich die Gelegenheit bot, beschimpften indem sie sich vor mir aufbauten, lachten, mit dem Finger auf mich zeigten und mich ‚einen Bastard‘ nannten. Ich hatte keine Ahnung, was sie damit meinten, denn ich kannte dieses Wort nicht. Aber ich fühlte, dass es was Schlimmes sein musste. Vor allem aber tat es mir weh und ich spürte ihren Hass.
Als wir dann eines Tages alle zusammen am Tisch beim Abendessen saßen, fragte ich meine Oma ganz frei heraus: „Oma, was ist eigentlich ein Bastard?“ Und plötzlich war es mäuschenstill am Tisch. Alle sahen mich erschrocken an. Auch Oma und sogar Opa hatte sein Besteck auf die Seite gelegt. Dann wollte Oma wissen, wer denn sowas zu mir gesagt hatte. „Die dicke Babsi von nebenan sagt das andauernd zu mir. Und dann lacht sie immer so hässlich dabei!“, sagte ich bedrückt und traurig zu meiner Oma. „So etwas sagt man nicht, das ist ein ganz schlimmes Wort und wenn du etwas älter bist wird deine Mutti dir erklären, was damit gemeint ist. Sag Babsi, wenn sie noch mal sowas zu dir sagt, kriegt sie Ärger. Versuche ihr am besten aus dem Weg zu gehen. Opa wird aber trotzdem nachher mal mit ihrer Mutti darüber reden, damit das aufhört!“ Mein blinder Onkel, der ebenfalls mit am Tisch saß, meinte: „Lass mich das mal regeln ich gehe sowieso gleich zu Lehmans, da kann ich gleich mal bei Babsis Eltern klingeln und mit ihnen reden, denn so geht das nicht.“ Oma und Opa nickten zustimmend.
Babsi war ein ganz besonders gehässiges älteres Mädchen aus der Nachbarschaft. Ich mochte sie nicht. Sie beschimpfte mich oft, indem sie sich vor mich hinstellte und höhnisch sagte: „Du hast ja noch nicht mal einen richtigen Vater.“ Dann lachte sie, schubste mich und trat nach meinen Spielsachen, mit denen ich draußen spielte.
Babsi war größer, kräftiger und älter als ich, und sie ließ keine Gelegenheit aus, mich zu ärgern und einzuschüchtern. Ich versuchte, ihr meistens aus dem Weg zu gehen, was nicht immer so einfach war, denn sie wohnte mit ihrer Familie im Nachbarhaus. Und ich hatte auch manchmal ein kleines bisschen Angst vor ihr. Aber das ließ ich mir natürlich nie anmerken.
Babsi hatte noch eine jüngere Schwester, die Bille hieß und die war ganz anders als ihre ältere Schwester. Sie war jünger als ich, etwas kleiner und hatte ihre Haare immer zu lustigen blonden Rattenschwänzen gebunden. Sie war stets fröhlich und freundlich. Wir waren das, was man damals Freundinnen nannte. Wir mochten dieselben Dinge und spielten draußen häufig zusammen, was sich schon deshalb anbot, weil wir ja Tür an Tür wohnten.
Fast täglich verbrachten wir Zeit zusammen. Aber auch ihre Mutter war mir gegenüber oft sehr reserviert. Manches Mal wenn, ich bei ihnen klingelte, um nach Bille zu fragen, wimmelte sie mich ab und meinte, dass Bille jetzt keine Zeit hätte, um mit mir zu spielen. Wenn sowas passierte, machte mich das nicht nur sehr traurig, sondern auch richtig wütend. Was hatten denn die Leute nur alle gegen mich, ich hatte ihnen doch überhaupt nichts getan!
Papa ...
Eine sehr wichtige Sache, auf die ich noch mal zurückkommen möchte, ist mein Vater.
Er wohnte nämlich ebenfalls mit seiner Familie in unserer Siedlung, nur eine Querstraße von uns entfernt.
Allerdings wusste ich ja damals noch nicht, dass er mein Papa war, denn meine Mutter hatte der gesamten Familie streng verboten, mir zu sagen wer mein Vater war und dass er mit seiner Familie in direkter Nachbarschaft wohnte. Und das sollte noch für so manchen unschönen Zwischenfall sorgen.
Ja, Mutti war schon damals immer sehr gründlich, wenn es darum ging Spuren zu verwischen oder Menschen schlecht zu reden oder zu manipulieren. Wie sich das auf Andere auswirkte, ganz besonders auf mich, das interessierte sie nicht im Mindesten. Wichtig für sie war nur, wie sich das auf sie auswirken könnte, und wie und was die Leute über SIE reden würden. Nach außen hin sagte sie: „Es ist nur zu ihrem Besten!“ Damit meinte sie mich.
Anfangs spielten da meine Großeltern jedoch nicht mit, denn beide waren sehr gerechte Menschen und fanden es grundverkehrt, mir den Umgang mit meinem Vater vollständig zu verbieten. Für sie war der Kontakt zwischen Vater und Tochter viel wichtiger als das Gerede fremder Menschen. Sie fanden nichts dabei, wenn er mich dann und wann besuchte und ein wenig Zeit mit mir verbrachte.