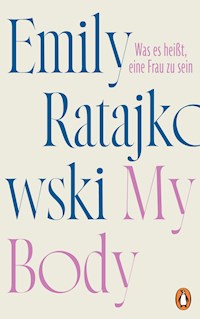
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Der New York Times-Bestseller jetzt auf Deutsch
»Eine kluge und glänzende Essaysammlung« (The Guardian)
In My Body, ihrem ersten, begeistert aufgenommenen Buch, offenbart Emily Ratajkowski, was es bedeutet, als Frau erfolgreich zu sein und sich in einer vom »männlichen Blick« geprägten Welt zu beweisen. In ihren ebenso klugen wie schonungslosen Texten hinterfragt Ratajkowski die Kultur der Fetischisierung von Mädchen und weiblicher Schönheit und kritisiert die Misogynie und Machtdynamiken innerhalb der heutigen Unterhaltungsindustrie. Dabei macht sie deutlich, wie schmal der Grat zwischen Stolz und Scham, zwischen Kontrolle und Ohnmacht, zwischen Einvernehmlichkeit und Missbrauch oft ist. Und vor allem zeigt sie, dass sie mehr ist, als nur ein Körper: Ratajkowski ist ehrlich, verletzlich und wütend und macht sich mit My Body zur Verbündeten aller Frauen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 288
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Der New York Times-Bestseller jetzt auch auf Deutsch
My Body ist Emily Ratajkowskis zutiefst persönliche Betrachtung von Feminismus, Sexualität, Macht, der Behandlung von Frauen durch Männer und der Erklärungen und Rechtfertigungen von Frauen, diese Behandlung zu akzeptieren. Ratajkowskis Essays zeichnen Momente aus ihrem Leben nach und untersuchen die Kultur der Fetischisierung von Mädchen und weiblicher Schönheit, ihre Besessenheit mit weiblicher Sexualität und zugleich die Verachtung dieser, die perversen Dynamiken innerhalb der heutigen Mode- und Unterhaltungsindustrie sowie die Grauzone zwischen Einvernehmlichkeit und sexuellem Missbrauch. Nuanciert, unerschütterlich und prägnant – My Body ist nicht nur Emily Ratajkowskis schriftstellerisches Debüt, sondern ein Statement, das geradezu vor Leidenschaft, Mut und Intelligenz strotzt.
Emily Ratajkowski, geboren 1991, ist ein US-amerikanisches Model, Schauspielerin, Unternehmerin, Aktivistin und Schriftstellerin. Sie ist eines der gefragtesten Laufsteg- und Covermodels der Welt und ein globales Social-Media-Phänomen mit über 28 Millionen Followern allein auf Instagram. Seit ihrem internationalen Durchbruch im Alter von einundzwanzig Jahren erhielt sie sowohl Lob als auch Kritik für die provokante Darstellung ihres Körpers, die sie als Statement feministischen Empowerments versteht. Seither hat sich Ratajkowski intensiv mit der medialen Vermarktung von Frauen und Frauenkörpern in der Unterhaltungskultur beschäftigt. Ihr 2020 im New York Magazine erschienener Essay »Buying Myself Back« erlangte in nur 24 Stunden über eine Million Klicks und wurde zum meistgelesenen Artikel des Jahres. My Body ist Ratajkowskis erstes Buch.
»Dieses Buch ist für jede Frau, die versucht, zwischen Konsum und Kontrolle einen Platz für sich und ihren Körper zu finden […] Es hat mich verändert.«
Lena Dunham
»Eine kluge und glänzende Essaysammlung [...]«
The Guardian
Besuchen Sie uns auf www.penguin-verlag.de und auf Facebook.
Emily Ratajkowski
My Body
Was es heißt,
eine Frau zu sein
Aus dem Englischen
von Stephanie Singh
Die Originalausgabe erschien 2021 unter dem Titel My Body
bei Metropolitan Books, einem Imprint von Henry Holt & Company, New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © der Originalausgabe 2021 by Emily Ratajkowski
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2022
by Penguin Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Hanne Reinhardt
Umschlaggestaltung: Hafen Werbeagentur gsk GmbH
Satz: Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-29118-1V002
www.penguin-verlag.de
Für Sly
Man malte eine nackte Frau, weil man sie gern betrachtete; man gab ihr einen Spiegel in die Hand, nannte das Gemälde Eitelkeit und verurteilte damit moralisch eben jene Frau, deren Nacktheit man zum eigenen Vergnügen abgebildet hatte.
In Wahrheit jedoch hatte der Spiegel eine andere Funktion. Er sollte die Frau zur Komplizin machen, sodass auch sie sich zuallererst als Anblick begriff.
JOHNBERGER,
Sehen: Das Bild der Welt in der Bilderwelt
Inhalt
Einleitung
Beauty-Lektionen
Blurred Lines
Mein Sohn, meine Sonne
Toxisch
Moment mal – Halle Berry!?
K-Spa
Ein flaues Gefühl
Transaktionen
Wie ich mich selbst zurückkaufte
Pamela
Männer wie du
Befreiungen
Danksagung
Einleitung
Im Sommer 2020 erschienen die Single und das Musikvideo WAP (Wet Ass Pussy) von Megan Thee Stallion und Cardi B. Beide gingen sofort viral; das Video wurde binnen vierundzwanzig Stunden 25,5 Millionen Mal angesehen, der Song stieg auf Platz eins der US- und der weltweiten Charts ein, was zuvor noch keinem gemeinsamen Song zweier Künstlerinnen gelungen war. Schon bald wurde online intensiv über die hypersexuellen Inhalte sowohl des Songtextes als auch des Videos debattiert. Der Kulturbetrieb lobte den Song vielfach als sexpositive Hymne und behauptete, mit der Thematisierung expliziter sexueller Details und Begierden bestätigten Cardi und Megan sich als aktiv handelnde Individuen und ließen einen längst nötigen Rollentausch Wirklichkeit werden. Andere argumentierten, der Feminismus werde durch den Song und das Video um ein Jahrhundert zurückgeworfen.
Zuletzt hatte 2013 das Musikvideo Blurred Lines von Robin Thicke, Pharrell Williams und T. I. eine ähnlich hitzige Debatte um weibliche Emanzipation und Sexualität ausgelöst. Es zeigte drei tanzende, beinahe nackte Frauen. Eine dieser Frauen war ich.
Durch Blurred Lines wurde ich im Alter von einundzwanzig Jahren über Nacht bekannt. Bis heute wurde die zensierte Version, die unsere Nacktheit nur teilweise zeigt, auf YouTube ungefähr siebenhunderteinundzwanzig Millionen Mal angesehen; der Song gehört zu den bestverkauften Singles aller Zeiten. Die unzensierte Version wurde kurz nach ihrem Erscheinen von YouTube entfernt, da sie gegen die Richtlinien der Plattform verstoße. Später war sie kurzfristig wieder aufrufbar, ehe sie endgültig verschwand, was die ganze Diskussion weiter anheizte.
Plötzlich wurde ich – genauer gesagt, die kulturelle Bedeutung meines Körpers – weltweit sowohl von feministischen Theoretikerinnen als auch von Jungs im Teenageralter seziert. Von der Presse nach meiner Haltung zu dem Video gefragt, gab ich die überraschende Antwort, meinem Empfinden nach sei es kein bisschen antifeministisch. Ich sagte den Reportern, Frauen würden oder sollten sich durch meine Darstellung bestärkt fühlen. Meine Aussagen über Blurred Lines fielen in die Entstehungszeit von feministischen Blogs, Sheryl Sandbergs Bestseller Lean In und Leitartikeln wie »Warum Frauen doch nicht alles haben können«, lagen aber noch vor der Popularisierung des Begriffs »feministisch«: Noch hatte Beyoncé nicht vor dem riesigen Neon-Schriftzug FEMINIST getanzt, und noch verkaufte nicht jede Billigmodekette T-Shirts mit dem Aufdruck FEMINIST. Viele empörten sich darüber, dass das nackte Mädchen aus dem bekannten Musikvideo es gewagt hatte, sich als Feministin zu bezeichnen. Andere, vor allem junge Frauen, fanden meine Perspektive erfrischend. Ich argumentierte, mit meinem Körper und meiner Nacktheit selbstbewusst umzugehen. Niemand könne mir vorschreiben, nacktes Herumtanzen sei kein Akt der Selbstermächtigung. War es nicht vielmehr frauenfeindlich, mir zu diktieren, was ich mit meinem Körper tun sollte? Ich erinnerte die Welt daran, dass es im Feminismus um Entscheidungsfreiheit geht und deshalb alle aufhören sollen, mich zu kontrollieren.
Einige Jahre nach Blurred Lines schrieb ich den Essay »Baby Woman«. Darin erzählte ich von meiner Jugend und den Erniedrigungen, die ich in Bezug auf meine Sexualität und meinen sich entwickelnden Körper erlebt habe. Selbst als professionelles Model und Schauspielerin, so schrieb ich, hätte ich nicht das Ausmaß an Erniedrigung empfunden wie damals, als ein Lehrer in der Mittelstufe vorwurfsvoll an meinem BH-Träger zupfte, weil der unter meinem Tanktop hervorgerutscht war. Anders als Feministinnen und Anti-Feministinnen uns glauben machen wollen, bestand das Problem für mich nicht darin, dass junge Frauen sich selbst sexualisierten, sondern in deren Erniedrigung. Warum sollten wir uns anpassen, uns für unsere Körper entschuldigen und sie verhüllen? Ich hatte keine Lust mehr, mich schuldig zu fühlen, weil ich mich auf eine bestimmte Weise präsentierte.
Meine Haltung war das Ergebnis einer Jugend voller widersprüchlicher Signale hinsichtlich meines sich entwickelnden Körpers und meiner aufkeimenden Sexualität. Mit dreizehn war ich verwirrt, weil mein Vater vor dem Aufbruch zu einem eleganten Restaurant sagte, ich solle mich »heute Abend ausnahmsweise nicht so anziehen«. Ich betrachtete mein rosafarbenes Spitzentop und den Push-up-BH. Meine Mutter hatte mir immer vermittelt, mein Aussehen zu genießen, und dieses Outfit hatte mir bereits Bestätigung sowohl durch die Blicke erwachsener Männer auf der Straße als auch gleichaltriger Jungen in der Schule eingebracht. Plötzlich schämte ich mich für etwas, worauf ich gleichzeitig stolz war.
Als meine fast zwanzig Jahre ältere Cousine einmal atemlos ins Wohnzimmer gerannt kam, nachdem sie mich dort ein paar Minuten mit ihrem Freund allein gelassen hatte, verstand ich die Situation nicht. Ich wusste nicht, wovor sie Angst hatte, obwohl ich instinktiv spürte, was die Körpersprache ihres Freundes bedeutete, der zurückgelehnt, mit nach vorn gestreckten Hüften und mit einladendem Lächeln auf der Couch saß. Ich war ein Kind, aber aus irgendeinem Grund bereits Expertin für männliches Begehren, selbst, wenn ich nicht gänzlich verstand, wie es zu deuten sei: War es gut? Sollte ich mich davor fürchten? Dafür schämen? Die Antwort schien zu lauten: alles zugleich.
»Baby Woman« schließt mit einem Gespräch, das ich nach meinem ersten Studienjahr an der Kunsthochschule mit einem Zeichenlehrer geführt habe. Damals zeigte ich ihm eine von mir angefertigte Kohlezeichnung eines weiblichen Akts. Er schlug vor: »Warum zeichnen Sie nicht eine Frau, deren Taille so schmal ist, dass sie nicht aufrecht stehen kann?« Er riet mir, entweder »mit den Stereotypen des Schönheitsideals zu spielen oder dessen niederdrückende Kraft zu zeigen«. Ich wollte nicht glauben, dass der Kontrast so scharf war und ich nur diese beiden Möglichkeiten hatte.
Die meiste Zeit meines Lebens hielt ich mich für schlau und für eine, die schon irgendwie durchkommt. Ich begriff, dass ich einen Vorzug hatte, der sich vermarkten ließ, dem ein gewisser Wert beigemessen wurde. Ich war stolz, mit meinem Körper ein Leben und eine Karriere aufgebaut zu haben. Ich glaubte, alle Frauen würden bis zu einem gewissen Grad sexualisiert und zu Objekten degradiert und ich könne dies genauso gut zu meinen eigenen Bedingungen geschehen lassen. Meine Fähigkeit, mich dafür zu entscheiden, hielt ich für einen Beweis meiner Stärke.
Wenn ich diesen Essay und Interviews aus der Zeit heute wieder lese, löst mein jüngeres Ich einen zarten Schmerz in mir aus. Heute spüre ich, wie trotzig und defensiv ich damals war. Was ich schrieb und sagte, spiegelte meine damaligen Überzeugungen wider und ließ doch ein Bewusstsein für die Komplexität meiner Lage vermissen.
In vielfacher Hinsicht war ich für die Vermarktung meiner Sexualität unbestreitbar belohnt worden. Ich wurde international bekannt, Millionen folgten mir in den Medien, und ich verdiente mit Promotion und Modewerbung mehr, als meine Eltern – eine Professorin für Englische Literatur und ein Lehrer für Malerei – mit ihren Berufen je hätten erwirtschaften können. Ich baute eine Online-Präsenz auf, indem ich Bilder von mir und meinem Körper teilte und damit zuerst meinem Körper und später meinem Namen einen Wiedererkennungswert verlieh, der letztlich auch dazu beigetragen hat, dass ich dieses Buch veröffentlichen kann.
Zugleich und in weniger offensichtlicher Weise fühlte ich mich durch meine Rolle als sogenanntes Sexsymbol objektiviert und eingeschränkt. Ich habe meinen Körper innerhalb der Grenzen einer cis-heterosexuellen, kapitalistischen, patriarchalen Welt zu Geld gemacht, in der Schönheit und Sex-Appeal ausschließlich durch die Befriedigung des männlichen Blicks ihren Wert erhalten. Meinen Einfluss und Status erhielt ich nur, weil ich Männern gefiel. Meine Position brachte mich in die Nähe von Reichtum und Macht und verlieh mir eine gewisse Autonomie, führte aber nicht zu wahrer Emanzipation. Die habe ich erst jetzt, mit dem Schreiben dieser Essays erlangt, in denen ich meinen Gedanken und Erfahrungen eine Stimme verliehen habe.
Dieses Buch steckt voller Gedanken und Tatsachen, mit denen ich mich früher nicht auseinandersetzen wollte – vielleicht war ich dazu auch nicht in der Lage. Ich hatte mir angewöhnt, Erfahrungen zu verdrängen, die schmerzhaft waren oder im Widerspruch zu meinen Überzeugungen standen – wie die, dass ich das Paradebeispiel einer durch die Vermarktung ihres Bildes und Körpers emanzipierten Frau war.
Die Beschäftigung mit der komplexen Wirklichkeit meiner Situation bedeutete ein brutales Erwachen, die Zerstörung einer Identität und eines Narrativs, an die ich mich verzweifelt geklammert hatte. Ich war gezwungen, mich einigen schwierigen Fragen zu stellen: Was war mir wichtig? Was war Liebe? Was machte mich zu etwas Besonderem? Und ich musste mich mit meinem Verhältnis zu meinem Körper auseinandersetzen.
Ich bin mir noch immer nicht im Klaren darüber, wie ich zu Sexualität und Emanzipation stehe. Ziel dieses Buchs ist es nicht, Antworten darauf zu finden, sondern eher, mich in aller Offenheit mit Gedanken auseinanderzusetzen, auf die ich immer wieder zurückgeworfen werde. Ich will die verschiedenen Spiegel untersuchen, in denen ich mich betrachtet habe: Männeraugen, andere Frauen, mit denen ich mich verglichen habe, und die unzähligen Fotos, die von mir gemacht wurden. Die folgenden Essays schildern die zutiefst persönlichen Erfahrungen und das darauffolgende Erwachen, die meine Zwanziger prägten und meine Überzeugungen und mein Handeln veränderten.
Beauty-Lektionen
1
»Nach deiner Geburt«, erzählt meine Mutter, »hielt dich der Arzt in die Höhe und sagte: ›Sehen Sie sich ihre Größe an! Sie ist wunderschön!‹ Und das warst du tatsächlich.« Sie lächelt. Ich habe diese Geschichte schon oft gehört.
»Am nächsten Tag brachte er seine Kinder mit ins Krankenhaus – nur, damit sie dich sehen konnten. Du warst so ein schönes Baby.« Hier endet die Erzählung normalerweise, doch diesmal ist meine Mutter noch nicht fertig. Sie blickt unschuldig drein, wie immer, wenn sie meinem Vater oder mir etwas sagt, das sie vielleicht nicht sagen sollte. Ich mache mich innerlich bereit.
»Schon komisch«, sagt sie mit feinem Lächeln. »Neulich habe ich mit meinem Bruder geredet …« Sie ahmt seinen Ostküstenakzent nach: »Kathy, Emily war ein wunderschönes Baby. Aber nicht so schön wie du. Du warst das schönste Baby, das ich je gesehen habe.« Sie zuckt die Schultern und schüttelt den Kopf, als wolle sie sagen: »Ist das nicht verrückt?« Ich frage mich, welche Antwort sie erwartet, sehe aber, dass sie aus dem Fenster blickt und mich nicht weiter beachtet.
2
Bei einem Fotoshooting sitze ich in der Maske und unterhalte mich mit dem Assistenten der Friseurin. »Ist deine Mutter schön? Siehst du ihr ähnlich?«, fragt er, während er mir mit den Fingern durchs Haar fährt.
Er sprüht meine Haarspitzen ein, betrachtet mein Spiegelbild und macht mir Komplimente für meine Augenbrauen. »Die sehen gut aus«, verkündet er und greift nach einer Bürste.
»Welche ethnische Herkunft hast du, Mädchen?« Unterhaltungen wie diese bin ich am Set gewöhnt, sie laufen fast immer gleich ab, und ich möchte sie so schnell wie möglich abwürgen. Es gefällt mir nicht, wie diese Frage als Aufhänger für die Thematisierung der eigenen Herkunft genutzt wird, um »exotisch« zu wirken: Ich bin dreizehn Prozent dies und sieben Prozent das. Stattdessen sage ich einfach: »Ich bin ein weißes Mädchen.« Der Assistent lacht.
»Okay, weißes Mädchen.« Er grinst breit. »Ich merke aber, dass bei dir noch irgendetwas anderes drinsteckt.« Er erzählt, er selbst sei Puerto-Ricaner.
»Und deine Mama?« Er wiederholt die Frage mit echter Neugier. »Ist sie so schön wie du?«
»Ja«, antworte ich. »Noch schöner.« Er wirkt erstaunt und wendet sich wieder den Extensions zu. »Das kann nicht sein«, sagt er. Ich bin daran gewöhnt, dass sich manche Menschen unwohl fühlen, wenn sie meine Antwort hören.
»Es stimmt aber«, beharre ich sachlich. Und so meine ich es auch.
3
Meine Mutter ist eine klassische Schönheit: Sie hat weit auseinanderstehende, grüne Augen, eine schmale, elegante Nase, ist von kleiner Statur und hat eine – wie sie es bezeichnen würde – Sanduhrfigur. Ihr Leben lang wurde sie mit Elizabeth Taylor verglichen, und ich finde den Vergleich passend. Menschen aus einer bestimmten Generation sagten, sie sehe aus wie die junge Vivien Leigh. Meine Eltern bewahrten sowohl Kleines Mädchen, großes Herz als auch Vom Winde verweht als VHS-Kassetten neben ihrem Bett auf. Als Kind habe ich diese Filme unzählige Male gesehen und hatte stets das Gefühl, inmitten der Südstaatenschönheiten eine jüngere Version meiner Mutter zu sehen. Vivien Leigh warf Clark Gable einen Blick von unten zu, und ich musste an die Geschichten meiner Mutter aus der Schulzeit denken – ihre Verehrer hatten reihenweise unter ihrem Fenster gewartet. Ich stellte mir den seidigen Stoff der Schärpe vor, die sie als Königin des Schulballs getragen hatte, und das Gewicht der glitzernden Krone, die auf ihren Fotos im Jahrbuch zu sehen ist.
4
Im Wohnzimmer meiner Eltern steht ein hölzerner Buffetschrank, in dem Silberbesteck und Porzellangeschirr aufbewahrt werden. Auf dem Schrank stehen gerahmte Bilder, Souvenirs und einige kleinere Skulpturen meines Vaters. Gäste interessieren sich meist für einen Bilderrahmen, in dem zwei runde Fotos nebeneinander zu sehen sind. Rechts ein Schwarz-Weiß-Foto meiner Mutter aus ihrer Grundschulzeit. Sie trägt die Haare zu kurzen Zöpfen gebunden. Links ein Foto von mir im gleichen Alter. Meine Haare werden von einem schwarzen Band zurückgehalten. Beide Mädchen lächeln breit. Wäre das eine Foto nicht alt und vergilbt und trüge keine Jahreszahl in der rechten unteren Ecke, könnte man die Bilder für Fotos desselben Kindes halten. »Wer ist wer?«, fragen die Gäste immer.
5
Mein feines Haar hat sich schon immer schnell verknotet. Als ich klein war, benutzte meine Mutter Entwirrungsspray und einen Kamm, mit dem sie nach dem Baden die Knoten herauskämmte. Es ziepte, tat an der Kopfhaut weh und bereitete mir Nackenschmerzen, weil ich den Kopf hochhalten musste. Die Prozedur war mir verhasst. Ich konzentrierte mich auf die Sprayflasche, auf der Meerestiere abgebildet waren, und starrte auf das lächelnde, orangefarbene Seepferdchen und den moppeligen blauen Wal, während mir Tränen über das Gesicht liefen. Der süßliche Geruch des Sprays ließ mir das Wasser im Mund zusammenlaufen. Ich spürte, wie sich der Kamm in meine Kopfhaut grub und schrie: »Nicht!«
Ich wuchs in einem Haus ohne Decken auf. Es gab nur schräge Wände, die kurz vor dem Dach endeten, sodass meine Schreie den gesamten Raum ausfüllten. Wenn mein Vater mich schreien hörte, sang er aus dem Nebenzimmer zur Melodie von Star Wars: »Hair wars, nothing but hair wars.«
6
Ich wurde nicht religiös erzogen. Gespräche über Gott kamen in meiner Kindheit nicht vor. Ich habe nie viel gebetet, erinnere mich aber, dass ich als junges Mädchen um Schönheit betete. Ich lag im Bett, kniff die Augen zu und konzentrierte mich so stark, dass ich Schweißausbrüche bekam. Ich glaubte, damit Gott mich ernstnähme, müsse ich meinen Geist so frei wie möglich machen, mich auf die Lichtpunkte hinter meinen Augenlidern konzentrieren und nur an die eine Sache denken, die ich mir so verzweifelt wünschte.
»Ich will die Schönste sein«, wiederholte ich wieder und wieder im Kopf. Das Herz schlug mir bis zum Hals. Wenn ich den anderen Gedanken nicht länger widerstehen konnte, schlief ich ein und hoffte, Gott durch meine Meditation so sehr beeindruckt zu haben, dass er mir meinen im Gebet geäußerten Wunsch erfüllen würde.
7
Ely, der Vater meiner Mutter, war ein strenger und ernster Mann. Er wurde 1912 geboren, kam aus einem kleinen Schtetl in einem Teil Polens, der heute zu Belarus gehört, und reiste über Ellis Island in die USA ein. Als talentierter Pianist schloss er mit fünfzehn Jahren ein Musikstudium an der Juilliard School ab, wurde Chemiker und Vater dreier Töchter und eines Sohnes. Er erklärte meiner Mutter, es sei unhöflich, sich nur zu bedanken, wenn die Leute ihr sagten, sie sei schön. Er hatte nicht das Gefühl, sie habe etwas erreicht.
»Was hast du schon getan?«, fragte er sie stets. »Nichts. Nichts hast du getan.«
8
Ich wusste von frühester Jugend an, dass ich mir meine Schönheit nicht verdient hatte – wie mein Großvater es meiner Mutter erklärt hatte. War meine Schönheit also etwas, das meine Mutter mir gegeben hatte? Manchmal spürte ich, dass sie einen Anspruch darauf zu haben glaubte, wie auf ein vererbtes Schmuckstück, das einst ihr gehört und das sie ihr ganzes Leben besessen hatte. Ich hatte es samt aller Tragödien und Triumphe geerbt, die sie selbst damit erlebt hatte.
9
»Zieh an, was du willst, Ems«, sagte meine Mutter immer. »Mach dir keine Gedanken um andere Leute.« Sie wollte, dass ich mich nicht schämte und mein Aussehen und die damit verbundenen Möglichkeiten annahm.
Mit dreizehn wurde ich von einer Tanzveranstaltung nach Hause geschickt, weil die Aufsichtspersonen mein Kleid zu sexy fanden. Meine Mutter hatte es mit mir gemeinsam gekauft. Es war babyblau, aus dehnbarer Spitze und schmiegte sich eng an meine gerade erst entwickelten Brüste und Hüften. Als ich unsicher aus der Umkleide trat, stand meine Mutter auf und umarmte mich.
»Du siehst wunderbar aus«. Sie lächelte warm.
»Ist das nicht zu sexy?«, fragte ich.
»Überhaupt nicht. Du hast eine wunderschöne Figur.« Meine Mutter wollte nicht, dass ich glaubte, Körper oder Schönheit im Übermaß zu besitzen. »Falls es die Leute stört, ist das ihr Problem«, pflegte sie zu sagen.
Als sie mich von der Tanzveranstaltung abholte, war ich in Tränen aufgelöst, beschämt und verwirrt. Sie strich eine Haarsträhne hinter mein Ohr und umarmte mich. »Diese Leute können uns mal«, sagte sie. Sie bereitete mir ein besonderes Abendessen zu und erlaubte mir, beim Essen irgendeinen dummen Film anzusehen. Später schrieb sie mit meiner Erlaubnis einen gepfefferten Beschwerdebrief.
»Denen werde ich was erzählen«, verkündete sie.
10
Ich versuchte herauszufinden, wo in der Welt der Schönen meine Eltern meinen Platz sahen. Beiden, vor allem meiner Mutter, schien es wichtig zu sein, dass ihre Tochter als schön wahrgenommen wurde. Gerne erzählten sie Freunden davon, wie ich von Modelscouts angesprochen wurde, und als ich später den ersten Modelvertrag unterschrieben hatte, berichteten sie von meinen Erfolgen. Sie hielten die Arbeit als Model für eine Gelegenheit, die sie mir als verantwortungsvolle Eltern bieten sollten. »Sie kann viel Geld verdienen. Gibt es Porträtfotos von ihr?«, fragte einmal eine Frau, als ich im Supermarkt an der Kasse stand. Auf dem Weg zurück zum Auto musste meine Mutter mir erst erklären, was ein Porträt ist.
Irgendwann suchten meine Eltern mir eine Agentin und fuhren mich zu Fotoshootings und Castings in Los Angeles, wie andere Eltern ihre Kinder zu Fußballspielen fuhren. Mein Vater hängte meine erste Sedcard (eine Karte, auf der meine Maße und einige Bilder präsentiert wurden und die normalerweise bei Castings an potenzielle Kunden verteilt wird) an die Wand neben das Pult in seinem Klassenraum. Als ich in die Highschool kam, rahmte meine Mutter ein 23 x 30 cm großes Schwarz-Weiß-Foto von mir und stellte es in der Küche gegenüber der Haustür auf, sodass jeder, der das Haus betrat, sofort meinen Schmollmund, meine nackten Beine und meine verwuschelten Haare erblickte. Mir waren sowohl das Foto als auch dessen Standort peinlich. Nachdem ich von zu Hause ausgezogen war, überredete ich meine Mutter, es zu entfernen. Es hatte schon mehrere Jahre dort gestanden. »Du hast recht«, sagte sie. »Das bist nicht mehr du. Du bist jetzt noch viel schöner.«
11
Schönheit war für mich ein Weg, etwas Besonderes zu sein. Wenn ich etwas Besonderes war, spürte ich die Liebe meiner Eltern am stärksten.
12
Das erste Casting, zu dem meine Mutter mich brachte, war für einen Hersteller teurer Jeans, die ich selbst nie besessen hatte. Meine Mutter organisierte einen Vertretungslehrer, damit sie mich nach Los Angeles fahren konnte, und holte mich früher von der Schule ab. Ich sprang in ihren VW Käfer.
Sie setzte ihre Sonnenbrille auf, und wir machten uns auf den Weg. »Ich habe deine Agentin nach deinen Chancen gefragt. Sie meinte: ›Sie hat definitiv eine Chance, aber das ist immer schwer zu sagen.‹« Sie sah mich im Rückspiegel an. »Ich meinte deine Chancen für dieses Casting. Nicht deine allgemeine Chance, berühmt zu werden.« Sie schüttelte den Kopf. »Das hat mir gar nicht gefallen.« Die Agentin mache den zweiten Schritt vor dem ersten, erklärte meine Mutter.
Wir betraten das Casting-Büro durch deckenhohe Glastüren. Kalte Luft strömte uns entgegen. Das Wartezimmer war mit weißen Bänken ausgestattet. Bildschirme an der Wand zeigten an, in welchem Raum welches Casting stattfand. Ich trug eine günstige Stretch-Version der klassischen Jeans des Herstellers und grobe schwarze Stiefel. Beides hatte ich reduziert gekauft. So lief ich ein paarmal vor meiner Mutter hin und her. Mit Absätzen war ich fast einen Kopf größer als sie.
Wir setzten uns auf eine der Bänke. Die Reißverschlüsse der ungewohnten Stiefel drückten an den Füßen. Ein Junge mit Sommersprossen und wilden, naturgelockten Haaren saß in der Nähe.
»Emily?« Eine junge Frau mit einem Klemmbrett in der Hand sah sich suchend im Raum um. Ich stand auf.
»Bausch die Haare auf«, flüsterte meine Mutter. Ich warf den Kopf nach vorne, spürte, wie mir das Blut ins Gesicht stieg, und richtete mich schwungvoll wieder auf. Ich spürte den Blick meiner Mutter auf meinem Hinterkopf, als ich den Casting-Raum betrat.
Auf der Rückfahrt sah ich gedankenverloren aus dem Fenster. Die Sonne schien mir ins Gesicht.
»Der Junge hat dich angeschaut, als du die Haare zurückgeworfen hast«, sagte meine Mutter.
Ich fragte mich, was der Junge gesehen hatte.
13
Meine Mutter erzählte gern, dass Männer mir seit dem zwölften Lebensjahr Aufmerksamkeit schenkten. (»Ich werde nie seinen Gesichtsausdruck vergessen, als du an ihm vorbeigingst! Er blieb einfach mit offenem Mund stehen!«) Gleichzeitig war sie der Überzeugung, das männliche Verständnis von Schönheit sei begrenzt und undifferenziert.
»Marilyn Monroe war nie wirklich schön«, pflegte sie zu sagen, wenn mein Vater sich positiv über die Monroe äußerte.
Meine Mutter unterschied zwischen Frauen, die Männern gefielen, und wahren Schönheiten. »Jennifer Lopez verstehe ich einfach nicht«, sagte sie zum Beispiel naserümpfend. »Männern scheint sie zu gefallen.« Mit der Zeit verstand ich, dass »Männern gefallen« in der Hierarchie meiner Mutter weit unter »schön« angesiedelt, aber immer noch besser war, als gar nicht erwähnt zu werden. Meine Mutter sprach manchmal sehr herablassend über solche Frauen: »Sie ist süß«, pflegte sie lächelnd und mit einem Hauch von Mitleid in der Stimme zu sagen. Wenn wir Filme mit jungen Schauspielerinnen sahen, kommentierte meine Mutter fast immer deren Aussehen: »Also, eine Schönheit ist sie nicht.« Das Gleiche machte sie mit meinen Freundinnen, deren Aussehen sie beim gemeinsamen Shopping ganz nebenbei bewertete. »Sie ist gewiss nicht hübsch, aber sie hat eine gute Figur«, verkündete sie etwa, während sie den Reifegrad einer Avocado einzuschätzen versuchte.
14
Nachdem ich von zu Hause ausgezogen war, posteten meine Eltern regelmäßig professionelle Fotos von mir auf Facebook. Meine Mutter beantwortete jeden Kommentar ihrer Freundinnen mit »Dank dir, Suzy!« oder »Wir sind so stolz auf sie, Karen«. Mein Vater antwortete seinen Freunden eher mit Witzen: »Von mir hat sie nur ihre inneren Werte, Dan.« Sein Kommentar erinnerte mich daran, wie er einmal sagte, ich hätte seine Nase geerbt.
»Sie ist ziemlich groß«, hatte er gelacht. Meine Mutter sah ihn böse an. »Sag so was nicht, John«, flüsterte sie missbilligend.
15
Die Bestätigung meiner Schönheit durch andere wirkt für meine Mutter wie ein Spiegel, der ihren eigenen Wert reflektiert.
Sie sagt: »Ein Freund vom College hat auf Facebook geschrieben, dass er dein neustes Zeitschriftencover gesehen hat. Er postete: ›Es überrascht mich nicht, dass Kathleens Tochter schön ist! Aber sie ist nicht so wundervoll wie du, Kathy. An dich kommt keine ran.‹«
Meine Mutter erinnert mich gerne daran, wie sie sich einmal beklagte, andere Frauen würden sie schlecht behandeln. Ich sei drei Jahre alt gewesen und hätte geantwortet: »Mama, die sind nur neidisch!«
Sie erzählt die Geschichte als charmanten Beweis für mein schon in jungen Jahren sanftes und aufmerksames Wesen. Erst später wurde mir klar, dass ich bereits mit der Konkurrenz zwischen Frauen vertraut gemacht worden war, ehe ich lesen konnte. Und dass ich schon so früh verstanden hatte, dass meine Bemerkung meiner Mutter angesichts ihrer negativen Erfahrungen Trost spendete.
16
Auch ich konstruiere mir eine Art Spiegel, der dem meiner Mutter ähnelt, aber auf andere Weise. Online betrachte ich Fotos von mir auf dem roten Teppich oder Bilder, die Paparazzi von mir gemacht haben, oder ich wische mich durch meine Bildergalerie auf dem Telefon. Ich zoome auf mein Gesicht und versuche zu ergründen, ob ich tatsächlich schön bin. Auf Reddit lese ich die Kommentare in meinem Thread und frage mich, ob ich – wie ein Nutzer bemerkt – »überbewertet« bin oder doch »eine der schönsten Frauen der Welt«, wie ein anderer meint. Eine Nutzerin, die bei einem meiner letzten Shootings mitgearbeitet hat, erklärt, ich sei »nichts Besonderes, wenn man ihr begegnet«. Eine andere hat mich im Café um die Ecke mit meinem Hund gesehen und findet, ich sei »im echten Leben viel hübscher. Schöner als auf den Bildern«.
Ich poste Instagram-Fotos, die ich für Beweise meiner Schönheit halte, und zähle wie besessen die Likes, um herauszufinden, ob das Internet meine Einschätzung teilt. Solchen Daten schenke ich mehr Aufmerksamkeit, als ich zugeben will – ich versuche, meine Ausstrahlung so objektiv und brutal wie möglich zu messen. Ich will meine Schönheit berechnen, um mich selbst zu schützen und zu verstehen, über wie viel Macht ich tatsächlich verfüge, wie liebenswert ich wirklich bin.
17
Als Schülerin lag ich nach dem Sex mit meinem ersten festen Freund im Bett, als er mir von den anderen Mädchen erzählte, mit denen er geschlafen hatte. Er beschrieb ihre Körper, ihre Haare, was ihm an ihnen gefallen hatte. Ich hörte zu und bekam plötzlich Panik. Mir drehte sich der Magen um. Ich begann zu schwitzen. Ich fragte mich, was mit mir los war, warum ich so auf die Beschreibungen attraktiver Frauen durch meinen Freund reagierte.
Er fuhr fort. Die Muskeln in meinem Unterleib verkrampften sich. In wenigen Minuten würde ich ins Bad rennen müssen. Er redete weiter und merkte nicht, wie ich mich unter der dünnen Decke zusammenkrümmte. Ich begann zu zittern. Er redete noch immer. »Sie …, ihr …« Ich nickte, stellte Fragen, tat unbeeindruckt und wusste doch, dass ich all diese Mädchen später googeln und in der Schule beobachten würde. Ich würde Informationen darüber sammeln, inwiefern sie mir glichen oder sich von mir unterschieden. Schließlich rannte ich ins Bad, weil ich fürchtete, es nicht länger zurückhalten zu können. Ich wusste zwar, dass diese Mädchen aus der Vergangenheit meines Freundes keine echte Bedrohung für mich waren, doch mein Körper reagierte, als seien sie eben dies. Ich hasste die Vorstellung, er könnte jemanden attraktiver gefunden haben als mich.
18
Manche Erinnerungen meiner Mutter haben sich mir so tief eingebrannt, dass ich manchmal nicht mehr weiß, ob es sich um ihre oder meine eigenen Erlebnisse handelt. Das gilt zum Beispiel für die Geschichte, in der ihr mein Vater noch nicht lange den Hof machte – wie sie es ausdrücken würde – und sie auf einer Party aus der Toilette kam. Die Ex-Freundin meines Vaters stand an dem großen Spiegel vor den Waschbecken und wusch sich die Hände. Meine Mutter stellte sich neben sie. »Da dachte ich, das sind wir also. So verschieden. Verstehst du?« Da waren sie also: Zwei Frauen, die mein Vater erwählt hatte. Ich stelle mir vor, wie sie reglos, mit hängenden Armen und ausdruckslosen Gesichtern nebeneinanderstehen. Vielleicht läuft noch ein Wasserhahn. Meine Mutter ist fast einen Kopf kleiner als die blonde Frau, mit der mein Vater einst zusammenlebte. Sie hat helle Haut, breite Schultern und einen langen Oberkörper. Ihre Haare riechen nach Salzwasser. Die dunklen Locken meiner Mutter umspielen ihr herzförmiges Gesicht und die Rundungen ihrer Hüften zeichnen sich vor den weißen Badkacheln ab. Die Gesichter beider Frauen liegen im Schatten, während sie sich selbst und einander betrachten.
19
Meine Mutter erzählte mir gern, dass sie sich immer Haare wie meine gewünscht hatte.
»Wie ein Satinlaken«, sagte sie und ließ ihre Hand über meinen Kopf gleiten. Ich duckte mich weg.
»Lass das, Mom!«, rief ich ärgerlich und hasste im selben Moment den durchdringenden Klang meiner Stimme.
»Ist ja gut«, säuselte sie. »Du bist jetzt ein Teenager und willst nicht angefasst werden, aber du wirst immer mein kleines Mädchen bleiben.«
»Mein Leben lang wollte ich Haare wie deine«, wiederholte sie nun ernster. »Ich bügelte meine Haare auf dem Bügelbrett, um sie so glatt zu bekommen wie die von Jane Asher.« Sie starrte ins Nichts und stellte sich ein anderes Leben vor, eine andere Welt, deren einziger Unterschied zu unserer in ihren Haaren bestand. (Aber das wäre mal wirklich ein Unterschied!, hörte ich sie in Gedanken sagen.)
Heute weiß ich, dass mein Verhalten nicht einfach das eines typischen Teenagers war. Ich wollte bloß deshalb nicht von meiner Mutter betrachtet werden, weil ich wusste, dass ihr Blick oft kalkulierend, analytisch und vergleichend war.
20
Als junge Frau hasste ich es, Komplimente über mein Aussehen zu bekommen – ganz egal, ob sie von meinen Freundinnen kamen oder von Jungs, für die ich mich interessierte. Ein Mann, mit dem ich in meinen frühen Zwanzigern kurz zusammen war, machte sich immer darüber lustig, wie unangenehm es mir war, wenn er mir sagte, wie schön ich sei. »Oh Gott! Du kannst überhaupt nicht damit umgehen!«, sagte er, während ich immer unsicherer wurde.
»Halt die Klappe.« Ich verdrehte die Augen, womit ich ihm vermitteln wollte, dass er sich täusche.
»Aber du bist Model und für deine Schönheit berühmt«, beharrte er. Er verstand das nicht und wartete auf eine Erklärung. Ich wusste nie, was ich antworten sollte. Ich hätte ihm gern gesagt, dass Männer, die mich mochten, so etwas nicht sagen mussten. So etwas hörte ich gerne am Set, beim Geldverdienen, aber im Privatleben wollte ich es nicht. Ein Teil von mir widersetzte sich der erlernten Verbindung von Schönheit mit Besonderheit und Liebe. Nein danke, dachte ich. Was auch immer die Männer mir hier anbieten – ich will es nicht. Ich will ihren Spiegel nicht und nicht die Art von Liebe, bei der ich »die Allerschönste« bin.
21
In ihren frühen Sechzigern hörte meine Mutter auf, ihre Haare zu färben. Sie ließ sie erst grau, dann silbrig und schließlich weiß werden. Sie trug die Haare weiter kurz. Das natürliche Volumen gab ihrem Kopf eine gewisse Form. Sie sah hübsch aus. Dieses Adjektiv wird für Frauen über sechzig selten verwendet, traf aber auf meine Mutter und ihre eleganten, mit dem Alter weicheren Gesichtszüge durchaus zu.
»Altern ist seltsam«, sagte sie eines Morgens, als sie in meinem Loft in Los Angeles auf dem blauen Sofa am Fenster saß. »Neulich ging ich die Straße entlang und sah zwei attraktive, junge Männer auf mich zukommen. Unbewusst streckte ich mich leicht, als ich an ihnen vorbeiging.« Sie lachte auf. »Die beiden haben mich keines Blickes gewürdigt. In diesem Moment wurde mir klar, dass ich für sie jetzt unsichtbar bin. Sie sehen nur eine grauhaarige Dame!«
Während sie das erzählte, sah sie in dem natürlichen Licht ganz zauberhaft aus.
»So ist eben der Lauf der Dinge.« Sie zuckte die Schultern. Sie wirkte friedlich. Ich stellte mir vor, wie es sein mochte, eines Tages nicht mehr von Männern bemerkt zu werden.
»Vielleicht ist es irgendwie befreiend?«, fragte ich.
»Vielleicht«, sagte sie nach einer Pause.
22
Mein Mann und ich sind gerade frisch verheiratet, als er wie nebenbei bemerkt: »Auf der Welt gibt es so viele schöne Frauen.«
Ich werde ganz steif. Ich weiß, dass seine Bemerkung völlig akzeptabel und wahr ist, spüre aber dennoch das altbekannte Krampfen in meinem Unterleib.
»Was ist?«, fragt er. Er spürt die Veränderung, bemerkt die Anspannung in meinem Körper.
»Ich weiß nicht«, antworte ich. Beschämt vergrabe ich mein Gesicht an seiner Brust. »Ich weiß nicht, warum es wehtut, wenn du so etwas sagst.«
Ich merke, dass er mich trösten will, aber er ist verwirrt. Ich will, dass er mich tröstet, kann aber gar nicht sagen, warum ich Trost brauche. Warum habe ich plötzlich das Gefühl, dass er mich nicht genug liebt?
23
Ich erzähle meiner Therapeutin in ihrem kleinen, fensterlosen Büro von meiner Reaktion auf die Bemerkung meines Mannes. Ich erzähle ihr von den Unterleibsschmerzen. Von den Vergleichen mit anderen Frauen.
»Äpfel und Birnen«, sagt meine Therapeutin. »Was wäre, wenn Sie nicht wie andere Frauen wären, sondern eine ganz andere Obstsorte?«, fragt sie sanft.
Ich hasse diese Unterhaltung. Ein Teil von mir schämt sich fürchterlich. Am liebsten würde ich aufstehen und schreien: »Natürlich weiß ich das! Ich hasse Frauen, die sich mit anderen Frauen vergleichen! So bin ich nicht!«
Doch ein anderer Teil von mir muss ihr zuhören, weil er sie korrigieren will. »Jeder hat ein Lieblingsobst«, antworte ich. Eine Träne rinnt meine Wange hinunter. »Jeder zieht eine Obstsorte der anderen vor. So funktioniert die Welt eben – überall gibt es Rangordnungen. Immer ist eine besser als die andere.«





























