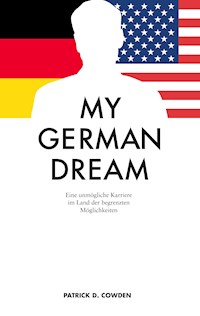
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Auf der Überholspur durch die Wand. Der einzige Weg zu mir selbst. Ein Highschool-Abschluss und einige Brocken Deutsch: Mehr braucht Patrick Cowden nicht für den Aufstieg vom einfachen Betanker am Frankfurter Flughafen zum jüngsten Geschäftsführer einer Landesbank. Mit 29 ist er Millionär und der treueste Diener einer renditehörigen Wirtschaft. Aber Cowdens Traum wird immer wieder zum Alptraum. Nach Rekordergebnissen verliert er jedes Mal seinen Job. Weil keiner seiner Chefs mit ihm zurechtkommt. Und er nicht mit ihnen und einem System, in dem Zahlen wichtiger sind als Menschen. Erst nach drei Jahrzehnten als Topmanager und der schlimmsten Niederlage kommt Cowden an: bei sich selbst und der Mission seines Lebens.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 327
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
For Christin
My life as a book just for you.
Wish you a happy 16th birthday.
I will never forget you.
In love, your dad.
Volume one of one
5. April 2015
Inhalt
Kaltstart
Ein Amerikanischer Traum
TEIL I – TEILCHENBESCHLEUNIGUNG
High-Speed-Engineer
Im Herzen einer neuen Welt
Two Call Close
Der schnellste Weg zur Begeisterung
One Man Show
Coming-out des Missionary Man
Sales-Man
Im Zeichen der Gier
TEIL II– WARP 9
Gegen die Wand
In den Fängen der Unternehmenspolitik
New versus Old School
Eine zweite Lektion
New Economy Fieber
Führen bis in den Abgrund
Auf Büffeljagd bei Dell
Erfolg kennt keine Gnade
Ein Kampf um Ehre
Die Anti-Ethik der Vorstandsetage
TEIL III – NEUSTART
Beyond Leadership
Mein German Dream
Beyond
Die Kraft des Miteinanders
Kaltstart
Ein Amerikanischer Traum
Es gibt keinen Namen für das Virus, das mich beherrscht. Für die Unruhe und die Euphorie, die schwer zu kontrollierende Energie, die Teilchen, die in mir aufeinander prallen und mich jederzeit beschleunigen können. In mir, einem eins achtzig großen, hyperaktiven US-Amerikaner, der mit Anfang Zwanzig die deutsche Staatsbürgerschaft annahm. Seit jeher brannte in mir eine Kraft, die größer zu sein scheint als ich selbst.
Meine Umgebung ließ ich damit niemals kalt. Ich bin eine Herausforderung – für mich selbst und alle Menschen, denen ich jemals begegnet bin.
Von Anfang an war ich ein Wanderer zwischen den Welten.
Ein Mensch ohne angestammte Heimat. Mein Vater, ein US-Army Offizier, und meine deutsche Mutter zogen umher wie Vagabunden, unzählige Male von einem Armeestandort zum nächsten, aus den USA nach Deutschland und wieder zurück. Und auch sonst sprang ich beständig hin und her, zwischen Menschen und Ideen, zwischen reiner Logik und purer Leidenschaft. Als Junge ein kleines mathematisches Genie, wurde ich doch immer von meiner Intuition, meinen Gefühlen gesteuert.
Vielleicht war es auch mein ungebremster Ehrgeiz, der mich nie stillsitzen ließ. Einen, den mein Vater in mich pflanzte, ohne mir die Gabe zu schenken, mich mit dem einmal Erreichten zufrieden zu geben. Fast immer wollte ich der Erste sein. Musste es einfach sein. In der Schule. Und Draußen, wenn es darum ging, das Leben zu feiern und dabei Grenzen zu überschreiten.
Nicht nur deshalb verlor ich als junger Mann irgendwann die Orientierung. Lebte von der Hand in den Mund, besaß weder genügend Geld noch Geduld.
Also haute ich einfach ab. Folgte kurzerhand einer warmen Erinnerung und nahm den nächstbesten Flug nach Deutschland, wo ich in einem Militärkrankenhaus 19 Jahre zuvor zur Welt gekommen war.
Doch erst zwei Jahre später, in einer eisigen Nacht am Frankfurter Flughafen, suchte und fand dieses Magma in mir, das nur scheinbar für einige Zeit Ruhe gegeben hatte, endlich einen Ausweg. Es war der Beginn meines beruflichen Lebenswegs.
Zu Geld und beruflichem Erfolg, der meinen Hunger nach Veränderung nie stillen würde.
Januar 1986. Kurz vor Mitternacht. Alles fing damit an, dass die Temperatur in den Keller sackte und der Wind zunahm, während ich durch den Schnee über das Rollfeld auf das große Flugzeug zu stapfte.
Fluchend und routiniert wie ein Fließbandarbeiter begann ich mit durchgefrorenen Händen den Schlauch aufzurollen, um die Boeing für ihren morgendlichen Flug aufzutanken.
Vom Fahrersitz des Tankwagens polterte mein Kollege die Stufen herab. Es war wie immer. Wie fast jeden Tag und jeden Abend seit ich vor zwei Jahren die USA verlassen hatte und in Deutschland angekommen war. Angekommen? Ich hielt kurz inne. Schob mit klobigen Arbeitshandschuhen die Mütze über meinem jungenhaften Gesicht zurecht, das den Ausdruck eines besonders eifrigen Schülers nie verlieren sollte. War ich in meinem Leben überhaupt jemals irgendwo angekommen?
Während ich auf den metallenen Bauch des Flugzeugs starrte, spulten sich meine Gedanken zurück. Ein Jahr, zwei Jahre, drei, sechs, zehn. Ja, einmal, Mitte der 70er. Im Bundesstaat Georgia, im heißen Süden der USA. Fort Lauderdale. Dorthin war mein Vater, ein mehrfach dekorierter Vietnam-Held der US-Army, verlegt worden. Meine deutsche Mutter hatte mir einmal erzählt, dass ich anfangs meine Kisten erst gar nicht hatte auspacken wollen.
Wenn ich an Georgia zurückdenke, sehe ich den Schweiß in den Gesichtern, die rot verbrannte Haut der Soldaten.
Manchmal beobachte ich meinen Vater heimlich, wenn er, der Drill-Sergeant und spätere Sergeant Major, seinen Job mit knappen, unmissverständlichen Befehlen ausübte. Wenn die Offiziersanwärter auf dem Exerzierplatz vor ihm den Rücken durchdrückten, die Hände an die Seiten pressten und ihre Köpfe wie schlecht geölte Roboter bewegten. Sobald er einen Laut von sich gab, rannten sie los, blieben stehen, gingen in den Liegestütz und sprangen wieder auf. Das Schauspiel faszinierte mich.
Wenn er sie plötzlich abtreten ließ, rannte ich nach Hause.
Suchte meine Hausarbeiten zusammen, sowie meine Klausuren und legte alles fein säuberlich nebeneinander auf den Küchentisch.
Dann wartete ich bis er kurz darauf vor mir stand, den tropischen Temperaturen trotzend jeden Knopf seiner Uniform geschlossen. Lediglich ein einzelner Tropfen wagte es unter seinem Barett hervor. Er wischte ihn nicht weg.
„Yes, Sir. Drei Einsen. Nur eine davon mit einem Minus.“ Er schwieg. Nickte ein, zweimal. Dann durfte ich gehen.
Für einen kurzen Moment blieb ich noch stehen. Ich blickte zu ihm hoch. Er schaute mich an als wäre ich schwer von Begriff. Was ich noch wolle?
„No, Sir, keine weiteren Fragen.“ Bis auf das Minus hatte ich die Erwartungen erfüllt. Ich sehe mich noch heute, wie ich mich ruckartig umdrehte und wegrannte, raus dem Haus, auf die Straße. Den Nachbarjungs vor dem Basketballkorb kündigte ich mich mit einem lauten Schrei an. Es war mir egal, dass jeder von ihnen ein Kopf größer war. Ich war furchtbar wütend.
Eine Stimme riss mich aus meinen Gedanken. Der Tankschlauch klemmte mal wieder. Ich zerrte daran wie an einer steif gefrorenen Riesenschlange. Mein Kollege, der mit seinen über 100 Kilo fast das Doppelte wog wie ich, brachte mit seinen Pranken Bewegung rein. Punkt halb zwei sollte der Tank voll sein. Wir mussten uns ranhalten. Ich packte den oberschenkeldicken Füllschlauch, setzte ihn an die Tanköffnung, dann zogen wir die Schrauben fest. Ein paar Sekunden später gab ich ein Zeichen, um im gleichen Augenblick zu spüren wie 10.000 Liter Kerosin durch den festen Mantel schossen. Machten wir jetzt einen Fehler, konnte es einen riesigen Feuerball entfachen. Der Gedanke ließ mich angenehm erschauern. Ein bisschen Aufregung, wenigstens. Vor Begeisterung schrie ich so laut als würde ich einen Rodeo-Bullen reiten. Nach ein paar Minuten, als ich keine Lust mehr hatte zu warten, begann ich den frisch gefallenen Schnee im Trommelwirbel meiner Füße hart zu stampfen. Dabei feuerte ich meinen schwerfälligen Kollegen an, er solle mitmachen, aber er winkte lachend ab.
Ansonsten brachte die Arbeit als Verkehrsladeplaner bei Air Canada vor allem eines: Eine körperliche Erschöpfung, die mich nach Dienstschluss meine schweren Stiefel ausziehen und die Beine ausstrecken ließ. Meistens machte ich es mir in meiner Zweizimmer-Wohnung in einem Frankfurter Vorort vor dem Fernseher bequem. Das war mein Leben, schockgefroren wie das Essen in meiner Tiefkühltruhe und so aufregend und vorhersehbar wie das Fernsehprogramm der staatlichen deutschen Rundfunksender. Ich erkannte mich selbst kaum wieder.
Früher, da kam jeder Marschbefehl für meinen Vater so plötzlich und unvorhersehbar wie ein Verkehrsunfall. Ein kompletter Umzug innerhalb weniger Tage – mit allem, was wir hatten, ging es von einer Army-Base zur nächsten. Nicht selten von den USA nach Deutschland und wieder zurück. Jedes Mal packten wir aufs Neue unsere Kartons und ließen vieles hinter uns, das eben noch wichtig und unersetzlich erschien.
Im Alter von 16 Jahren hatte ich bereits sechs transatlantische Umzüge hinter mir und ebenso viele Freunde kennen und wieder vergessen gelernt.
Der erste Schultag in einer neuen, fremden Klasse. Die Anspannung. Stellte ein Lehrer eine Frage, riss ich als Erster den Arm nach oben. Ich wollte alles wissen, sog alles auf wie ein Schwamm. Die Blicke der anderen. Das gegenseitige Einschätzen in Sekunden. Dann die erste Pause. Mein Gegenüber, ein kräftiger, fieser Typ. Schnell einen frechen Witz hinausposaunt bevor er seinen Mund überhaupt auf bekam. Die anderen standen rum und lachten. Die Faust traf den nächstbesten.
Einen, der sich weder mit Worten noch durch seine Physis wehren konnte. Das Recht des Stärkeren. Ein Unrecht, das mich später noch genauso schmerzte wie damals.
Mit jedem Schulwechsel ging mir die Vorwärtsverteidigung mehr in Fleisch und Blut über. Ein kleiner, unbändiger Kämpfer. Meine Waffen waren Worte. Wasserfälle aus Worten.
Lauter, wilder, lustiger sein. Das Heft des Handelns, ich wollte es immer in der Hand behalten.
Die unscharfen Bilder in meinem Kopf, sie drehten sich, bis alles verschwamm. Jetzt nicht erinnern. Zu viel Vergangenheit.
Ein Kessel kochendes Wasser, Deckel drauf. Hey und Goodbye. Verbissen drückte ich gegen die großen Schrauben des Tankverschlusses. Dabei waren sie längst zu.
Über das Rollfeld bewegte sich eine Wolke aus Atemluft und Körperwärme langsam auf mich zu. Mein Kollege keuchte. Leise meckernd begann er, das Werkzeug zu sortieren. Mit seinen vierzig Jahren war er doppelt so alt wie ich. Aber er fühlte sich wesentlich älter. Die Arbeit im Freien bei jedem Wetter, das Be- und Entladen, das schwere Hantieren beim Betanken der Flugzeuge zehrten an seiner Kraft. Bis zur Rente würde er tagein tagaus das gleiche tun – auch wenn sein angeschlagener Rücken ihm immer mehr zusetzte. Eine Alternative gab es für ihn nicht. Ich betrachtete ihn. Es waren auch meine Aussichten.
Während ich nach oben schaute, auf das matte Metall der Tragfläche, spürte ich die feuchte Kälte des Schnees langsam in meine schweren Arbeitsstiefel drängen. Für einen Augenblick gefroren die nächsten vier Jahrzehnte meines Arbeitslebens zu einem einzigen unendlich langen und mühsamen Schichtdienst. Dieser Job war eine Sackgasse. Ich ließ den Schraubenschlüssel sinken. Ein paar Jahre zuvor hatte ich fest daran geglaubt, dass mir jede Karriere offen stehen würde.
Aber mich, einen der Besten meines Highschool-Jahrgangs in den USA, ließ man nicht studieren. Mister Reagan und meine Eltern schienen in den 80ern ein Bündnis geschlossen zu haben.
Die letzten Tage meiner Highschool-Zeit. Ich sah es vor mir, das abgelegene, winzige Nest in den Bergen Virginias, in das mich mein Vater verbannt hatte. Er war nicht mehr mit mir klargekommen. Und ich nicht mit ihm. Denn als die ersten männlichen Hormone die Herrschaft über meine Sehnsüchte übernahmen, wollte ich aus seinem übergroßen Schatten treten.
Ich begann zu revoltieren – mit allem, was nicht in seine soldatische Welt passte.
Er reagierte schnell. Schickte mich ohne zu zögern weg aus Deutschland. Weit weg von den für einen jugendlichen Querulanten so gefährlichen Angeboten einer großen Army-Base. Ich bettelte, ich brüllte ihn an. Es hatte keinen Sinn.
In den Bergen Virginias, wo mein Vater 20 Jahre zuvor als junger Soldat in die Welt aufgebrochen war, schaffte ich unter lauter Hillbillies einen hervorragenden Abschluss. Einer Zulassung an der Georgia Tech University, zu der ich unbedingt wollte, stand nichts mehr im Wege. Ich würde Astrophysik studieren, um das zu tun, wovon ich als Star-Trek-Fan immer geträumt hatte: die Raumschiffe der Zukunft zu bauen. Stattdessen verbaute man mir meine Zukunft.
Meine letzte Highschool gehörte mit 50 Schülern zu den kleinsten. Entsprechend gering fiel die Höhe meines möglichen Stipendiums aus, das von der Zahl der Schüler einer Highschool abhing. Das Geld reichte nicht für große akademische Sprünge. Und das mittlerweile gute Einkommen meines Vaters schloss in den Reagan-Jahren jede Form staatlicher Unterstützung aus.
Blieben meine Eltern. Als sie erkannten, dass ich mich keinen Deut gebessert hatte, machten sie mir klar, dass ich mir das Geld für ein Studium abschminken konnte. Sie nahmen mich mit zu ihrem neuen Wohnort an die Ostküste. Aber die Zeiten von „Yes, Sir - No, Sir“ waren damit endgültig vorbei.
Aus Wut und Trotz wollte ich meinen ersten Sommer in Freiheit erst Recht in vollen Zügen genießen. Es war ein Sommer ohne Grenzen, der den Sturm in mir zeitweilig betäubte.
Aber jeder Rausch endet irgendwann. Meiner endete an einem frühen Morgen in der Nähe eines Strandes in einem nassen mit Abfällen übersäten Straßengraben.
Als ich erwachte und mit unsicheren Beinen aufstand, wusste ich nicht mehr, was ich alles zu mir genommen hatte.
Aber eines wurde mir schlagartig klar: Dieses sinnlose Herumtreiben, das war nicht ich. Ein Blick auf mein mittlerweile leeres Konto zeigte mir zudem, dass etwas passieren musste.
Ich musste mein Leben endlich in eigene Hände nehmen. Es begann eine Zeit der Experimente. Try and Error. Das erste, was mir in den Sinn kam, war die US-Navy.
Seit Kindheitstagen hatte ich auf Militärbasen gelebt, ich wusste genau, was mich erwartete und genoss das, was andere verfluchten: eine knallharte Grundausbildung im eisigen Winter von Chicago, die mich körperlich an meine Grenzen brachte und einer Gehirnwäsche gleich kam.
Kopf auf, Altes raus, Neues rein, Kopf zu.
Das war ganz in meinem Sinne. Ich wollte alles was in mir rumorte, alles, was mich runter zog, endlich loswerden. Ich wollte mich neu erschaffen. Doch das war nicht so einfach, wie ich es mir vorgestellt hatte.
Dass ich nach einer nächtlichen Kneipentour den Jeep eines Vorgesetzten mit einer Latrine verwechselte, war bereits kein gutes Vorzeichen. Ein paar Monate später verwehrte mir dann ein Einstellungsstop für Reservisten endgültig den Zugang zu einer militärischen Karriere. Es blieb bei einer kurzen Ausbildung zum Meteorologen – das Leben schien etwas anderes mit mir vor zu haben.
Ich landete ein paar Hundert Meter entfernt vom Navy-Stützpunkt in einem großen Supermarkt. Dort kümmerte ich mich um die Salatbar. Von irgendetwas musste ich ja leben. Der Lohn reichte jedoch hinten und vorne nicht und ich trat um die Ecke meiner schäbigen Wohnung bald jeden Abend in einem ebenso herunter gekommenen Imbiss als Burger-Brater auf.
Mein Frust wuchs mit jedem Tag und ich begann mich zu bewerben. Was ich als einer der Besten meines Jahrgangs in den USA natürlich erwartete, waren offene Türen, tolle Angebote, glänzende Aussichten. Was ich bekam, waren Absagen.
Tag für Tag, Monat für Monat.
Meine innere Kompassnadel schlug wild in alle Richtungen aus, ich war ohne jede Orientierung. Ich war erst 19 und sah im Spiegel schon einen Verlierer. Ich hasste mein Leben.
Ich weiß nicht, wann ich zum ersten Mal daran dachte.
Aber irgendwann überkamen mich wehmütige Erinnerungen.
An meine Zeit als Highschool-Schüler in Deutschland. Damals hatte ich mir ab und zu mit einem Ferienjob das Taschengeld aufgebessert. Es waren einfache Arbeiten gewesen, gut versichert und gut bezahlt.
Wenn man eine Gesellschaft danach beurteilt, wie gut es sich dort mit einer einfachen Tätigkeit leben lässt, dann erschien mir das Land meiner Geburt unendlich viel voraus zu haben. Und deshalb tat ich es. Wanderte einfach aus, mit einem Seesack voller Hoffnungen. Ich wollte weg, um endlich anzukommen – in einem neuen Leben, in meinem Leben.
Dazu brauchte ich einen ganzen Ozean zwischen dem Jetzt und dem, was kommen sollte.
Mein Kollege stand vor dem Tankwagen und machte mir ein Zeichen. Er wollte zurück ins warme Büro. Und während ich hinüber starrte, schlich sich ein Entschluss in mein Bewusstsein.
Nein, das hier war immer noch nicht meine Zukunft und würde es auch niemals sein. So dankbar ich für diesen Job bei Air Canada gewesen war, der mich vor zwei Jahren bei meiner Ankunft in Deutschland aufgefangen hatte, ich konnte und wollte in meinem Leben mehr erreichen. Dieser Flugplatz durfte nicht mein Landeplatz sein. Ich war noch lange nicht angekommen.
Egal wie mich die Arbeit am Flughafen körperlich forderte, Grenzen hatte ich hier keine erfahren können. Ich war wie ein Dauerläufer, dessen Herzschlag sich beim Laufen nicht beschleunigt hatte, dessen Atem immer im gleichen Rhythmus blieb, obwohl er wusste, dass er ein weit höheres Tempo gehen könnte.
In der Schulzeit hatte ich es genossen, herausgefordert zu werden, mich an die eigenen Leistungsgrenzen heranzutasten. Das Gefühl, eine mathematische Rechnung im Kopf zu lösen und zu glauben, die Synapsen im Kopf vor Anstrengung summen zu hören. Der ganze Körper unter Spannung, das Kribbeln im Bauch, wenn die Lösung nah aber noch nicht erreicht war.
Ja, ich konnte mehr und ich wollte es zeigen, allen anderen und vor allem mir selbst. Am liebsten sofort. Ungeduldig schaute ich mich um, niemand außer meinem Kollegen wartete auf mich. Er stand da wie ein unbeholfener Tanzbär.
Ich begann leichtfüßig um ihn herum zu tänzeln, täuschte an, kniff ihn blitzartig in die Seite. Ich, ein blitzschneller, schmalbrüstiger Derwisch.
„Yeah, come on!“ Er wollte mich wegstoßen, ich tauchte unter seinem schweren Armen hinweg, boxte ihm spielerisch in die offene Flanke.
Ich zappelte umher, die Energie meiner Gedanken brauchte ein Ventil. Mein großer Kollege brummte nur genervt, wie immer, wenn ihm alles an mir zu schnell ging. Ihm war kalt, er wollte weg. Ich lachte ihn aus.
Langsam rollte der automatische Einzug den Tankschlauch zurück. Ein paar Öltropfen landeten mal wieder auf meiner Arbeitshose. In den USA nennt man Menschen, die einen Blau-mann tragen, Blue-collars. Im Gegensatz zu den White-collars, den anderen, denen mit den sauberen Händen und der unbefleckten Kleidung, den Studierten in der Geschäftsleitung.
Jetzt war ich noch Blue-Collar, ich war ein Arbeiter. Mit meiner Muskelkraft aber auch mit meiner schnellen Auffassungsgabe war ich seit zwei Jahren ein kleines, aber notwendiges Rädchen im Getriebe des Airports. Eines, das jetzt am liebsten sofort das Rotieren einstellen und ausbrechen wollte.
Um hier wegzukommen, brauchte ich ein Ziel. Eines, das so groß war, dass es alle Kraft in mir freisetzen würde. Was konnte ich in den nächsten zehn Jahren erreichen? Bis Ende Zwanzig, einem Alter, in dem viele deutsche Studenten gerade ihr Studium abschlossen. Was, wenn ich nicht studieren würde und bis dahin längst selbst Geschäftsführer eines Unternehmens wäre, schoss es mir in den Sinn. Der Gedanke gefiel mir. Ich stellte mich als Chef vor, wie ich irgendwann selbst Studenten einstellen würde.
In meinem Kopf lief ein Film. Bis zu meinem 30. Geburtstag Millionär zu werden, war ich dazu in der Lage? Ich würde es herausfinden. Ich hatte mich in den vergangenen zwei Jahren deutlich unter Wert verkauft. Das würde sich jetzt ändern.
Denn irgendwann wollte ich in die USA zurückkehren – und das nur als erfolgreicher Mann.
Der Tankwagen folgte den aufblitzenden Bodenlichtern zurück zum Terminal. Ich saß am Steuer, während mein Partner schwer schnaufend an seiner Thermoskanne nestelte.
Aufmunternd klopfte ich ihm auf die Schulter. Ich war aufgedreht.
Die kalte Luft hatte mir geholfen ein paar klare Gedanken zu fassen und ich begriff, dass etwas Einschneidendes passiert war. Ich hatte ein Ziel gefunden. In weniger als einem Jahrzehnt wollte ich von einem Arbeiter auf dem Frankfurter Flughafen zu einem Manager mit einer Million Mark auf dem Konto aufsteigen. Ohne Studium und ohne Zeit zu verlieren.
Nichts mehr aber auch nichts weniger als das sollte es sein.
Ich spürte die Magie meines Traums. Meine Flucht nach Deutschland bekäme endlich einen Sinn: Ich würde den American Dream wahr werden lassen. In einem Land, dass seit langem für vieles berühmt ist, nur nicht für seine unbegrenzten Möglichkeiten, vom Habenichts zum Millionär aufzusteigen.
Es gibt Leichteres, dachte ich mir, und trat so plötzlich aufs Gaspedal, dass sich die Hände meines Mitfahrers um die Thermosflasche krampften.
Teil I TEILCHENBESCHLEUNIGUNG
„…durch elektrische Felder auf große Geschwindigkeitenbeschleunigt, erlangen die Teilchen eine Bewegungsenergie,die einem Vielfachen ihrer eigenen Ruheenergie entspricht.“
[Wikipedia]
High-Speed-Engineer
Null oder Eins: Im Herzen einer neuen Welt
Das Erste, was beim Öffnen der Tür in mich drang war ein metallisches Sausen und Schwingen. In großen Schränken drehten sich schwere magnetische Scheiben in hoher Geschwindigkeit, als würden sie wie eine Hubschrauberstaffel abheben wollen. Vom Ende der unterirdischen Halle kam das stoische Brummen von Motoren und über allem lag ein Knistern, das nur eine geballte Masse Elektronik zu erzeugen vermag.
Und dann dieser Geruch. Anders als das zähe Kerosin der Flugzeuge schmeckte Ozon kühl und zugleich verbrannt.
Für einen Moment ging das Licht aus, und wie in der abgedunkelten Kommandozentrale eines Raumschiffes leuchteten unzählige Punkte auf, verschwanden wieder um von neuem aufzublinken, wenn der summende Kreislauf der Signale sie passierte. Ein vielfarbiges Orchester aus Schaltern und Bildschirmen.
Was links und rechts, hinter und neben mir lärmte, atmete und leuchtete, war nichts anderes als die Zukunft.
„Herr Cowden, bitte in den 3. Stock.“ Fast hätte ich die Durchsage überhört. Ich griff nach meiner Tasche mit den Schraubenziehern, die an der Spitze so breit waren wie der Kopf einer Stecknadel und kehrte zurück ins Tageslicht.
Am Flughafen hatte ich zu jeder Sekunde das Wetter gespürt. Hier aber war eine andere, neue Welt. 24 Stunden am Tag herrschte in dem Rechenzentrum der Deutschen Bank mit seinen rotierenden Festplatten, den erhitzten Großrechnern vom Umfang komfortabler Badezimmer und der geräuschvoll arbeitenden Kühlanlage die gleiche angenehme Temperatur, ein endloser Lärm und ein grelles künstliches Licht. Eine laute aber saubere Werkstatt für Angestellte in weißen Kitteln.
Die letzten vier Stufen des Treppenhauses nahm ich mit einem Satz, dann stürmte ich das Großraumbüro im dritten Stock.
Als die schwere Tür hinter mir mit einem Knall ins Schloss fiel, wehte der Zugwind ein paar Papiere von den Schreibtischen.
„Also wirklich“, beschwerte sich eine Frau Mitte Dreißig im Flüsterton ein paar Meter entfernt. Bevor sie sich bückte, hatte ich die Blätter schon wieder auf ihrem Tisch.
„I‘m sorry! Alles in Ordnung?“ Sie rang sich ein halbes Lächeln ab, unschlüssig, ob sie nicht das Recht hatte, noch ein wenig länger pikiert zu bleiben. Gut gelaunt lächelte ich darüber hinweg und mitten hinein in das Großraumbüro vor mir, wo ein paar Dutzend Bankangestellte wie emsige Arbeitsbienen vor sich hin summten. Ich sah zu den vielen Regalen an den Wänden, den riesigen Aktenschränken dazwischen, den meterlangen Ordnerreihen und den Stapeln an Formularen auf den Tischen. Das alles konnte mich nicht täuschen.
1987 hatte die Digitalisierung der Welt längst an Fahrt aufgenommen.
Während Personal Computer seit Ende der siebziger Jahre zu ihrem Siegeszug in die Wohn- und Kinderzimmer angetreten waren, hatte sich in den Unternehmen längst vieles für immer verändert. Die große Zettelwirtschaft ging dem Ende zu. Die unfassbar großen Datenmengen, die Unternehmen jeden Tag produzierten, wurden längst nicht mehr nur auf vergänglichem Papier gespeichert, sondern unsichtbar und virtuell in fensterlosen Hinterzimmern.
Dort, in den großen Rechenzentren mit ihren Tonnen schweren Servern, pochte, angefeuert vom US-amerikanischen Computer-Riesen IBM, immer schneller das Herz der digitalen Zukunft. Wer wusste, was dieses Herz zum Schlagen brachte, war besser als andere dafür gerüstet, die Chancen einer neuen Zeit wahrzunehmen. Und das war ich.
In Deutschland gab es etwa 100.000 PC-Programmierer – aber nur etwa 1.000 Experten, die die Geheimnisse der Großrechner und Sprachen wie ‚Assembler‘ beherrschten, auf die Unternehmen mehr und mehr angewiesen waren.
Neugierig hatte ich bei Air Canada dem einen oder anderen System-Administrator über die Schulter geschaut und mir gewünscht, diese unbekannte Welt von Grund auf zu verstehen.
Mir war klar, dass ich für meinen Traum von einer Karriere etwas können musste, das so komplex war, dass nur wenige andere es verstanden.
Kleine PCs zu programmieren, das schien mir ganz nett, aber nicht ehrgeizig genug; was ich wollte war die maximale Herausforderung. Ich wollte zu einer exklusiven Minderheit gehören: Mainfraime-Programmierer, das waren die Könner, die den Daten und damit auch den Unternehmen und ihren Mitarbeitern den Takt vorgaben, die ganze Systeme am Laufen hielten und immer weiter optimierten.
Ich war zwar nie ein Computer-Nerd gewesen, hatte meine Zeit nicht zuhause hinter geschlossenem Vorhang mit dem Programmieren von Spielen verbracht – der Commodore 64, die Ikone einer neuen Generation, hatte mich nie interessiert.
Aber hey, war nicht in meiner Lieblingsserie Star-Trek der Computer das Herzstück des Raumschiffes Enterprise?
Es war immer die Zukunft mit ihren ungeahnten technologischen Möglichkeiten, die mich faszinierte. Auch wenn ich in diesem Leben wohl keine Raumschiffe mehr bauen würde – die Ausbildung zum Programmierer war die Chance, mein mathematisches Talent in die Waagschale zu werfen. Meine Leidenschaft war astreine unbezwingbare Logik, bei der es nur falsch oder richtig gab und kein Sowohl-als-auch. Null oder Eins.
„Herr Cowden, schauen Sie sich das bitte an. Hier geht nichts mehr!“ Der Abteilungsleiter konnte seinen Frust nicht verbergen.
Um uns herum saßen seine Mitarbeiter, unterhielten sich leise, rührten gelangweilt in ihren Kaffeetassen oder schimpften mit ihrem PC, dem sie den Zusammenbruch des ganzen Systems anlasteten.
„No problem, Sir.“ Voller Tatendrang schaute ich in die Runde, in der einige doppelt so alt waren wie ich. Ihre Programme liefen nicht über den eigenen PC, sondern noch über Server. Die meisten von ihnen akzeptierten nur widerwillig, dass der Erfolg ihrer Arbeit immer mehr von technischen Faktoren abhing. Die zwei Herren am Tisch nebenan beäugten mich kritisch. Ich war schon öfter an ihnen vorbei geeilt. Beide arbeiteten seit zwei Jahrzehnten bei der Deutschen Bank. Ebenso lange saßen sie sich gegenüber. Es amüsierte mich, dass sie sich noch immer siezten.
„Darf ich Sie etwas fragen?“ Ihr Blick sagte mir, dass ich einfach meine Arbeit machen sollte. Aber ich konnte nicht anders und wartete ihre Antwort nicht ab.
„Wann bieten Sie Ihrem Kollegen denn nun endlich das Du an? Solange wie Sie hier zusammenarbeiten, müssten Sie eigentlich doch längst verheiratet sein.“ Erwartungsvoll lachte ich sie an. Eigentlich wollte ich nur die Stimmung ein wenig auflockern.
„Junger Mann, auf Sie wartet Arbeit.“ Mit einem betretenen Schweigen vertieften sich beide wieder in ihren Unterlagen. Ich grinste, etwas betroffen, und drehte mich weg. Diese Steifheit – eine sehr deutsche Eigenschaft, wie ich fand – irritierte mich einfach immer wieder.
Ich hatte keinen festen Arbeitsplan. Aber für einen System-Administrator gab es immer irgendetwas zu tun. Manchmal lief ich einfach nur durch die Büros, weil ich wusste, dass mein Anblick gleich den nächsten Hilferuf auslösen würde. Eines wurde mir bei der Deutschen Bank schnell klar. In einer Welt der Technik mit ihrer scheinbar lupenreinen berechenbaren Logik war das Unvorhersehbare, das Unbegreifliche und damit die menschliche Verzweiflung an der Tagesordnung. Irgendwo funktionierte immer irgendetwas nicht.
Was andere in den Wahnsinn trieb, weckte meine Neugier.
Den Kopf in das Gehäuse eines Rechners zu stecken, eine Idee auszuprobieren und wieder zu verwerfen um aufs Neue einem kniffligen Problem auf die Spur zu kommen und die großen Rechner wieder zum Laufen zu bringen, das war ein durch und durch befriedigendes Gefühl. Und ein neues, kribbelndes Aufputschmittel.
Je schneller etwas erledigt werden musste und je unvorhergesehener es passierte, desto wahrscheinlicher war es bald, dass man nach mir rief. Es war für mich selbstverständlich, da zu sein, wenn man mich brauchte. Und mehr als das, ich wollte jeden Job, bei dem ich mich beweisen konnte.
An einer privaten Schule hatte ich eine einjährige Ausbildung zum Mainfraime-Programmierer absolviert. Eine, die ich selbst finanzierte. Auch deshalb begann ich vom ersten Tag an mit absoluter Konzentration und Hingabe zu lernen. Zurück in der Schule – es hatte sich angefühlt wie eine zweite Chance.
Was ich lernte, war mehr als nur zu programmieren. Während die Lehrer die Inhalte im Stundentakt abspulten und meine zwanzig Mitschüler eifrig alles mitschrieben, kämpfte ich mit der deutschen Sprache. Zu Anfang versuchte ich das, was ich verstand, auf Englisch festzuhalten – eine Transferleistung, die nicht nur ein Chaos auf dem Papier, sondern auch in meinem Kopf erzeugte. Also schrieb ich das, was ich verstand, auf Deutsch nieder, ohne je die Schriftsprache gelernt zu haben.
In meinen Unterlagen entstand ein eigenwilliger, wahrscheinlich nur für mich verständlicher Sprachkosmos.
Auf das, worauf es letztlich ankam, das Verstehen der Programmiersprache und das schnelle Durcharbeiten der dicken, eng bedruckten Handbücher, die fast immer in Englisch verfasst waren, war ich mit meinem Talent für Zahlen aufs Beste vorbereitet. Es fiel mir leicht, schwierigste Logarithmen nicht nur zu begreifen, sondern auch in unterschiedlichen Zusammenhängen anzuwenden.
Was für andere aus meiner Klasse auf den ersten Blick öde Zahlenwüsten waren und auf den zweiten Blick ein verwirrender Dschungel aus unverständlichen Formeln, war für mich eine neue Welt, deren verschlungene Wege voller mathematischer Fallstricke mich faszinierte und die ich voller Entdeckerlust erobern wollte.
Bewaffnet mit Handbuch und filigranen Schraubenziehern streifte ich nun hungrig durch das Rechenzentrum der Deutschen Bank, immer auf der Suche nach der nächsten Herausforderung.
Nur ein paar Hundert Meter entfernt wohnend, genügte ein Anruf, wenn am Wochenende mal wieder ein paar Server ausfielen. Das Gefühl, gebraucht zu werden, ist eine Droge, die sich meist unbemerkt im Körper und Geist ausbreitet, sich dann aber umso wirksamer entfaltet. Bald hatte sie mich fest im Griff und ich hatte nichts dagegen.
Nach einem Jahr verstärkten neue Kollegen unser Team, meist frisch von der Uni. Ich blieb mit Anfang Zwanzig der Jüngste. Es beflügelte mich. Denn was einer wirklich konnte oder nicht, zeigte sich erst, wenn die Plastikwände eines Rechners abgeschraubt waren und bei einer Operation am offenen IT-Herzen des Unternehmens die richtige Lösung gefunden werden musste. Wenn frustrierte und verärgerte Kollegen aus anderen Abteilungen so schnell wie möglich wieder einen einwandfreien Arbeitsablauf wollten. Diesem Druck konnte ich standhalten.
Anders der neue Kollege vor mir, der gerade auf seinen Knien sitzend mit dem Kopf im Gehäuse eines Rechners hin und her zuckte, als würde ihm eine Reihe von Zuschauern den Blick auf die Bühne verstellen. Ich stand daneben. Mit verschränkten Armen versuchte ich mir meine Unruhe nicht anmerken zu lassen. Nur meine Fußspitze tippte einen wilden Takt. Die drei Sachbearbeiter, die uns umringten, hatten uns vor vierzig Minuten gerufen. Seitdem bemühte sich mein neuer Kollege. Meine leisen Ratschläge geflissentlich ignorierend.
Entnervt stand er auf, schob sich die Brille auf der schweißnassen Nase nach oben, um die verzweifelten Kollegen und mich wissen zu lassen, dass man sich die Sache morgen noch mal in aller Ruhe anschauen müsse. Es sei doch etwas komplizierter.
Mir reichte es.
Mein Deutsch war nicht gut genug für ausschweifende Ausreden. Bevor er mich zurückhalten konnte, war ich auf den Knien. Es war sein Job, aber das war mir in diesem Moment egal. Nach ein paar Minuten, begleitet von dem immer noch nach Gründen suchenden Kollegen, hatte ich das Problem behoben.
„Yeaah“, war das Erste was ich rief, als ich wieder stand.
Ich zeigte die Zähne, reckte die Arme in die Luft und ließ mir von den drei Sachbearbeitern gratulieren. Ich konnte nicht anders. Ich brauchte den Wettkampf. Dem verdatterten IT-Experten schlug ich auf die Schulter. „Don‘t worry.“
Dass ein noch so gut Ausgebildeter in seinen ersten Wochen nicht alles wissen konnte, das warf ich niemanden vor. Aber etwas anderes begann mich dagegen zu frustrieren.
Irgendwann war auch zu mir durchgedrungen, dass die vielen Neueinsteiger von Anfang an weit mehr verdienten als ich, obwohl sie über keinerlei Berufserfahrung verfügten – dafür aber über einen akademischen Abschluss und einen Altersvorsprung von etwa sieben Jahren. Was nicht zählte, war die tatsächliche Leistung. Bisher hatte ich nicht über den Wert meiner Arbeit nachgedacht, jetzt horchte ich irritiert auf. Ich fühlte mich ungerecht behandelt. Ein Gefühl, das an meinem Stolz nagte.
Ich wollte, dass die Nachfrage nach meinen Leistungen ihre Entsprechung auf meinem Lohnzettel fand. Das, was für mich raus sprang, für all die an Wochenenden geleisteten Überstunden, war mir auf einmal deutlich zu wenig. Der Sonderbonus für Akademiker, der vorab eine Ausbildung honorierte, ohne dass die Praxistauglichkeit bewiesen war, lief meinem uramerikanischen Verständnis von Wettbewerb zuwider.
Mein Chef, ein gutmütiger Typ um die 50, der seit einer Dekade das Rechenzentrum leitete und sich wahrscheinlich am meisten freute, wenn man ihn in Ruhe ließ, hatte mir in den vergangenen zwei Jahren nie Probleme gemacht, aber auch nicht groß unter die Arme gegriffen. Er hatte mich machen lassen. Das war insoweit gut, als dass ich mir ungestört das aneignen konnte, was ich an Wissen über die Funktionsweise eines Rechenzentrums brauchte.
Jetzt wollte ich sehen, dass er sich als mein Captain für mich einsetzen würde, dass meine tatsächlich erbrachten Leistungen so viel Wert waren wie ein akademischer Abschluss auf dem Papier. Und ja, auch mein Chef sah ein, dass etwas passieren musste.
Zwei Wochen später lud er mich in sein Büro. Als ich eintrat strahlte er über beide Ohren.
„Patrick, ich habe mich für Sie ins Zeug gelegt, ab nächsten Monat gibt es mehr.“ Ich begann mit ihm um die Wette zu strahlen – für ein paar Sekunden. Als er auf meine Frage, wie viel mehr es denn sei, mit 50 Mark im Monat antwortete, hörte ich schlagartig damit auf.
Er freute sich, überhaupt eine Gehaltserhöhung herausgeschlagen zu haben. Ich dagegen empfand das als Beleidigung.
Hatte mich mein eben noch über beide Ohren strahlendes Gesicht wie ein unbedarfter Teenager aussehen lassen, verriet der überraschte Ausdruck meines Chefs, dass meine erstarrten Gesichtszüge jetzt eine ganz andere Seite zeigten.
„Das kann nicht Ihr Ernst sein. Für all das, was ich hier jeden Tag leiste. Für all die Wochenenden, die ich hier verbracht habe. Dafür, dass ich Ihr bester Mann bin, bezahlen Sie mich am schlechtesten? Ich will nur eine Antwort: Schaffen Sie es mir ein gerechtes Gehalt zu ermöglichen, Ja oder Nein?“ Meine barsche Antwort stieß in förmlich zurück in seinen Sessel. Dann schob er sich nach vorne und legte die Unterarme auf den Schreibtisch: „In Unternehmen gibt es Regeln, die ausnahmslos für alle gelten. Dazu gehören auch die vereinbarten Tarifregeln. Sie tun gut daran, das zu akzeptieren.
Auch, wenn Sie es nicht verstehen.“ Er hatte alles gesagt. Ich sparte mir jedes weitere Wort.
Verdammt! Als ich abrupt aufstand, zuckte er zum Abschied nur mit den Schultern.
Auf dem Weg nach Hause wurde ich mit jedem Schritt wütender.
Es schmerzte, gegen diese Ungerechtigkeit nicht anzukommen.
Egal, was ich konnte und wie viel ich leisten würde – bei der Deutschen Bank würde für mich, den Youngster ohne Studium, kein Weg nach oben führen, weder in meiner Position noch auf meinem Gehaltszettel. Die deutschen Tarifregeln, die ursprünglich dafür entwickelt worden waren, um gerechte Löhne durchzusetzen, waren für mich ein äußerst ungerechtes, leistungsfeindliches Karrierehindernis. Eines, das ich so schnell wie möglich hinter mir lassen wollte.
Aufgebracht ging ich Richtung meiner Wohnung. Und übersah diesmal nicht, wie viele Male zuvor, ein Firmenschild:
EMC2. Ich überlegte. Es war eine physikalische Formel.
Energie gleich Masse mal Geschwindigkeit zum Quadrat.
Einstein. Ich kannte die Formel noch aus meiner Schulzeit.
Oder war es aus einer Folge von Raumschiff Enterprise? In diesem Moment konnte ich nicht wissen, dass es der Name einer Firma war, die in den folgenden eineinhalb Jahrzehnten einen sensationellen Aufstieg erleben würde.
Der 1. Januar 2000 an der Wallstreet. An der New Yorker Börse richteten sich die Augen Hunderter Broker gespannt auf einen Mann. In seiner Hand die Schnur einer Glocke. Gleich würde er das neue Jahrtausend einläuten.
Es ist eine besondere Ehre, die Mike Rüdgers zu Teil wurde, dem Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens EMC. Der Aktienkurs des US-amerikanischen Hardware-Herstellers war in den Neunziger Jahren um sagenhafte 39.000 Prozent gestiegen. In einer Dekade, in der die amerikanische Wirtschaft boomte wie nie zuvor, hatte sich das Unternehmen zum erfolgreichsten Wert an der New Yorker Börse entwickelt.
Ende der Achtziger Jahre hätte darauf niemand eine Wette abgeschlossen. Der Riese IBM beherrschte unangefochten den Markt für Computer-Hardware als der unbedeutende Wettbewerber EMC sich daran machte die Verhältnisse zu ändern.
Als Mitarbeiter Nummer 209 fing ich bei dem Unternehmen an, das zur Jahrtausendwende weltweit mehr als 35.000 Mitarbeiter haben sollte. Es war eine Zeit des Aufbruchs – für EMC und für mich.
Mein Aufbruch begann im März 1988. Mein neuer Arbeitsplatz lag nur ein paar Hundert Meter entfernt von meinem vorherigen. Und doch lagen Welten dazwischen. Ging es bei der Deutschen Bank oft so bedächtig und bürokratisch zu wie bei einer Behörde, so schien bei EMC alles in Bewegung zu sein. Überall klingelten Telefone, wurde per Zuruf das nächste Treffen organisiert. Als würden die etwa zwei Dutzend Mitarbeiter der Frankfurter EMC-Filiale, die Verkäufer, Techniker und Vertriebsleute von denen kaum einer über 30 war, alle auf einmal in den öden kargen Gängen und Zimmern umher rennen. Auch wenn ich mit 22 Jahren noch immer einer der Jüngsten war, hier fühlte ich mich endlich unter Meinesgleichen.
EMC war ein amerikanisches Unternehmen, auch in Deutschland. Der Umgangston war locker, man war per Du, und alle schienen es immer eilig zu haben. Es war ihren Augen abzulesen: Jeder meiner neuen Kollegen wollte etwas erreichen und war bereit, mehr dafür zu geben als nur acht Stunden pro Tag. Das war ich, der neue System Engineer, sowieso.
Dennoch war ich überrascht, als mein erster Arbeitstag nicht um 18 Uhr endete, sondern dann erst richtig anfing.
Einer der Verkäufer teilte mir hastig mit, dass ich mit ihm zu einem Kunden müsse. Und zwar sofort. Kaum hatte ich mich versehen, saß ich auf dem Rücksitz eines großen Audi und hielt mich krampfhaft an umzugskistengroßen Speichereinheiten fest, die man mir, mit der Bitte darauf Acht zu geben,
auf den Schoss gelegt hatte. Die Bitte war berechtigt, denn vor mir am Steuer saß ein Verkäufer von der schnellen Sorte, von denen ich in den nächsten Jahren noch viele kennenlernen sollte.
Das erste, was mir an ihm auffiel, war das, was nicht da war: an seiner rechten Hand fehlten drei, an seiner linken zwei Finger – wie er mir ungefragt erzählte, hatte er als Kind gerne mit Feuerwerkskörpern experimentiert. Vorsichtiger war er seitdem keineswegs geworden, seine Behinderung hinderte ihn nicht an einem mehr als gewöhnungsbedürftigen Fahrstil.
Seit unserer Abfahrt in Frankfurt in Richtung Taunus-Berge bretterten wir durch ein weißes Nichts und Frau Holles Arme schienen nicht müde zu werden. Das Schwarz des Asphalts verriet den Verlauf der Straße nur noch in reifendünnen Spuren. Mein Kollege hielt das nicht auf, wir hatten es eilig.
Vor uns lag eine vierstündige Autofahrt über Bundes- und Landstraßen, zu einem Kunden, der auf seine neuen Speichersysteme nicht länger warten wollte. Dort sollte ich die schweren Teile, die langsam aber sicher meine Knie taub werden ließen, installieren.
„Auf welchem Betriebssystem läuft das Ganze eigentlich?“ Ich schrie gegen den Lärmpegel des Autoradios an. Seine Antwort ließ mich kurz stocken: von dem Betriebssystem, das er nannte, hatte ich nicht die leiseste Ahnung. Er drehte sich nach hinten, schaute mich Kaugummi kauend mit offenem Mund an, um plötzlich mit seinem Kopf abrupt zwischen Beifahrersitz und Armaturenbrett zu verschwinden. Vor mir sah ich nur noch drei Finger am Lenkrad und durch die Windschutzscheibe eine Wand aus Schnee. Dass wir für ein paar Sekunden blind fuhren, störte ihn nicht. Dafür knallte mir von vorne ein dickes Etwas gegen meine Stirn.
„Lies dir mal das Handbuch durch. Bis wir ankommen, solltest du das können. Und zwar richtig.“ Auf mich warteten 500 Seiten, randvoll gefüllt mit den Geheimnissen eines mir unbekannten Betriebssystems. Eingezwängt hinter dem Hochleistungspaket auf meinem Schoss, begann ich wie ein Scanner im Speed-Modus die Seiten zu überfliegen. Es war mein erster Tag und ich wollte mich beweisen.
Der Schnee um uns herum schien jedes Geräusch zu verschlucken und ich versank in einer Welt aus Zahlen und Codes, aus der ich nur für kurze Momente erwachte. Meistens dann, wenn der Verkäufer mit einer Hand am Steuer ein halsbrecherisches Überholmanöver vollbrachte und sich nebenbei wieder einmal für einen kurzen Moment, der mir wie eine Ewigkeit erschien, nach hinten umdrehte, um Anekdotisches aus seinem Verkäuferdasein zum Besten zu geben. Nicht ohne Stolz ließ er mich wissen, dass er jedes Jahr im Durchschnitt zwei Wagen demolierte. Schnell zu sein wäre schließlich sein Job.
Was scheinbar weniger zu seinem Job gehörte, war das Verstehen der Technik, die er jeden Tag an den Kunden brachte.
Schon nach kurzer Zeit schienen meine Fragen zu komplex für ihn, dabei ging es um Grundlegendes. Das erstaunte mich:
Musste er nicht mehr verstehen von dem Produkt, das er verkaufte?
Wie sonst konnte er gegenüber Kunden glaubwürdig sein? Er ahnte wohl, was mir durch den Kopf ging.
„Es kommt als Verkäufer nicht darauf an, was du weißt, sondern wie du auftrittst“ ließ er mich sein Mantra wissen und trat aufs Gas.





























