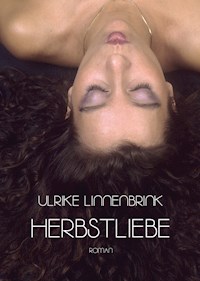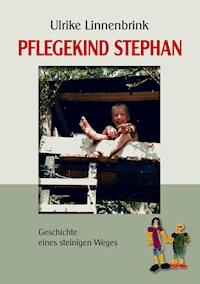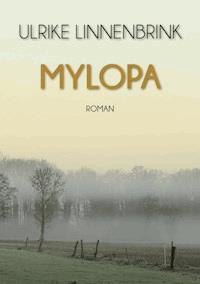
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks Self-Publishing
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Es bedarf schon einer enormen Portion Fantasie, in diesem abgewirtschafteten Bauernhaus, der hässlichen Scheune und dem wildwuchernden Areal die Erfüllung eines Lebenstraumes zu erkennen. Doch für Christine ist es Liebe auf den ersten Blick. Mit Feuereifer macht sie sich zusammen mit ihrem Lebensgefährten Robin daran, Visionen in die Tat umzusetzen, Mylopa nach ihren Vorstellungen umzubauen und aus wilder Wiese einen prachtvollen Garten zu erschaffen. Ein Paradies soll es werden, doch ... Zwischen all den Plänen, die sie enthusiastisch umsetzen, spürt Christine, dass die rissige Fassade ihrer Beziehung zu Robin Tag für Tag heftiger bröckelt. Das drohend aufziehende Unheil, das mit der Mieterin Karin in ihr Leben tritt, erkennt sie zu spät. Und dann gibt es da plötzlich diesen Toten im Wiechholz ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 605
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ulrike Linnenbrink
Mylopa
Roman
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
PROLOG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
EPILOG
Impressum neobooks
PROLOG
Der Waldweg, in dem man Philip damals fand, zieht mich noch immer wie magisch an - immer dann, wenn es mich nach Mylopa treibt. Wie von selbst biegt mein Wagen vom asphaltierten Weg durch das Wiechholz ab, holpert über tief in den Waldboden gegrabene Traktorspuren und rollt zwischen Brombeerranken und verrottendem Holz langsam aus. Manchmal fällt Sonne in schillernden Fäden durch das Laub der Baumkronen, zeichnet Schatten, die mit dem Wehen der Blätter wie geheimnisvolle Waldwesen durch das Unterholz huschen. Insekten flirren in Schwärmen durchs gebrochene Licht, und es duftet nach Moder und feuchtem Moos.
Der Schotter des Wirtschaftsweges knirscht unter meinen Reifen. Ich habe das letzte Stück Asphalt hinter mir gelassen und bin scharf links abgebogen. Steine werden hochgeschleudert, schlagen mir mit spitzem Klacken gegen das Bodenblech und tanzen durch meinen Rückspiegel wie harte Gummibällchen nach rechts in den Graben. Der Wagen sackt in Schlaglöcher, so groß wie kleine Teiche - zur Hälfte mit Wasser gefüllt. Es hat geregnet heute Morgen.
Zur Rechten dann, einige hundert Meter entfernt, das Anwesen von Lilo und Franz. Habe sie eine Ewigkeit nicht mehr gesehen, sie auch nicht vermisst. Damals, seit der Sache mit Harald und Sabine. Die Dächer ihrer Hofgebäude schimmern wie rostrote Farbtupfer durch die Kronen der Obstbäume. Ihre aufbrechenden Blüten übertupfen das Rot der Ziegelpfannen mit zartem Rosa und Weiß. Das sieht hübsch aus an diesem leicht diesigen Nachmittag im späten April. Erinnert an ein verwaschen gemaltes Aquarell.
Davor, auch wie mit Pinselstrichen gezogen, das frische, satte Grün der Weide, auf der damals unsere Hündin Paula zum letzten Mal lebend gesehen wurde. Langmähnige, braune Schottenrinder glotzen nun von ihr herüber.
Die schottischen Rinder gab es zu unserer Zeit noch nicht, die sind neu hier. Auch das fein gezimmerte Gatter mit der eingebrannten Gravur und der beinahe wohnliche Unterstand daneben. Früher grasten auf dieser Weide ganz normale rot- oder schwarzbunte Bullen. Das Land hat ein Schaler Geschäftsmann gekauft, schon vor zwei oder drei Jahren. Weiß ich von Nele, meiner Freundin aus dem Dorf.
"Aber ich hab's nicht selbst gesehen, hab's nur gehört", hat sie gesagt. "Nie wieder setze ich einen Fuß in diesen verdammten Wald oder auf ein Stück Boden in seiner Nähe!"
Dann liegt es vor mir: Mylopa!
Wie eingewachsen in die Natur, versteckt hinter Baumkronen. Bis hinauf über Teile der Dächer eingehüllt in einen Pelz aus Efeu und wildem Wein. Auch die Scheune, die einmal so hässlich war. Fünf Jahre weiter wucherndes Wachstum eben, als sei nichts geschehen. Unbeeindruckt von der Dramatik jener Tage und dem Schmerz danach. Weit weg noch, wie auf einer Postkarte.
Tränen schießen mir in die Augen. Ich kann es nicht verhindern. Halte an und schaue voraus. Streiche mit der Hand über das braune Fotoalbum auf dem Sitz neben mir. Wie über einen Schatz, der endlich wieder bei mir ist. Gefüllt mit Bildern aus der Vergangenheit. Aus einer Zeit, als Mylopa noch uns, zu uns und unserem Leben gehörte.
Endlich habe ich es zurück. Von den Leuten, die nun an meiner Stelle an einem sonnigen Morgen aus dem Haus treten und beobachten können, wie der Frühnebel sich auflöst und den Blick auf den Garten, die Wiesen, den umgebenden Wald freigibt. Die dem Morgengesang der Vögel lauschen, den unbeschreiblichen Duft des Landes genießen und mitten in diesem hinreißenden Konzert der Natur unter der großen Kastanie frühstücken können. An dem runden Tisch mit der steinernen Brunnenplatte. Neben dem Lagerfeuerplatz. Neben dem Badesee.
Sie brauchen diese Bilder nicht mehr. Sie haben inzwischen ihre eigenen. Sind dabei, ein neues Kapitel für Mylopa zu schreiben. Ein riesiges Projekt, mit einem Konzept, das anders ist als zu unserer Zeit. Wenn das neue Mylopa fertig ist, werden Frauen an diesen bezaubernden Ort zu Seminaren kommen. Der ideale Platz für ein Bildungshaus. Einsam, inmitten der Natur. Ruhe und Beschaulichkeit. Ohne Störungen von außen. Ähnlich wie auch Kerstin , die Mylopa nach uns bewohnte, es vorhatte.
Eine "Farm der Sinne" wollte sie daraus machen. Etwas für gestresste Manager, ausgebrannte Lehrer oder herzgeschädigte Banker. Schade, dass es ihr nicht gelungen ist, das Anwesen zu halten und ihre Pläne zu verwirklichen.
Als die Frauen des Bildungsvereines damals eine Gelegenheit sahen, den gepachteten Hof im Dorf endlich aufgeben zu können, in Kerstins Vertrag einstiegen und Mylopa übernahmen, haben sie mich um Fotos oder andere Hinweise auf den 'Urzustand' gebeten. Als Planungshilfe für ihre Architektin. Ich habe ihnen gleich das ganze Album überlassen, und damals war ich froh, es aus der Hand geben zu können, mir diese Fotos nicht immer und immer wieder anschauen zu müssen. Jetzt sind sie zurück bei mir, und die Bilder schmerzen weiter, als sei alles erst gestern gewesen.
Die Bilder werden einen Teil meines Lebens wieder anschaubar, greifbar machen. Einen wichtigen Teil meines Lebens. Den wichtigsten vielleicht.
"Eine von unseren Gärtnerinnen hat sich provisorisch dort einquartiert, damit der Hof nicht allein bleibt", sagte Barbara vom Frauenbildungshaus zu mir. Eben, als ich im Dorf das Fotoalbum bei ihr abholte. "Du weißt ja, dass man ein Anwesen so weit draußen nicht ohne Aufsicht lassen kann. Melde dich erst bei ihr. Du musst verstehen Christine, für sie bist du eine Fremde dort."
Eine Fremde auf Mylopa?!
Ich?
Als wäre das Gelände irgendjemandem vertrauter als mir. Jeder Baum, jeder Strauch - wie eines meiner Kinder. Gebäude, die durch uns damals ein neues Gesicht bekamen. Durch uns. Durch Robin und mich ...
Zögernd lasse ich den Wagen vorwärtsrollen, erreiche die erste große Eiche. Die Weißdornhecke lehnt sich an ihre Rinde und begleitet den Verlauf des Wirtschaftsweges vor dem Haus. Unbeschnitten, zottelig und wild wie das Fell der schottischen Rinder. Hochgeschossen und ohne die Kontur, die sie früher einmal hatte. Ich kann ihn wieder riechen, diesen Duft. Leicht süßlich, wenn der frische Schnitt sein Aroma verströmte, und wenn unzählige Rhododendronblüten unseren Vorgarten in ein summendes Farbbad tauchten.
Fast bedrückend, das Gefühl, wieder in die Einfahrt zu lenken, nach so langer Zeit etwas zu tun, was einmal ganz normal mit dem Heimkommen verbunden war. Beladen mit Einkaufstaschen und -körben. Oder nach der Schule, wenn ich vom Kinderlärm erschöpft und müde wieder zurückkehrte in die Oase der Ruhe. Einer anderen Ruhe als heute. Einer lebendigen Ruhe, die nach innen strahlte und froh machte.
Auch jetzt kein Autolärm, nicht einmal weit entfernt. Keine Düsenjäger in der Luft. Kein Kindergeschrei aus der Scheune. Nichts. Selbst die Vögel scheinen verhalten zu singen. Aber diese Ruhe heute ist kalt. Der Hof liegt da wie tot. Emma und Arco springen nicht vor Wiedersehensfreude kläffend am Zaun hoch. Das Hundegehege ist leer, das Tor weit geöffnet.
Auch im Haus regt sich nichts. Die Scheiben der Fenster sind trüb, voller Schmutz und Spinnweben. Hinter dem staubigen Glas keine kleinen Gardinchen mehr aus feiner Häkelspitze, keine Pflanzen, keine Leuchter und Tongefäße innen auf den Fensterbänken.
Der Wein, der einmal so schwer anwachsen wollte, den wir stützen und gegen die Mauer drücken mussten - wie zerfetztes Tuch hängt er von der Scheunenwand herunter, überwuchert sich selbst und kriecht oben schon über die gewellten Dachplatten. Scheint den hässlich grauen Bau endgültig verschlingen zu wollen. Zauberhaft sieht das aus!
Geradeaus hinter dem Fachwerkstall die alten Kastanien. Eine davon scheint abgestorben. Die, um die ich mir immer schon Sorgen gemacht hatte.
Eine Weile sehe ich mich einfach nur um und fühle, wie mir das Herz bis hinauf in den Hals schlagen will. Dann atme ich ein paar Mal tief durch, steige aus dem Wagen und gehe langsam auf die Wohnung im ehemaligen Kuhstall zu. Hier haben sie ihr Büro, hat Barbara gesagt. Aber es scheint niemand da zu sein. Ich klopfe, rufe nach der Frau, der Gärtnerin, die eigentlich hier sein sollte. Keine Antwort.
Ich will hinüber zum Haupthaus, dorthin, wo einmal mein Zuhause war. Vielleicht ist sie dort und kann mich nicht hören, denke ich. Der Weg von der Betonplatte zum Gartentörchen ist mir jedoch vom Bauschutt versperrt. Ich steige zurück zur Straße, laufe ein Stück daran entlang zum schmiedeeisernen Haupttor. Früher gab es einen sauber geschnitten Heckenbogen darüber. Jetzt muss ich die wild gewachsenen Triebe zur Seite biegen, um hindurchzukommen. Dornröschen-Schloss, denke ich, schiebe vorsichtig die zum Gestrüpp verwachsenen Zweige auseinander und zwänge mich hindurch. Achte darauf, mich an den Dornen nicht zu verletzen.
Über die Natursteinplatten gehe ich auf die Haustür zu. Die Tür müssen sie umgedreht haben. Außen nach innen. Man sieht an der dunklen Verfärbung noch die Stelle, wo innen unser hölzerner Briefkasten gesessen hat. Ich versuche, oben durch die Sprossen-Scheiben ins Innere der Diele zu sehen.
Eine einzige Baustelle dort drinnen. Sie haben den Kachelofen und beinahe alle Wände herausgerissen. Auch die Decken und die Balken darunter. Ich kann durch die Spalten der verbliebenen Bretter bis hinauf auf den Dachboden schauen. Aber unsere aus rauen, roten Klinkern gemauerte Spüle, rechts hinter der Balkenwand in der Küche, die ist noch da! Und geradeaus, dort wo einmal unser erstes Wohnzimmer und später unser Schlafzimmer war, steht noch einer unserer alten Stühle ...
Wieder rufe ich, und wieder nur das Echo vom Wald. Entweder sie ist einkaufen gefahren, oder sie macht einen Spaziergang, denke ich, steige die Eingangsstufen wieder herab und gehe vorbei an den Rhododendronbüschen, herum ums Haus. Lasse meine Augen schweifen und bleibe einen Moment lang am wild verwachsenen Teich unter der Eiche, dem massigen, sicher hundertjährigen Eckpfeiler des Grundstücks, stehen. Dann sehe ich mir die Staudenbeete an. Hier ist nichts mehr übrig von der einstigen Pracht. Der Farn hat in seinem Egoismus alles an die Seite gedrängt und sich großflächig ausgebreitet. Auch dort, wo früher Rittersporn, Phlox und all die anderen Blütenschönheiten in die Höhe geschossen sind. Aber die kleine Kastanie aus Erkenschwick hat sich zu einem beachtlichen Baum entwickelt. Ich kann mich noch gut entsinnen, wie wir ihr fingerdünnes Stämmchen gegen den zuweilen heftig über das Land fegenden Wind stützen mussten. Jetzt ist sie stark genug, um sich selbst dagegen zu wehren.
Am Erker, unserem Fenster zum Süden, blättert die Farbe ab, und die Isolierung darunter hat sich ein wenig gelöst. Die Bretter wölben sich und etwas von der Steinwolle quillt heraus. Wieder quetsche ich meine Nase gegen das Glas.
Hier im Anbau hat sich nur wenig verändert. Die Eichenbalken stehen noch wie massive Fachwerk-Regale vor den Wänden und halten die Bretter der Zimmerdecke. Der Holzfußboden, die Natursteinplatten in der Ecke und selbst der gusseiserne Kamin sind noch da. Nur unsere Möbel fehlen, das flackernde Feuer mit den Hunden davor und das Licht unserer Kerzen. Unser kleiner Phil mit seinen Duplo-Steinen auf dem Schafsfell, Robin mit einem Buch unter der marokkanischen Hängelampe in der Sofaecke und die leise Musik, die bei uns eigentlich immer durch alle Räume zog. Schon wieder dieses beklemmende Gefühl in der Brust. Bis in den Hals hinauf!
Das Bild verschwindet und alles schwimmt hinter einem neuen Tränenfilm. Warum tust du dir das an, Christine? frage ich mich und reiße mich los aus meinen Erinnerungen, weg vom Erkerfenster. Doch es wird nicht besser, als ich hinter der Buchenhecke in den Gemüsegarten schaue und neben dem Törchen liebevoll über Wallis Rinde streiche. Groß ist auch er geworden, unser Walnussbaum. Irgendwann wollte ich zwischen ihm und Erwin, unserem Kirschbaum, einmal eine Hängematte spannen. Im Schatten der vereinigten Kronen lesen und mich leise davon ablenken und in den Schlaf wiegen lassen.
Aber ich war schon fort, als Walli stark genug dazu gewesen wäre. Walnussbäume bleiben lange biegsam. Erwin dagegen hätte die Belastung ausgehalten. Ein Kirschbaum ist eben eher erwachsen als ein Walnussbaum.
Weinend laufe ich weiter über das Gelände. Vorbei am Hühnergehege, das es nicht mehr gibt. Vorbei am Brunnen mit der Handschwengel-Pumpe, vorbei am Essplatz unter der größten Kastanie. Dem mit der Brunnenplatte, in deren Fuß aus Natursteinblöcken wir für die Nachwelt unsere Geschichte, Fotos von uns, zwei unserer abgeschnittenen Haarbüschel und ein paar wichtige Kleinigkeiten eingemauert haben. Vorbei an den Viehwiesen, jetzt ohne Zäune, am Lagerfeuerplatz, am nächsten Teich. Durch das Wäldchen, dessen Baumsetzlinge mir nach dem Pflanzen gerade mal bis zur Stirn reichten, und das nun einige der alten, hohen Kastanien überragt. Bis hin zum Badesee.
Der See ist nach dem Regen der letzten Tage randvoll. Verwittert das Gästehäuschen. Auch hier keine Häkelgardinchen mehr hinter den Fensterscheiben, kalt und leer die Terrasse davor. Überall schießt das Gras in die Höhe. Nur ein kleiner Teil ist gemäht und gibt den Weg frei.
Ich habe einen großen Bogen um das Haus und die Stallungen geschlagen, gehe vom See zurück zur Scheune, an ihr vorbei, bleibe dann vor dem Hundegehege noch einmal stehen. Wo Emma nur sein mag?, frage ich mich. Wir hatten unsere große Hündin bei Kerstin zurücklassen müssen und Arco, Emmas Sohn, verkauft. Dazu wäre Emma schon zu alt gewesen. Niemand hatte Interesse an dem betagten Mädchen, und Kerstin hat die ersten zwei Jahre allein hier verbracht. Sie konnte die große, alte Hündin als Beschützerin gut gebrauchen. Auf diese Weise musste wir nicht auch Emma noch hier herausreißen. Hoffentlich hat Kerstin sie mitgenommen, als sie Mylopa verließ.
Vor der Scheune setze ich mich auf eine Bank und schließe müde die Augen.
Was nur treibt mich immer wieder hierher? Immer wenn es Frühling wird. Jedes Jahr im April. Langsam mit dem Wagen vorbeischleichend, so viel wie möglich mit den Augen verschlingend. Jahr für Jahr? Wie eine Sucht, die nicht in den Griff zu bekommen ist. Nach fünf Jahren immer noch nicht.
1
Nach all den Jahren, den Odysseen von Arzt zu Arzt, von Klinik zu Klinik, nach all den Hormonpillen, Muss-Beischläfen, bei denen von Lust keine Rede mehr sein konnte, nach dem siebenten Fieberthermometer und einer dicken Kladde voller Basaltemperaturkurven, nach allen im Vier-Wochen-Zyklus wiederkehrenden Enttäuschungen - nach all diesem psychischen und körperlichen Stress - endlich ein kleiner grüner Kreis im Röhrchen aus der Apotheke!
Vor Freude fast durchdrehen, morgens, im Bett neben Robin. Ihm das Ding vor die Nase halten. Mein Amüsement über seinen ungläubigen Blick. Sein langsames Begreifen. Gemeinsame Suche nach einem Namen ...
Philip wäre für einen Jungen nicht schlecht ... Ja, wäre nicht schlecht ... Hedda vielleicht für ein Mädchen ... Um Gottes Willen nicht Hedda, das klingt fürchterlich! ... Wieso? ... Irgendwie zappelig. Hedda, Hedda, hör dir nur an, wie das klingt! Diese beiden 'd's hintereinander, schauderhaft! ... Ich finde aber, das hat was nordisch Kühles und ist doch voller Leidenschaft, wie aus einem skandinavischen Melodram ... Ich hab ja gesagt, das klingt mir zu negativ ...
Vertagung der endgültigen Entscheidung. Wir hatten schließlich noch Zeit.
Etwas beunruhigend vielleicht, mein merklich in sich gekehrter Freund und Lebensgefährte Robin. In den Wochen nach dem Testergebnis schien er mir mit seinen Gedanken oft meilenweit weg. Ich fragte mich in manchen Augenblicken, was ihn mir plötzlich so fremd machte, warum er sich mit einem Mal wieder so tief in seine Bücher vergrub, psychologische in der Hauptsache. Doch ich erklärte es mir mit der veränderten Situation, auch für ihn. In neue Situationen musste er sich immer erst einlesen. Rat holen, Unterstützung, Bestätigung, Hilfe. So ging jeder von uns anders mit seinen Problemen um. Er leise, mit dem, was irgendjemand irgendwann einmal zu irgendeinem Problem geschrieben hatte, im Anschluss dann mit sich selbst. Ich eher laut, Freude teilend, mit anderen Pläne schmiedend und weit vorausschauend, kleine Hürden dabei gern übersehend. Vertrauensvoll, gutgläubig.
Ich versuchte, mich nicht einfangen zu lassen von seiner Stimmung, seiner nachdenklichen Ruhe. Das würde ohnehin bald vorübergehen. Dann, wenn sich nach dem inneren Chaos für ihn die Dinge langsam wieder ordneten. Für mich war jetzt schon alles klar, auch ohne psychologische Literatur. Ich wollte mir keine negativen Gedanken machen, mich nicht fragen, ob es gut oder nicht gut sei, dieses Kind zu bekommen. Ich wollte mich nur freuen darauf und auf alles, was damit verbunden war. Endlich würde auch ich mit so einem Bauch herumlaufen, wie im Augenblick - nein, seit Jahren - die meisten jungen Frauen um mich herum. Anscheinend hatten sie sich alle abgesprochen, meine Freundinnen. Eine nach der anderen wurde schwanger, und sie begegneten mir mit dieser geheimnisvoll wissenden, spürenden Mütterlichkeit im Blick und mit diesen aufgetriebenen, blassen Lippen. Jede von ihnen hat sich fast entschuldigt bei mir, wenn es mal wieder so weit war.
Doch jetzt würde alles anders. Jetzt würde auch ich bald die Arme um meinen Bauch schlingen und verträumt lächelnd nach innen horchen. Mit einem Bauch, der Sinn machte, der nicht nur anschwoll, weil ich über den Winter zu viel Schokolade und Nüsse in mich hineingestopft und ein paar Pfunde zugelegt hatte. Jetzt war ich endlich auf der anderen Seite des Lebens, mit 'normalen' Körperfunktionen. So, wie es sich für eine gesunde junge Frau gehörte.
Und jetzt hatte ich verdammt noch mal Blutungen!
"Wir helfen ein bisschen nach", meinte mein Arzt und verschrieb mir ein Hormonpräparat. "Machen Sie sich keine Sorgen, das muss gar nichts heißen." Und dann sprach er nicht weiter, sondern kritzelte in seiner unleserlichen Handschrift auf dem Rezept herum. "Das Präparat nehmen Sie dreimal am Tag." Er reichte mir das Rezept herüber. "Und dann legen Sie sich ein paar Tage hin und schonen sich. Ich schreibe Sie krank." Er füllte mir ein Attest für die Schule aus. Gab es mir auch. "Wenn die Blutungen übermorgen nicht weg sind, melden Sie sich wieder. Unter Umständen schicke ich Sie zur Sicherheit dann doch in die Klinik."
Robin klappte mir die grüne Schlafcouch in seinem Arbeitszimmer auseinander. Sein Arbeitszimmer war der einzige Raum, in dem es bei uns einen Fernseher gab. Ohne Ablenkung wäre ich verrückt geworden. Er blieb bei mir und korrigierte Hefte an seinem Schreibtisch.
"Was ist, wenn ich es verliere?"
"Dann verlierst du es." Er schien automatisch zu antworten, sah dabei weiter die Arbeiten seiner Schüler durch.
Ich ließ das, was er gesagt hatte, ein paar Sekunden in mir nachhallen. "Wärst du nicht traurig?"
Er legte seinen Stift zur Seite und lehnte sich in seinem Stuhl zurück. Sah mich nicht an, sah aus dem Fenster in die beginnende Dämmerung. Draußen trudelten dicke Schneeflocken am Glas entlang, und der dichte, graue Wattehimmel, den ich von meiner Schlafcouch aus im Blick hatte, versprach noch eine Menge mehr davon. "Ich weiß es nicht."
"Du weißt es nicht? Freust du dich denn nicht auch?"
"Ich weiß es nicht. Es hat mich auch erschreckt. Vielleicht habe ich mich im Grunde darauf verlassen, dass es weiterhin nicht klappt. Es war schon so normal, dass es nicht klappte. Vielleicht ist es für mich doch noch ein bisschen zu früh."
"Zu früh? Ich bin dreiunddreißig und du neunundzwanzig! Wann hast du gedacht, soll ich mein erstes Kind bekommen?"
"Ich weiß im Augenblick nicht, ob ich überhaupt ein Kind will. Ich weiß nicht, ob mir die Verantwortung nicht doch zu groß ist. Ich weiß im Moment eben gar nichts mehr."
Er hätte mir genauso gut mit dem Knüppel eins überziehen können.
"Ja, wozu, wieso haben wir denn dann die ganze Maschinerie durchgemacht? Wieso renne ich von einem Arzt zum anderen? Wieso schlucke ich Hormonpillen und prüfe jeden Morgen meine Temperatur? Wieso machen wir unsere Turnübungen, wenn du gar keine Lust auf ein Kind hast?"
"Weil du ein Kind willst", sagte er, drehte sich jetzt zu mir herum. "Weil du ein Kind willst, und weil ich weiß, dass das sehr wichtig für dich ist - aus welchen Gründen auch immer."
"Du machst das alles nur mit, weil ich ...? Alles nur wegen mir?" Ich hielt mir den Bauch. Das, was er gesagt hatte, schien mich dort wie mit kleinen Messern zu treffen. Weiß Gott, er hatte es tatsächlich geschafft, mich von meinen Blutungen abzulenken!
"Ich habe nie einen Zweifel daran gelassen, dass ich Probleme mit meiner möglichen Vaterrolle habe, aber da hast du offenbar nie richtig hingehört. Ich habe ganz einfach Angst zu versagen, zu sehr gebunden zu sein, noch nicht erwachsen genug."
"Doch, doch, ich hab schon hingehört, hab diese Probleme auch verstanden. Probleme mit einer so weitreichenden Entscheidung sind normal für einen Mann wie dich, habe ich immer gedacht. Das legt sich, wenn es erst mal so weit ist. In der konkreten Situation. Er denkt eben auch dieses Thema bis in den letzten Winkel durch. So etwas muss wirklich gut überlegt sein, hab ich gedacht. Ich fand sogar gut, dass du so ernsthaft darüber nachgedacht hast. Abgewogen hast. Und letztendlich hast du doch mitgemacht! Ich hab dich zu nichts gezwungen, oder?"
Es klingelte unten an der Haustür. Fast erleichtert ließ er mich zurück, lief die Treppe hinunter und öffnete. Lautes Gelächter vor der Tür. Unsere Freunde aus der Nachbarschaft, bierlaunig, fröhlich. Ich hatte ganz vergessen, dass Karnevalszeit war. Alles, nur das jetzt nicht! Nicht ein solches Kontrastprogramm!
Er kam wieder nach oben, streckte den Kopf zur Tür herein.
"Hast du was dagegen, wenn ich dich eine Weile allein lasse? Die wollen draußen vor Robert und Sonjas Tür einen Schneemann bauen. Als Überraschung, wenn sie nachher aus dem Kino nach Hause kommen."
"Geh nur, ich bin sowieso müde, ich werde jetzt schlafen." Ich schloss die Augen und drehte mich zur Seite.
"Bist du wirklich nicht böse, wenn ich jetzt gehe?"
"Nein, nein", sagte ich - und als er fort war, weinte ich mich in den Schlaf.
Seltsamerweise hatte ich geschlafen wie ein Stein. Robin brachte mir das Frühstück ans Bett.
"Entschuldige", sagte er, "ich wollte dir gestern mit dem, was ich gesagt habe, nicht wehtun. Ich bin eben nur unsicher im Moment, aber ich wollte dich nicht verletzen. Nur, wenn du mich fragst ... Soll ich lügen? Ich weiß, bei mir klingen die Dinge manchmal zu hart. Natürlich hätte ich nicht mitgemacht, wenn ich überhaupt nicht gewollt hätte, ich bin doch keine Marionette!"
Ich richtete mich auf und stopfte mir das Kissen fester gegen den Rücken. Ließ mir dann von ihm das Tablett auf die Beine setzen. Es war nicht das erste Mal, dass sich für Robin die Dinge von einem auf den anderen Tag in einem ganz anderen Licht darstellten. Seit ich ihm vor vier Jahren während der Referendars-Zeit unserer Lehrerausbildung begegnet war und mich unsterblich in ihn verliebt hatte, mich für ihn von meinem Mann trennte und später scheiden ließ. In all der Zeit hatte ich zwischendurch immer wieder in einem Wechselbad seiner Gefühle gesessen. Mal heiß, mal lau, mal kalt, dann wieder heiß - und so weiter. Nicht leicht, sich jedes Mal neu zu orientieren, von Glück auf Unglück, von Euphorie zu Depression, von wattiger Zufriedenheit hin zu alles infrage stellenden Überlegungen. Zuweilen kam ich mir vor wie ein Chamäleon. Immer wieder die Farbe wechselnd, sich der jeweiligen Situation anpassend. Auch jetzt versuchte ich, mich auf die veränderte Stimmung einzustellen, auch wenn es mir schwerfiel.
"Schon gut. Habt ihr euren Schneemann gestern Abend noch fertigbekommen?"
"Du hättest ihre Gesichter sehen sollen, als sie nach Hause kamen!" Er lachte und goss mir Tee ein. "Sie kamen kaum durch die Tür. Du musst dir das Ungetüm nachher ansehen, bevor du zum Arzt fährst. Wie geht es dir überhaupt?"
Es hatte sich nichts verändert. Auch durch die Medikamente nicht. Durch so etwas wie innere Ruhe schon gar nicht. Nicht nach dem, was Robin gestern Abend gesagt hatte. Gut, er hatte in der Tat schon früher davon gesprochen, dass ihm die Entscheidung für ein Kind nicht leichtfiel. Dass ihn auch Bedenken beschäftigten. Mit der Betonung auf auch. Vermutlich hatte ich ihn dabei nicht ernst genug genommen, weil es daneben diese andere Seite an ihm gab. Diesen Robin, der sich aktiv daran beteiligte, dass aus meinem intensiven Wunsch eines Tages Wirklichkeit werden sollte, der bewusst das gesamte Programm mit mir gemeinsam durchzog. Auch wenn das für ihn, genauso wie für mich, nicht immer die reine Freude war. Dass er mir jedoch nun, da die Situation so eingetroffen war, wie ich es mir ersehnt hatte, so klar und deutlich seine im Grunde ablehnende Haltung offenbarte, hatte mich wirklich verletzt. Ausgerechnet in diesem Augenblick, in dem die lang erwartete Schwangerschaft aufs Höchste bedroht war und die Sorge darum mich tief bedrückte.
Der Arzt überwies mich in die Klinik. Abortgefahr. Weil Robin zur Schule musste, fuhr unsere Nachbarin Sonja mich hin. Der Professor untersuchte mich. Mit den Händen, denn Ultraschall gehörte damals noch nicht zum Routineprogramm.
"Ganz klar intrauterin. Das behandeln wir konservativ." Was so viel heißen sollte wie: Es sitzt dort, wo es hingehört, in der Gebärmutter. Therapie: Spritzen, Bettruhe und Beobachtung. Fast eine Woche lang.
Robin brachte zu einem seiner Besuche Alexander mit, meinen Geschiedenen. "Wie kommen Sie nur an all diese schönen Männer?", fragte mich eine Krankenschwester anschließend.
Ich reagierte gereizt, beleidigt, spöttisch. "Vielleicht bin ich eine Granate im Bett, wer weiß?"
Mitleidiges Kopfschütteln bei ihr. Ich muss wirklich furchtbar ausgesehen haben in diesem Zustand!
Und dann - Robin saß gerade an meinem Bett und hatte mir eine Palette Fruchtjoghurt mitgebracht, das, worauf ich im Augenblick absoluten Heißhunger hatte - dann ging plötzlich alles sehr schnell. Schneidender Schmerz schien meinen Unterleib zu zerteilen, der Joghurtbecher entglitt meinen Händen, ich krümmte mich, griff mit einem entsetzten Schrei nach meinem Bauch, bekam kaum noch Luft.
"Mein Gott, sie wird leichenblass!", schrie meine Bettnachbarin. "Um Himmels Willen, tun sie doch was! Rufen Sie die Schwester!"
Robin stürzte aus dem Zimmer, kam mit der Schwester zurück. Die sah mich, rannte wieder hinaus und eilte kurz darauf zusammen mit einer Kollegin auf mich zu. Sie lösten die Sperren an meinem Bett, schoben es auf den Flur, zum Fahrstuhl, zwei Etagen abwärts, aus dem Fahrstuhl wieder heraus, hinein in einen anderen Flur. Ich wand mich weiter in meinen Schmerzen. Wurde von ihnen überrollt, zermalmt, aufgefressen. Die Ereignisse überschlugen sich. Ich registrierte kaum mehr, was in dieser rasenden Geschwindigkeit mit mir geschah. Nahm alles um mich herum wie unwirklich wahr. Wie durch bizarr verzerrendes Glas, hinter dem ein Film lief, den ich nicht klar erkennen konnte. Zu schnell alles, zu unfassbar! Über mir rasten die Neonlampen der Deckenbeleuchtung vorbei, Stimmengewirr, Klappern von Metall, Geruch nach Äther, aber alles weit weg.
Eine Nadel in meinem Arm, meine Beine hochgerissen in die Halteschalen. Der Professor vor mir. Ganz weit weg auch, was er zu mir sagte. "Ich steche jetzt den Douglasschen Raum an. Wenn Blut kommt, müssen wir sofort operieren ..."
Ein Gesicht über mir. Bis auf die Augen verdeckt hinter einem Mundschutz. Ein Stich mehr, kaum merklich hinter anderem Schmerz, dann Auflösung der Konturen, wegschwimmen, abtauchen, nichts mehr.
Sie hatten Robin nach Hause schicken wollen, aber er war nicht gegangen. Langsam wurde sein Gesicht neben mir wieder deutlicher. Meinen Bauch beschwerte ein Sandsack.
"Ich hab es verloren, nicht wahr?"
Er nickte und griff nach meiner Hand.
"Du kannst froh sein, dass du noch lebst. In deinem Bauch war schon alles voller Blut. Es saß nicht in der Gebärmutter, es saß im Eileiter. Wenn sie dich erst von zu Hause hätten abholen müssen, hättest du es nicht mehr geschafft. Gut, dass du schon hier warst." Er streichelte meinen Arm und rückte näher an mich heran. "Sei nicht traurig, Schatz, vielleicht war es besser so."
"Ja, vielleicht", sagte ich leise und spürte, wie mir Tränen die Wangen herunterliefen. "Vielleicht war es besser so ..."
2
Bis zur Zeit der reifen Kirschen hatte ich mein seelisches Tal einigermaßen durchquert. Meine Trauer war nicht völlig weg, doch ich versuchte, damit umzugehen. Immer noch waren da diese leisen, schmerzhaften Stiche, wenn ich bei Freundinnen in den Kinderwagen schauen durfte, wenn ich den Nachbarskindern beim Spielen zuschaute oder ihr Lachen zu mir herüber drang. Doch diese Stiche verloren mit jedem überwundenen, überlebten Monat etwas von ihrem Schmerz, berührten mich nicht mehr in der anfangs so atemberaubenden Intensität.
Robin bemühte sich sehr liebevoll, mir bei meinem inneren Neuaufbau zu helfen. Er zeigte sich in jeder Hinsicht sehr viel sensibler und in seinem Gefühl mir gegenüber zuverlässiger als zuvor. Wir hatten einen neuen Frühling, befreit vom Kinder-Zeugungs-Stress. Ich entspannte mich und genoss es erstaunlicherweise rasch, mein Augenmerk auf andere Dinge als auf meinen Bauch zu lenken. Auch wenn es nicht endgültig geklappt hatte - es war mir zumindest einmal im Leben gelungen, schwanger zu werden. Zumindest im Ansatz eine Bestätigung meiner Weiblichkeit.
Robin wirkte wie von einer schweren Last befreit. Wir stürzten uns gemeinsam mit unseren Doppelhaus-Nachbarn Robert und Sonja und mit einigen anderen Freunden in die politische Arbeit. Gründeten eine Umwelt- und eine Friedensgruppe. Eröffneten einen Dritte-Welt-Laden. Kümmerten uns um die kommunale Politik vor Ort und hetzten von Termin zu Termin. Fanden mit der Zeit immer neue akute Wunden, in die wir unsere Finger legen, für deren Heilung wir uns einsetzen wollten. Lenkten uns durch die Beschäftigung mit Problemen, die über unseren kleinen Beziehungshorizont hinausgriffen, von unseren eigenen Schwierigkeiten ab. Immer noch ein Wegrennen vor dem eigenen Schmerz, aber es wirkte.
Dann gab es kurz hintereinander zwei Ereignisse, die auf längere Sicht Robins und meinem Leben eine völlig neue Richtung geben sollten.
"Ich hab jetzt das Ergebnis der Untersuchung", sagte Robert an diesem sonnigen August-Nachmittag und legte uns den Brief vom Gesundheitsamt auf den Gartentisch. Wir hatten als Umweltgruppe beschlossen, unser Gemüse auf Schadstoffe testen zu lassen. Nicht weit von unserem Haus und seinen beiden Gärten gab es eine Zinkhütte.
Robert war in seinem Schreiben an das Amt als besorgter, naiv fragender Familienvater aufgetreten. Vielleicht lag es daran, dass wir überhaupt eine Antwort bekamen. Wie wir später erfuhren, haben die zuständigen Mitarbeiter wegen ihrer Offenheit ziemlichen Ärger bekommen, denn natürlich sahen wir uns genötigt, die Ergebnisse der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Dass nichts mehr bedenkenlos zu genießen ist, weiß heute jedes Kindergartenkind. Aber damals, als man rauchende Schornsteine noch als ein Zeichen florierender Wirtschaft bejubelte, als die, die mit dem Finger auf die weniger rosigen Zeichen des Wohlstands zeigten, gern als Nestbeschmutzer ausgegrenzt und der Lüge bezichtigt wurden, war es schon ein Riesenskandal, dass das Untersuchungsergebnis nun – durch unsere Indiskretion - in allen Zeitungen zu lesen war.
Ich stopfte mir den Happen Erdbeertorte in den Mund, schob meinen Teller zur Seite und zog das Schreiben zu mir herüber. Robin rückte an mich heran, legte mir den Arm um die Schulter und las mit.
"Ist ja nicht zu fassen!", rief er. "Dreimal so viel Cadmium in den Möhren wie zulässig."
Laut las ich allen versammelten Nachbarn den Passus vor, in dem es hieß: '... für Kleinkinder ungeeignet ...' "Das muss man sich mal vorstellen!"
"Bei den anderen Gemüsearten, Salat, Grünkohl, Porree und so weiter sieht es zum Teil sogar noch schlimmer aus", sagte Sonja und sah hinüber zum Sandkasten. Johanna und Anna-Lena, ihre beiden Kinder bauten darin mit ihren Förmchen kleine 'Kuchen' und bejubelten gelungene Ergebnisse voller Vergnügen. Unberührt und unbeeindruckt von der Aufregung, die sich unter uns Erwachsenen ausbreitete.
Robin nahm mir den Brief aus der Hand und schüttelte den Kopf. "Es ist wirklich nicht zu glauben. Da bemüht man sich, alles ohne Gift hochzuziehen, natürlich zu düngen, und es geht einfach nicht. Man holt es sich aus dem Boden. Das kann bei den Bauern um uns herum auch nicht anders aussehen. Bei denen kommen der Kunstdünger und all die chemischen Unkraut- und Schädlings-Vernichtungsmittel noch dazu! Wenn ich daran denke, wie viel Schadstoffe sich in unseren Körpern schon summiert haben."
"Selbst der Kompost ist eine einzige Giftbombe", sagte Robert. "Durch die Verrottung und die Schrumpfung des Materials potenzieren sich die prozentualen Anteile der Schadstoff-Rückstände noch." Wenn Robert redete, meinte man oft, man sei in einer seiner Vorlesungen an der Uni Essen. Inzwischen jedoch hatten wir uns an seine Sprache gewöhnt und schätzten seinen Sachverstand.
"Und denkt nur an die Kinder! Stellt euch vor, welche Belastung das später für einen so kleinen Menschen bedeutet, wenn ihre Körper jetzt schon anfangen, dieses giftige, nicht mehr abbaubare Zeug zu sammeln. Ich mag mir gar nicht ausmalen, was das für Johanna und Anna-Lena bedeutet." Auch Sonja war tief betroffen.
Wir dachten alle darüber nach, was zu tun sei und redeten über Flucht. Malten uns Bilder aus vom Leben auf dem Lande, weit weg von allen Giftschleudern des Ruhrgebietes. Allein, nur in mir selbst, fragte ich mich zuweilen, ob nicht auch dieses Gift eine Mitschuld trug an meiner Kinderlosigkeit. Vielleicht reagierte mein Körper zu sensibel, zu empfindsam auf diese Form der Zivilisation, gegen die offenbar auch die Errungenschaften der Medizin nichts auszurichten wussten. Ja, ich spürte immer dringlicher, dass ich weg musste von diesem Ort. Ein erstes Flämmchen begann zu glimmen ...
Im Herbst kam eine ehemalige Kollegin zu Besuch und erzählte voller Begeisterung von einem Haus, das sie sich nach ihrer Versetzung gekauft hatte. "Im Emsland, dort, wo eigentlich kein Schwein hin will, kannst du noch jede Menge billige Häuser bekommen." Und sie rechnete uns vor, wie sie das gemacht hatte. "Bei den Preisen brauchst du entweder kaum oder gar kein Eigenkapital. Zumindest nicht als Beamter, denen schmeißen sie die Kredite ja geradezu nach. Ich musste zwar noch einiges hineinstecken, um es bewohnbar zu machen, aber die finanzielle Belastung ist immer noch niedriger, als die Miete, die ich hier in Erkenschwick gezahlt habe."
Als sie wieder gegangen war, spannen Robin und ich den Faden weiter. Auch wir hatten bis auf zwei blutjunge Bausparverträge zwar eigentlich kein Geld, aber wir waren Beamte. Und wir waren motiviert. Ich ganz besonders.
Das Flämmchen bekam neue Nahrung, wuchs sich zu einem lodernden Feuer aus.
3
Ich weiß nicht mehr, der wievielte Versuch es an diesem Tag war. Aber auf der Apfelwiese vor unserem kleinen Häuschen in Erkenschwick regte sich nach dem Winter das Leben wieder. Pfirsich- und Pflaumenbäume leuchteten rosa und weiß über dem von Tag zu Tag rascher in die Höhe wachsenden Gras. Der immer währende Kreislauf von Werden und Vergehen nahm einen neuen Anlauf, und die Luft des warmen Aprilmorgens war erfüllt von den Düften des Frühlings. Die Nachbarskinder Johanna und Tobias stritten sich um die Schaukel, die Robert aus dem Schuppen gekramt, entstaubt und an den ausladenden Ast eines der alten Apfelbäume gehängt hatte. Dort hing sie in jedem Jahr, und dass sie dort hing, war für alle Bewohner des Krikedillweges wie der Startschuss für das Frühjahr.
Es war Samstag. Robin und ich mussten nicht zur Arbeit in die Schule. Wir hatten vor, wieder einmal loszufahren, um uns einige der Häuser anzusehen, die uns nach unseren Inseraten angeboten worden waren. An solchen Tagen waren wir jedes Mal voller aufgeregter Spannung und hatten keine Mühe, morgens aus dem Bett zu kommen. Liefen nicht - wie sonst üblich - nach dem Frühstück mit der Kaffeetasse in der Hand durch unseren Mini-Garten, um das Wachstum der Nacht zu inspizieren, um unseren Frosch Konrad im kleinen Teich zu begrüßen und zu schauen, ob sich wieder frische Spuren an den Rattenlöchern in unserem Komposthaufen zeigten.
Aufbruchstimmung. Ein neues Ziel, das Veränderungen, Hoffnung versprach. Wie schon so oft in diesem Jahr. Leider waren wir bisher immer enttäuscht zurückgekehrt, ohne auch nur die Spur des Gefühls: Das war es! Das müssen wir unbedingt haben, dafür würden wir hier alles hinter uns lassen! Unsere Umgebung, unsere Freunde. Aber in jeden neuen Versuch setzten wir neue Hoffnung. Jedes Mal waren wir wieder genauso aufgeregt, glücklich, ein neues Ziel zu haben, eine neue Möglichkeit.
"Sind Mütze und Dulle schon im Wagen?" fragte Robin und stellte die Thermoskanne zu dem übrigen Proviant in den Weidenkorb. Unsere beiden kleinen, wuseligen Hunde hatte ich bereits auf dem Rücksitz des Autos verstaut, damit sie uns in der Hektik nicht ständig zwischen den Beinen herumliefen.
"Wir sollten uns beeilen", sagte ich, "Dulle bekaut schon die Sitze. Es ist furchtbar, man kann sie wirklich keine zwei Minuten irgendwo allein lassen. Wenn wir nicht so lange unterwegs wären, würde ich sie lieber nicht mitnehmen."
Unser quirliges Hundebaby hatte ein ausgesprochen analytisches Interesse, sobald man es irgendwo für ein paar Minuten allein zurückließ. Mit Begeisterung nahm es alles auseinander, was seinen spitzen Zähnchen nicht standhalten konnte. Ganz anders als Dulles Mutter, die ich vor vielen Jahren 'Mütze' taufte, nachdem ich sie einem Bauern entrissen und vor dem Ertränken gerettet, sie dann in meiner Wollmütze nach Hause getragen hatte. "Wir sollten uns wirklich beeilen", sagte ich noch einmal und quetschte das Paket mit belegten Broten neben die Thermoskanne mit dem heißen Kaffee.
Robin lachte und hob den Korb vom Küchentisch. "Die Hunde nicht mitnehmen? Hast du nicht gesagt, sie müssen mit entscheiden, wo sie in Zukunft ihre Pinkelplätzchen einrichten wollen?"
Robert und Sonja saßen draußen auf der Bank, unserem gemeinsamen 'Kommunikationszentrum' zwischen den beiden Hauseingängen. Sonja hielt Baby Anna-Lena auf dem Schoß, zog ihr den Sauger aus dem Mund und stellte das Fläschchen mit dem Tee auf den runden Blechtisch davor.
"Geht es schon wieder los?", fragte sie. "Jetzt macht ihr aber Ernst damit, was? Beinahe jedes Wochenende unterwegs? "
"Wir sehen uns erst wieder ein paar Sachen an", sagte Robin. "Vielleicht ist ja auch heute noch gar nichts Schönes dabei."
"Und es muss schon sehr beeindruckend sein, bevor wir das hier aufgeben", sagte ich, sah an der rosenberankten Fassade unseres gemeinsam gemieteten Doppelhauses entlang und fuhr dann dem Baby auf Sonjas Schoß über die Wange.
Es erkannte mich, lachte mich mit seinen wenigen Zähnchen an, streckte mir die kleinen Ärmchen entgegen und stieß ein paar Gigi-Gaga-Ki-Ki-Laute aus. Ki-Ki, das war ich. Christine auf Anna-Lenisch. Leicht würde es mir nicht fallen, alles hier hinter mir zu lassen und die vielen Freunde im Ruhrgebiet nur noch selten zu sehen. Und doch ...
Robin war schon auf dem Weg zu unserem in der Schottereinfahrt geparkten alten VW. Meine quietschgelbe Ente konnten wir heute nicht nehmen. Die war in der Werkstatt. Den VW hatten wir im letzten Herbst völlig abgeschliffen und grün angestrichen. Jede nicht mehr zu vertuschende, immer wieder durch den neuen Lack aufbrechende Rostblüte hatten wir mit einem dieser zur Zeit bei uns sehr in Mode geratenen Umwelt-Aufkleber verdeckt, und so sah unsere ehemalige Rostbeule inzwischen aus wie ein hemmungslos überladener Reklamewagen für Umwelt- und Friedenspolitik.
Vor ein paar Tagen hatten wir eine Annonce aus Hopsten-Schale entdeckt, einem Dörfchen, das uns auf der Rückfahrt von unserer letzten Besichtigungstour durch das Osnabrücker Land äußerst angenehm aufgefallen war. Wie wir später erfuhren, war das auch kein Wunder, denn sie hatten es dort schon mehrmals geschafft, im Wettbewerb 'Unser Dorf soll schöner werden' einen hervorragenden Platz zu belegen.
"Was denn, Sie rufen aus Schale an?", hatte ich den Sohn des Bauern ganz entgeistert am Telefon gefragt. "Ist das nicht dieses entzückende Dörfchen im nördlichen Münsterland? Das mit der romanischen Kirche, (oder war sie gotisch, Robin? Ich werfe das immer durcheinander) und den vielen, hübschen Fachwerkhäusern? Das mit diesem Gasthof Zur Post, dem schon Friedrich der Große einen Besuch abgestattet haben soll? Sprechen wir von Hopsten-Schale...?"
"Das wird es dann wohl sein, aber von romanisch, gotisch oder so hab ich keine Ahnung", hatte er etwas mürrisch gebrummt und den Termin für heute Nachmittag mit mir ausgemacht.
Ich kam mir reichlich fein gemacht vor. Normalerweise lief ich, besonders natürlich an den Wochenenden, aber bis auf wenige Ausnahmen auch in der Schule, in so einer Art Einheitstracht herum. Pumphose mit Latz, möglichst weit und bequem geschnitten, weil ich einige Pfunde mehr wog, seit ich mir das Rauchen abgewöhnt hatte. Dazu T-Shirt und Gesundheits-Sandalen, ab und zu auch ein Halstuch, weil ich am Hals seltsamerweise immer am ehesten fror. Solche Sachen trugen zur Zeit alle Leute, mit denen wir zu tun hatten. Robin sah außerhalb der Schule auch nicht viel anders aus. Latzhose, T-Shirt und bequeme Sandalen.
Für diese Besichtigungstour jedoch hatte ich mir extra einen neuen blauen Rock mit dazugehöriger blau-weiß karierter Bluse und eine blaue Weste gekauft, was dem Ganzen den Eindruck einer beinahe eleganten Kombination verlieh. Dazu trug ich blaue Lederschuhe mit einem kleinen Absatz, der mir beim Laufen Schwierigkeiten bereitete, und ich hatte beim Föhnen an meinen dunklen, widerspenstig krausen, langen Haaren so lange gezogen und gezerrt, bis sie glatt und glänzend auf die Schulter fielen.
Ich fand mich schon fast unangenehm gut gekleidet, fragte mich auch, ob es richtig sei, derart die eigene Persönlichkeit zu vergewaltigen, aber ich hoffte, auf diese Weise bei den fremden Leuten einen besseren Eindruck machen zu können. Auch Robin hatte sich den blonden Vollbart ein wenig gestutzt, war wieder auf bessere Jeans umgestiegen und hatte dazu den flauschigen, grauen Mohairpullover mit den weißen Streifen über der Schulter angezogen. Inzwischen gab es in seinem Schrank eine beträchtliche Auswahl an kreativen Pullovern, die ich ihm bisher aus den unterschiedlichsten, meistens edlen Materialien, mit schon fast süchtiger Begeisterung gestrickt hatte.
Die Landkarte, die wir am vergangenen Wochenende noch brauchten, um diesen verfallenen Kotten bei Bohmte und anschließend, weiter nördlich, das winklig gebaute alte Kötter-Häuschen in Gehrde mit den zwei Linden vor der Haustür (leider auch mit der Schnellstraße in der Nähe) zu besichtigen, war heute nicht nötig. Wir kannten den Weg ja.
Mütze und ihre halbstarke, sehr verwöhnte und ein wenig hysterische Tochter Dulle freuten sich, dass wir endlich zu ihnen an den Wagen kamen, sprangen auf dem Rücksitz durcheinander und brachten sich halb um, so, als hätten wir uns tagelang nicht gesehen. Ich tätschelte beruhigend auf sie ein, verstaute unseren Proviantkorb im Fußraum vor meinem Sitz, und Robin setzte sich hinters Steuer. Die Hinfahrt wollte er übernehmen. Ungern zwar, weil es für ihn kein besseres Schlafmittel als das Autofahren gab, aber ich riss mich auch nicht gerade um den Platz hinter dem Lenkrad, und so musste die Fahrerei irgendwie, und zwar so gerecht wie möglich verteilt werden.
"Na, dann los", sagte er, startete den Motor und winkte mit mir zusammen noch einmal Robert und Sonja zu. Auch die beiden Kinder, Johanna und Tobias hatten sich von ihrer Schaukel getrennt, kamen von der Wiese gerannt und winkten uns hinterher. Dann ließen wir unseren Grünen den kleinen Hügel zur Hauptstraße hinunterrollen und waren auf dem Weg zu unserem neuen Zuhause.
Aber so konkret ahnten wir das natürlich damals noch nicht.
Unsere Bauern hatten sich mitten ins Dorf einen protzigen Neubau gesetzt. Zwischen andere Häuser einer frisch aus dem Boden gestanzten Siedlung. Wir mussten nicht lange suchen, denn zum Glück sind solche Dinge auf dem Lande im Gegensatz zu einem Ballungszentrum wie dem Ruhrgebiet immer sehr gut überschaubar.
Irgendwann gegen vier Uhr, zur Kaffeezeit also, parkten wir auf dem noch lehmigen Randstreifen vor ihrem Haus, ließen die Hunde im Wagen, weil es uns peinlich gewesen wäre, die Leute in ihrem feinen Palast gleich so massiv zu überfallen. Gingen dann langsam auf die doppelflügelige, ebenfalls sehr auffällige Eingangstür zu.
Sie schienen uns trotz der fest zugezogenen, dichten Gardinen bereits entdeckt zu haben und öffneten direkt nach unserem Klingeln. Die komplette Familie hatte sich zu unserem Empfang in der Diele versammelt. Die kleine, rundliche Bäuerin, die uns durch eine Zahnlücke freudig anstrahlte, (wobei man allerdings nicht genau erkennen konnte, wen von uns beiden sie eigentlich ansah, da ihre Augen in zwei Richtungen gleichzeitig zu sehen schienen), ihr hagerer, etwas größerer Mann, der uns durch seine dicken Brillengläser musterte, und ein wenig im Hintergrund ein jüngerer Mann mit dunkel gelockter, üppiger Haarpracht. Offensichtlich der Sohn, der mit mir telefoniert hatte.
Nach der Begrüßung führten sie uns in ihr stilmöbliertes Wohnzimmer. Genauso geräumig, wie wir es von außen her erwartet hatten, mit dicken, holzeingefassten Leder-Sitzmöbeln, einer bombastischen Eichen-Schrankwand und überladenen Wänden. Unser Geschmack war das alles nicht, aber wir wollten ja auch weder dieses Haus noch die Möbel darin kaufen. Die Leute zumindest erschienen uns recht freundlich, und wir ließen uns gern von ihrem Leben 'hinter dem Wiechholz' erzählen.
Dabei erfuhren wir, dass der Hof eigentlich schon verkauft war. Seit einem Jahr gäbe es einen Vertrag mit Leuten, die dort so etwas wie eine Pension, Ferien auf dem Bauernhof, aufziehen wollten, erzählten sie uns. Die Familie wohne mit ihren zwei Kindern auch schon drin, habe auch tatsächlich damit angefangen, den ganzen Kuhstall 'kaputtzumachen', um dort Zimmer für Feriengäste zu bauen. Aber mit dem Geld schien es bei denen nicht so recht zu klappen, und man sei inzwischen doch sehr ärgerlich, zumal auch 'dieses wunderschöne neue Haus' nicht umsonst zu haben war.
Nun sitze man auf den immensen Kosten, müsse auch noch etliche Tausender wegen Aufgabe der Landwirtschaft entrichten, und von dem, was aus dem Verkauf zu erwarten gewesen sei, habe man nach einer kleinen Anzahlung, die man inzwischen aber eher als eine Art Pacht ansehe, keinen weiteren Pfennig mehr zu Gesicht bekommen.
Auf Anfragen habe es von Seiten dieser Leute kaum eine Reaktion gegeben, man habe nur immer wieder um zeitlichen Aufschub gebeten, da die Zuschüsse, die man sich erwartet hätte, nicht so flössen, wie zu Beginn angenommen.
Nun sei das Maß jedoch voll, das habe man denen auch unmissverständlich klar gemacht, und nun seien sie endlich damit einverstanden, dass der Hof neuen möglichen Käufern angeboten werde. Den Kaufvertrag habe man bereits entsprechend geändert.
Damit erübrigte sich die Frage, die uns auf der Zunge lag, ob man denn unter diesen Umständen einfach so zu einer neuen Besichtigung hereinschneien könne. Aber ein bisschen komisch war Robin und mir diese Situation schon. Wir schluckten innerlich, sahen uns an. Dann hörten wir weiter zu.
"Für uns war es doch sehr weit außerhalb", sagte die ehemalige Bäuerin Wanda, "zumal mein Mann schon lange woanders gearbeitet hat. Der ist zusammen mit Horst, unserem Sohn im gleichen Betrieb. Die Tochter ist verheiratet, wohnt auch schon lange nicht mehr bei uns, und so blieb die Arbeit auf dem Hof zum Schluss eigentlich nur noch an mir hängen. Schweine habe ich gezüchtet, bis es nicht mehr ging. Man kann sagen, dass dieses Haus hier", und sie fuhr mit dem Arm einen Bogen durch die Luft, "unter anderem auch mit meinem Schweinegeld finanziert wurde. Aber das wurde mir auf die Dauer zu viel, und als ich schließlich diese Krankheiten bekam, ging es einfach nicht mehr. Ohne Auto saß ich dort fest."
Etwas beunruhigt hakte ich nach. "Sie wurden krank?"
"Ja, so eine Art Krebs", sagte sie verlegen. "Nicht richtig. Eine Vorstufe, hat der Arzt gesagt. An der Gebärmutter. Außerdem noch ein paar andere Sachen." Über die wollte sie jedoch offenbar nicht reden. "Zuerst haben wir gedacht, es käme vom Wasser. Wir hatten dort eine Hauswasserversorgung. Eine Bohrung, über vierzig Meter tief."
"Und?", fragte ich gespannt.
"Wir haben es untersuchen lassen. Mit dem Wasser war alles in Ordnung."
"Ja, am Wasser hat es nicht gelegen. Aber das lohnte sich auch alles nicht mehr", bekräftigte der Bauer, der Horst hieß, wie sein Sohn, und kramte aus der massiven, überreichlich, schon fast erdrückend beschnitzten Eichenschrankwand eine Kiste mit Fotos hervor.
Eine leichte Beunruhigung meldete sich in mir. Doch ich schaltete sie rasch wieder ab, indem ich mir sagte, dass die Menschen zu allen Zeiten und überall krank werden. Ein Schluck Kaffee half mir dabei, dieses eigenartige Gefühl schnell wieder hinunterzuspülen.
Bauer Horst reichte uns einige vergilbte Schwarz-Weiß-Fotos, diese ganz alten mit noch gezacktem Rand, herüber und kommentierte sie.
Dabei erfuhren wir mit Bedauern, dass wir uns auf diesen Bildern Dinge anschauten, die es schon gar nicht mehr gab. Eine niedliche kleine Fachwerkscheune zum Beispiel. Und er erzählte voller Stolz, dass man das 'alte Ding' vor Jahren abgerissen habe, um an die gleiche Stelle einen riesigen, modernen Klotz mit geräumigem Schleppdach zu setzen. "Da passt jetzt wenigstens ordentlich was rein!"
Schade, dachten wir beim Anblick des entzückenden alten Gebäudes. Wie kann man nur?!?
Dann erfuhren wir, dass sie das Gelände auch nicht in langer Familientradition besessen hatten. Bäuerin Wanda kam ursprünglich aus dem Ruhrgebiet, aus der 'Ecke' Gelsenkirchen, hatte hierher geheiratet und zusammen mit der Familie ihres Mannes das einsame Gehöft hinter dem Wiechholz gekauft. Da lebte der Großvater noch, und er züchtete Schafe auf den Wiesen hinter dem Wald. Das habe sich zwar auch nicht gelohnt, aber es sei doch eine recht schöne Zeit gewesen, und die Bäuerin zeigte uns stolz einige der wunderbaren Dinge, die sie aus der Schafswolle gesponnen und gewebt hatte.
Wir fragten nach dem Baujahr und dem Zustand der Gebäude.
Na ja, das ursprüngliche Haupthaus stamme aus den Zwanzigerjahren, aber die Scheune - wie schon gesagt - sei recht neu. Auch die Verklinkerung des Kuhstalles habe man erst vor wenigen Jahren machen lassen, und es gäbe sogar schon doppelverglaste Fenster. Aber eine Heizung? Nein, die gäbe es nicht, zumindest nicht zentral. Da habe man mit Ölöfen geheizt, und das sei doch immer recht praktisch gewesen. "Natürlich war dort im Winter nicht jeder Raum warm, aber das muss ja auch nicht sein."
Robin und ich wechselten einen raschen, verzweifelten Blick.
"Und das Gelände ist tatsächlich siebentausendfünfhundert Quadratmeter groß?", fragte ich, denn nach allem, was ich bisher gehört und gesehen hatte, erschien mir die Größe des Grundstückes noch am verlockendsten.
"Siebentausendfünfhundert", nickte der Bauer. "Wir haben das für diese Auerbachs extra neu vermessen lassen."
"Natürlich gehört das Land drum herum auch noch uns", ergänzte die Bäuerin und lächelte wieder mit unverhohlenem Stolz durch ihre Zahnlücke. "Schließlich wollten wir nicht gleich alles verkaufen."
Robin räusperte sich und schaute auf die Uhr. "Was ist, sollen wir nicht einfach hinfahren und es uns ansehen?"
Ich wollte auch gern fort aus diesem Wohnzimmer, und ich begann, wegen der Hunde im Wagen unruhig zu werden. An unserem alten Grünen war zwar nicht mehr allzu viel zu zerstören, aber man musste ja nicht unbedingt provozieren, dass Dulle ihre Kauleidenschaft dort weiter an den Sitzen austobte. Außerdem hatten wir die beiden nach der relativ langen Autofahrt noch gar nicht auf die Wiese gelassen. Und der gepflegte Rasen vor diesem Prachtbau erschien uns doch einigermaßen unpassend dazu.
Etwas skeptisch, wie uns schien, betrachtete Bauer Horst unseren alten Wagen, bevor er zusammen mit seiner Familie in seinem eigenen aus der Einfahrt fuhr. Mit Sicherheit wären ihm Zweifel auch an unserer Zahlungsfähigkeit gekommen, wenn wir zuvor nicht versichert hätten, dass wir als Beamte jederzeit kreditwürdig seien und zusammen mit unserer Bausparberaterin sogar schon einmal pauschal abgeklärt hatten, in welchen Größenordnungen wir uns finanziell bewegen durften. Dass dies sich durchaus noch im Rahmen des geforderten Kaufpreises befand, hatte ihm ein beruhigtes Lächeln hinter die Brillengläser gezaubert.
Wir hängten uns an und folgten dem Wagen. Einmal quer durch das Dorf, vorbei an einer kleinen Volksbank und einer Firma für Landmaschinen, bogen dann nach links Richtung Fürstenau ab, blieben eine Weile auf dieser schmalen Landstraße, vorbei an einem wunderhübschen Ententeich mit einer kleinen Insel mittendrin und einer mächtigen Trauerweide darauf, und bogen dann in einer scharfen Linkskurve nach rechts in einen asphaltierten Wirtschaftsweg ab.
Schnurgerade, gesäumt von Erlen, Birken, einigen Nadelbäumen auch und wunderschön wilden Hecken, zog er sich auf eine nächste Biegung zu und lief danach weiter wie auf dem Reißbrett gezogen geradeaus, bis er vor einer weit hinten gelegenen Baumgruppe wieder abknickte. Hinter den bewachsenen Böschungen erstreckten sich frisch umgebrochene, braune Felder oder umzäunte Wiesen, so weit das Auge reichte, knallgelb dann und wann, vom blühenden Löwenzahn, immer wieder auch unterbrochen durch kleine Wäldchen oder Hecken. Auf einigen der Wiesen liefen schon Kühe, und vor dem Wiechholz sprang direkt vor unseren Autos ein Rudel Rehe über den Weg.
Die Fahrt kam mir enorm lang vor. So weit weg vom Dorf hatte ich das Ganze nicht erwartet. Aber die Gegend war atemberaubend schön und so einsam, wie ich es mir erträumt hatte. Mag sein, dass solche Einsamkeit nicht etwas für jedermann ist, doch ich war begeistert. Mein Herz machte kleine Sprünge, als wir das Wiechholz durchquert hatten, der Wald nach einer sanften Rechtskurve den Blick auf weitere Wiesen und das einige hundert Meter entfernte Hofgelände freigab.
Da lag es, Mylopa, umgeben von ein paar alten, mächtigen Eichen, Buchen, Birken, Haselnussgebüsch, Holunder und ausladenden Kastanien. Außer der Scheune, deren Schleppdach sich bis etwa auf die Höhe von zwei Metern an den Boden zog, war von den anderen Gebäuden aus dieser Entfernung noch nicht viel zu sehen.
Eigentlich eher hässlich, dieser erste Anblick. Doch das machte nichts, denn die Lage erschien mir dermaßen traumhaft, dass fast gleichgültig war, wie die übrigen Bauten hinter diesem grauen Koloss aussahen. Gebäude konnte man verändern mit der Zeit. Die Lage musste man so nehmen wie sie war.
Unsere Wagen rollten in die Hofeinfahrt, und wir kamen nebeneinander auf einer Betonplatte zum Stehen. Robin und ich blieben einen Moment sitzen und sahen an der mit rotem Backstein verklinkerten Front entlang, verrenkten uns die Hälse, um uns nach dieser beinahe Furcht einflößenden, grau verputzten Scheune mit ihren gewaltigen grünen Schiebetüren umzuschauen.
Bauer Horst hatte seinen Wagen bereits verlassen, kam auf uns zu und rieb sich die Hände beim Gehen. Die Hunde gebärdeten sich wie wild, kläfften ihn an und sprangen gegen die Wagenscheiben. Wir beeilten uns mit dem Aussteigen, klappten die Sitze vor und ließen die kleinen Kläffer hinaus ins Freie. Blitzartig waren beide auf dem Grünstreifen, der die Betonplatte vom Wirtschaftsweg trennte, und sie gingen wie auf Kommando gleichzeitig in die Hocke. Das schien knapp gewesen zu sein!
Die ehemaligen Stallfenster im neueren Teil des Gebäudes waren durch quadratische, moderne, doppelverglaste Fenster ersetzt und hatten Rahmen aus dunklem Merantiholz. Bei einem klebte noch der Zettel mit der Firmenbezeichnung am Glas.
Wir gingen um die niedrige Mauer auf das Haupthaus zu, vor uns die entsetzlichste Haustür, die ich je gesehen hatte. Sie hatte einen noch unverfugten Vorbau, der wohl nachträglich angesetzt war und wie ein unfertiger Klotz wirkte. Das Dach hörte über ihm einfach auf, so dass der Vorbau oben wie abgeschnitten wirkte. Ehe ich jedoch genügend Zeit hatte, diese Eindrücke auf mich wirken zu lassen, wurde die Aluminium-Haustür geöffnet, und zwei kleine Kinder streckten vorsichtig ihre Köpfe heraus.
"Da sind sie, Mami", rief das Ältere der beiden ins Innere zurück. Gleich darauf erschienen zuerst eine junge Frau, die uns mürrisch entgegen sah, und danach ein Mann im grünen Arbeitskittel. Erst wischte er sich die Hände am Kittel ab, dann begrüßte er uns - etwas verlegen, während seine Frau, ein Kind links, ein Kind rechts, beide Arme um deren Schultern schlang.
Ich nickte ihr zu und versuchte dabei ein Lächeln. Aber auch mir war im Augenblick nicht ganz wohl bei dem Gedanken, dass diese Leute in naher Zukunft auf der Straße stehen würden. Ganz gleich, wer dieses Haus nun kaufen würde. Und spontan überlegte ich, wie lange wir ihnen wohl Zeit lassen würden, falls wir das wären.
In der eher bescheidenen, spartanisch möblierten Diele saß man gerade bei Kaffee und Schokoladenkuchen. Der Raum hatte so gar nichts von den Eingangsbereichen, wie ich sie mir bei alten Bauernhäusern vorstellte. Ein ganz normales Zimmer. Billige Pappmaschee-Türen mit Limba-Furnier. In jeder Wand eine. Ich nahm an, dass sie gegen die ehemaligen, massiven Füllungstüren ausgetauscht worden waren, weil man der Zeit folgen und den alten Plunder loswerden wollte. Bauer Horst nickte selbstzufrieden und bestätigte damit meinen Verdacht.
Die Tür an der Stirnwand gegenüber der Alu-Eingangstür mit Riffelglasfüllung führte, wie man uns sagte, in die ehemalige Küche, die gleichzeitig der Durchgang zum Schweinestall war. Wir schauten kurz hinein und entdeckten drei weitere Türen. Eine rechts um die Ecke und zwei links direkt nebeneinander. Durch eine der beiden Zwillingstüren kam man über eine Steintreppe in ein dunkles Kriechkellerloch, hinter der anderen verbarg sich eine kurze, ziemlich vergammelte, teppichbelegte Holztreppe, die hinauf in die Upkammer, direkt über dem niedrigen Kellerraum führte.
Durch die gegenüberliegende Tür ging es nun in einen Wirtschaftsraum, in dem rechts um die Ecke die großen Behälter der Haus-Wasseranlage standen und links, zur hinteren Eingangstür hin, eine Kühltruhe und eine Waschmaschine. Von dort führte eine massive Holztür hinter das Haus in einen zugigen Raum, den überdachten Durchgang zum alten Stall. Aus Bauer Horsts Erzählungen wussten wir bereits, dass diesem alten Fachwerkgebäude um ein Haar das Schicksal erspart worden war, ebenfalls abgerissen zu werden.
Wir kehrten wieder um und schauten uns einen anderen Trakt des Hauses an. Nichts war wirklich schön. Nichts hätte man so lassen können wie es war. Doch mein inneres Auge sah anders. Baute bereits um.
"Eigentlich hatte ich vor, auf Dauer den ganzen alten Kram hier dazwischen wegzuhauen", sagte Bauer Horst, "und Zimmer für Zimmer neu hochzuziehen. Mit diesem hier haben wir angefangen, und wir wollten so lange weitermachen, bis wir den Anschluss an den neuen Kuhstall gehabt hätten."
Um Gottes Willen! Wie gut, dass ihr vorher ausgezogen seid!, dachte ich, schaute aus dem Fenster der besten Stube und bewunderte die ausladenden Rhododendrenbüsche vor dem Haus. Noch hielten sie ihre Blütenknospen fest verschlossen, aber was für eine Pracht mochten sie sein, wenn wir erst Mitte Mai hätten.
Nach einer Weile landeten wir wieder in der Diele bei den Kindern mit den vom Schokoladenkuchen verschmierten Gesichtern. Wir folgten dem Bauern durch die letzte Tür, die von der Diele aus in den neueren Bereich führte. Diesmal ging es in Richtung Kuhstall.
"Hier wollten wir das Frühstückszimmer für unsere Gäste machen", erzählte die junge Frau, und sie sah dabei gar nicht glücklich aus.
Der erste wirklich schöne Raum mit einer Abtrennung aus alten Eichenbalken, etwa zwei Meter dahinter eine frisch gezogene Wand und ein offener Mauerdurchlass zum Stall. Wir befanden uns auf einer inzwischen stillgelegten Baustelle. Von einem langen Mittelflur gingen rechts drei, links zwei kleine Zimmerchen, Duschräume und Toiletten ab.
"Ja, und hier sollten die Leute schlafen und Urlaub machen", sagte der Mann im grünen Kittel, und meine Fantasie richtete sich im Frühstückszimmer schon die Küche ein.
Wir schauten überall kurz hinein, traten schließlich am Ende des langen Flures durch die neue Eingangstür aus Holz und befanden uns wieder draußen vor der Scheune. Ich fühlte mich noch immer erschlagen von diesem Ding. Es schüttelte mich ein wenig, und fast taten mir die beiden Island-Pferde Leid, die hinten im Schleppdach in provisorisch zusammen gezimmerten Boxen standen. Als wir zu ihnen herein kamen, hörten sie für einen Moment damit auf, Heu aus den Raufen an der Wand zu zupfen und schauten sich mit großen, mir traurig erscheinenden Augen kauend nach uns um.
Doch dann geschah es. Wir liefen am Schweinestall und einem daran anschließenden, vor Altersschwäche fast zusammenbrechenden Holzschuppen entlang nach hinten auf das Gelände, und ich weiß noch heute, wie mir beim Blick unter den Kronen der Kastanien hinweg, über die Wiesen bis hinüber zum Wald, fast das Herz stehen blieb. Mich durchströmte ein solches Glücksgefühl wie ich es nie zuvor und selten danach wieder erlebte, und ich bin sicher, dass ich es nie wieder in der gleichen, gewaltigen Intensität erleben werde. Das war ganz einfach Liebe auf den ersten Blick.
Seit diesem Augenblick weiß ich, dass es so etwas gibt. Das Gefühl, endlich irgendwo angekommen und zu Hause zu sein. Etwas, das sich wie eine warme Decke um die Schulter zu legen scheint und eine Geborgenheit gibt, nach der man zeitlebens auf der Suche war. Wie eine warme Woge überrollte mich dieses Gefühl, riss mich mit in einem wilden inneren Sturm, und ich ahnte, ja, ich wusste: Robin ging es ebenso.
Er schaute mich an und lächelte, und auf dem Rückweg, einmal ganz herum um den Schweinestall bis an die südliche Grenze des Geländes, schlang er mir den Arm um die Schulter und zog mich mit sanfter Gewalt an sich heran. Wir hatten beide genug Vorstellungskraft, um im Geiste aus dem unbearbeiteten, von Unkraut überwucherten Land wundervolle Staudenbeete, neue Räume schaffende Hecken und Obstwiesen entstehen zu lassen. Mit vielen immer wieder anderen Gelegenheiten zum Sitzen und der Möglichkeit, aus unterschiedlichen Perspektiven unsere zukünftige Idylle betrachten zu können. Mit Wasserflächen auch, unter der Sonne glitzernd, umgeben von üppiger heimischer Vegetation und vielen der Findlinge, die wir auf dem Weg hierher überall an den Ackerrändern herumliegen gesehen hatten ...
Wir hatten genug gesehen, verabschiedeten uns von Auerbachs, versprachen der Bauersfamilie, dass wir uns bei ihnen melden würden, so bald wir uns endgültig entschieden hätten, luden die Hunde wieder ins Auto und krochen zurück Richtung Dorf. Mussten uns dabei immer wieder umsehen und konnten uns kaum losreißen von diesem Anblick.
Nach ein paar hundert Metern hielten wir an, wendeten in einer Weideneinfahrt und fuhren zurück. Diesmal wollten wir uns alles noch einmal allein und aus der Ferne ansehen. Unsere Wolldecke auf der Wiese ausbreiten, den Picknickkorb aus dem Wagen holen, uns mit Frikadellen, Eiern, Kartoffelsalat, Tomaten, ein paar Broten und Kaffee ins Grüne hocken, essen, schauen und nachdenken.
Die Hunde tobten ausgelassen über den Acker nebenan, und Robin lag auf dem Bauch, hatte das Kinn in die Hände gestützt und sah hinüber zum Hof. "Was meinst du?", fragte er nach einer Weile.
"Ich denke, wir sollten es kaufen", sagte ich und nahm einen Schluck Kaffee. "Wir könnten von unterwegs gleich anrufen."