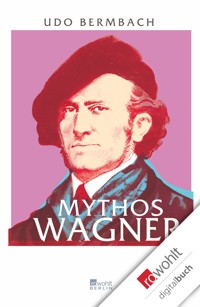
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Richard Wagner ist ein Mythos, nicht nur der Deutschen. Seit über hundertfünfzig Jahren üben sein Werk und sein Leben eine ungebrochene Faszination auf Kultur, Gesellschaft und sogar Politik aus. Wagners künstlerisch revolutionäres Musiktheater hat die Abgründe der modernen Seele ausgeleuchtet und politische Utopien entworfen, es problematisiert den Kapitalismus und wird immer wieder neu gedeutet. Sein Schöpfer wurde zum Gegenstand völkischer Heroisierung, sagenverliebter Idolatrie und klügster Erörterung. Zugleich schafft es Wagner bis heute in die Boulevardpresse, nämlich durch die Festspiele in Bayreuth und ihren gesellschaftlichen Rummel: Der Mythos lebt. Udo Bermbach, einer der renommiertesten Wagner-Kenner, zieht nun nach jahrzehntelanger Forschung Bilanz. Anhand der Lebensstationen Wagners, seiner Werke und der schillernden Festspielgeschichte zeigt er, wie aus Selbststilisierung, Politik und Kalkül der Mythos entstand: wie der Revolutionär Wagner zum Nationalkünstler avancierte, wie die «Ersatzmonarchie» Bayreuth zur Pilgerstätte deutscher Staatsoberhäupter wurde und warum Wagner nicht ohne sein historisches Umfeld zu begreifen ist. Ein glänzend erzähltes, erhellendes Buch über eine deutsche Legende.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 423
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Udo Bermbach
Mythos Wagner
Über dieses Buch
Richard Wagner ist ein Mythos, nicht nur der Deutschen. Seit über hundertfünfzig Jahren üben sein Werk und sein Leben eine ungebrochene Faszination auf Kultur, Gesellschaft und sogar Politik aus. Wagners künstlerisch revolutionäres Musiktheater hat die Abgründe der modernen Seele ausgeleuchtet und politische Utopien entworfen, es problematisiert den Kapitalismus und wird immer wieder neu gedeutet. Sein Schöpfer wurde zum Gegenstand völkischer Heroisierung, sagenverliebter Idolatrie und klügster Erörterung. Zugleich schafft es Wagner bis heute in die Boulevardpresse, nämlich durch die Festspiele in Bayreuth und ihren gesellschaftlichen Rummel: Der Mythos lebt.
Udo Bermbach, einer der renommiertesten Wagner-Kenner, zieht nun nach jahrzehntelanger Forschung Bilanz. Anhand der Lebensstationen Wagners, seiner Werke und der schillernden Festspielgeschichte zeigt er, wie aus Selbststilisierung, Politik und Kalkül der Mythos entstand: wie der Revolutionär Wagner zum Nationalkünstler avancierte, wie die «Ersatzmonarchie» Bayreuth zur Pilgerstätte deutscher Staatsoberhäupter wurde und warum Wagner nicht ohne sein historisches Umfeld zu begreifen ist. Ein glänzend erzähltes, erhellendes Buch über eine deutsche Legende.
Vita
Udo Bermbach (1938 bis 2024) war Professor für Politische Ideengeschichte an der Universität Hamburg. Er galt als einer der versiertesten und originellsten deutschen Wagner-Kenner. Mit seinen Arbeiten zu den Bayreuther Festspielen und der ideologiegeprägten Wagner-Rezeption hat er Maßstäbe gesetzt. Bermbach, der auch Konzeptdramaturg für die Bayreuther «Ring»-Inszenierung von Jürgen Flimm war, veröffentlichte u. a. «Blühendes Leid. Musikdramen» und «Richard Wagner in Deutschland».
Impressum
Rowohlt Digitalbuch, veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, Januar 2013
Copyright © 2013 by Rowohlt · Berlin Verlag GmbH, Berlin
Umschlaggestaltung Frank Ortmann, Berlin
(Umschlagabbildung: Richard Wagner, English School, (20th century) / Private Collection / © Look and Learn / The Bridgeman Art Library)
ISBN Buchausgabe 978-3-87134-731-3 (1. Auflage 2013)
ISBN Digitalbuch 978-3-644-11331-2
www.rowohlt-digitalbuch.de
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
In Deutschland ist Wagner
bloß ein Mißverständnis.
Friedrich Nietzsche
Vorwort
Richard Wagner war eine Ausnahmeerscheinung. In seinem Jahrhundert überragte er alle, die mit ihm konkurrieren wollten. In seinem Schaffen von einsamer Größe, in seinem Denken von folgenreicher Wirkung, in seinem Wollen von eindrucksvoller Stärke, war er ein Genie, das ein Leben lang gegen die Widerstände in seiner Zeit ankämpfte. Mehrfach schien er am Ende, schien finanziell ruiniert und existenziell gebrochen, aber immer wieder gelang es ihm, sein Schicksal zu wenden. Zuletzt brachte er alles zustande, was er sich vorgenommen hatte. Kein Künstler vor ihm war so bedingungslos von sich und seiner Mission überzeugt, war allen Selbstzweifeln zum Trotz von einem so unbeugsamen Willen geprägt, sich und seine Ideen durchzusetzen und ein Werk zu schaffen, das die sich zersplitternde Moderne noch einmal zu einem Ganzen zusammenfügen, der Welt eine kulturell-moralische Erneuerung bringen sollte. Richard Wagner war nie nur Musiker, nie nur Musikdramatiker, nie nur Dichter – er war ein Künstler mit weitausgreifenden Sendungsideen, zutiefst beseelt von der Überzeugung, seine Kunst könne die Wunden einer entfremdeten Moderne heilen und in eine bessere Zukunft führen. Dass er seine Überzeugungen in großen Teilen auch lebte, machte ihn lange vor seinem Tod schon zu einem Mythos.
Den Weg hin zu diesem Mythos erzählt das vorliegende Buch. In einer Mischung aus biographischen und systematischen Beobachtungen werden die Stufen der Entwicklung zum Mythos Wagner nachgezeichnet, zu einem Mythos, der nach Wagners Tod in den Mythos Bayreuth fast nahtlos überging. Wagners eigene Leistungen, seine Selbststilisierungen wie seine Bemühungen um die Popularität seiner Werke sind dabei ebenso Thema wie das Wirken seines Umfelds, von wohlwollender und feindseliger Presse bis hin zu jenen Aktivitäten von Freunden und Gegnern, die ihn alle auf je eigene und durchaus gegensätzliche Weise zu einer exzeptionellen Erscheinung emporhoben.
Erzählt wird auch, wie Wagners Erbverwalter nach seinem Tod den Nachruhm des Komponisten für den Mythos Bayreuth nutzten, wie sie Wagners Ideen und Werke auf ihre eigene, vom «Meister» durchaus abweichende Art weiterentwickelten und dabei die Festspiele als den steingewordenen Ausdruck des Mythos Wagner politisch dem nationalistischen, rechtsradikalen, später nationalsozialistischen Lager andienten und eingliederten. Erzählt wird, wie der Mythos braun eingefärbt wurde, bis er mit dem «Dritten Reich» verschmolz.
Diesen Zustand wieder aufzubrechen, nach dem Krieg neu anzufangen, bedeutete auch eine Abrechnung mit der bis dahin geübten mythischen Überhöhung Wagners. Die «Werkstatt Bayreuth», von Wieland und Wolfgang Wagner als neues Prinzip proklamiert, markierte das Ende des alten Mythos um Wagner und Bayreuth. Als Werkstatt wurden die Festspiele nach ihrer Neueröffnung von 1951 in die demokratisch-pluralistische Gesellschaft der jungen Bundesrepublik eingepasst, in der es den Bonus des kulturellen Vorrangs vor praktischer Politik, der lange Bayreuths Selbstverständnis geprägt hatte, nicht mehr gab. Inzwischen ist Bayreuth in der Normalität einer sich als liberal verstehenden Gesellschaft angekommen und hat ein Wagner-Verständnis etabliert, das einer offenen Demokratie einzig angemessen ist.
Hamburg, im Herbst 2012
1. Vom Mythos Wagner
Abschied vom Meister
Der «Meister» war tot. Am 13. Februar 1883 war er in Venedig gestorben. Schon am Vormittag hatte er sich nicht wohlgefühlt, über Herzkrämpfe geklagt, sich um die Mittagszeit nach einem heftigen Streit mit seiner Frau Cosima in sein Arbeitszimmer zurückgezogen und dort an seiner letzten Schrift, Über das Weibliche im Menschlichen, gearbeitet. Nach dem Satz «Gleichwohl geht der Prozeß der Emanzipation des Weibes nur unter ekstatischen Zuckungen vor sich» glitt ihm, nach einem neuerlichen Herzanfall, die Feder aus der Hand, er rief nach Cosima, die ihn bewusstlos vorfand. Gegen 15 Uhr stellte der Arzt den Tod fest.
Die Überführung der Leiche nach Bayreuth glich den Begräbnisvorbereitungen für einen Herrscher: In einer schwarzen Gondel wurde der Sarg am folgenden Tag zum Bahnhof in Venedig gebracht und dort in einen aus zwei Wagen bestehenden Sonderzug geladen. In Bozen und Innsbruck unterbrach der Zug, in dem Cosima mitfuhr, seine Fahrt, weil Abordnungen und Musiker dem toten Komponisten ihre Ehre erweisen wollten. In Kufstein stieg ein Abgesandter König Ludwigs II. zu, in München waren sämtliche Sänger- und Musikervereine der Stadt im Bahnhof versammelt, und als der Zug seine Fahrt fortsetzte, erklang der Trauermarsch aus der Götterdämmerung. In Regensburg und Weiden erzwangen Abordnungen ein erneutes Halten, und als am 17. Februar der tote Wagner endlich Bayreuth erreichte, stellte die Feuerwehr eine nächtliche Ehrenwache. Am folgenden Tag, einem Sonntag, formierte sich ein unübersehbarer Trauerzug, um den Leichnam vom Bahnhof nach Wahnfried zu geleiten, wo Wagner dann im Garten hinter seinem Wohnhaus seine letzte Ruhestätte fand.
«Ein kleiner Kreis engerer Freunde des Dahingeschiedenen», so schrieb später einer seiner engsten Vertrauten, «stand einsam schweigend im sinkenden Abenddunkel um das frische Grab, nachdem die Trauerfeier lange vorüber war, und der Schnee rieselte leise nieder zwischen den ernsten Pappeln und Büschen ringsum auf die winterlich dürren Epheublätter am Steine, der das teure Eigen der Natur uns barg; da war es wohl kalter, stiller, öder Winter – ; aber in den Herzen der Einsamen und Verwaisten regte sich das Ahnen jenes Geheimnisses: daß das ‹Staub zum Staube› auch ein ‹Leben aus dem Tode› bedeute.»[1] Allen war klar: Man hatte den «Fürsten von Bayreuth zu Grabe getragen»[2], aber zugleich waren sich alle sicher, dass nach seinem Tod sein Werk weiterleben würde, Jahr um Jahr mit stärkerer Wirkung, dass es über Deutschland hinausstrahlen und so der Welt die deutsche Kultur künden würde.
In den Bayreuther Blättern, jener Zeitschrift, die Wagner 1878 noch selbst begründet hatte und die seither von seinem Vertrauten Hans von Wolzogen herausgegeben wurde, deren Aufgabe es sein sollte, dem musikalischen Werk wie vor allem der Weltanschauung Wagners eine möglichst große Verbreitung zu sichern, erschien im April ein Nachruf, dessen zentrale Passagen hier wiedergegeben werden sollen:
«Der Meister, dem diese Zeitschrift ihre Begründung verdankt, ist von uns geschieden. (…) die strenge Bestimmtheit des Todes verpflichtet uns zum treuesten Festhalten an Dem, was uns als eine Schöpfung des von uns Geschiedenen auch in der Gestaltung dieser Blätter hinterlassen ist. Unendlich groß ist unser ganzes Erbteil, und viel haben wir zu tun, es überall gleicherweise rein zu bewahren und sorglich zu pflegen. (…) Ist er von uns geschieden, nichts scheidet uns von Ihm! Gedenken wir seines letzten Mahnwortes, das an uns alle gerichtet ist, die wir zusammenstehen bei der Arbeit für sein Werk: ‹Das Reinmenschliche mit dem ewig Natürlichen in harmonischer Übereinstimmung zu erhalten›, und ‹auf solchem maßvollen Wege besonnen vorzuschreiten›. (…) So wollen wir denn auch daran gedenken, daß wir einem Volk angehören, aus welchem nur während eines halben Jahrhunderts ein Goethe und ein Wagner von hinnen geschieden sind! Zwei Helden – zwei Welten! Zu welcher Treue, zu welcher Arbeit, zu welcher Hoffnung verpflichtet und kräftigt uns dieser Gedanke! Hehre Sterne blicken auf den Weg, den wir zu wandeln haben: Der über allen Sternen waltet, gebe seinen Segen!»[3]
Der Sarg Richard Wagners auf dem Weg durch Bayreuth, 1883.
© Bildarchiv Stiftung Preußischer Kulturbesitz
Das waren die Sprache und der Ton, die zum Mythos Wagner führen sollten. Für den ihn unmittelbar umgebenden Kreis seiner Anhänger, aber auch für die in weltanschaulicher Verbundenheit etwas weiter entfernt lebenden Mitglieder des Bayreuther Kreises war Wagner schon Jahre vor seinem Ableben der «Meister» – und Cosima die «Meisterin». In solcher Betitelung schwang vieles mit, das italienische maestro, in aller Regel herausragenden Dirigenten und Sängern vorbehalten, ebenso wie jene Mahnung von Hans Sachs am Ende der Meistersinger: «Verachtet mir die Meister nicht, und ehrt mir ihre Kunst!» Meister: Das ließ vielfältige Assoziationen zu, vom handwerklich Soliden, der virtuosen Beherrschung der eigenen Kunst bis hin zum singulären Rang eines Auserwählten. Es meinte die charismatische Strahlkraft einer überragenden Persönlichkeit ebenso wie den impulsgebenden Mittelpunkt einer Kunst, einer Kunstreligion, einer weitausgreifenden Weltanschauung. Und es meinte die Person im Zentrum einer Bewegung, um die sich seine Anhänger in konzentrischen Kreisen scharen konnten, mit der stillschweigenden Verpflichtung, bedingungslos für Person und Werk einzutreten.
In seinen Pressekritiken Nüchterne Briefe aus Bayreuth von 1876 bemerkte Paul Lindau: «Es ist charakteristisch genug, daß Richard Wagner, ohne daß man irgendetwas Auffälliges an der doch etwas veralteten Titulatur findet, beständig der Meister genannt wird. Der Meister ist hier nicht im Gegensatz zum Schüler zu verstehen, denn das wäre ja ganz gerechtfertigt, sondern als Magister im Verhältnis zum Famulus. Es herrscht hier eine dienerhafte Unterwürfigkeit, von der man sich kaum eine Vorstellung macht.»[4] Und er fährt fort: «Es kommt mir so vor, als sei die gute alte Zeit des beschränkten Unterthanenverstandes wiedergekommen, und es würde mich gar nicht wundern, wenn ich am Eingang des Festspielhauses dieser Tage ein Plakat angeschlagen fände, das (…) so lautete: Es ziemt dem Festspielbesucher, vor dem Meister in weltvergessener Unterthänigkeit zu ersterben, aber es ziemt ihm nicht, dessen Leistungen an den Maßstab seiner beschränkten Einsicht anzulegen und sich im dünkelhaften Übermuth ein öffentliches Urtheil über dieselben zu erlauben. – Die Rechte des Bayreuther Festspielbesuchers sind ungefähr dieselben wie die des Unterthanen im alten Preußen, die in den beiden Worten wiedergegeben waren: Steuernzahlen, Maulhalten.»
Die ironische Überspitzung macht deutlich, worum es im zitierten Nachruf ernsthaft ging: das Erbe und Andenken sowohl der Person als auch des Werkes, beides von «unendlicher Größe», «rein» zu bewahren und «sorglich zu pflegen». Denn mit Wagner war nach Überzeugung der Hinterbliebenen einer dahingegangen, dessen Werk ein kostbares Vermächtnis barg, das zu hüten den Auserwählten vorbehalten war. Da ging es um eine «hehre» Kunst und deren Botschaft, die wie keine sonst die menschlichen Grundbefindlichkeiten zu ihrem Thema hatte, die das «Reinmenschliche», die unverbildete Natur des Menschlichen, ästhetisch zum Vorschein bringen wollte. Immer wieder sprach Wagner vom «Reinmenschlichen» und bezeichnete damit den «Widerstreit mit den stärksten Interessen der Gesellschaft»[5], meinte «das Wesen der menschlichen Gattung, als solcher», «das von aller Konvention losgelöste»[6] freie Leben, das sich aller historischen Formen entledigt hat. Eine utopische Perspektive ewiger Harmonie von Mensch und Natur wurde da verkündet, deren Propagandist Wagner von seinen Verehrern offenbar nahe bei Gott gesehen wurde. Wie selbstverständlich rief man Gott in jenem Nachruf an, um dessen Segen für die Pflege des Vermächtnisses des Verstorbenen zu erbitten. Wenn zugleich noch die «hehren Sterne» beschworen wurden, dann erinnerte das den literarisch-philosophisch gebildeten Leser der damaligen Zeit an jenes Kant-Wort, wonach der gestirnte Himmel und das Sittengesetz in der eigenen Brust das Einzige seien, das dem Menschen gebiete.
Der Nachruf verdeutlicht: Die religiös eingefärbte Sprache hob Wagner und sein Werk in eine Sphäre, die ihn der irdischen Zugehörigkeit entzog. Der «Meister» erschien vielen gleichsam als Erlöser, was seine Anhänger zu «Jüngern» machte. Was als Nachruf formuliert wurde, erinnerte in Duktus und Metaphorik an religiöse Gemeinschaften, die ihrem Stifter oder einem Propheten folgen und nur einen Lebensinhalt kennen: die Verkündigung der «frohen Botschaft». Mythische Höhen wurden hier angezielt, ohne dass das Wort Mythos selbst fiel. Aber dass es sich um einen Mythos handelte, den man beschwor, steht ganz außer Frage.
Nachdenken über den Mythos
Doch was ist ein Mythos, und wie entsteht er? Bezieht der Mythos sich auf einen Sachverhalt, eine große Erzählung, ein lange zurückliegendes Geschehen, das immer wieder von den nachfolgenden Generationen erzählt und verklärt wird, ausgeschmückt und in seiner Bedeutung mehr und mehr gesteigert? Und wie kann ein Mensch mythische Qualitäten erlangen, wie können ihn seine Begabung, sein Genie, seine in jeder Hinsicht einzigartige Persönlichkeit in eine Sphäre einrücken, die den Zurückbleibenden nur noch staunende Bewunderung und sprachlose Verehrung zugesteht? Fragen über Fragen, die sich freilich aufklären lassen, wenn sich die einzelnen Entwicklungsstufen hin zur mythischen Erhabenheit aufzeigen lassen.
In seiner theoretischen Hauptschrift Oper und Drama von 1851/52 hat Wagner selbst ausführlich vom Mythos gehandelt und ihn, in einer vielzitierten Formulierung, so bestimmt: «Das Unvergleichliche des Mythos ist, daß er jederzeit wahr, und sein Inhalt, bei dichtester Gedrängtheit, für alle Zeiten unerschöpflich ist.»[1] Das bezog sich zunächst einmal auf die Wahl der Stoffe für seine Musikdramen. Wagner wollte keine historischen Vorlagen mehr wählen, wie es in der grand opéra seiner Zeit üblich war. Diese hatte große historische Tableaus auf die Bühne gestellt, beeindruckende historische «Gemälde» dargeboten, geschichtliche Großkonflikte dramatisiert und mit alledem, Abend für Abend, ein auf Sensationen erpichtes Publikum in ihren Bann geschlagen. Da gab es in Daniel-François Aubers La Muette de Portici (1828) den Aufstand der Neapolitaner gegen ihre spanischen Besatzer von 1647 zu sehen, in Jacques Fromental Halévys Oper La Juive (1835) die scharfe Konfrontation von Christentum und Judentum auf dem Konzil von Konstanz 1414, in Giacomo Meyerbeers Les Huguenots (1836) die Ermordung Tausender protestantischer Hugenotten anlässlich der Pariser «Bluthochzeit» des evangelischen Heinrich von Navarra mit der katholischen Margarete von Valois 1572 und in seinem Le Prophète (1849) die Geschichte der Wiedertäufer in Münster von 1536 – um nur einige, besonders erfolgreiche Große Opern zu nennen. Doch Wagner brachte all diesen Werken nur ein äußerst begrenztes Interesse entgegen, konnte sie nicht als Vorbild für die eigenen Arbeiten akzeptieren.
Denn aus seiner Sicht waren diese Stoffe nur von eingeschränktem Aussagewert. Was da auf der Bühne zu sehen war, musste vor dem jeweiligen Zeithintergrund verstanden werden, war also kontextabhängig und Wagner zufolge deshalb ungeeignet, überzeitliche Konflikte der Menschen vorzuführen. Für die Darstellung von Problemen der Gegenwart waren solche historischen Beispiele für ihn nahezu wertlos. Was sich in der Vergangenheit ereignet hatte, musste, wie Wagner fest glaubte, keineswegs für die Zukunft und für alle Zeiten gelten. Wenn es denn Lehren der Geschichte gab, dann konnten sie jederzeit durch neue Erfahrungen überholt werden. Geschichtliche Beispiele hatten deshalb eine kurze Verfallszeit, sie konnten schnell Patina ansetzen und kaum auf ein dauerhaftes Interesse beim Publikum hoffen.
Ganz anders dagegen der Mythos, der – so wie Wagner ihn verstand – aufs Grundsätzliche zielte, das Archetypische der menschlichen Existenz zum Vorschein brachte, jenes von ihm als Ziel seiner Kunst verstandene «Reinmenschliche». Mythen erzählten ewig gültige Geschichten, ihre Stoffe waren Beispiele für das, was sich zu allen Zeiten unter Menschen immer wieder ereignete. In Mythen wurden Grundkonflikte behandelt, die großen Widersprüche der Menschen von Leben und Tod, von Liebe und Verzweiflung, von Macht und Unterwerfung, von Verantwortung und Verantwortungsflucht – Gegensätzlichkeiten, die sich kaum auflösen und versöhnen lassen. Daher hatte der Mythos etwas zutiefst Tröstliches: Indem er den Menschen vorführte, dass es immer schon grundlegende Konflikte gegeben hat, relativierte er deren eigene, half ihnen, sich nicht allein zu fühlen, trug dazu bei, ein schweres Los zu bewältigen. Zugleich machte die Wiederkehr der immer gleichen Konflikte deutlich, weshalb Mythen «jederzeit wahr» waren, wie Wagner es formulierte. Sie konnten daher jederzeit hervorgeholt, bearbeitet und aktualisiert werden. Eben weil der Mythos in seiner Substanz unabhängig und unbeschädigt blieb vom Wandel der Zeiten, weil er in sich festgefügt war, jenseits der Vergänglichkeit geschichtlicher Erscheinungen und Ereignisse.
In Wagners Sicht – und darin stimmt er mit heutigen Mythenforschern überein – besteht der Mythos aus einem harten narrativen Kern, aus stets gleichbleibenden Elementen einer inneren Erzählung, um die sich eine Vielzahl variierender Ausdeutungen legt, ähnlich wie Jahresringe um den Kern eines Baumes. Die gleiche Geschichte kann in immer neuen Ausschmückungen berichtet und dadurch auch ständig neu hergestellt werden – ganz so, wie im Ring des Nibelungen die Geschichte Wotans mehrfach erzählt wird, aber jedes Mal leicht abgewandelt. Es ist diese schillernde Vielfalt des Neuerzählens, der voneinander abweichenden Perspektiven, die es erlaubt, einen mythischen Stoff umstandslos in die Gegenwart zu holen. Es ist diese plastisch formbare Eigenschaft, die den Mythos, wie Wagner sagt, «für alle Zeiten unerschöpflich» werden lässt, ihn zum idealen Stoff macht für Dichter und Komponisten, die der Nachwelt Allgemeingültiges überliefern wollen. Das erklärt, weshalb Wagner nach seinem Rienzi von 1840, der sich mit dem Schicksal eines römischen Volkstribuns einer historischen Vorlage bediente, die freilich selbst bereits mythische Züge angenommen hatte, seinen Musikdramen keine weiteren historischen Stoffe mehr zugrunde gelegt hat. Selbst die Meistersinger, die oft als historische Oper verstanden werden, greifen zwar auf historische Vorlagen zurück, erzählen dabei aber vom Mythos der Kunst und thematisieren diesen vor dem Hintergrund eines mythisch verstandenen Nürnberg. Die Oper lässt also jegliche geschichtliche Einbindung weit hinter sich. Seit dem Fliegenden Holländer hat Wagner seine eigenen Mythen, also Kunst-Mythen, geschaffen, am beeindruckendsten sicherlich mit der Ring-Tetralogie sowie mit Tristan und Isolde und Parsifal.
Dass Wagners Mythentheater eine so nachhaltige Wirkung weit über den Rahmen des üblichen Theaters hinaus entfalten konnte, hängt auch mit spezifisch politischen Enttäuschungserfahrungen der Deutschen zusammen, vor allem mit der immer wieder uneingelösten Hoffnung auf einen gesamtdeutschen Staat. Dieser kam weder nach den Napoleonischen Kriegen 1815/19 noch nach der Frankfurter Paulskirchenversammlung 1849 zustande, sondern wurde erst 1871 durch Bismarck «von oben» realisiert. Wann immer die auch von Wagner gestellte Frage auftauchte, was denn deutsch sei, konnte sie nicht politisch, sondern nur mit dem Verweis auf die gemeinsame Sprache und die gemeinsame Kultur beantwortet werden. Die Deutschen waren – das hat ihre Geschichte bis in das 20. Jahrhundert hinein entscheidend geprägt – eine «Kulturnation» (Friedrich Meinecke), die sich unterschied und abgrenzte von den «Staatsnationen» der westlichen Nachbarn. Man war stolz auf die weltweite Anerkennung der eigenen Kulturleistungen, stolz auf die ausländische Bewunderung der Weimarer Klassik und Romantik, besonders aber stolz auf die weltweite Geltung der deutschen Musik: Bach, Haydn, Gluck, Mozart, Beethoven, Weber und all die unzähligen weniger bedeutenden, aber höchst produktiven Komponisten, die das deutsche Musikleben prägten und selbst die Vorherrschaft der deutschen Musik im Ausland sicherten – etwa durch Meyerbeer oder Offenbach in Frankreich. In ihrem Selbstverständnis wie auch im Bewusstsein anderer Völker waren die Deutschen das Musikvolk par excellence.
Musik aber war eine internationale Sprache, und wer sie sprach, nahm eine hervorgehobene Stellung ein.[2] So entwickelte sich der Mythos von der deutschen Musik, der sich im 19. Jahrhundert auf den beispiellosen Aufstieg der deutschen Instrumentalmusik, der Kammermusik, der Sinfonik, des Instrumentalkonzerts, bald auch der deutschen Oper und nicht zuletzt auf ein durch die Verbreitung des Klaviers ermöglichtes breites bürgerliches Musizieren im eigenen Heim stützen konnte. Kein Wunder, dass bedeutende ausländische Komponisten wie Frederick Delius, Edward Grieg oder Leoš Janáček nach Deutschland kamen, ab 1843 häufig in das von Mendelssohn Bartholdy gegründete, bald weltberühmte Leipziger Konservatorium, um die blühende deutsche Musik an der Quelle zu studieren. Kein Zweifel auch, dass «keine Kunst sich im 19. Jahrhundert für den ästhetischen Diskurs eine vergleichbar zentrale Stelle erworben und diese auch genossen (hat) wie die Musik»[3].
In diese Lage hinein schuf Wagner seine mythischen Stoffe, die noch einmal, zusätzlich zur Musik, auch die eigenen vorzeitlichen und mittelalterlichen Traditionen beschworen, auf die man bei der Suche nach der nationalen Identität zurückgreifen konnte. Der Mythos der Musik verband sich hier mit den Mythen der Deutschen, die gerade neu entdeckt wurden, den germanischen Sagen, den großen mittelalterlichen Epen, die sich in den gebildeten Schichten rasch verbreiteten, weil ihre Leser die eigene Vergangenheit in ihnen wiederfanden. Dass Wagner beides zusammenfügte, war unter strategischen Gesichtspunkten optimal: Musik als der eigentliche Ausdruck des «deutschen Wesens» kam hier zusammen mit einer aus der Geschichte herausgelesenen, sehr spezifischen und heldischen Tradition, und beides war geeignet, die Unsicherheit über die Frage, was eigentlich deutsch sei, zu beenden und überdies die Überlegenheit dieser deutschen Kultur zu garantieren.
Doch es stellt sich die Frage, ob Wagners Mythos-Vorstellungen und Mythos-Verarbeitung sich auch auf seine eigene Person beziehen lassen. Denn es ist eine Sache, mythisch «wahre» Musikdramen zu schreiben, die über Grundbefindlichkeiten menschlicher Existenz aufklären wollen, eine andere, sich selbst als Mythos zu entwerfen, an der eigenen Mythifizierung zu arbeiten oder von anderen zum Mythos hochstilisiert zu werden. Gibt es zwischen dem Mythos der Bühne und dem Mythos der Person eine Verbindung?
Es ist überraschend, dass die Mythen der Deutschen[4], wie sie sich vor allem in dem mythenfreundlichen und Mythen hervortreibenden 19. Jahrhundert entwickelt haben, fast stets von herausragenden historischen Gestalten handeln. Arminus der Cherusker, der nach deutscher Geschichtsüberzeugung die Römer im Teutoburger Wald vernichtend schlug und Germanien die Freiheit brachte, ist das erste und eindrucksvollste Beispiel in einer langen Reihe von Persönlichkeiten, zu denen Karl der Große, Friedrich Barbarossa, Faust, Martin Luther oder auch Friedrich der Große gezählt werden – und die sich leicht um weitere Namen ergänzen ließe. All diese Personen eint eine einzige Eigenschaft: Sie waren charismatische Persönlichkeiten und damit von ungewöhnlicher Ausstrahlungskraft, beispielhaftem Verhalten und vorbildlichem Agieren für die Zeitgenossen und Nachfahren, begabt mit jener außeralltäglichen Faszination, von der Max Weber, der berühmte Soziologe, behauptete, sie sei den normalen Menschen nicht eigen und mache daher denjenigen, der sie besitze, zu einem verehrungswürdigen, zugleich unerreichbaren Vorbild und Führer. Wer Charisma hat – so Weber – lenkt die Aufmerksamkeit der anderen, auch ohne sein Zutun, auf die eigene Person, er steht, ob er es will oder nicht, im Mittelpunkt des allgemeinen Interesses. Daraus gewinnt er seine souveräne Position gegenüber denen, die um ihn sind, die sich ihm eng verbinden, um ihm nahe zu sein, um von seiner Ausstrahlung zu profitieren, um ein wenig über sich selbst hinauszuwachsen. Solches Charisma speist sich aus scheinbar übernatürlichen Quellen, bündelt rational nicht verfügbare Ressourcen, entzieht sich bloßer Verstandeskontrolle. Daher die magische Wirkung, die vom Charismatiker ausgeht, daher der Sog auf diejenigen, die sich ihm nähern und ihm zu folgen bereit sind, daher die Unwiderstehlichkeit, die seinen Überzeugungen und Visionen eignet.
Der Charismatiker ist aber stets auch als Genie oder Führer gesehen worden, nicht selten als beides zugleich. Im Deutschland des 19. Jahrhunderts sind es die Literaten und Denker der Weimarer Klassik, die großen Philosophen des deutschen Idealismus, später dann Maler, Bildhauer und vor allem Musiker, die den Deutschen als genial gelten. Menschen von einem außerordentlichen geistigen Rang, deren Wirken die Welt veränderte, die dadurch zu Leit- und Orientierungsfiguren wurden. Geistige Führer durch den Gang der Zeiten, gleichrangig jenen politischen und militärischen Führern, wie sie in Friedrich dem Großen oder auch, um in der Zeit des jungen Wagner zu bleiben, in Napoleon ihre beispielhafte Verkörperung finden. Genie und Führer[5]: Für viele Menschen, ungebildete wie gebildete, ging damals – und geht auch heute noch – beides ineinander über, sind die Grenzen fließend.
Das gilt natürlich alles auch für Wagner: Wenn es in der Moderne je einen Komponisten gegeben hat, der ein Charismatiker war, dann Wagner. Sein Genie veränderte die Musik seiner Zeit, die Musikszene Deutschlands, ja Europas und der Welt grundlegend. Aber Wagner war nie nur Musiker – und eben darin lag ein Gutteil seiner Wirkung begründet. Er wollte Denker sein und Handelnder zugleich, Visionär und Kämpfer für eine andere, bessere Zukunft, Revolutionär und weitgreifender Philosoph, der in seiner «Weltanschauung» die Möglichkeiten einer besseren Zukunft entwarf und sie auch einzulösen suchte, als Vorbild für eine große Bewegung, die Einfluss nehmen sollte auf die geschichtliche Entwicklung Deutschlands. Und tat dies in einem durchaus ambivalenten Sinn, weil die künstlerische Avantgardegesinnung nicht immer mit einer entsprechend progressiven Gesellschafts- und Politikperspektive zusammenging. Doch alle seine Leistungen sind auch seiner Fähigkeit geschuldet, Menschen in seinen Bann zu schlagen, sie für seine Ideen einzunehmen, zu begeistern und in vielen Fällen zu bedingungslosen Gefolgsleuten zu machen. Weil er so vieles zugleich war: ein Sprachgewaltiger, der sich seine eigene Sprache für seine Werke schuf; ein Dichter, der aus dem Geist der Musik heraus seine Verse fand; ein Musiker, der seine Musik der Sprache ablauschte und diese bis in ihre Ursprünge hinein verfolgte; ein Mystiker, der sich den Mythos zu eigenen Zwecken zurechtlegte; ein Theatraliker, der nicht nur die synästhetischen Möglichkeiten des Theaters neu erfand, sondern im Theater und durch das Theater die Welt neu formen wollte; ein unermüdlicher Leser, der sich aus Literatur und Kunst, aus Philosophie und Religion, aus Geschichte, Gesellschafts- und Staatstheorie zusammensuchte, was er brauchen konnte. Darüber hinaus ein unermüdlicher Kommentator seiner selbst, seiner Werke und seiner Absichten, niedergelegt in autobiographischen Werken, Essays und Abhandlungen, festgehalten in Briefen, Notaten und Tagebüchern. Ein Mensch, der zu jeder Tages- und Nachtzeit in Rundumaktivitäten verfallen konnte und mit seinen Begeisterungsstürmen andere begeisterte, sie mitriss und an sich band. Bei Wagner konnte man erleben, was Charisma für das Leben bedeutete: unerschöpflicher Antrieb und Lebensstoff für die eigene Produktivität und Bindemittel zu Anhängern und Umwelt zugleich.
Werbung mit Bildern
Wagner als Charismatiker zu bezeichnen mag auf den ersten Blick erstaunen, denn er war nicht von beeindruckender Statur; eher klein von Wuchs, nur eben 1,56 Meter groß, hatte er einen charaktervollen, etwas zu großen Kopf, ein energisches Kinn und einen ausschwingenden Hinterkopf. Auf frühen Bildern wirkt er beinahe schüchtern, zumindest sensibel, und man gewinnt den Eindruck, dass er durch füllige Kleidung seine Erscheinung zu stärken sucht. Von gepflegtem Äußeren, aber als Typus doch sehr durchschnittlich, bietet er sich dem Zuschauer ohne imperatorisches Sich-ins-Bild-Setzen dar, zurückgenommen und von unsicherem, zweifelndem Blick. Schon in jungen Jahren sieht man die Ansätze zu jenem unter dem Kinn verlaufenden Backenbart, der später zu einem seiner äußerlichen Markenzeichen werden sollte.
Fast ein privates Porträt: Richard Wagner auf einer Daguerrotypie nach einer Zeichnung von Ernst Benedikt Kietz, 1850.
© Nationalarchiv der Richard-Wagner-Stiftung, Bayreuth
Wagner auf einem Aquarell von Clementine Stockar-Escher, noch nicht in Künstlerpose. Zürich, 1853.
© Nationalarchiv der Richard-Wagner-Stiftung, Bayreuth
Die frühen Bilder wirken, obgleich sie natürlich gestellt sind, auf den unbefangenen Zuschauer eher spontan, zufällig aufgenommen, ohne die Absicht einer demonstrativen Selbstrepräsentation, auch wenn diese durchaus schon anklingt – und wenn die Porträts bereits zum Zweck der Eigenwerbung angefertigt wurden. Denn Wagner ließ seine Porträts in der Absicht herstellen, sie zu verbreiten und so sich selbst in ein günstiges Licht zu setzen. Dabei war er keineswegs der Erste, der diese Strategie zu eigenen Gunsten verfolgte; schon Mozart und Beethoven hatten ihre Bilder zu solchen Zwecken anfertigen und verbreiten lassen, und zu Wagners Lebenszeit, der Zeit der industriellen Revolution und der rapiden Entwicklung auch maschineller Reproduktionstechniken wie der Fotografie, bot es sich an, sein Bild zu Werbezwecken für die eigene Person und vor allem für das eigene Werk gezielt einzusetzen.
Das scheinbare Fehlen demonstrativer Selbstrepräsentation, das die ersten Bilder noch ausstrahlten, ändert sich freilich im Lauf der Jahre. In dem Maße, wie Wagner bekannt wurde, wie sein Ruhm als Komponist zunahm, seine Werke heftig umstritten und ebenso heftig verteidigt und bejubelt wurden, dienten seine Porträts mehr und mehr auch der Werbung in eigener Sache. Das schlägt sich in seinen Porträts selbst nieder. Die Bilder aus reiferen Lebensjahren zeichnen den Komponisten in die Richtung des Exzeptionellen, suchen ihn in seiner Einzigartigkeit einzufangen. Da wird – wie auf einer Pariser Fotografie vom März 1860 – der Kopf leicht zur Seite gedreht, was ein markantes Profil ergibt, wird der Umhang in weiten Falten um den Körper drapiert, um eine gut proportionierte und gewichtige Person vorzustellen. Der Blick geht in die Ferne, als zeichne sich dort eine große Vision ab, er geht weg vom Betrachter in Sphären, die scheinbar nur dem Künstler erreichbar sind. Der Gesichtsausdruck ist ernst und gefasst, Entschlossenheit steht Wagner ins Gesicht geschrieben. Da präsentiert sich einer, der für die eigene Utopie des Gesamtkunstwerks einsteht, entschieden seine Ideale im Blick hat und dem vielgehassten Opernbetrieb seiner Zeit als «Unterhaltung der Gelangweilten» ein Ende bereiten will.
Sich mit visionärem Blick ins Bild setzend: der Komponist auf einer Pariser Fotografie, 1860.
© Nationalarchiv der Richard-Wagner-Stiftung, Bayreuth
Die Art, wie Wagner in seinen ersten Bildern – auch in den meisten der späteren Porträts – aufgenommen ist, entspricht einer damals weitverbreiteten Typisierung. Wagner erscheint in «napoleonischer Pose»[1], in der er sich immer wieder fotografieren – und auch malen – ließ und die das Moment des «Herrschers» einfangen sollte, zugleich ein Moment des Genialen, das ihn aus aller Durchschnittlichkeit heraushebt. Gleichwohl ist es eine ritualisierte Haltung, der eine gewisse Starrheit innewohnte, die nur schwer den individuellen Eigenschaften des Porträtierten gerecht werden konnte.[2] So gängig eine solche Geste damals war, sosehr sie auch der Intention Wagners entsprechen mochte – er selbst war zumeist damit unzufrieden und merkte 1858 in einem Brief an einen Freund an: «Noch nie ist eine Photographie von mir gelungen (…). Ich bin zu wechselnd in meinem Ausdrucke, und unter den Vorbereitungen und in der zwangvollen Haltung entgeht mir immer der günstigste Ausdrucksmoment.» Was ihn allerdings nicht daran hinderte, sich immer wieder in ebendieser Pose fotografieren zu lassen. Auf vielen seiner zahlreichen Reisen ging er in jenen Städten, in denen er sich länger aufhielt, zum Fotografen, ließ sich dessen Porträtfotos vorlegen, dann sich selbst fotografieren, um seine Fotos sowohl in den Fenstern des Ateliers ausgestellt zu sehen wie deren Abzüge großzügig an Freunde und Musikerkollegen zu verteilen – gezielt warb er so für sich und seine Werke.
Wie kalkuliert Wagner seine eigenen Fotos und Bilder verbreitete und sich auf seinen Porträts selbst stilisierte, zeigt ein am 9. Mai 1872 in Wien aufgenommenes, in den folgenden Jahren weitgestreutes Bild von ihm und Cosima. Es ist eine durch und durch kühl komponierte Fotografie, die Momente der Bewunderung und Verklärung festhält und damit visuell dem Prozess der Mythisierung des «Meisters» dient. Cosima sitzt, weil sie ihren Gatten sonst fast um Haupteslänge überragen würde, sie blickt bewundernd zu ihm auf, streckt ihm die Hand entgegen, die er mit seiner von oben kommenden linken Hand fest umschließt. Das Verhältnis der beiden drückt Zusammengehörigkeit und Abhängigkeit gleichermaßen aus. Der breit aufgefächerte Rock Cosimas signalisiert sowohl Eleganz als auch Bodenständigkeit, was beides durch das Sitzen noch unterstrichen wird; Wagners rechte Hand zur Sessellehne schafft die Verbindung seiner Person zu der Cosimas, zu ihrer «Erdung», aber zugleich setzt der Schwung seines Körpers, unterstrichen durch das helle Hemd und die helle Hose, der sich der fließende Überrock anschmiegt, einen deutlichen Gegenakzent. Ein insgesamt geglücktes Arrangement, dessen ästhetische Stilisierung seine Wirkung bis heute nicht verfehlt und die Selbsteinschätzung als Hohes Paar sinnfällig macht. Noch am Abend vor seinem Tod, am 12. Februar 1883, hatte Wagner zu Cosima bemerkt: «Alle 5000 Jahre glückt es», und – wie Cosima hinzufügte – er «umarmte mich lange und zärtlich».
Auf den im Dezember 1871 in München aufgenommenen Fotos sitzt Wagner wiederum in der beliebten Napoleon-Haltung: den Kopf nach links gedreht, im scharfgeschnittenen Profil, mit Barett und Samtjacke, seinem künstlerischen «outfit», das energische Kinn in die Höhe gereckt, die Augen nach vorn gerichtet. Hier zeigt sich, dass die Porträts von ihm, sofern sie für die Öffentlichkeit bestimmt sind, in seinen späteren Lebensjahren einem festen ikonographischen Muster folgen, das bereits mit der Pariser Fotografie vom März 1860 festgelegt worden ist: Der «Meister» tritt dem Zuschauer als Künstler entgegen, sein Blick ist in die Ferne und damit in die Zukunft gerichtet. Diese Pose suggeriert, dass Wagners Werke die ihnen einkomponierte Wirkung erst noch voll entfalten werden, dass sie auf lange Zeiten berechnet sind, nicht gedacht für schnellen Konsum und raschen Verbrauch. Vollends imperatorisch erscheint der Komponist auf dem zweiten Bild, bei dem der übergelegte Pelz die Assoziation zu einem königlichen Hermelin nicht zufällig hervorruft. Da ist einer zu sehen, dessen überragende Bedeutung außer Zweifel steht, für ihn selbst wie für den Betrachter.
Ein Hohes Paar, raffiniert inszeniert – Richard und Cosima, 1872.
© akg-images
Man sieht: Die zu Wagners Lebzeiten entwickelte Technik der Fotografie wurde von ihm durchaus schon gezielt eingesetzt, um den eigenen Interessen zu dienen. Sie war eines der Mittel, die den Mythos Wagner mit aufbauen halfen, nicht das einzige, aber ein wirksames, eines, das mithelfen sollte, das große Ziel, Wagner und sein Bayreuth zu einer nationalen Sache zu machen, zu erreichen. Die Bilder wurden gestreut, persönlich verteilt, aber auch über seinen Verlag Breitkopf & Härtel der interessierten Öffentlichkeit angeboten und zugänglich gemacht. Während der Jahre seines Schweizer Exils dienten sie dazu, Wagner als Komponisten und Denker, der die deutschen Länder nicht betreten durfte, im öffentlichen Bewusstsein der Deutschen präsent zu halten.
Ein deutscher Meister, fast wie von Holbein gemalt. Richard Wagner, 1871.
© akg-images
Hier fand der Mythos sein ikonisches Bild. Fotografie von 1871.
© akg-images
Wie nachhaltig mit solchen offiziellen Bildern die eigenen kunst- und kulturpolitischen Ziele verfolgt wurden, wird deutlich, wenn man sie mit einer Zeichnung des englischen Malers Henry Holiday vergleicht. Holiday durfte Wagner auf Proben in London skizzieren, und er erfasste dabei einen «konzentrierten» Künstler in einem «sehr innigen Moment».[3] Da fehlt jede berechnende Pose, fehlt die Absicht, öffentlich zu wirken; Wagner schaut nachdenklich, fast in sich versunken vor sich hin, kein Bildarrangement wertet ihn repräsentativ auf. Der Maler zeigt ihn in seiner ganzen, fast zerbrechlichen Privatheit.
Das innige, persönliche Porträt von Henry Holiday.
© Nationalarchiv der Richard-Wagner-Stiftung, Bayreuth
Einsamkeit und volles Leben
«Mein Verhältnis zu Wagner ist der Welt gegenüber nicht haltbar, und ich selber komme auch dabei um. Wagner weiß und glaubt es nicht, wie er anstrengt – in dieser ewigen Hitze. (…) Von sich sprechen, lesen, singen muß unser großer Freund, sonst ist ihm nicht wohl. Deswegen begehrt er auch immer nach einem intimen Kreis, weil es mit anderen Leuten nicht so geht. – Von dem Moment an, wo ich – nachmittags um 2 Uhr – bei ihm esse, ist an ein Loskommen nicht mehr zu denken, das gelingt nur ausnahmsweise, und das ist ein Zustand, der mich umbringt. Und sagen kann ich ihm das nicht. Es wäre ungerecht, grausam – er versteht es nicht – ahnt nicht, wie mir solches Zusammensein Mark aus der Seele saugt, wie ich die Einsamkeit, vor allem aber die Freiheit brauche.»[1]
Was Hans von Bülow hier in einem Brief vom 24. Januar 1865 an einen Freund beklagt, ist vielfach bezeugt: das raumgreifende, zeitfressende, alles an sich reißende und dominierende Auftreten Wagners im Kreis seiner Freunde, sein unbändiger Selbstdarstellungstrieb, der darin wurzelt, dass er, von seinen Musikdramen und seinen Ideen besessen, allen, die um ihn sind, diese Ideen mitteilen möchte. Und wen er nicht unmittelbar um sich hat, versucht er zu sich heranzuholen. «Ich kann nichts schaffen, wenn ich Niemanden habe, dem ich es mittheilen soll und mag», schreibt er 1852 aus Zürich an Julie Ritter, «Sie – aufrichtig gesagt – haben dort, wo Sie weilen, Niemand der Ihnen das mitteilen kann, was ich vermag. (…) Wären Sie hier, ich wollte und könnte Ihnen manche Freude machen, von der Sie, ich sage es kühn, dort keinen Begriff haben.»[2] Das schickt er der Freundin nach Dresden, während er in Zürich bereits einige Bewunderer um sich versammelt hat, mit denen er sich regelmäßig trifft und die er regelmäßig über seine Arbeiten informiert, was ihm aber offensichtlich noch nicht ausreicht. Die vielen Briefe, die er an enge Freunde in deutsche Länder sendet, belegen, dass er seinen Freundeskreis stetig erweitern möchte, dass sein Mitteilungs- und Selbstdarstellungsbedürfnis weit über diesen hinausreicht. Um in der Züricher Zeit zu bleiben, in der sein opus magnum, Der Ring des Nibelungen, entsteht: Zahlreiche Briefe gehen in zeitlich kurzer Abfolge an seine engsten Vertrauten, Uhlig und Röckel, nach Dresden und ins Zuchthaus Waldheim, um beiden immer wieder die eigene Befindlichkeit und die Details des entstehenden Ring zu erklären; zahlreiche Briefe gehen auch an seine damalige Frau Minna, nach Weimar an Franz Liszt und an verstreut lebende Freunde, an viele Bekannte und Geschäftspartner – das Register der Briefausgabe gibt erschöpfenden Aufschluss über den sich kaum erschöpfenden Mitteilungs- und Selbsterklärungsdrang.
Doch nicht nur das Mitteilungsbedürfnis erzwingt diese ausufernde Briefflut, sie zeugt auch von einem ebenso großen und intensiven Zuwendungsverlangen. «Habt Ihr mich alle vergessen? Ich bin seit einiger Zeit so einsam, daß es mir oft bang wird. (…) Im Uebrigen ist meine Lebenslust nicht groß. Es ist sehr still und einsam um mich – und ich komme mir oft wie gestorben und verschollen vor», schreibt er Anfang 1851 an Liszt[3], und ähnliche Klagen erreichen viele seiner Briefpartner, die ihm alle antworten, dass sie an seinem Leben und entstehenden Werk teilhaben. Aber während er noch um Aufmerksamkeit und ständiges Mitleben bittet, während er am vollen Leben beteiligt sein will, beteuert er zugleich, wiederum gegenüber Liszt, er könne nur in Zurückgezogenheit und abgeschlossen von der Welt wirklich schaffen, er bedürfe «der ruhigsten Ruhe zum productiven Arbeiten». Zerrissen nennt man normalerweise Menschen, die zwischen solchen Polen hin- und herschwanken, sich weder im einen noch im anderen wohlfühlen, gar verharren können. «Ich kann nur in den Extremen leben», bekennt Wagner in einem Brief, «– größte Activität und Aufregung und – vollkommenste Ruhe.»[4]
Es ist diese polare Spannung, die ihn ein ganzes Leben lang in Atem hält, die seine Produktivität ermöglicht, den Umgang mit Freunden wie Gegnern entscheidend bestimmt und nicht selten schwermacht. Wagner erträgt es schlecht, einerseits nicht ständig im Kontakt mit seiner Umwelt zu sein, mitzuteilen, woran er denkt und arbeitet, worauf er hofft, was er erwartet und was man ihm schuldet. Aber im selben Augenblick spürt er den heftigen Drang, sich zurückzuziehen, oft gerade dann, wenn er eben noch voller Freude und guter Laune Freunde empfangen hat, um mit ihnen einen geselligen Abend zu verbringen. Eine durch und durch widersprüchliche Gemütsveranlagung tritt da ans Licht, aus der ein irritierendes Verhalten resultiert, das mit Kants Begriff der «ungeselligen Geselligkeit» treffend bezeichnet werden kann.
Es geht hier nicht um ein abgerundetes und in sich stimmiges Psychogramm Wagners, sondern lediglich um einige der Verhaltensdispositionen, die schon recht früh und im Lauf der Jahre Bausteine für den Mythos Wagner liefern. Aus jener ungesellig-geselligen Veranlagung, die größte Aktivität mit vollkommenster Ruhe verbindet, geht manches hervor, was Wagner charakterisiert: ein in die Einsamkeit verlegtes hypochondrisches, lebenslanges Jammern über die eigene höchst mangelhaft erlebte Gesundheit, die zu ausgedehnten Wanderungen ebenso zwingt wie zu vielfachen Aufenthalten in Kurbädern; unerwartet auftretende emotionale Schwankungen, die den Umgang mit dem «Meister» höchst schwierig gestalten, weil jede denkbare Reaktion in einer bestimmten Situation verletzend wirken kann; überschäumende Lebenslust, die sich oft in einen makabren Humor flüchtet, die aber auch schnell in Verzagtheit, in Niedergeschlagenheit, ja sogar in Todessehnsucht umkippen kann. «Ich sehe nur, dass der meiner Natur – wie sie sich nun einmal entwickelt hat – normale Zustand die Exaltation ist, während die gemeine Ruhe ihr anormaler Zustand ist. In der Tat fühle ich mich nur wohl, wenn ich außer mir bin: dann bin ich ganz bei mir»[5], schreibt er einmal an seinen engen Freund August Röckel, und er trifft damit den Nagel auf den Kopf. Wagner ist in der Tat ein Mensch der Extreme, der zwischen Antagonismen wie Rückzug und verstörender Präsenz, zwischen Egozentrik und Hingabe, zwischen einfühlsamer Mitmenschlichkeit und abrupter Menschenverachtung oszilliert. Ganz zutreffend ist daher die Selbstdiagnose, der eigentliche Grund seines Leidens und seiner Existenz liege «in meiner außerordentlichen Stellung zur Welt und zu meiner Umgebung»[6].
Zu dem aus solchen Extremen sich formenden Bild des «Meisters» zählt, dass er in allen Lebenslagen Freunde um sich versammelt, die ihn als Mittelpunkt auch ihres eigenen Lebens akzeptieren. Wo immer sie zusammenkommen, werden sie zu «Foren der Selbstdarstellung»[7], verbunden durch das vom Meister gepflegte Ritual des Vorlesens aus seinen Dichtungen und Schriften. Das beginnt bereits im Pariser Exil, wo Einladungen zu dem völlig mittellosen Wagner nicht den Zweck der Bewirtung der Gäste, sondern der Darbietung eigener Werke verfolgen. Friedrich Pecht, ein Maler und enger Freund, berichtet von einer solchen Begegnung 1839, bei der Wagner den Fliegenden Holländer so vortrug, dass die Zuhörer «die Oper allmählich Gestalt gewinnen» sahen und fasziniert waren von der «magische(n) Anziehungskraft und seine(r) frühe(n) Überlegenheit in allen Dingen». Und das setzt sich regelmäßig so fort. «Wagner hat uns zu unserer Überraschung gestern seinen neuen Operntext vorgelegt», schreibt Robert Schumann im November 1845 an Mendelssohn Bartholdy, «den Meisten gefiel der Text ausnehmend (…), da findet sich dann immer allerhand zum Erzählen oder Vorlesen und es geht recht rege dabei her.» Häufig zitiert wird jene Zusammenkunft im Züricher Hotel Baur au Lac, in das Wagner vom 16. bis 19. Februar 1853 einen ausgewählten Kreis von Freunden und Honoratioren eingeladen hatte, um seine eben beendete Nibelungen-Dichtung vorzutragen, in einem sehr eigenen Stil, wie hernach berichtet wurde, mit allen Regieanweisungen, flüsternd und schreiend, sprechend und singend, wobei er die Szenen mit großen, weitausgreifenden Gesten und Ausbrüchen unterstreicht und mit abrupten körperlichen Wendungen die dramatischen Momente des Geschehens sichtbar heraushebt. So sehr identifiziert er sich mit seinen Figuren, verwandelt sich in die jeweiligen Charaktere, deren Verse er liest, dass es sich in der Stadt herumspricht und Abend für Abend mehr Leute kommen.[8] Sie alle sind fasziniert, vom Stoff, nicht minder von Wagner selbst, der im Lesen mit seinem Werk verschmilzt und sich über die Abende so steigert, dass er anschließend, erschöpft, wie er ist, kaum mehr nach Hause findet.
Diese bedingungslose Identifikation und die Hingabe Wagners ans eigene Werk, an die eigenen Ideen ebenso wie an die Musikdramen, der Glaube an seine Mission, die all seine Kräfte restlos fordert und überfordert – das alles beeindruckt seine Freunde, Bekannten, Anhänger und Sympathisanten und formt aus ihnen jenen engeren Kreis von Wagnerianern, die den «Meister» in höheren Sphären wandeln sehen. Wagners bis in die letzten Jahre seines Lebens stets sprungbereite Aktivität, sein vorbehaltloses Engagement in eigener Sache erregten nicht selten ungläubiges Staunen und vielfältige Bewunderung, gelegentlich provozierte er damit auch ängstliche Warnungen, es nicht zu übertreiben. Bei den Proben zur Uraufführung des Ring des Nibelungen notierte der dessauische Ballettmeister und Bayreuther Hilfsregisseur Richard Fricke Tag für Tag Wagners Aktivitäten im Festspielhaus, die bald dem Orchester, bald der Bühne, bald einzelnen Sängern und Sängerinnen, aber auch dem Hilfspersonal galten. «Es ist sehr schwer», schreibt Fricke, «Wagner, wenn er spricht, zu folgen, zu verstehen und es bedarf wieder einiger Tage meinerseits, mich hinein zu finden. Er spricht ungefähr so, wie einer, der für sich und mit sich spricht. Dann braust er wieder derart heraus, daß man sich den Zusammenhang nur annähernd zusammenreimen kann. Er lacht auf, ist gereizt, um schnell wieder mit Sarkasmus, das, was ihn ärgert, lachend zu geißeln. (…) Es war geradezu komisch und originell, wie Wagner bei seiner Lebendigkeit, seinem fortwährenden Agieren mit den Händen jedes Wort betont und ausgedrückt haben wollte (…). Es ist schwer, mit Wagner zu arbeiten, weil er nicht lange Stich hält. Er springt von einem zum anderen, ist nicht lange festzuhalten bei einer Sache (…). Er will sein eigener Regisseur sein, aber für diese Kleinarbeit fehlt ihm so zu sagen alles, da sein stets auf das große Ganze gerichteter Sinn ihn die Einzelheiten wieder aus den Augen verlieren läßt und er morgen vergessen haben wird, was er heute arrangierte und angeordnet hat. (…) Wagner spricht leise, undeutlich, gestikuliert viel mit den Händen und Armen; die letzten Worte eines Satzes geben annähernd zu verstehen, was er will und man muß höllisch aufpassen; (…) die Sprechart Wagners ist, um einen Vergleich zu ziehen und um die Eigentümlichkeit desselben annähernd deutlich zu machen, ohngefähr die eines Menschen, der sitzend ein leises Selbstgespräch hält und die letzten Worte des Satzes, wie schon gesagt, mit dem Ausatmen herausstößt.»[9] Das alles übt «einen mächtigen Zauber»[10] aus, schafft für Künstler wie für alle übrigen Mitwirkenden eine Aura, die sie erfasst und an der sie teilhaben möchten, voller Bewunderung für diesen Meister, der sich im Zweifelsfall «mit der alten Lebhaftigkeit trotz aller Schmerzen in das Arrangement»[11] hineinwirft, um vorzuführen, wie eine dramatische Situation dargestellt werden soll. Und weil Wagner sich, was sein Werk betrifft, nicht schont, weil er alles gibt, was er hat, sehen die Beteiligten «ängstlich mit an, mit welcher Lebhaftigkeit er nun oben auf Bergeshöhen den Kampf leitet», fürchten, er werde abstürzen, sehen dann aber, dass er «mit einer dicken Backe, welche noch durch Watte und ein dickes Tuch verbunden war, wie eine Gemse ins Tal» springt – «eine der sonderbarsten Erscheinungen»[12] der Theaterwelt. Aus solchen Erlebnissen werden Mythen gemacht.
Einsatz für das Werk
Wagner hatte mehrere Leben. Neben dem Menschen und Künstler gab es auch jenen Propagandisten in eigener Sache, der stets darauf bedacht war, seine großen Musikdramen zu fördern, ihnen jene bedeutenden Bühnen zu öffnen, für die er sie komponiert hatte. Natürlich war solches Bemühen auch getrieben von der materiellen Not, vom Zwang, Geld zu verdienen, um den eigenen Unterhalt finanzieren zu können. Doch war Wagner zudem überzeugt, dass ihm zustehe, was er verlangte. «Ich bin anders organisiert, habe reizbare Nerven, Schönheit, Glanz und Licht muß ich haben! Die Welt ist mir schuldig, was ich brauche! Ich kann nicht leben auf einer elenden Organistenstelle, wie Ihr Meister Bach!», sagte er einmal zu seiner Freundin Eliza Wille, und fuhr fort: «Ist es denn eine unerhörte Forderung, wenn ich meine, das bißchen Luxus, das ich leiden mag, komme mir zu? Ich, der ich der Welt und Tausenden Genuß bereite?»[1] Aber neben der Selbstverständlichkeit, mit der er ein finanziell abgesichertes Leben einforderte, blieb für ihn die künstlerische Vision einer grundlegenden Umwälzung des zeitgenössischen Operntheaters entscheidend, die Hoffnung auf einen Abschied von der vermeintlich seichten Unterhaltung französischer und italienischer Opern, denen er ein eigenes deutsches Musiktheater mit Ernst und nationalem Aufklärungswillen entgegensetzen wollte. Für Wagner ging es ein Leben lang darum, seine Werke und Ideen durchzusetzen, und von Anfang an machte er mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln darauf aufmerksam.[2]
Das beginnt schon in seinen frühen Pariser Jahren. Zu dieser Zeit konnte er an Meyerbeer beobachten, wie ein Komponist sich erfolgreich zu vermarkten verstand. Solche Vermarktung versuchte er zunächst auf seine eigene Art. Er schrieb Novellen und Aufsätze über Berlioz, Liszt oder Halévy, über die Oper in Paris und die dort aufgeführten Stücke, über sich selbst als Deutscher Musiker in Paris[3] in der Nachfolge der großen deutschen Musiker, der Nachfolge von Bach bis Beethoven – und erhob damit nicht nur gewaltige Anforderungen an das eigene Talent, sondern stellte auch die eigene Person noch vor seinen entscheidenden kompositorischen Leistungen auf einen hohen Sockel. Später, in seiner Autobiographischen Skizze, bekannte er, diese schriftstellerischen Arbeiten hätten ihm «nicht wenig geholfen, in Paris bekannt und beachtet zu werden»[4]. Gleichwohl ist es bemerkenswert, dass in diesen essayistischen Arbeiten schon jene Topoi versammelt sind, die später auch zu Elementen seines Mythos werden sollten: Verklärt wird die Armut eines Komponisten, der für die wahre Kunst lebt, verherrlicht die Unbeirrbarkeit eines deutschen Musikers in einer auf äußeren Glanz und hohle Repräsentation bedachten und daher zutiefst befremdlichen Kultur, formuliert die Vision einer wahren und wahrhaftigen Kunst, und überdies wird er selbst in die Reihe der ganz Großen eingeordnet. «Ich glaube an Gott, Mozart und Beethoven, in Gleichem an ihre Jünger und Apostel»[5], sagt in der Erzählung Ein Ende in Paris der sterbende deutsche Musiker und fährt, dem Tod nahe, mit einem Glaubensbekenntnis fort: «Ich glaube an den Heiligen Geist und an die Wahrheit der einen, untheilbaren Kunst; – ich glaube, daß diese Kunst von Gott ausgeht und in den Herzen aller erleuchteten Menschen lebt; – ich glaube, daß, wer nur einmal in den erhabenen Genüssen dieser hohen Kunst schwelgte, für ewig ihr ergeben sein muß und sie nie verläugnen kann; – ich glaube, daß alle durch die Kunst selig werden, und daß es daher Jedem erlaubt sei, für sie Hungers zu sterben; – ich glaube, daß ich durch den Tod hochbeglückt sein werde; – ich glaube, daß ich auf Erden ein dissonirender Accord war, der sogleich durch den Tod herrlich und rein aufgelöst werden wird. Ich glaube an ein jüngstes Gericht, das alle Diejenigen furchtbar verdammen wird, die es wagten, in dieser Welt Wucher mit der hohen keuschen Kunst zu treiben, die sie schändeten und entehrten aus Schlechtigkeit des Herzens und schnöder Gier nach Sinnenlust; – ich glaube, daß diese verurtheilt sein werden, in Ewigkeit ihre eigene Musik zu hören. Ich glaube, daß dagegen die treuen Jünger der hohen Kunst in einem himmlischen Gewebe von sonnendurchstrahlten, duftenden Wohlklängen verklärt, und dem göttlichen Quell aller Harmonie in Ewigkeit vereint sein werden. – Möge mir ein gnädiges Loss beschieden sein! – Amen!»
Gleichsam in nuce sind hier zentrale Elemente der späteren Kunstvision Wagners schon zusammengestellt, die ihn in seiner Selbsteinschätzung von den Komponistenkollegen abheben sollten. Kein Zufall, dass die Worte von einem sterbenden deutschen Musiker gesprochen werden; sie sind dessen verpflichtendes Erbe, sie dienen der Abgrenzung gegenüber Franzosen und Italienern, sie markieren den Wesenskern einer zukünftigen Kunst, wie sie Wagners eigenem Verständnis entspricht. Daher sind sie schon in der Form des Glaubensbekenntnisses zur einzigartigen deutschen Kunst verfasst, die – im Anschluss an Bach, Mozart und Beethoven – in ihrer ganzen Würde und ihrem vollen Ernst, in ihrer Wahrheit und Wahrhaftigkeit aber erst wiederhergestellt werden muss. Natürlich durch Wagner, durch keinen anderen lebenden deutschen Komponisten. «Mit hellen Thränen», beschreibt Wagner in seiner Autobiographischen Skizze seinen Grenzübertritt am Rhein, «schwur ich armer Künstler meinem deutschen Vaterlande ewige Treue.»[6]
Schon diese frühen Schriften, die mit den späteren musikdramatischen Werken thematisch noch nicht verbunden sind, lassen ihren Autor als exzeptionelle Persönlichkeit aus dem Meer der Durchschnittlichkeit heraustreten. Sie formulieren jene Alleinstellungsmerkmale, die ihn auch in der Opernszene Deutschlands besonders positionieren sollten. Mit der Autobiographischen Skizze von 1842, nach der Rückkehr aus Frankreich in Dresden geschrieben und in Heinrich Laubes Zeitung für die elegante Welt





























