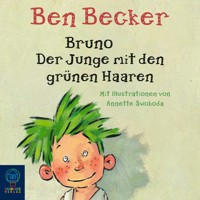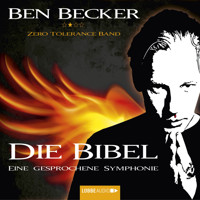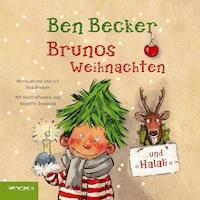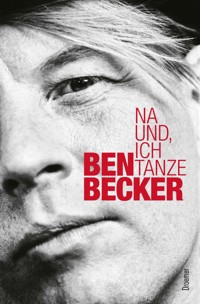
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Ben Becker ist der Rockstar unter den deutschen Schauspielern und als Enfant terrible so berüchtigt wie beliebt. Der eigenwillige Künstler hat eine beispiellos vielseitige Karriere gemacht: Am Theater brillierte er im klassischen Rollenfach von Shakespeare bis Genet, aber ebenso als Franz Biberkopf in "Berlin Alexanderplatz", in "Endstation Sehnsucht" oder als Tod im Salzburger "Jedermann". Seine zahlreichen Kino- und Fernsehfilme, darunter "Comedian Harmonists", "Schlafes Bruder", "Sass" oder "Ein ganz gewöhnlicher Jude", haben ihn berühmt gemacht. Mit der Band Zero Tolerance und Platten wie "Und lautlos fliegt der Kopf weg" feierte er auch als Musiker Erfolge, und seine gigantische Bibel-Performance wurde von Tausenden bejubelt. Seine unverwechselbare Stimme – "so finster und kratzig, so voller Pathos, sie allein ist ein Ereignis" ("Die Zeit") – wirkt magnetisch, er weiß um seinen bad boy-Sexappeal, und er liebt die Provokation. Und doch überrascht Ben Becker sein Publikum immer wieder, mit eigenen Theaterprojekten, Hörbüchern, impulsiven Lyrik-Lesungen, mit zärtlichen Kinderbüchern und gelegentlich auch mit öffentlichen Auftritten, bei denen sein Temperament mit ihm durchgeht. In "Na und, ich tanze" erzählt er, was bisher geschah: wo er herkommt, wie er wurde, der er ist – und was ihn antreibt. Seine unbändige Lebensgier und seine großen Erfolge bieten den anekdotenreichen und packenden Stoff für eine Lebensgeschichte, die Spuren hinterlassen hat. Denn, so Ben Becker: "Was man nicht macht, passiert nicht."
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 653
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Ben Becker
NA UND, ICH TANZE
Mit Fred Sellin
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Ben Becker ist einer der wichtigsten deutschen Schauspieler. Als Enfant terrible so berüchtigt wie beliebt, hat der eigenwillige Künstler eine beispiellos vielseitige Karriere gemacht: am Theater, im Film, als Musiker mit seiner Band »Zero Tolerance« und nicht zuletzt mit der gigantischen Bibel-Performance. Seine unverwechselbare Stimme wirkt magnetisch, er liebt die Provokation und polarisiert. Und er überrascht immer wieder mit impulsiven Lyrik-Lesungen, mit zärtlichen Kinderbüchern und öffentlichen Auftritten, bei denen ihm nicht selten sein Temperament durchgeht. In »Na und, ich tanze« erzählt er, was bisher geschah: wo er herkommt, wie er wurde, der er ist – und was ihn antreibt. Seine unbändige Lebensgier und seine großen Erfolge bieten den anekdotenreichen und skandalumwitterten Stoff für dieses Buch, das man ein Ereignis wird nennen dürfen.
Inhaltsübersicht
[Motto]
[Widmung]
1. Der Tod
Die Verwandlung beginnt. Ich [...]
2. Frauenvolksversammlung
Meine Mutter stopfte ein [...]
3. Westberlin
Um auf dem kürzesten [...]
4. Punk
Die entscheidende Frage war: [...]
5. Wir machen Musik
Wir waren die Szenekönige! [...]
6. Sympathy for the Devil
Hey, ich hol was [...]
7. Theater
Auf einmal trug ich [...]
8. Soll ich nochmal anfangen?
Dass es noch tiefer [...]
9. Die »Charisma«
Die Zusage kam genau [...]
10. Free Schach
11. Zwei Klassiker
Romeo und Julia also, [...]
12. Das Leben – ein Kinderspiel
Manchmal muss man nur [...]
13. Kurze Hose, Holzgewehr
Im selben Sommer verschlug [...]
14. Und lautlos fliegt der Kopf weg
Meine Reise ging direkt [...]
15. Schneewittchen
Fünf Jahre spielte ich [...]
16. Hotel »Humpelkumpel«
Auf unserer Promotiontour für [...]
17. Mädchen aus Ostberlin
Durch den Erfolg von [...]
18. Lilith
Natürlich war Stau! Wie [...]
19. In der Wildnis
Ein halbes Jahr nach [...]
20. Weiße Nächte
Vielleicht wollte ich im [...]
21. Das Leben
Das Leben in der [...]
Bildnachweis
1. Na und, ich tanze
Was man nicht macht, passiert nicht.
2. Widmung
1.
Der Tod
3. Als Tod im Jedermann, Salzburg 2009
Die Verwandlung beginnt. Ich sitze in der Maske. Zweieinhalb Stunden, dann fängt die Vorstellung an. Zweieinhalb Stunden wie eine Ewigkeit, die ich auf einem spartanischen Stuhl ertragen muss, als würde ich auf meine Henkersmahlzeit warten. Eingesperrt in dieser engen Kammer, die Wände so nah, dass es beinahe unmöglich scheint, einen klaren Gedanken zu fassen. Wie eine Kugel beim Flippern prallt er irgendwo dagegen, wird zurückgeschleudert, stößt auf der anderen Seite an, um erneut seine Richtung zu ändern. Gedanken-Pingpong, ein grausames Spielchen. So geht das die ganze Zeit, und so ist es jedes Mal, dass ich mich immer überwinden muss, überhaupt hierherzukommen. Nicht, dass es anderswo, in einem normalen Theater, anders wäre, doch hier ist es aus irgendeinem Grund besonders zermürbend. Das Vernünftigste wäre, an gar nichts zu denken, völlige Leere im Kopf, aber das muss man erst mal hinkriegen. Zur Ablenkung fingere ich, etwas fahrig, eine Parisienne aus der Schachtel, die vor mir auf dem schmalen Schminktisch liegt, schiebe sie zwischen die Lippen, werfe meinem Spiegelbild einen kurzen Blick zu, greife nach dem Feuerzeug. Eine kleine Flamme blitzt auf. Ich sehe, wie meine Hände zittern.
Das passt gerade schlecht. Der Tod zittert nicht! Warum auch? Der Tod ist allmächtig. Und ich bin der Tod. Bin es heute, war es gestern und werde es morgen sein. Das ist meine Rolle. Nur eine Rolle, nicht mal eine besonders umfangreiche. Achtzehn Einsätze in einem Spektakel, das zwei Stunden dauert – übermäßig viel kann man das wirklich nicht nennen, besonders aber schon. Den Tod spielt man nicht mal eben so runter, jedenfalls mache ich das nicht. Bei mir funktioniert das nur, wenn ich tiefer gehe, mich drauf einlasse. Also, auf den Tod als solchen kann ich mich natürlich nicht einlassen. Ich kann ihn aber auch nicht allein dadurch darstellen, dass ich dem Publikum ein paar markige Sätze entgegenschmettere. Meine Stimme, okay, die kann Luft zum Vibrieren bringen, sagen mir die Leute dauernd. Mag sein. Doch der Tod verlangt mehr.
Salzburg im Sommer. Was soll ich sagen? Thomas Bernhard schrieb mal: »Meine Heimatstadt ist in Wirklichkeit eine Todeskrankheit, in welche ihre Bewohner hineingeboren oder hineingezogen werden …« Vielleicht macht es das einfacher, sich in die Rolle des Tods hineinzuversetzen. Hier, bei den Festspielen, in Hugo von Hofmannsthals Jedermann. An diesem eigentümlichen Ort – strahlend schön und gleichzeitig doch schaurig, selbst in gleißendem Sonnenlicht irgendwie morbide. Und jetzt erst recht, während der Festspielzeit, in der die Stadt von Menschen aus jedem Winkel der Welt überschwemmt wird. Erinnert mich irgendwie an Disneyworld.
Das Festspielhaus steht in der Altstadt, am Fuße des Mönchsbergs. Genau genommen dehnt es sich nach hinten aus bis hinein in das Felsmassiv. Vom Max-Reinhardt-Platz aus betrachtet eine Kulisse aus Glas und Stein und Putz, wie gewaltige Perlen eng aneinandergereiht, dass sie zu einem Ganzen verschmelzen: das Große Festspielhaus, das Haus für Mozart, die Felsenreitschule. Mein Kabuff liegt irgendwo hinter dieser Fassade, ungefähr in der Mitte des Komplexes, zweiter Stock, am Anfang eines überschaubaren Gangs – oder an dessen Ende. Kommt darauf an, ob ich das Treppenhaus hinaufsteige oder den Fahrstuhl nehme wie heute. Das einzige Fenster geht zum Innenhof hinaus. Es steht offen, doch Abkühlung bringt das nicht. Draußen geht kein Luftzug. Wie ein schwerer feuchter Vorhang hängt die schwüle Hitze vor dem Fenster. Und unten auf dem Hof formiert sich die buntgemischte Armee der Komparsen, kostümiert und geschminkt, um zum Domplatz rüberkutschiert zu werden.
Bis ich so weit sein werde, wird Hedwig, der Belgier, noch mächtig ins Schwitzen geraten. Hedwig ist mein Maskenbildner, ein angenehmer Mensch. Normalerweise arbeitet er in Brüssel, am ehrwürdigen Opernhaus De Munt. Seine Art gefällt mir: bescheiden, fleißig und geschickt mit den Händen, vor allem quatscht er einem nicht die Ohren voll. Was zwischen ihm und mir abläuft, muss man sich als eine recht intime Angelegenheit vorstellen. Nicht, weil der Tod ein eigenes Kämmerlein für die Maske hat und wir darin ganz allein sind. Habe ich erwähnt, dass ich nackt auf dem Stuhl sitze? Aber damit habe ich kein Problem, prinzipiell nicht. Von mir aus marschiere ich nackt auf die Bühne, wenn der Regisseur meint, auf diese Weise verkörpere ich die Figur am überzeugendsten – vorausgesetzt, ich sehe das genauso. Hier mit Hedwig ist das ähnlich: Wenn er sich meinem Gemächt nähert, was bei diesem Kostüm zwangsläufig passieren muss, ist das ein rein professioneller Vorgang.
Im Moment fummelt er mir auf dem Kopf herum. Der Tod soll eine Glatze kriegen. Dafür pappt er zuerst meine Haare mit Gel fest, nimmt dann eine Reinigungslotion, um die Hautpartien rund um den Haaransatz zu entfetten, bevor er damit beginnt, mein Haar mit einer fleischfarbenen Badekappe abzudecken. Vorher zieht mir Hedwig noch ein dünnes Kabel über den Scheitel. Dessen vorderes Ende ist ein winziges Mikrofon, nur unwesentlich größer als ein Stecknadelkopf, das er auf meiner Stirn befestigt, direkt über der Nase. Danach klebt er den Glatzenrand fest, was sich leicht sagt, aber eine wahnsinnige Fummelei ist: einen Tropfen Mastix auf die Haut, ein Stück vom Rand der Kunstglatze kurz draufpressen, wieder hochklappen, antrocknen lassen, festdrücken. Und das Zentimeter für Zentimeter. Ich versuche, gelassen zu bleiben. An der Wand hinter meinem Rücken hängt eine Uhr. Im Spiegel kann ich sehen, wie der Zeiger von einer Sekunde zur nächsten hastet – tack … tack … tack …
Noch klebt die Kunstglatze nicht perfekt, besonders die Partie hinter den Ohren scheint sich zu sträuben. Trotzdem fängt Hedwig schon mal an, ihr die richtige Farbe zu verpassen. Zementgrau oder Steingrau, keine Ahnung, irgendwie eine Melange aus helleren und dunkleren Grautönen. Er packt ordentlich drauf, erst Farbe, sehr klebrig das Ganze, wie Uhu, dann Steinmehl, so dass sich meine Schädeldecke allmählich in eine Kraterlandschaft verwandelt, fleckig und pockig – man kann jedenfalls nicht sagen, dass ich damit besonders gesund aussehe. Und da er sich dann gleich daran macht, die Flächen um meine Augen mit derselben Farbe einzupinseln, erkenne ich mich bald selbst nicht mehr. Aber das ist nicht die schlechteste Voraussetzung, sich auf die Figur des Gevatter Tod einzustimmen.
Während die graue Pampe auf meinem Kopf trocknet, kriege ich Hafterleichterung: Ich darf aufstehen und nutze die Gelegenheit, mich zu strecken und zum Fenster hinüberzuwatscheln. Von dort wieder zurück und das Ganze noch mal, wofür ich höchstens zehn Sekunden benötige. Hedwig zuppelt derweil das erste Kleidungsstück meines Kostüms zurecht, um es mir fachmännisch anzulegen. Die Verkleidung besteht aus insgesamt nur drei Teilen, die Glatze nicht mitgerechnet. Allerdings ist die Bezeichnung »Kleidung« für das, was er da in den Händen hält, etwas übertrieben. Man könnte das Ding mit einem Stringtanga vergleichen, wobei flexibler Eierbecher auch nicht falsch wäre. Ein wabbeliges Teil aus Silikon, das extra für mich angefertigt wurde. In doppelter Ausführung, sicherheitshalber, man weiß ja nie.
Jetzt hebe ich meine Arme und halte mich mit beiden Händen an einer Metallstange fest, die waagerecht über mir an der Wand befestigt ist. Das ist der Augenblick, der selbst mich Überwindung kostet. Nackt war ich die ganze Zeit schon, doch in dieser Pose entblöße ich mich vollkommen. Wahrscheinlich sehe ich aus wie Jesus am Kreuz. Gefällt mir, eigentlich. Doch im Ernst: Es ist unglaublich anstrengend, einfach nur dazustehen, an sich rumfummeln zu lassen und dabei die Orientierung nicht zu verlieren. Das Wort Taucherkrankheit fällt mir dazu ein. Ohne die Stange würde ich früher oder später wahrscheinlich umfallen. Dass ich mir dabei auch noch selbst im Spiegel zusehen muss – der hängt direkt vor meinen Augen –, macht die Sache nicht lustiger.
Hedwig wirkt sehr konzentriert und gibt keinen Laut von sich, während er mich sorgfältig in das Silikonhöschen packt, das er über meinem Hinterteil wie ein Korsett zusammenschnürt. Nachdem das endlich erledigt ist, kann er sich wieder anderen Körperpartien widmen und großflächiger weitermachen. Er übertüncht die letzten Stellen im Gesicht, die noch hautfarben schimmern. Danach die Ohren, den Hals und dann, weiter abwärts, meine komplette Vorderfront, dazu noch die Hände. Und immer das gleiche Prozedere: erst die Farbe, dann das Steinmehl. Bis ich Hedwig kaum noch erkennen kann, obwohl er direkt vor mir rumwerkelt – so staubt das Zeug. Im ganzen Raum sieht es aus wie auf einer Baustelle. Am Ende bleibt kaum etwas von meinem Körper vom Farbmatsch verschont. Nur ein Teil des Rückens, die Oberarme und meine Arschbacken. Diese Partien werden von dem metallic-silbergrau schimmernden Mantel abgedeckt, den ich als Nächstes überstreife. Teil zwei des Kostüms, es reicht bis zu den Knöcheln. Jetzt noch die Stiefel und – Hokuspokus, da steht der Tod!
Eine Viertelstunde bleibt mir. Sollte ich noch mal den Text durchgehen? »Allmächtiger Gott, hier sieh mich stehn, nach deinem Befehl werd ich …« Quatsch, der sitzt.
Die Tür geht auf, Niki steckt seinen Kopf herein. Eigentlich Nicholas, Nicholas Ofczarek, aber so nennt ihn hier kein Mensch. Niki spielt den Jedermann, er ist in dieser Rolle der Jüngste, seit es die Festspiele gibt, seit neunzig Jahren also. Das Publikum liebt ihn. Niki kommt aus Wien, er gehört zum Ensemble des Burgtheaters. In Österreich ist er ein Star. Ich kannte ihn vorher nicht. Ein Schauspielkollege hatte mich vor Niki gewarnt, er sei eitel, selbstverliebt und so. Überflüssigerweise. Die ersten Proben liefen etwas verkrampft, aber das ist immer so. Misstrauisches Abtasten: Werden wir Freunde, oder bleiben wir Konkurrenten? Wie kommen wir miteinander klar? Jeder beobachtete genau, was der andere trieb, mit welchen Leuten aus dem Team er sich abgab, wen er links liegenließ. Wie zwei eifersüchtige Liebhaber. Oder eher noch wie zwei Antipoden, denn eine gewisse Anziehungskraft war durchaus vorhanden. Der Typ machte mich neugierig.
4. Nach der Vorstellung
Keine Frage, er als Jedermann trägt das Stück. Dafür bin ich sein stärkster Gegenpart, und als Tod letztlich mächtiger als er, als alle. Wenn man es genau nimmt, muss der Tod als Figur die Bühne gar nicht betreten, um präsent zu sein. Er schwebt die ganze Zeit auch so in der Luft wie ein Damoklesschwert. Jeder weiß, der Sensenmann ist bereits unterwegs; fragt sich bloß, wann wird er auftauchen und in welcher Gestalt? Das macht die Spannung aus, hier in Salzburg auf dem Domplatz – und im richtigen Leben auch.
Niki und ich steigen die Treppen hinunter. Hedwig begleitet uns. Im Hof wartet bereits ein Großraumtaxi. Unser Kollege Peter Jordan klettert auch hinein. Ihm haben sie zwei Rollen verpasst. Im Anfangsteil spielt er Jedermanns guten Gesell, danach den Teufel. Ein origineller Einfall von Christian Stückl, unserem Regisseur. Ich stehe dicht an der Hecktür, habe wieder eine Stange zum Festhalten, sitzen wäre wegen all der Farbe am Körper unmöglich. Während sich der Wagen im Schneckentempo durch die Menschenmassen in der Fußgängerzone pflügt, sehe ich draußen ungläubige Gesichter, die mich fassungslos anstarren. Die Fahrt zum Schafott. Hofstallgasse. Max-Reinhardt-Platz. Am Restaurant Triangel vorbei, während der Festspiele die Künstlerkantine und für mich so was wie ein Wohnzimmer, solange ich mich in Salzburg herumtreibe. Am liebsten würde ich rausspringen, ein Bierchen zur Beruhigung – macht sich nur nicht so gut, ein paar Minuten vor der Aufführung.
Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Ich zittere am ganzen Leib. Nicht, weil mir etwa kalt wäre, im Gegenteil. Gleichzeitig sickert unablässig Schweiß aus meinen zugekleisterten Poren. Angst.
Das kenne ich. Lampenfieber quält mich vor jedem Auftritt, ob ich Theater spiele, mit meiner Band auftrete oder Texte aus der Bibel unters Volk bringe. Lampenfieber nervt, ist aber nicht verkehrt, es schärft die Konzentration. Wenn es allerdings in nackte Angst umschlägt und dieses nervige Zittern hinzukommt, macht einen das fertig. Wobei die Angst hier nur durch diesen Einzug – als wären wir Gladiatoren – eine solche Wucht bekommt.
Wir erreichen die Alte Residenz. Vor dem Torbogen stehen Leute Spalier, um einen Blick auf uns zu erhaschen oder ein Autogramm zu ergattern oder beides. Nervös steige ich die alten, ausgetretenen Steinstufen hinauf, die zum Rittersaal führen. Niki läuft neben mir. Wir schweigen. Auf einmal spüre ich, wie er meine linke Hand nimmt und festhält, während wir weitergehen.
Mich überkommt ein Gefühl von Sicherheit, ich bin nicht allein, das fühlt sich gut an. Ich halte seine Hand, denke nicht daran, sie loszulassen, sondern drücke sie fest. Niki gibt mir Halt, innerlich. Mir fallen nicht viele Menschen ein, denen das einfach so gelingen würde. Dabei kenne ich diesen Menschen erst seit kurzer Zeit. Aber was Liebe ist, wissen wir beide. Liebe bezieht sich für mich auf einen anderen Menschen, ob Mann oder Frau, das spielt keine Rolle. Ich kann auch Liebe für einen Mann empfinden, ohne dass ich gleich mit ihm ins Bett springen wollte. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Aber das ist für den Moment vielleicht ein bisschen zu kompliziert.
Über einen roten Läufer durchqueren wir den Rittersaal, der leer geräumt ist. Die offenen Fenster auf der Giebelseite geben den Blick zum Domplatz frei. Davor zwei Reihen Stühle, wie Logenplätze. Wobei man von hier oben die Bühne nur seitlich sieht und sehr schlecht versteht, was die Schauspieler unten von sich geben. Jemand kommt mit einem Foto auf mich zu, auf dem ich unterschreiben soll. Mechanisch wie ein Roboter nehme ich den Stift, der mir hingehalten wird, kritzle meinen Namen und ziehe weiter. Unmittelbar vor einem Auftritt – das ist so ziemlich der falscheste Moment, um einen Ben Becker locker zu erleben.
Weiter durch den Domgang. In einer Ecke, links von uns, aufgetürmte Möbel, Tische und Stühle, roter Samt, weißes Holz. Daneben liegen zusammengerollte Teppiche, aufeinandergestapelt wie gefällte Bäume im Wald. Wir landen vor einer schweren Holztür, dahinter wieder Treppenstufen, die diesmal abwärts führen, hinunter bis in die Vorhalle des Salzburger Doms. Durch ein vergittertes Fenster kann ich die Zuschauer sehen. Alle Plätze besetzt. Seit Monaten sind sämtliche Vorstellungen ausverkauft. Zweitausend Zuschauer? Zweitausendfünfhundert? Ich weiß es nicht genau. Aber mindestens tausend Fächer, mit denen die Damen im Publikum die staubtrockene Luft quirlen, die vor ihren Gesichtern steht. Wird nicht einfach, gegen diese Unruhe anzuspielen. Die Sonne brennt noch immer. Bei den Proben haben wir mal die Temperatur an der Stelle auf der Bühnentreppe messen lassen, wo ich nachher ungefähr zehn Minuten sitzen muss, bevor ich als Tod mein Werk vollende. Sechsundfünfzig Grad Celsius! Ein Wahnsinn, das Stück bei dem Wetter in der Nachmittagsglut aufzuführen!
Wir stehen hinter der Bühne. Niki fragt, ob er etwas tun könne für mich. Der ist gut! Muss selbst jeden Moment raus und zwei Stunden durchspielen, und ausgerechnet er fragt mich das! Aber das brachte er auch schon vor der Premiere. Das hilft ihm nämlich genauso. Jetzt rückt er seinen Stuhl wieder so, dass er mir direkt gegenübersitzt. Er nimmt meine Arme, jeden in eine Hand, als wolle er ihr Gewicht schätzen. Um es ihm nicht unnötig schwerzumachen, hebe ich sie an. Doch er sagt: »Nein! Lass locker! Tu gar nichts!« Meine Arme fühlen sich auf einmal viel leichter an. Danach massiert er mir die Hände, erst die linke Hand, dann die rechte. Ich habe keine Ahnung, wie er das anstellt, aber das erdet mich tatsächlich. Hinterher wird er mir erklären, dass es darum geht, dem anderen Beachtung zu schenken, ihm durch die Berührung und das »Tragen« seiner Arme zu signalisieren: »Du bist nicht allein. Ich bin für dich da!« Was für ein wunderbarer, großer Kollege – ein Gladiator!
Als dann Birgit Minichmayr mit ihrer Maskenbildnerin hinter den Kulissen erscheint, grazil wie eine Königin, in der prächtigen Robe der Buhlschaft, dieses Jahr orangefarben, was perfekt zu ihrem Haar passt, herrscht auf der Bühne bereits ordentlich Trubel. Sie hat ein dickes Buch in der Hand und kommt mir vor wie die Ruhe selbst. Beneidenswert. Sie steuert den erstbesten Stuhl an, schlägt das Buch ungefähr in der Mitte auf – Balzac übrigens, Verlorene Illusionen – und fängt an zu lesen. Sie sagt, durch das Lesen könne sie hervorragend ihre Konzentration bündeln. Oder so ähnlich. Ich weiß nicht, Balzac war gewiss ein Bedeutender. Trotzdem, bei mir würde das wahrscheinlich gar nichts bündeln. Mir fehlt zum Lesen grundsätzlich die innere Ruhe. Klingt wahrscheinlich merkwürdig, wenn ausgerechnet ich das sage. Ich meine, ich habe eine Menge Bücher zu Hörbüchern gemacht. Aber das ist eben eine andere Tasse Tee, das ist dann meine Arbeit. Da kann ich mich auch auf einen Text einlassen, verdammt intensiv sogar, jedes Komma will ich dann kapieren. Aber privat, nur so zum Vergnügen … Das heißt nicht, dass ich nicht lese. Hier und da empfiehlt mir jemand einen Autor oder einen bestimmten Titel. Auf diese Weise habe ich Joseph Conrad entdeckt, Kafka auch und Blaise Cendrars, den wahrscheinlich kaum noch einer kennt. Trotzdem, ich kann nicht behaupten, mein tägliches Einschlafritual bestünde darin, in einem Buch zu schmökern, bis mir die Augen zufallen. Was wiederum nicht bedeutet, dass ich gelegentlich nicht einen gewissen Drang verspüre, mich ein bisschen der Realität zu entziehen und in eine andere Welt zu zaubern. Letztlich ist die Schauspielerei auch nichts anderes als eine Art von Flucht. Warum wird man denn Schauspieler? Doch nicht, weil einen Hemmungen plagen, sich in ein fremdes, eventuell erfundenes Leben zu stehlen.
Das hier ist gerade sehr fremd. Und ich bin sehr weit weg – mit meinen Gedanken und überhaupt. Gäbe es hinter der Bühne nicht diesen Spiegel, mir wäre wahrscheinlich nicht mal aufgefallen, dass ich mir den Mantel runtergezerrt habe. Nur gut, dass Hedwig nicht von meiner Seite weicht. Er pinselt und pudert zwischendurch immer mal an mir herum, bessert Stellen aus, die ihm nicht perfekt erscheinen oder die von meinem Schweiß ruiniert werden. Restauration am lebenden Objekt. Von mir aus, lenkt auch ein bisschen ab. Die Hände kriegen noch mal die volle Dosis Steinmehl, mein Totenkopfring gleich mit, der bleibt dran. Da signalisiert mir Karin, unsere Inspizientin: Es wird ernst.
Ich muss keine Angst haben! Ich schaffe das schon! Aber heute fällt es verdammt schwer.
Wer noch nie eine Jedermann-Aufführung bei den Salzburger Festspielen erlebt hat: Die Bühne steht direkt vor der Fassade des berühmten Doms. Seine drei riesigen Portale gehören zur Kulisse. Vor den äußeren beiden werden breite Treppen aufgebaut, das Portal dazwischen wird bis zu den obersten Stufen verkleidet. Für die Zuschauer sieht es aus, als gelänge man über die Bühnentreppen hinauf zu einem Gang, der hinter den Portalbögen entlangführt, ungefähr in vier Metern Höhe. In Wirklichkeit steht dort nicht mehr als ein Baugerüst, an dessen beiden Enden schlichte Holzstufen nach unten führen, fürs Publikum ebenfalls nicht sichtbar. Ich muss mich also erst mal als Gerüstkletterer betätigen – exakt siebzehn Stufen, ich habe sie bei den Proben gezählt –, bevor die Zuschauer das erste Mal den Tod zu sehen bekommen. Hedwig hilft mir in den Mantel, danach reicht er mir eine Flasche mit schwarzer Lebensmittelfarbe. Damit spüle ich meinen Mund, damit Zähne, Zunge, der gesamte Rachenraum auch noch zum Fürchten aussehen. Schnell einen letzten Blick in den Spiegel – und auf geht’s!
Noch nicht hinaus auf die Bühne, erst mal nur nach oben. In der Zwischenzeit ist Birgit dem Publikum als Buhlschaft erschienen. Sie startet ihren Auftritt aus derselben Höhe wie ich, jedoch von der anderen Seite. Kurzes Durcheinander auf der Bühne, dann erklingt für einen Moment nur ihre Stimme, markant wie kaum eine andere, ich würde sie aus Hunderten heraushören: »… der heißt Je-der-mann!«
Oben muss ich noch einen Moment warten. Karin steht in der Nähe ihres Pults, auf dem das Textbuch liegt mit den Markierungen, wann sie wen auf die Bühne zu schicken hat. Besser, ich behalte sie im Auge. Sobald sie ihren linken Arm nach oben reckt, heißt das: Achtung! Jetzt nimmt sie ihn wieder runter. Das bedeutet: Und los! Ich schreite bis unter den ersten Portalbogen, baue eine leichte Drehung Richtung Publikum ein und bewege mich erhaben die Treppe hinunter zu Niki und den anderen. Zugegeben, keine unlösbare Aufgabe. Wenn nur dieses verdammte Zittern aufhören würde! Der Tod sollte nicht unbedingt wie ein junger Hüpfer dahergerauscht kommen, aber auch nicht als gebrechlicher alter Sack. Ich halte den Gang, also die Art, wie sich ein Darsteller bewegt, wenn er eine Figur verkörpert, für etwas Elementares bei der Schauspielerei. Wenn man für seine Rolle einen eigenen Gang entwickelt und eine eigene Körperhaltung gefunden hat, kann man ihr damit mehr Charakter einhauchen als mit bloßen Worten. Heinrich George zum Beispiel war groß darin. In dem Film Berlin Alexanderplatz verlässt er ganz am Anfang das Gefängnis, dreht sich vor dem geschlossenen Tor noch einmal um. Was er da allein mit seinem Gang und der Körperhaltung ausdrückt, das ist Wahnsinn. Auch Yul Brunner in Westworld, Henry Fonda in Spiel mir das Lied vom Tod und – leider für mich unerreichbar – Burt Lancaster in Der rote Korsar wussten mit ihrer Körperlichkeit umzugehen.
Später stehe ich wieder auf dem Gerüst, neben dem Portalbogen, und harre der Zeichen, die von unten kommen. Bis zum Finale wird sich das noch zweimal wiederholen. Plötzlich rummst es auf der Bühne, Niki und Birgit sind mit der Tischgesellschaft zugange. Getöse, Trubel, ein Bühnentechniker ballert durch eine Öffnung im Bühnenboden goldenes Konfetti in die Luft. Dann beruhigt sich die Szenerie, und der dünne Vetter des Jedermann trällert ein Liedchen, reichlich schief und in einer Tonlage, dass man sich die Ohren zuhalten möchte – als hätte ihm jemand die Eier abgeschnitten, aber das soll so sein.
Trotz der späten Nachmittagsstunde brennt die Sonne weiter unerbittlich, bestrahlt wie ein riesiger heißer Spot die Bühne. Ein paar Minuten später finde ich mich genau dort unten wieder, in einen unerfreulichen Dialog mit Jedermann verstrickt, in dem ich ihm klarzumachen versuche, dass sein letztes Stündlein geschlagen hat. Für mich ist das dieses Jahr eine unglaublich intensive Szene. Den Leuten fällt es vielleicht erst mal schwer, sich den präpotenten Becker weich und verletzlich vorzustellen. Als Tod sollte ich für sie eine furchteinflößende, unnachgiebige Gestalt abgeben, emotionslos wie ein kasachischer Schuldeneintreiber, der sich von niemandem mit leeren Händen wegschicken lässt. Aber das ist nicht das, was ich zum Ausdruck bringen will. Ich bin Jedermanns Freund, ich kann nur nicht anders, denn ich bin der Tod – auch wenn das eine recht eigenwillige Interpretation sein mag.
5. Niki Ofczarek und ich
Die Kunst, wenn ich das so nennen darf, besteht darin, dem Tod selbst ohne Worte eine Präsenz zu verleihen, an der keiner vorbeikommt. Und die sogar wirkt, wenn er aus dem Blickfeld der Zuschauer verschwindet. Jedenfalls reicht es nicht, nur auszusehen wie ein Schreckgespenst und den Rest der Einbildungskraft der Zuschauer zu überlassen. Ich stehe als Behauptung da: Schaut mich an! Hier bin ich, der Tod, der allmächtige! Tut mir leid, was soll ich machen, das ist mein Job.
Dann der bekannte Disput zwischen Jedermann und Tod, als könnte man um sein Ende feilschen. Um dasselbe abzuwenden oder wenigstens hinauszuzögern, bietet mir Jedermann, dem langsam einzuleuchten scheint, in welcher Bredouille er steckt, ein Säckchen mit Goldmünzen an.
Niki: »… Ich bin ein mächtig reicher Mann. Die Sach soll aufgeschoben sein. Nur dies tu! … Willst’s nit? Tust’s nit?«
Ich: »Nein …! Mein Brauch ist gradaus umgekehrt. Wird dir kein Aufschub nit gewährt. Du kommst mit mir und zögerst nit!«
Ich greife Nikis Arm, halte ihn fest, unsere Blicke treffen sich – und mir steigen Tränen in die Augen. Verfluchte Scheiße! Ich bin zu nah dran. Aber dann sehe ich, dass Niki auch heult. Verdammt, was geht hier vor? Nichts anmerken lassen, einfach weiterspielen, weitersprechen, den Faden nicht verlieren, die Übergänge nicht verpatzen! Jede Bewegung ein Automatismus. Unbedingt die Spannung halten. Schön professionell bleiben, wir machen großes Kino – oder grandioses Kasperletheater, je nachdem, wie man es sieht. Vergiss die Tränen!, sage ich mir, das könnten ebenso gut Schweißperlen sein. Kein Mensch auf den Rängen kann das unterscheiden. Und selbst wenn, sie würden denken, wir haben die Tränen auf Kommando abgerufen, ein dramaturgischer Kniff des Regisseurs, nichts weiter.
So tief geht das, wenn man sich auf diese Rolle einlässt. Für mich ist der Tod nicht bloß eine abstrakte Bühnenfigur, sondern etwas Existenzielles. Ich weiß, dass sich Theater und Realität für mich schwer auseinanderhalten lassen, Kunst und Leben überhaupt. Den Tod kann man vielleicht spielen, aber mit ihm spielen kann man eben nicht. Grenzen austesten oder auch mal überschreiten – gut, da bin ich dabei. Man könnte sagen, das ist ein Charakterzug von mir, der übrigens schon in jungen Jahren überdeutlich ausgeprägt war. Aber was ich inzwischen begriffen habe: An einem bestimmten Punkt ist Schluss mit lustig. Wer den Moment verpennt, ist auf eine ganze Armada von Schutzengeln angewiesen. Ich weiß, wovon ich spreche. Deshalb hatte ich auch lange überlegt, ob ausgerechnet ich den Tod in Salzburg übernehmen sollte. Fantasie brauchte ich jedenfalls keine, um mir die Schlagzeilen auszumalen: »Ausgerechnet der Becker …«
6. »Vertu’s nit, Mensch« – Birgit Minichmayr, Niki und ich
Ich habe es trotzdem getan. Und falls jemand denkt, das alles passt viel zu gut zusammen, dahinter steckt bestimmt eine ausgebuffte PR-Inszenierung – bitte schön! Ich weiß, wie es wirklich war.
Ich habe noch nicht viel bereut im Leben. Dass ich mir diese eine böse Erfahrung lieber erspart hätte, versteht sich von selbst. Wie ich schon sagte: Mit dem Tod sollte man besser nicht spielen. Dass ich es trotzdem getan habe, war ziemlich blöd. Doch das gehört jetzt nun mal zu mir: ein Abdruck, der tiefer ist als alle anderen, die ich mit mir herumschleppe. Leben hinterlässt Spuren.
2.
Frauenvolksversammlung
7. Mein erstes Werbeshooting, zirka 1969
Meine Mutter stopfte ein paar Sachen in ihren Koffer und düste nach Berlin ab. Begeistert war ich nicht. Bereits als kleiner Junge, der ich damals war, hasste ich es, wenn mir jemand das Gefühl gab, er lässt mich allein. Der Vorgang an sich jedoch war mir vertraut – durch meinen Vater. Seit er nicht mehr an unserem Theater arbeitete, schien eine seiner wichtigsten Beschäftigungen darin zu bestehen, die Tasche zu packen, beziehungsweise von Mama packen zu lassen, und sich aus dem Staub zu machen. Allerdings kam er jedes Mal wieder zurück, so dass ich mir dieses ständige Verschwinden als Eigenart seines Berufs einredete. Ich geriet also nicht in Panik oder höchstens ganz kurz, als meine Mutter die Wohnung verließ. Und damit auch uns, Papa, meine Schwester Meret und mich. Aber ich tröstete mich: Mein Vater Rolf war ständig fort. Jetzt kam eben mal Mama an die Reihe, schließlich hatte sie den gleichen Beruf wie er.
Ich schätze, es waren solche Gedanken, die durch meinen Kopf wirbelten, als Monika, meine Mutter, sich nach Berlin aufmachte, genauer gesagt: nach Westberlin. Wenn ich von Berlin spreche, meine ich in dieser Zeit natürlich immer Westberlin. Wir lebten damals in Bremen. Damals heißt: 1973. Ich war acht Jahre alt, besuchte die Bürgermeister-Smidt-Schule, und obwohl ich mir einbildete, über empfindsame Sensoren für innerfamiliäre Störungen zu verfügen, hätte ich nie damit gerechnet, dass Mama eine solche weltbewegende Entscheidung treffen würde.
Meine Erinnerungen an diese Zeit liegen wie hinter einer dichten Nebelwand. Ich kann nicht beschwören, dass ich das Erlebte tatsächlich selbst erinnere oder nur herbeigezaubert durch Erzählungen anderer, hauptsächlich meiner Mutter. Ich habe mich oft gefragt, warum über alldem ein undurchsichtiger Schleier hängt, bis heute. Nach meiner Theorie kann es dafür nur eine Erklärung geben: Weil diese Phase meines Lebens einfach unglaublich beschissen war. Wenn eine heile Welt oder das, was man dafür hielt, auf einmal zu bröckeln beginnt und dann zusammenkracht wie ein wackliges Kartenhaus, dann denkt man als Kind ja nicht: Läuft zwar gerade ziemlich mies, aber keine Bange, das geht vorüber! So was begreift man erst hinterher, vielleicht.
Noch lautete die offizielle Version auch: Mama muss ein Weilchen weg. Sie übernimmt eine Rolle an einem Theater in Berlin. Wie ich heute weiß, war es für sie die ersehnte Gelegenheit, den Absprung zu schaffen. Sie wollte raus aus ihrer Ehe. Und das ging am Einfachsten, indem sie Distanz schuf. Kein Geringerer als Kurt Hübner, elf Jahre Impresario des Bremer Theaters, war derjenige, der ihr in jenem Sommer in die Steigbügel half. Mit Beginn der neuen Spielzeit sollte er das Ruder der Freien Volksbühne in Berlin übernehmen. Meine Mutter unterschrieb erst mal für zwei Stücke, da sie nicht die Ahnung von einem Plan hatte, wie das mit Meret und mir gehen sollte – wir hier, sie dort und Rolf ständig unterwegs.
Höchste Zeit, jemanden zu erwähnen, ohne den meine Kindheit viel beschissener ausgefallen wäre: Oma Mannke, der gute Geist unserer Familie. Wenn ich nur ihren Namen erwähne, schießen mir Tränen in die Augen, immer noch, so habe ich sie geliebt. Wobei »Geist« es nicht ganz trifft. Oma Mannke besaß eine überaus starke Präsenz, ersetzte mir und Meret Mutter und Vater, war Erzieherin, Betreuerin, Versorgerin, eigentlich alles. Manchmal auch Schmusekatze, das aber selten, dafür war sie zu sehr von handfesterem Kaliber. Sie bestimmte, wo es langging, und zwar auf eine Weise, dass einem gar nicht in den Sinn kam, ihre Anweisungen in Frage zu stellen. Nicht etwa, weil sie uns Kinder einschüchterte oder verängstigte. Sie besaß eine natürliche Autorität, die man einfach akzeptierte. Zumindest in den frühen Jahren war das so – bei mir. Später wurde ich aufmüpfiger, und das kriegte Oma Mannke dann manchmal auch zu spüren, worauf ich im Nachhinein nicht sonderlich stolz bin.
Wann genau diese bemerkenswerte Person – o ja, das war sie! – in mein Leben trat, kann ich nicht sagen. Was dafür spricht, dass ich sehr klein gewesen sein muss. Es heißt, an Geschehnisse der ersten zwei Lebensjahre könne sich niemand erinnern. Doch ich versuche, die Situation zu rekapitulieren, in der meine Mutter Oma Mannke ins Haus holte. Aber der Reihe nach: Aus Erzählungen meiner Eltern weiß ich, dass sie als Ehepaar Rolf und Monika Becker, geborene Hansen, in einer Wohnung – und die Betonung liegt auf: Wohnung! – am Osterdeich in Bremen lebten, als ich am 19. Dezember 1964 auf die Welt kam. Ohne nennenswerte Zwischenfälle, sieht man davon ab, dass ich es ziemlich eilig hatte. Ich muss gespürt haben, dass ein großes Fest bevorstand. Rolf erschien gerade noch rechtzeitig, einen Tag vor Heiligabend, um mich und meine Mutter in seinem schwarzen VW Käfer nach Hause zu holen. Doch kaum hatte er uns abgesetzt, verschwand er gleich wieder – ins Theater, zu einer Probe. Meine Mutter wird sich ihr Nachhausekommen sicher anders vorgestellt haben. Mit einem Schlag stand sie völlig allein da mit der Verantwortung für das kleine rothaarige Bündel auf ihrem Arm.
Meine Mama war da gerade mal einundzwanzig. Ihr Lebenslauf passte noch auf ein halbes Blatt Papier: Geboren in Berlin, Kindheit in Kopenhagen, Schulzeit überall und nirgends, Schauspielausbildung in München, an der Otto-Falckenberg-Schule, damit konnte man sich sehen lassen. Und sofort danach das erste Engagement in Ulm. Irgendwann dazwischen, bevor sie in Ulm anfing, lag die Begegnung mit einem gewissen Rolf Becker, der ihr acht Jahre voraus war, altersmäßig und wohl auch sonst. Er arbeitete an jenem Theater in Ulm und verguckte sich auf der Stelle in das junge Ding. Darüber, wie die beiden ein Paar wurden, existiert von jedem eine eigene Version. Sie deckungsgleich zu nennen wäre eine Lüge. Belassen wir es dabei, dass sie eins wurden und es Zeiten gab, in denen sie glücklich waren.
Vielleicht täusche ich mich, aber ich vermute, es fing damit an, dass Monika sich nicht als Partnerin, sondern mehr als Anhängsel fühlte. Ihre Entscheidung, sich am Theater in Ulm zu bewerben, dürfte für lange Zeit die letzte von Gewicht gewesen sein, die sie für sich allein traf. Danach nahm Rolf das Zepter in die Hand, und zwar für beide. Als ihm der Intendant des Theaters – übrigens besagter Kurt Hübner – anbot, in dessen Kielwasser mit nach Bremen zu wechseln, schlug er sofort ein. Und bevor die junge Schauspielschulabsolventin, die meine Mutter werden sollte, sich selbst darüber klarwerden konnte, ob das für sie ebenfalls eine vernünftige Entscheidung wäre, reichte er ihre Kündigung gleich mit ein – obwohl ihr kein Job in Aussicht gestellt worden war. Fragt man sie heute danach, kann es passieren, dass ihr der Fluch »Totaler Schwachsinn!« entfährt. Damals jedoch packte sie artig ihre Sachen und ging mit – erst nach Bremen und dort dann auch ziemlich schnell zum Standesamt.
Beim großen Hübner stand sie anfangs nur auf der Warteliste. So verschlug es sie nach Celle. Das dortige Theater konnte eine hoffnungsvolle Anfängerin gut gebrauchen. Büchners Leonce und Lena war das erste Stück, in dem sie auftrat. Zu einer zweiten Rolle kam es nicht mehr. Monika fuhr von Bremen immer mit dem Zug in das kleine Städtchen am Rande der Lüneburger Heide. Eines Tages hetzte sie zum Bahnhof, hatte ihn fast erreicht, sie brauchte nur noch den Zebrastreifen zu überqueren. Dann auf einmal ein dumpfer Knall: Wie eine große Puppe schleuderte ihr Körper durch die Luft. Ein Autofahrer hatte sie übersehen. Ihr Kopf schlug böse aufs Pflaster, um ein Haar wäre meine Mutter hinüber gewesen.
Drei Monate lag sie im Krankenhaus. Danach dauerte es noch mal eine Ewigkeit, ehe sie sich wieder normal artikulieren konnte. Doch noch immer verwechselte sie Kirschkuchen mit Sofakissen. Könnte an mir gelegen haben. Denn bevor sie eine neue Rolle am Theater annehmen konnte, schrieb ihr das Leben eine auf den Leib: Monika wurde schwanger – mit mir.
Sie würde es niemals so hart ausdrücken, aber ein Wunschkind kann ich unmöglich gewesen sein, nicht zu diesem Zeitpunkt. Ihr Leben habe ich wohl nicht versaut, ihren Berufsstart ganz sicher. Trotzdem liebte sie mich, das weiß ich, wie nichts anderes auf der Welt.
Das Rot-Kreuz-Krankenhaus, in dem ich zur Welt kam, existiert noch. Es steht am westlichen Ufer der Kleinen Weser, einem Nebenarm der eigentlichen Weser. Mein erstes Zuhause befand sich auf der anderen Seite des Flusses, in unmittelbarer Nähe des Weserstadions. Die Bundesliga spielte damals gerade ihre zweite Saison. Vom Balkon konnten wir am Wochenende hören, wenn ein Tor fiel, vorausgesetzt, ein Spieler von Werder hatte eingelocht, denn dann schwoll der Geräuschpegel schlagartig an. Das bewirkte bei mir allerdings rein gar nichts. Wenn mir etwas gleichgültig ist, dann ein Sport, der darin besteht, in kurzen Hosen einem Ball hinterherzurennen.
Das entscheidende Kriterium, die Wohnung am Osterdeich aufzugeben, war aber auch nicht die Lage, sondern ihre Größe. Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche, Bad – alles war vorhanden, nur eben in Miniaturausführung. Für eine Familie mit Kind auf Dauer ungeeignet. Wir zogen in die Thomas-Mann-Straße, eine gute Gegend, hauptsächlich Villen und sogenannte Bremer Häuser, Reihenhausketten im Jugendstil. Zu diesem architektonisch ansehnlichen Reigen bildete unsere neue Bleibe einen deutlichen Kontrast. »Papphaus« sagten wir dazu. Heute würde man es Fertighaus nennen. Ein Architekt, der bald zu einer regionalen Politgröße avancieren sollte, beabsichtigte, mit solchen Häusern ins Immobiliengeschäft einzusteigen. Rolf kannte ihn und brachte es irgendwie fertig, dass er uns sein Papphaus vermietete. Da es ursprünglich als Musterobjekt zusammengebastelt worden war, fielen Grundriss und Ausstattung üppig aus. Allein der Wohnbereich maß fast hundert Quadratmeter und war von der Küche bloß durch eine Glaswand abgetrennt. Übertroffen wurde das nur noch vom Garten, einem herrlich verwilderten Fleckchen Erde, eine Oase mitten in der Stadt.
Aber wie war das nun mit Oma Mannke? »Erinnerungen sind Erfindungen«, sagte Keith Richards mal. Oma Mannke kann ich schlecht fragen, sie starb vor einigen Jahren, mit sechsundneunzig. Ich war noch bei ihr im Krankenhaus, um mich zu verabschieden, aber ich glaube, das kriegte sie nicht mehr mit. Ich weiß nur, dass sie zu uns kam, als wir in dem Papphaus wohnten. Erstaunlich ist, dass bei aller Erinnerungsunschärfe, die mich sonst bei dieser Zeit umgibt, ausgerechnet die Sequenz, wie ich Oma Mannke das erste Mal zu Gesicht bekam, in meinem Kopfkino konturenscharf wie sonst nichts erscheint, als wäre sie in HD gespeichert: eine ältere Frau, deutlich über sechzig, nicht besonders groß und nicht gerade dünn, aber auch kein Brocken, eher ein Typ wie Mary Poppins oder wie die zauberhafte Nanny McPhee. Sie kam die Straße entlang getappelt und steuerte geradewegs auf unser Haus zu. Ihr Hut fiel mir zuerst auf. Aus dem ragte eine Feder, wie eine kleine Antenne, die im Rhythmus ihrer Schritte hin und her schwang. Automatisch musste ich an eine Ente denken, so watschelte sie. Außerdem schleppte sie eine gewaltige Tasche mit sich, als hätte sie vor, gleich den Rest der Woche bei uns zu übernachten. Als sie dann vor Mama und mir stand, guckte sie ziemlich mürrisch, und ich dachte: O je, was für ein Dampfer! War sie aber überhaupt nicht, nicht die Spur. Oma Mannke hatte ein unwahrscheinlich großes Herz und eine schier unendliche Geduld. Obwohl sie in einer winzigen Wohnung mit Kohleofen hausen musste, beklagte sie sich nie. Sie hatte schlimmere Zeiten überstanden. Oma Mannke stammte aus Ostpreußen, Kurische Nehrung, Memelgebiet, von irgendwo da her. Sie hatte im Krieg ihren Sohn verloren. Ich glaube, er war erst siebzehn, als sie ihn an der Front erschossen haben. So was gräbt sich nicht nur ins Herz, das fräst einem Spuren ins Gesicht, so tief, dass sie nicht mehr weggehen.
8. Oma Mannke
Monika schwört, mit meiner Erinnerung an Oma Mannkes Antrittsbesuch, das könne gar nicht sein, ich sei damals viel zu jung gewesen. Das meinte ich vorhin: Womöglich erinnere ich mich nur an ihre Erzählungen, und meine Fantasie liefert die Bilder dazu. Aber dann stimmt das Ganze trotzdem, in gewisser Weise. In meiner Erinnerung meine ich später auch gesehen zu haben, wie Oma Mannke beim Bügeln eine Maus entdeckte, blitzschnell ihren Pantoffel schnappte und das Viech mit einem gepfefferten Wurf auf dem Fußboden plättete. Das beschreibt ziemlich treffend ihre handfeste Art. Sie wusste einen Haushalt zu führen, mit Kindern umzugehen, und in ruhigen Momenten verlor sie sich in reiner Liebe.
Relativ schnell nach meiner Geburt muss Monika beschlossen haben, mit der Schauspielerei weiterzumachen. Rolf verdrückte sich an den meisten Tagen schon vormittags ins Theater und ließ sich bis spät in die Nacht nicht mehr blicken. Damals hatte er noch eine feste Stelle, führte Regie, spielte selbst und machte gleichzeitig den Oberindianer für alles Schauspielerische im Opernbereich. Spielte meine Mutter dann auch noch am Theater, waren ihre Tage vollgestopft, dass sie kaum zum Luftholen kam. Den Haushalt in Schuss halten, Einkäufe erledigen, zur Probe ins Theater flitzen. Und vorher schnell noch das Kind, also mich, bei der Schwiegermutter unterbringen. Oma Elfriede lebte auch in Bremen. Ich nannte sie immer nur Mam, englisch ausgesprochen. Keine Ahnung, wie ich darauf kam. Wenn Mama mich abgeliefert hatte, musste ich mich direkt umziehen. Mam steckte mich in Cordhosen und in einen Wams, den sie selbst gestrickt hatte. Dazu meine Frisur, wie von den Beatles geklaut – ich muss komisch ausgesehen haben. Den Kleidungsstil, den Mama mir aufdrückte, kann man im Vergleich dazu als unkonventionell beschreiben. Ich dürfte kaum älter als zwei gewesen sein, als sie mir meine erste Jeansjacke verpasste. Kleinkinder in Jeans waren in Bremen damals ungefähr so häufig anzutreffen wie ein zweites Dromedar im Bürgerpark. Mam jedenfalls fand meinen Aufzug zu ausgeflippt und nicht hanseatisch genug, um damit vor die Tür zu gehen. Mich störte das ganz und gar nicht. Ich liebte Omas Verkleidungsritual und fühlte mich weit weg von zu Hause. Ein unschuldiges Kostüm.
Nach der Probe hetzte Monika die gleiche Strecke, nur in umgekehrter Richtung. Und abends dann zur Vorstellung. Sowenig ich von der Welt verstand – dass sie wegwollte, spürte ich genau. Also beschloss der kleine Trotzkopf in mir: Zum Schlafengehen ist es eindeutig zu früh! Nun war das Gitterbettchen in meinem Zimmer aber der einzig sichere Ort, wenn sie mich im Haus allein lassen wollte. Kann sein, dass sich zu dieser Zeit mein kräftiges Stimmorgan herausbildete. Denn meckern half nichts, ich musste schon schreien. Aber auch das hörte niemand, Mama war ja inzwischen ins Theater verschwunden. Zwar gab sie einer Nachbarin einen Wohnungsschlüssel, für den Notfall, doch so laut, dass mein Geschrei bis zu ihr gedrungen wäre, hätte ich wahrscheinlich gar nicht brüllen können.
Lange weiß ich noch nicht, dass es an manchen Abenden so ablief, bevor Oma Mannke in unser Leben trat. Dieses Geheimnis ließ sich meine Mutter erst kürzlich entlocken. Sie meinte, heute würde ihr auch ein bisschen schlecht bei der Vorstellung. Möglicherweise enthält diese Geschichte einen Hinweis darauf, warum ich bis heute schlecht allein sein kann. Garantiert fände sich ein Seelenklempner, der mit der Geschwindigkeit eines Wimpernschlags einen Zusammenhang herstellen würde. Ich kann das Wort »Trauma« schon förmlich hören. Ich frag mich nur: Ist das wirklich ein Problem, das mir schlaflose Nächte bereiten sollte? War es nicht einfach nur so – und basta?! Ein paar Therapeuten sind mir deswegen schon mächtig auf den Sack gegangen. »Herr Becker, überlegen Sie doch mal: Woher könnte das kommen? … Herr Becker, wieso müssen Sie immer so gesellig sein? … Herr Becker, kann es sein, dass es Ihnen schwerfällt abzuschalten, dass Sie nie zur Ruhe kommen?« Die können mich alle mal mit ihrem Freudschen Blablabla! Jeder von denen hat mich am Ende ein Stück unglücklicher gemacht, als ich vorher gewesen war! Nur mal angenommen, es hätte tatsächlich mit dem Geschrei im Gitterbettchen angefangen – ja, und? Eigentlich bin ich recht froh darüber, dass ich es allein schwer aushalte. Mir macht es nämlich ungemein Spaß, unter Leuten zu sein.
Meine Mutter jedenfalls war zu der Zeit schwer gestresst und bald ziemlich im Eimer, deshalb Oma Mannke. Ratzfatz wurde sie Dreh- und Angelpunkt unserer Familie und für mich und Meret so was wie eine Oma. Sie kochte für uns und nähte und bügelte, sogar Eier auspusten konnte sie. Wobei mir immer ein Rätsel war, wie ihr das gelang, ohne die dünne Schale zu zerdrücken, bei den kräftigen Händen, die sie hatte. Für mich gehörte Oma Mannke einfach zu uns. Von mir aus hätte sie sogar unseren Namen tragen dürfen, schon ehrenhalber. Immerhin verbrachten wir mehr Zeit mit ihr als mit unseren echten Großmüttern zusammengenommen.
Oma Elfriede, Rolfs Mutter, genannt Mam, mochte ich allerdings auch gern. Sie war ein lustiges, aufgewecktes Frauenzimmer, das mit mir immer was unternahm. Dabei war unser Revier meistens der Bremer Bürgerpark, ein Paradies zum Austoben. Man konnte einen ganzen Tag darin verbringen, ohne sich eine Sekunde zu langweilen. Das Haus, in dem Mam ihre Eigentumswohnung besaß, stand in der Hollerallee und somit genau an der Straße, die auf kürzestem Weg zum Park führte. Dort gab es viele Spielplätze und mehrere Tiergehege – eins mit einem Dromedar, an dem wir nie vorbeigingen, ohne es zu füttern. Und auf dem Rückweg kamen wir immer an der Esso-Tankstelle vorbei. Dort kaufte mir Mam Sammelbilder für mein Klebealbum, von Hans Hass, dem Tiefseetaucher.
Manchmal besuchten wir auch Mams Schwester, meine Tante Lieselotte, der im Süden von Bremen eine Arztpraxis gehörte. Die Praxis lag in der Nähe der Weser, ringsum sah es aus wie in einem Industriegebiet. Wenn ich aus dem Fenster guckte, konnte ich Güterzüge vorbeifahren sehen. Gegenüber befanden sich die Bremer Häfen. An den Kais machten riesige Pötte fest. Mam hatte eine Menge spannende Seefahrergeschichten auf Lager. Die meisten stammten von einem alten Kapitän, den sie gut kannte. Sie interessierte sich aber auch für Kunst. Ihre Wohnung hing voll mit Bildern. Sie besaß sogar einige Originale, von Heinrich Vogeler zum Beispiel, von Bruno Krauskopf und von Rolf Nesch. Ein paar Mal nahm sie mich mit in die Kunsthalle. Ich will nicht sagen, Mams Begeisterung hätte mit einem Schlag auf mich abgefärbt, aber etwas geblieben ist davon schon. Dass Mam darüber hinaus regelmäßig ins Theater ging, verstand sich von selbst. Schon, weil sie neugierig war, was ihr Sohn und die Schwiegertochter dort trieben. Kaum eine Vorstellung, die sie hinterher nicht wortreich kommentiert hätte, da konnte sie richtig temperamentvoll werden.
Meine andere Großmutter, Oma Claire, habe ich zwar ein paar Mal gesehen, aber nie richtig kennengelernt. Soweit ich weiß, trafen wir sie selten und dann immer nur in irgendwelchen Hotels. Manchmal schenkte sie mir Spielzeug, daran erinnere ich mich. Oma Claire war Komikerin, eine ziemlich berühmte sogar. »Claire Schlichting – die jüngste komische Alte«, so nannte sie sich vorm Krieg. Ihre große Zeit waren die Zwanziger- und Dreißigerjahre. Trat sie irgendwo auf, meistens in Varietés, wahrscheinlich in so ziemlich jedem, das im deutschsprachigen Raum existierte, stand ihr Name immer in der größten Schrift auf den Plakaten. Und immer war sie die Schlussnummer, der Höhepunkt einer Show. Sie spielte sogar in Kinofilmen mit. Auf jeden Fall in einem, Kornblumenblau hieß er und gehörte zu der Sorte von Lustspielen, die die Nazis gern dem daheim gebliebenen Teil des deutschen Volkes vorführen ließen, zur Zerstreuung und als Ablenkung. Während sie den anderen Teil in den Schützengräben des Zweiten Weltkriegs verheizten. In diesem Streifen, der 1939 irgendwo am Rhein gedreht wurde, war sie an der Seite von Leny Marenbach und Paul Kemp zu sehen, damals echte Leinwandstars, um die sich das Publikum riss. Womöglich hätte es Oma Claire auch so weit gebracht, wäre da nicht dieser schwarze Fleck in ihrer Ahnengalerie gewesen – aus Sicht der Nazis. Nach deren Rassengesetzen galt sie als Jüdin oder zumindest als »jüdischer Mischling«. Wobei nicht mal meine Mutter sagen kann, in welche Kategorie sie nun genau einsortiert wurde. Das liegt daran, dass Omi ihr im Laufe der Jahre immer mal etwas anderes erzählte. In einer Version hieß es, die Familie sei zum katholischen Glauben konvertiert. Sie selbst, also Oma Claire, sei demnach katholisch getauft und auch in diesem Glauben erzogen worden. Andererseits ist zumindest bekannt, dass ihr Vater, der ein hohes Tier bei Salamander, der Schuhfirma, gewesen sein soll, Jude war. Allerdings wurde sie als uneheliches Kind geboren, und ihr Erzeuger machte sich, noch bevor die Nazis an die Macht kamen, aus dem Staub und ging in die Vereinigten Staaten. Mich wundert, dass Oma Claire überhaupt beim Film beschäftigt wurde und als kodderschnauzige Komikerin durch Hitlers Reich ziehen durfte. Vor allem so lange. Als Monika geboren wurde, im April 1942, lebte die Familie immerhin noch in Berlin, in Zehlendorf, wo ihr ein ziemlich großes Haus gehörte. Lange ging es danach allerdings nicht mehr gut. Jemand soll Oma Claire angeschwärzt haben. Auf einmal hieß es, sie sei Jüdin. Kann auch sein, dass die sie sowieso auf dem Kieker hatten, weil ihnen die Sprüche, die sie auf der Bühne losließ, allmählich zu frech wurden. Wahrscheinlich kam beides zusammen. Und so war meine Mutter noch ein Baby, als sie Nazideutschland verließen und nach Kopenhagen gingen.
9. Omi Claire auf der Bühne
Dänemark deshalb, weil Oma Claires Mann, also Monikas Vater, er hieß Erik Knut Hansen, von dort stammte. Einige aus seiner Familie lebten in Kopenhagen und boten die nächstbeste Anlaufstelle. Die Dänen standen zu der Zeit zwar bereits unter der Fuchtel Nazideutschlands, die Wehrmacht war bereits einmarschiert. Doch sie hatten ihre Regierung und selbst ihren König behalten dürfen. Die meisten Behörden erledigten ihre Arbeit fast wie gewohnt. Im Alltagsleben hatte sich kaum etwas geändert. Juden lebten dort nicht halb so gefährlich wie in Deutschland.
Erik Knut Hansen, mein Großvater, den ich höchstens zwei- oder dreimal gesehen habe, war Oma Claires zweiter Ehemann. Und Tochter Monika, meine Mutter also, Oma Claires zweites Kind. Mit ihrem ersten Mann, Herbert Schlichting, der Schauspieler und Komiker war, hatte sie bereits einen Sohn, Herbert Günther mit Vornamen. Den sollte ich später noch kennenlernen, allerdings als Jonny Buchardt, weshalb ich ihn nur Onkel Jonny nannte. Falls jetzt jemand den Überblick verloren haben sollte, keine Bange, das ging mir am Anfang genauso: Künstlerfamilie eben. Dass Oma Claire unehelich zur Welt kam, erwähnte ich. Trotzdem soll ihr Vater, jener Herr von Salamander, zumindest finanziell für sie gesorgt haben. Ihr Pech war nur, dass sie das Geld nicht selbst in die Hand bekam, sondern ihre Mutter, die, so erzählte man sich in der Familie, den größten Teil für Pferdewetten und andere Glücksspielchen draufgehen ließ. Dagegen interessierte sich Oma Claire mehr fürs Musische. Sie ging mit fünfzehn an die Operette in Wuppertal, begann als Statistin, sang im Chor, und eines Tages wurde sie als Soubrette eingesetzt, wenn auch nie in großen Rollen. Weil man damals am Theater so gut wie nichts verdiente, ging sie nach den Vorstellungen tingeln. Das machten fast alle, selbst einer wie Gustaf Gründgens hängte sich gelegentlich einen Bauchladen um, rezitierte in Kneipen selbstgeschriebene Gedichte und verkaufte hinterher kleine Heftchen mit den Texten. Oma Claire zog für diese Auftritte ein rot-weiß kariertes Kleid an, ein Spitzenhöschen drunter, das ein wenig hervorlugte, und dazu band sie sich eine Küchenschürze um. Die Sachen stammten aus dem Fundus des Theaters, sie sollten ihr Markenzeichen werden. Schon bald wurde sie von Paul Spadoni entdeckt. Der Berliner hieß eigentlich Paul Krause, muss aber gewusst haben, dass er mit diesem Namen im Showgeschäft nichts hätte biegen können. Spadoni war nicht irgendein Künstlervermittler. Bevor er im Ersten Weltkrieg als Soldat verletzt wurde, seine Karriere beenden musste und deshalb eine Agentur gründete, war er als Kraftakrobat berühmt gewesen, weltberühmt sogar. Eine seiner spektakulärsten Nummern bestand darin, eine über zwanzig Kilo schwere Kugel, die aus einer Kanone abgefeuert wurde, nicht mit den Händen zu fangen, was andere vor ihm gemacht hatten, sondern mit seinem Genick. Keine Ahnung, wie man so was überlebte.
Dieser Spadoni also entdeckte Oma Claires humoristisches Talent, vermittelte sie gleich nach Berlin – an den Wintergarten, was einem Ritterschlag gleichkam. Seinerzeit stand das Varieté an der Friedrichstraße und war mit dreitausend Sitzplätzen das größte und modernste Theater, das man in Europa finden konnte, eines der angesagtesten außerdem. Hier waren Stars wie Claire Waldoff und Otto Reutter aufgetreten. Für die neue Claire, meine Oma, wurde der Laden die Startrampe als Komikerin.
Richtig amüsant wird es, knöpft man sich erst die dänische Linie unserer Sippschaft vor: Mein Großvater Erik kam auch als Bastard zur Welt, wie man damals sagte. Wie übrigens alle seiner fünf Geschwister, von denen vier Mädchen waren. Die Mutter verdiente ihren Lebensunterhalt als Weißnäherin. Sie soll für die damalige Zeit ungewöhnlich groß gewesen sein und hammermäßig ausgesehen haben. Die Nachbarn müssen sich das Maul zerrissen haben über die alleinstehende Frau, der sechs Bälger am Rockzipfel hingen, jedes wohl von einem anderen Vater. Alle Kinder erhielten den Mädchennamen ihrer Mutter. Sonst wäre aus Großvater Erik kein Hansen geworden, sondern ein Christiansen, und aus meiner Mutter folglich auch. Irgendwann tauchte dann noch ein Mann auf, der hieß Buchardt. Mit ihm zeugte Urgroßmutter kein Kind mehr, dafür blieb sie für den Rest ihres Lebens an seiner Seite. Aber das ist eigentlich nur interessant, weil sich einige der Kinder – und nicht nur die – später seines Namens bedienten. So traten Großvater Hansen und seine Schwester, die ein berühmtes Tanzpaar waren, als Erik und Ruth Buchardt auf. Warum, weiß ich nicht. Wahrscheinlich war es bei ihnen wie bei Onkel Jonny. Der hatte sich für seine Künstlerlaufbahn auch den Namen Buchardt geliehen, angeblich, weil der internationaler klang und im Ausland leichter auszusprechen war als sein richtiger. Später traten auch Jonny und sein Stiefvater Erik gemeinsam auf – ebenfalls als Buchardts.
Meine Mutter kannte ihren richtigen Familiennamen lange Zeit nicht einmal. Den erfuhr sie angeblich erst, als sie sechzehn wurde und einen Personalausweis brauchte für die Schauspielschule. Ihr Vater besorgte ihr den Ausweis, das war damals noch so, und als sie ihn dann das erste Mal aufschlug, war sie schwer verblüfft, dass da Hansen stand. Bis dahin hatte sie angenommen, sie hieße Buchardt. So hatte sie sich auch selbst immer genannt. Wenn sie eine normale Schule besucht hätte, wäre ihr das früher aufgefallen, aber da sie die meiste Zeit mit ihrer Mutter umherzog, von einem Engagement zum nächsten, war sie immer nur für ein paar Wochen in einer Schule, irgendwo, oder sie bekam Privatunterricht. Da war das mit dem Namen nicht so wichtig.
Doch weiter in der Familiengeschichte, denn Oma Claire und Opa Erik bewegten sich bald auf derselben Umlaufbahn. Das heißt, sie waren beide in der Showbranche unterwegs, so dass es nur eine Frage der Zeit – na gut, sicher auch des Zufalls – sein sollte, bis die beiden sich begegneten. Opa Erik trat wie gesagt mit seiner Schwester Ruth als Tanzpaar auf. Er sah nicht übel aus, sie aber war von einer Schönheit, die Männern schier den Atem raubte. Die zwei wurden für alle möglichen Revuen angeheuert, lebten in einer Glitzerwelt, kassierten reichlich Kohle und reisten mit riesigen Schrankkoffern – die konnte sich beileibe nicht jeder leisten – um den halben Globus. Bis es sie eines Tages für ein Engagement nach Dresden verschlug. Dort wohnten sie im selben Hotel wie Oma Claire, die anscheinend für die gleiche Show gebucht worden war. In unserer Familie munkelt man, Oma Claire sei hin und weg gewesen, als sie den attraktiven Tänzer erblickte. Dazu muss man wissen, dass sie zehn Jahre älter war und er ständig von attraktiven Frauen umschwärmt wurde. Oma Claire war bestimmt nicht hässlich. Auf ihre Art sah sie ganz süß aus. Ihre braunen Augen konnten manches Feuer entfachen. Nur, ihr Körper war nicht besonders in die Höhe geschossen, und ein Hungerhaken war sie irgendwie auch nicht. Aber so was spielt letztlich eben keine Rolle. Die beiden verliebten sich. Und nachdem meine Mutter geboren wurde, heirateten sie, trotz des Altersunterschieds. Wie groß ihre Liebe tatsächlich war – wer weiß das schon? Denkbar, dass sie sich durch das Kind verpflichtet fühlten, ansonsten aber vor allem an ihren Berufen hingen. Es sieht jedenfalls nicht danach aus, dass ihnen ein sortiertes Familienleben besonders wichtig gewesen wäre. Noch eine Sache, bei der ich manchmal ins Grübeln gerate und mich frage, ob so etwas vielleicht vererbbar ist. Bei mir scheint in Sachen Familienleben eine regelrechte Sperre eingebaut zu sein, die ich mir nicht wirklich erklären kann. Außer vielleicht damit, dass Blut dicker ist als Wasser. Aber ich will nicht vorgreifen.
Oma Claire und Opa Erik verschwanden mit Monika und Onkel Jonny schleunigst nach Kopenhagen, um ihre Haut zu retten. Dort waren Deutsche allerdings nicht besonders gern gesehen, seit die Wehrmacht einmarschiert war. Aus diesem Grund gab sich Großmutter, wo es nur ging, als Schweizerin aus. Und um auch die Tochter zu schützen, brachte sie ihr keine Silbe Deutsch bei, als sie anfing zu sprechen. Meine Mutter musste stattdessen Dänisch lernen.
Die einträgliche Tanznummer, mit der Großvater Erik und seiner Schwester unterwegs gewesen waren, hatte sich in der Zwischenzeit übrigens erledigt. Tante Ruth war dem tschechischen Regisseur Karl Anton begegnet, damals eine ziemlich einflussreiche Person in seiner Branche. Der führte sie nicht nur zum Traualtar, sondern sackte sie auch gleich noch fürs Filmgeschäft ein. Bis das Dritte Reich zusammenbrach, machte sie in ungefähr einem Dutzend Filme mit. Alle davon kenne ich nicht. Ich weiß auch nicht, wie gut sie überhaupt Deutsch sprach. Aber ich vermute fast, bei ihrer umwerfenden Schönheit hatten die Regisseure sie ohnehin eher als schmückendes Beiwerk vorgesehen.
Im Sommer 1943 änderte sich die Situation in Dänemark gravierend. Die Nazis setzten die dänische Regierung ab, verhängten den Ausnahmezustand und führten die Todesstrafe ein. Es passierte noch ungeheuer viel mehr, aber das soll hier kein Geschichtsbuch werden. Ich erwähne nur, was für unsere Familie unmittelbar Auswirkungen hatte. Großvaters Schwester und deren Mann gehörten der dänischen Widerstandsbewegung an. Und Omi wurde da irgendwie mit reingezogen. Ich will sie nicht nachträglich zu einer Heldin machen. Es kann sein, dass sie aus tiefster Überzeugung handelte. Es kann aber auch sein, dass sie anfangs nur mitmachte, weil sie sich bei den Verwandten revanchieren wollte für deren Gastfreundschaft. Ich weiß es einfach nicht. Und meine Mutter kann es mir auch nicht verraten, dafür war sie damals zu klein. Es war wohl so, dass Oma Claire eine Zeitlang im Dagmarhus am Rathausplatz arbeitete, in dem auch das Hauptquartier der Gestapo untergebracht war. Nun wäre es interessant herauszufinden, ob sie dort landete, weil es für sie als Deutsche sonst keine anderen Möglichkeiten gab, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Oder ob sie sich dort zielgerichtet um einen Job bemüht hatte, um für die Widerstandsbewegung aktiv zu werden, sozusagen in der Höhle des Löwen. Doch letztlich spielt das keine Rolle. Was zählt, ist, dass sie, als es drauf ankam, Mut bewies, was andere an ihrer Stelle wahrscheinlich nicht getan hätten. Es war die Zeit, als die Gestapo rigoros gegen Kommunisten und andere Gegner des Deutschen Reichs vorging. Verhaftung, Schnellgericht und ab ins Konzentrationslager. Oder gleich in eine Todeszelle.
Im Januar 1944 erwischte es wieder einige Leute aus dem Widerstand. Darunter eine gewisse Monica Wichfeld oder richtiger: de Wichfeld. Die Frau, die einer wohlhabenden Familie aus England entstammte, war mit einem dänischen Adligen verheiratet. Überhaupt hatte sie ein ziemlich schillerndes Leben geführt, bevor Hitler den Zweiten Weltkrieg anzettelte. Am glanzvollsten dürfte die Zeit in Paris und London gewesen sein, wo sie Parfum und Modeschmuck verkaufte und neben Coco Chanel eine der erfolgreichsten Geschäftsfrauen war. Als der Krieg ausbrach, ging sie mit ihrer Familie nach Dänemark zurück, schloss sich verschiedenen Widerstandsgruppen an, bis die Gestapo sie schnappte. Einige Leute aus der Gruppe, zu der Großmutters Verwandte gehörten, wollten Monica Wichfeld aus dem Knast befreien. Darum setzte sich Oma Claire mit einem Gestapo-Offizier in Verbindung, der mit dem Fall zu tun hatte. Schon damit riskierte sie ihr Leben. Sie machte ihrem Beruf alle Ehre, bequatschte ihn so lange, bis er sogar einwilligte, sich selbst an der Befreiungsaktion zu beteiligen. Dafür sollte er dreißigtausend Kronen kassieren und anschließend nach Schweden geschleust werden. Seine Aufgabe sollte darin bestehen, die Gefangene mit einem Auto aus dem Gefängnis abzuholen und zu einem bestimmten Punkt zu fahren, an dem Bahngleise die Straße kreuzten. Dort würden ein halbes Dutzend Widerstandskämpfer warten, verkleidet mit Nazi- und Polizeiuniformen, darunter angeblich auch Oma Claire, und zum Schein einen Überfall inszenieren. Gleichzeitig sollte ein Krankenwagen aufkreuzen, damit es nach einem Unfall aussah und Zeugen nicht auf die Idee kamen, Hilfe zu rufen. Erinnert einen irgendwie an das Verwechslungsspielchen, das die polnische Theatergruppe in Ernst Lubitschs Komödie Sein oder Nichtsein treibt. Ziemlich ausgebufft, doch es ging alles schief. Der Gestapo-Typ tauchte gar nicht erst auf. Angeblich hatte er am Abend zuvor im Suff seine Klappe nicht halten können. Oma Claire gehörte zu den Ersten, die verhaftet wurden.
Meine Mutter erinnert sich, dass sie gerade auf dem Hof spielte, als ein Auto vorgefahren kam, mit Männern in schwarzen Uniformen. SS-Leute. Sie holten Oma Claire aus der Wohnung, Monika musste auch mit. Sie weiß noch, dass Großmutter sie auf den Arm nahm. Ab dem Moment jedoch, als sie mit den Männern ins Auto stiegen, sind ihre Erinnerungen wie abgeschnitten, als wäre sie mittendrin aus einem Alptraum hochgeschreckt.
Das könnte daran liegen, dass sie mit ansehen musste, wie übel Großmutter beim Verhör zugerichtet wurde. »Frau Schlichting, Sie werden bald hinüber sein!« Worauf sie antwortete: »Aber Ihre Uniform auch.« Und schon setzte es Schläge, mit voller Wucht gegen den Kopf, dass man glaubte, ihre Gesichtsknochen brechen zu hören. Das erzählte Onkel Jonny später, der war schon erwachsen, als es passierte. Nach einer anderen Antwort, sie dürfte ähnlich schlagfertig ausgefallen sein, warf der SS