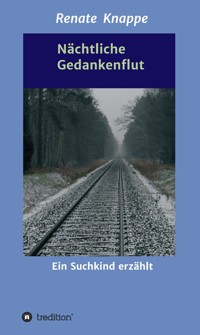
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Nena und ihre Geschwister werden während der Flucht aus Ostpreußen am Ende des 2. Weltkrieges von der Mutter getrennt. Nach vielen Schicksalsschlägen und langem Suchen finden sich in dieser entbehrungsreichen Zeit Mutter und Tochter wieder.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 151
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Renate Knappe
Nächtliche Gedankenflut
oder
Ein Suchkind erzählt
© 2018 Renate Knappe
Verlag und Druck: tredition GmbH,
Halenreie 40-44
22359 Hamburg
ISBN
Paperback:
978-3-7469-1153-3
Hardcover:
978-3-7469-1154-0
e-Book:
978-3-7469-1155-7
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Prolog
Ich heiße Nena und will hier von meiner Kindheit erzählen und damit also auch einen wesentlichen Teil unserer Familiengeschichte.
Es ist eine alte Geschichte, fast schon eine Tragödie, die sich vor etwa 70 Jahren zugetragen hat, deren Auswirkungen aber bis in die heutige Zeit zu spüren sind.
Sie ist ein Quälgeist. Einst ließ sie meine Mutter nachts nicht in Ruhe, und seit es Mutti nicht mehr gibt, kommen die Erinnerungen an vergangene Zeiten zu mir und bedrängen mich.
Diese Geschichte will aufgeschrieben werden. Das wünscht sie sich sehr. Sie fürchtet, und das mit Recht, sonst von der Welt vergessen zu werden.
Gut, ich werde ihr den Gefallen tun und das Familienschicksal aufschreiben.
Ich füge Begebenheiten, die meine Mutter und ich entweder gemeinsam oder auch getrennt voneinander erlebten, zusammen.
Möglicherweise ergeben sich hier und da ein paar Ungenauigkeiten. Das nehme ich dann auf meine Kappe, doch es ist niemand aus der Familie mehr auf dieser Welt, den ich bitten könnte, meine Ausführungen zu korrigieren. Noch ein Hinweis:
Da dieses kein Märchen ist, sondern die nackte Realität, gibt es nicht immer einen positiven Ausgang.
Kapitel 1
Unsere Familie war bis zu dem großen Schicksalsschlag eine ganz normale Familie mit Vater, Mutter und Kindern. Mein Vater, der den Beruf eines Kaufmanns erlernte, und zwischen den beiden Weltkriegen mehrmals arbeitslos war, ergriff die ihm gebotene Möglichkeit, wieder zu einem regelmäßigen Einkommen zu gelangen und wurde Sportlehrer bei der Wehrmacht. Seine Erfahrungen, die er in jugendlichen Jahren bereits im 1. Weltkrieg als Soldat gemacht hatte, kamen ihm nun zugute.
Er war stolz, nach Jahren der Arbeitslosigkeit wieder ein normales Leben zu führen und jetzt auch eine Familie gründen zu können, und zwar mit Gusti, einem hübschen Mädchen mit schwarzen Haaren und braunen Augen, das er bei einer Tanzveranstaltung in Königsberg kennengelernt hatte.
Gusti war glücklich über die bevorstehenden Jahre, die sie nun mit Ludwig haben sollte, und gab ihre Arbeitsstelle als Kontoristin auf. Sie heirateten beide im Jahre 1933. Ein Jahr später bekam das Paar das erste Kind, den Sohn Wolfram, das Jahr darauf das zweite, dieses Mal das Mädchen Britta.
Als ich im Jahre 1941 geboren wurde, wartete bereits ein gemütliches Zuhause auf mich, das sich im Familienhaus von Vaters Dienststelle befand. Gute drei Jahre später wurde aus dem Kindertrio mit Lilli noch ein Quartett.
An meinen Vater habe ich absolut keine Erinnerungen, weder von der Gestalt noch von den Gesichtszügen. Ich sehe lediglich einen Mann in einer Uniform vor mir. Außerdem weiß ich noch gut, dass er ein sehr strenger Familienvater war. Er duldete keine Widerrede, und so brauchte er mich beispielsweise bei Tisch, bei gemeinsamen Mahlzeiten, die die Familie an dem runden Esstisch im Wohnzimmer einnahm, nur scharf anzusehen, da zuckte ich schon zusammen, und ich aß meinen Teller ohne zu murren leer, auch wenn es mir nicht schmeckte oder ich eigentlich schon satt war. Ein Blick von ihm genügte, und ich wusste, was zu tun ist.
Was ich noch weiß, wenn ich an meinen Papa denke? Ja, da ist noch etwas. Er sitzt im Sessel, ich stehe hinter ihm und betrachte in seinem kurzgeschnittenen Haarschopf eine kahle Stelle am Hinterkopf, die von unserer Mutter scherzhaft als „Mond“ bezeichnet wurde. Das ist dann auch schon alles, was ich mir von meinem Papa vorstelle. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Im Gegensatz zu unserem Vater war unsere Mama den ganzen Tag bei uns Kindern und immer für uns greifbar. Sie war einfach da, sie hegte und pflegte unsere Wehwehchen und umsorgte liebevoll die Familie.
Die Familienidylle, so wie ich sie vor Augen habe, fand dann aber ein jähes Ende, als wir uns mitten in einer Januarnacht von unserem Vater und von unserer Heimat auf Nimmerwiedersehen verabschieden mussten. Dass es für immer sein sollte, war natürlich keinem in dieser Minute bewusst.
So begann unsere Odyssee:
„In der Nacht des 17. Januar 1945 gingen in Deutsch-Eylau unaufhörlich die Sirenen. Dazwischen folgte laufend die Bekanntgabe, dass die Einwohner sofort die Stadt zu verlassen haben, da der Feind im Anmarsch ist…
Züge würden auf dem Bahnhof bereitstehen.“
Diese Aussage meiner Mutter, Teil einer schriftlichen Notiz, die ich in den Unterlagen ihres Nachlasses fand, geht mir, seit ich sie las, nicht mehr aus dem Sinn.
Meine vielen Grübeleien über diesen Tatbestand mit allen seinen Folgeerscheinungen, welche mir durch diesen Vermerk wieder verstärkt bewusst gemacht wurden, lassen mich nicht mehr los. Immer wieder stelle ich fest, dass sich das, was damals im Winter 1945 und danach geschah, auf mein ganzes bisheriges Leben auswirkte und überall Spuren hinterließ, die mich verfolgten und die immer wieder meinen Weg kreuzten.
Kapitel 2
Wie war das damals?
Es war ein strenger Winter. Die Temperaturen waren unter -20°C, vielfach sogar auf -25°C gesunken, und es schneite ohne Unterbrechung.
Solch Wetter war für die Einwohner Ostpreußens nichts Ungewöhnliches, denn in diesem Landstrich gehörten klirrende Kälte und Schneegestöber zum richtigen Winter und wurde meist in jedem Jahr aufs Neue sehnlichst erwartet. Schlittenfahrten und Eislaufen, danach die Freude auf eine anheimelnde Wohnung mit einem großen warmen Kachelofen, das alles war nicht zu verachten und zu leugnen.
In diesem Winter allerdings, da war alles anders.
Nun war also für uns alle an diesem 17. Januar 1945 der entscheidende Augenblick gekommen, von dem zum Glück keiner im Vorfeld ahnte, was er auslösen und wie es weitergehen würde, und der auch unser vollständiges und intaktes Familienleben für immer beendete.
Unsere Mutter fürchtete sich schon lange vor diesem Tag, von dem sie wusste, dass er einmal kommt. Nur laut aussprechen durfte sie nicht, was sie insgeheim dachte. Das war verboten. Aber jetzt half nichts, jetzt war er da, dieser Tag, und sie allein musste die Kinder in Sicherheit bringen und sich selbst auch, schon der Kinder wegen. Sie hoffte, wünschte sich und baute darauf, auch bald wieder ihren treusorgenden Ehemann Ludwig an ihrer Seite zu haben. Bis dahin musste sie nun allein mit den Kindern auf die Flucht gehen.
Es war unserem Vater leider nicht vergönnt, uns in dieser kritischen Lage als Oberhaupt der Familie zu begleiten und zu beschützen, denn es war Krieg und er hatte sich dem fatalen und nutzlosen Kampf um den Endsieg Deutschlands zu stellen.
Ihm gelang es jedoch, für ein paar Minuten zu uns in die Wohnung zu einem traurigen Lebewohl zu kommen. Es war das letzte Mal, dass ich von Papa in den Arm genommen und gedrückt wurde und zu jemandem das vertraute Wort „Papa“ sagte. Das geschah nie wieder in meinem Leben und war mir auch erst viele Jahre später bewusst. Papa war jetzt weg, für immer für uns verloren. Unwiderruflich! Wir sahen ihn nicht wieder.
Ab sofort hatte Mutti, damals eine junge Frau von fast 35 Jahren, ein schweres Los auf sich genommen und trat, ganz auf sich gestellt, mit uns vier Kindern, mit
Wolfram (10 Jahre), Britta (9 Jahre), Nena (3 Jahre) und dem Baby Lilli (5 Monate)
eine Hals über Kopf begonnene ziellose Reise ins Unbekannte und nach Nirgendwo an.
Mutti war es in den vergangenen zwölf Jahren, in ihren Ehejahren, gar nicht gewohnt, wichtige Entscheidungen für die Familie zu treffen. Mein Bruder Wolfram, der ja immerhin sieben Jahre älter als ich und zudem ein helles Köpfchen war, hatte das mitbekommen und sagte mir dazu einmal, dass diese Situation völlig neu für Mutti war. Das wäre ganz typisch für diese Zeit, dass dem Mann, die Rolle des Bestimmens zukam. Das war sogar gesetzlich verankert und steht auch im Familienstammbuch, welches meinen Eltern zur Eheschließung im Jahre 1933 ausgehändigt wurde. Es heißt dort wörtlich:
„… In der Ehegemeinschaft ist der Mann das Haupt…
Ihm überlässt das Gesetz die Bestimmung
von Wohnort und Wohnung und die Entscheidung
in allen das gemeinschaftliche Eheleben
betreffenden Angelegenheiten…“
Weiter heißt es:
„…In den Geschäften
des engeren häuslichen Wirkungskreises
ist die Frau berechtigt, den Mann zu vertreten…“
Ich denke, Vater nahm dieses Privileg des Oberhauptes der Familie sehr ernst. Er war wirklich eine große Autoritätsperson, der wir Achtung und Respekt entgegenbrachten. Sein Wort galt ohne Wenn und Aber, ohne Widerrede, ohne Diskussion. Dennoch, er stellte seine Familie, die er abgöttisch liebte, über alles; das weiß ich von Wolfram.
Aber nun schickte er uns, zwar ungewollt, allein auf Reisen. Er kam nicht mit, uns zu beschützen und eventuelle Gefahren, die auf uns lauerten, abzuwenden oder wenigstens zu verringern. Er kam nicht mit und war nicht da, uns zu helfen und Mutti zu entlasten. Wir traten ohne ihn die ungewisse Reise an, und keiner wusste, wohin die Reise gehen würde; die Hauptsache weg und raus aus der Gefahr.
Kapitel 3
Ich war zum damaligen Zeitpunkt gute drei Jahre alt. An den Augenblick, an dem wir Abschied nahmen von der Heimat, Abschied vom Vater, Abschied vom Zuhause kann ich mich nur undeutlich erinnern, denn immerhin war es mitten in der Nacht, als ich aus dem Schlaf gerissen wurde und wir aus der Wohnung gingen. Wahrscheinlich funktionierte ich einfach, stellte auch keine Fragen, weil ich wohl spürte, dass es nicht die richtige Zeit für lange Erklärungen war.
Selbst wenn ich Näheres über das Wie und das Warum gewusst hätte, verstanden hätte ich es bestimmt nicht. Woher sollte ich, eine Dreijährige, auch wissen, was es bedeutet, vertrautes Terrain wegen Krieg verlassen zu müssen. Wussten das denn immer die Erwachsenen?
Ich sollte so peu à peu diese Erfahrungen machen.
Schon unterwegs zum Bahnhof erlebten wir, dass die Straßen mit Menschen vollgestopft waren. Was auf dem Bahnhofsgelände los war, kann sich wohl jeder denken und sich auch gut vorstellen, was es heißt, wenn alle Einwohner einer Stadt zum gleichen Zeitpunkt zu einer bestimmten Stelle kommen sollen.
Diese Menschenmassen, die alle in Züge einsteigen wollten! Schon allein dieser Anblick war beängstigend.
Jedenfalls fanden wir in einer Ecke eines bereitgestellten Zuges, eines Güterzuges, einen mit Stroh angereicherten Platz, allerdings auf engstem Raum. Wir hatten immerhin Glück, nicht auf nacktem Boden sitzen zu müssen.
Ich sehe mich in der Erinnerung noch viele Jahre später, wie ich als Dreijährige zusammen mit meinem Bruder Wolfram und der Schwester Britta dicht gedrängt bei Mutti und dem Kinderwagen mit dem Baby Lilli sitze, umgeben von vielen anderen Leuten, die alle dasselbe Los wie wir hatten.
Das wenige Gepäck, das wir unser Eigen nannten, behielten wir gut im Auge. Es war in der Menschenmasse wichtig, auf Hab und Gut zu achten, denn es war klar, Ersatz würde es nicht geben, wenn es abhandenkäme.
Aber was war das schon – unser Hab und Gut! Es konnte und durfte nur mitgenommen werden, was unbedingt notwendig war. In unserem Fall sah das so aus: Ein Koffer mit ein wenig Wäsche zum Wechseln für jeden, eine Tasche mit Nahrungsmitteln für unterwegs, wie Kekse, Stullenpakete, Zwieback und Milchprodukte.
In Muttis Handtasche steckten ein paar wichtige Papiere und einige Fotos. Wolfram und Britta hatten beide ihre Schultornister dabei mit jeweils einem warmen Pullover und einem dünnen Büchlein. Auf seinen Schulatlas hatte Wolfram auch nicht verzichten wollen. Er hoffte, darin noch das Ziel dieser Reise zu entdecken.
Ich hatte mich in aller Eile für eine meiner vielen Puppen entschieden. Natürlich durfte es nur eine ganz kleine sein, die in meine Manteltasche passte. Meine Lieblingspuppe, die Monika, lag bei unserem Verlassen der Wohnung in ihrem Puppenbett, das in der Ecke des Schlafzimmers meiner Eltern stand. Dort lag sie warm eingepackt. Ich hatte sie noch gut zugedeckt. Ade, Moni! Bis bald!
Ob sie wohl noch immer auf mich wartet? Oder hat sie mich schon vergessen, weil sie eine neue Puppenmama hat? Diese Fragen bewegten mich in meiner Kindheit sehr, aber niemand wollte sie mir beantworten.
Ein Trost war mir jedoch immer, dass mein Puppenkind Moni nicht allein war, als wir gingen. Bei ihr war Hilde, die hübsche und wertvolle Schildkrötenpuppe meiner Schwester Britta. Eigenartig war nur, diesen Puppen und den vielen anderen Dingen, die wir zurückließen, weinten wir keine bitteren Tränen hinterher. Warum nur nicht? Ich denke, dafür war nie der richtige Zeitpunkt. Wir wurden durch aktuelle Probleme immer wieder abgelenkt, durch neue brenzlige Situationen, in die wir gerieten und die wir meistern mussten.
Dennoch hatten wir während unserer Irrfahrt auf dem Fluchtweg genügend Zeit, ja, die hatten wir wirklich im Überfluss, Zeit gepaart mit Angst und Panik. Der Güterzug, der uns aus Deutsch-Eylau heraus aus der Gefahrenzone bringen sollte, kam nur sehr stockend voran. Immer wieder musste er halten, weil ringsherum der Krieg tobte und der Gegner unsere Weiterfahrt mit Barrieren auf den Gleisen, Tieffliegern, Panzern, Maschinengewehren oder Bombenabwürfen blockierte. Oft wich unser Güterzug auf Gleise der Nebenstrecken aus, um dem Schlimmsten zu entkommen, oder er musste die Strecke auch für unsere deutschen Soldaten, aber auch für die feindliche Armee freimachen. Dann brauchten diese die Eisenbahnschienen und Straßen, und die Zugreisenden mussten eben warten. Es kam zudem häufig vor, dass die Gleise zerstört waren. Auch dann war an eine Weiterfahrt nicht zu denken. Wir mussten dann eben warten und die Gewehrfeuer aus der Ferne oder gar die Salven der Maschinengewehre aus der Nähe mitanhören. Das erzeugte bei allen Angst. Wie viel Angst kann ein Mensch eigentlich ertragen?
In den einzelnen Waggons saßen die Fliehenden mit einer Zentnerlast von Angst auf den Schultern, furchtsam und zusammengepfercht zwischen fremden Leuten, Koffern, Taschen und Rucksäcken und waren dem Spektakel völlig hilflos ausgeliefert, jeden Tag und jede Nacht aufs Neue. Mittendrin waren wir, unsere Mutter mit uns, den vier Kindern, eigentlich suchten wir ja nur einen Weg in die Sicherheit, wo immer die auch war. Wir wollten nur diesen kritischen Zuständen entfliehen! Mehr nicht. Aber statt besser, wurde es immer unerträglicher. Dazu der Platzmangel, der uns zwang, still auf der ergatterten Stelle sitzen zu bleiben. Er nahm uns jegliche Möglichkeit, uns zu bewegen. Kein Hopsen, Springen, Laufen. Kein fröhliches Lachen, kein Spielen, kein Spaß. Solches war vorbei und auch vergessen.
So ging es eine lange Zeit, diese Tage und Nächte wollten kein Ende nehmen. Obwohl mit uns viele Leute in dem Waggon saßen, waren wir doch allein.
Uns Kindern ging es auch gar nicht gut. Britta kränkelte schon seit der Abfahrt, und ich bekam heftige Ohrenschmerzen. Auf dem engen und unbequemen Lager, auf dem wir uns, so gut es ging, eingerichtet hatten, war natürlich kein Auskurieren möglich, und die Fahrt zog sich hin und dauerte und dauerte.
Das war es aber nicht allein, was unsere Reise so beschwerlich machte. Es gab weitere große Probleme, die es zu bewältigen galt.
Kapitel 4
Als wir unsere Reise begannen, wusste niemand, wohin es geht und wie lange es dauert, bis wir irgendwo einen sicheren Hafen erreichen.
Am 17. Januar waren wir aufgebrochen. Nun war dieser Monat längst vorbei, und der Februar hatte begonnen. Ein Ziel war noch immer nicht in Sicht. So harrten wir auf unserem Strohlager aus, ruckelten abwechselnd mit unserem Zug vor- und rückwärts, mal zu dieser Seite, mal zu jener, hin und her oder standen bewegungslos auf der Strecke oder den Nebengleisen. Es ging nicht voran.
Der Reiseproviant war längst aufgebraucht, also die Stullen vertilgt, ebenso die übrigen Lebensmittel aus der Esstasche. Was sollten wir essen? Panik machte sich breit.
Ich kann mir heute, so viele Jahre später, auch gar nicht mehr erklären, wie wir die Fahrt ohne Verpflegung überstanden haben. Wie hat es Mutti nur geschafft, uns zu ernähren, uns durchzubringen, obwohl wir nichts mehr hatten?
Ja, gelegentlich tauchten Rote-Kreuz-Schwestern auf, die den verängstigen, durstenden und hungernden Flüchtlingen einen warmen Tee oder eine dünne Suppe anboten, aber das war sehr selten, und verlassen konnte sich niemand, dass dieses in absehbarer Zeit wieder geschieht beziehungsweise der Magen damit wenigstens annähernd gefüllt wird.
Eine „Delikatesse“ fällt mir an dieser Stelle ein, und ich will sie nicht unerwähnt lassen. Es gab da noch etwas, das wir, wenn auch nur ein- oder zweimal, unserem knurrenden Magen anboten. Dieses hing mit dem anhaltenden Winterwetter zusammen.
Wie bereits im Vorfeld erwähnt, ruckelten wir, allen ringsherum lauernden Gefahren zum Trotz, mal schnell, mal langsam, mehr stehend als fahrend durch die Lande. Wenn gelegentlich die Tür aufgeschoben wurde, sahen wir bei klarer Sicht eine weitreichende Landschaft, eine weiße Winterlandschaft. Wenn dann der lange Güterzug irgendwo unversehens anhielt und es vorauszusehen war, dass er nicht gleich wieder weiterfährt, nutzten viele aus dem Zug kurz entschlossen den Aufenthalt, das jetzt stehende Fahrzeug zu verlassen, sich eine Stelle zu suchen, um sich in freier Natur, möglichst, wenn vorhanden, hinter einem Busch versteckt, zu erleichtern, zwar auch nicht von anderen ungesehen, aber immerhin besser als beim Kübel im Waggon. Solche Pausen gab es öfter, aber nicht für uns. Das ließ Mutti nicht zu, dass wir ausstiegen. Es war einfach zu riskant und zu ungewiss, wann es weitergeht, wann sich der Zug wieder in Bewegung setzt.
Eine Ausnahme machte sie allerdings bei Wolfram, ihrem ältesten Kind. Er durfte sich hin und wieder unter die Aussteigenden mischen, um auf dem Feld, wenn dieses als abgeerntetes Rübenfeld zu erkennen war, zwischen Schnee- und Eisklumpen nach Nahrung zu suchen, nach Rüben oder zumindest Rübenresten, die nach der letzten Ernte liegengeblieben waren. Er wurde auch fündig, aber eben äußerst selten, und wir freuten uns über seine Beute. Von einem solchen kalten Rübenstück wurden wir zwar nicht satt, aber wir lebten weiter.
Diese Idee, auf diese Art etwas Essbares zu suchen und zu finden, stammte nicht von uns, die hatten andere vor uns auch schon, zum Beispiel damals – im 1. Weltkrieg. Das las ich einmal in einem Bericht, und es wurde sogar vom Rübenwinter gesprochen.
Es war für uns wirklich eine Delikatesse, die zu Eis gefrorenen Wrukenstücke möglichst langsam im Mund schmelzen zu lassen, lange zu kauen und dann runterzuschlucken. Das war besser als nichts, und wir hatten es einmal wieder geschafft, den Magen zu überlisten.
Bei dieser Fahrt hatte jeder seine eigenen persönlichen Feinde, und doch waren es bei allen immer die gleichen:





























