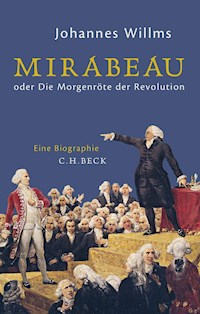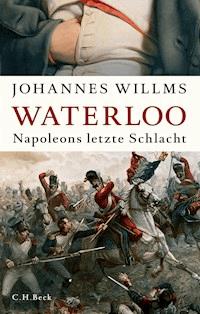19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
»Nationalismus ohne Nation« ist ein erzählendes Geschichtswerk über das 19. Jahrhundert. Der Historiker Johannes Willms schildert anschaulich die deutsche Geschichte vom Untergang des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation bis zum Untergang des bismarckisch-preußischen Nationalstaats im Ersten Weltkrieg. Dabei entlarvt er die Reichsgründung von 1871, die als die Erfüllung der deutschen Geschichte galt, als einen Mythos. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1458
Ähnliche
Johannes Willms
Nationalismus ohne Nation
Deutsche Geschichte von 1789–1914
FISCHER E-Books
Inhalt
Für REINHART KOSELLECK
Vorbemerkung zur Taschenbuchausgabe
Das jetzt in einer wohlfeilen Taschenausgabe vorliegende Buch wurde vom Verfasser als ein Korrektiv zu jener im Jahre 1980 aufkommenden weithin unkritischen Preußenverherrlichung und der aus dieser notwendig resultierenden perspektivischen Verzerrung, unter der die Geschichte der Deutschen insbesondere im 19. Jahrhundert gesehen wurde, konzipiert und geschrieben. Ersichtlich war schon damals, daß diese Preußenverherrlichung Mitteilung von einem Wandel der politisch-historischen Grundbefindlichkeit in der Bundesrepublik Deutschland machte. In einem Aufsatz, der im Spätsommer 1981 in der »Neuen Rundschau« erschien, schrieb der Autor: »Preußen wird immer Streitfall bleiben. Nicht weil es besonders reich an inneren Widersprüchen gewesen wäre, sondern einfach deshalb, weil es nicht mehr ist. Dadurch gewinnt es vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte, die unglücklicher verlief als die der meisten anderen europäischen Völker, die Faszination der verpaßten Chance … Preußen, so scheint es, wird zum Roman, der über das große Umsonst der deutschen Geschichte hinwegtrösten soll.«
Unterdessen hat sich die politische und gesellschaftliche Restauration, die sich mit jener Preußenrenaissance ankündigte, längst derart etabliert, daß ihr auch die offensichtlichste Tölpelei ihrer Repräsentanten keinerlei Eintrag mehr zu tun vermag. Dieses Phänomen einer beneidenswert wirksamen Immunisierung, derer sich die Exponenten dieser Restauration erfreuen, korrespondiert nicht zufällig mit dem anderen Phänomen einer der neohistoristischen Objektivitätsvergötzung verhafteten Geschichtsschreibung, deren Erkenntnis einer vermeintlich historischen Wahrheit letztlich im Unfaßlichen schlechthin, in der »tragischen Entwicklung der deutschen Geschichte« als solcher besteht. Der große Publikumserfolg dieser Geschichtsschreibung legt den Verdacht nahe, daß sie einem Volk, dem so viele Berührungsängste mit der eigenen Vergangenheit nachgesagt werden wie dem deutschen, vor allem deshalb als so plausibel erscheint, weil sie die historiographisch höchst fragwürdige Kategorie des Tragischen als den Kern der von ihr ermittelten historischen Wahrheit feststellt. Das Geheimnis dieser Plausibilität liegt jedoch in nichts anderem als darin, daß jene als Quintessenz historischer Wahrheit deklarierte Tragik dem hierzulande weitverbreiteten indolenten Bewußtsein historischer Verantwortungslosigkeit die höchst willkommenen Weihen wissenschaftlicher Rechtfertigung verleiht.
Solche Rechtfertigungen und Entlastungen, wie zeitgemäß oder opportun sie auch sein mögen, hält dieses Buch für seinen Leser nicht bereit. Und schon gar nicht huldigte sein Verfasser jener zutiefst unpolitischen und deshalb auch historisch unverantwortlichen Vergangenheitsverklärung, wie sie heute wieder en vogue ist. Seine Absicht war es vielmehr erklärtermaßen, mit den Mitteln der Geschichtsschreibung politische Aufklärung dergestalt zu treiben, daß das Vergangene von den Bedingungen der Möglichkeit des Hier und Heute aus ergründet, analysiert und bewertet wird. Nicht um Verurteilung oder Verdammung dessen, wie es eigentlich gewesen, ging es ihm dabei, sondern lediglich darum, Einsichten in die eigene Geschichte zu vermitteln, die unseren heutigen Erfahrungen entsprechen.
FRANKFURT AM MAIN, im Januar 1985
JOHANNES WILLMS
Vorwort
»Es kennzeichnet die Deutschen, daß bei ihnen die Frage ›was ist deutsch?‹ niemals ausstirbt.«
FRIEDRICH NIETZSCHE
Dieses Buch handelt von der Vergeblichkeit der deutschen Geschichte im 19. Jahrhundert; es schildert eine Epoche, von deren Ende nur noch wenige sehr alte Menschen eine aus eigener Anschauung gewonnene Vorstellung zu erinnern vermögen. Für die meisten ist diese Zeit heute tiefste Vergangenheit. Wie auch anders, da alles, was damals von den Menschen politisch erhofft, erstritten und erlitten worden ist, so offensichtlich vergebens war, ja schlimmer noch, in unserer Epoche, im 20. Jahrhundert, zu Unheil und Vernichtung wurde. Im Guten wie im Schlechten stellte das 19. Jahrhundert die Voraussetzungen für jenes Deutschland bereit, von dem Thomas Mann 1945 bemerkte, daß ihm »sein Bestes durch Teufelslist zum Bösen ausschlug«.
Das 19. Jahrhundert war die Epoche, in der die Deutschen den Traum von einer einigen deutschen Nation in Freiheit zu träumen begannen. Dieser Traum blieb eine Herausforderung, die von der politischen Wirklichkeit des Deutschen Reichs, das Bismarck mit »Blut und Eisen« schuf, nicht erfüllt wurde. Das Deutsche Reich Bismarcks, das einst nicht wenigen als die Vollendung der deutschen Geschichte erschien, ist heute eine verblaßte Erinnerung. Keine Irredenta, kein versprengter Haufen hält sein Andenken gewaltsam wach. Nein, für die Vergeblichkeit der deutschen Geschichte im 19. Jahrhundert bedarf es, so möchte man meinen, in dieser zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts keiner wortreichen Beweisführung mehr. Die Tatsachen sprechen eine allzu beredte Sprache. Wohl aber gilt es, nach den Gründen und Ursachen dieser Vergeblichkeit zu forschen und zu fragen, Gründe und Ursachen aufzudecken, die nicht nur in unserer Epoche, sondern vor allem auch in jener des 19. Jahrhunderts zu vermuten sind.
Der Nationalismus ist der große historische Mythos der Moderne, den die Französische Revolution gebar und der seine Signatur auch der deutschen Geschichte im 19. Jahrhundert aufgeprägt hat. Die nationalistische Ideologie, die das Recht der »Nationen« postuliert, sich als souveräne Staaten mit einer ihnen je eigenen »nationalen Individualität« zu etablieren, war derart erfolgreich, daß das Phänomen des »Nationalstaats« heute als eine gleichsam historische sprich »natürliche« und mithin selbstverständliche Tatsache angesehen wird. Dieser historische Determinismus beherrscht auch die Sicht auf die deutsche Geschichte im 19. Jahrhundert.
Der Nationalismus behauptet die »objektiv« vorgegebene Realität einer »Nation«, das heißt die Existenz einer Bevölkerung, deren Zusammengehörigkeit sowohl durch die Gemeinsamkeit ihres »Lebensraums« wie auch dadurch bestimmt ist, daß ihre Mitglieder in einer Reihe nur ihnen gemeinsamer kultureller oder ethnischer Merkmale übereinstimmen. Indem der Nationalismus die »Nation« als eine voluntaristisch gesetzte Wirklichkeit schafft, ist er zugleich aber auch stets bestrebt, dieses Manko zu vertuschen. Deshalb betont er die scheinbar natürliche Gemeinsamkeit vorpolitischer Traditionen kultureller, geschichtlicher, sprachlicher, religiöser oder ethnischer Natur, die von ihm als a priori vorhandene konstitutive Merkmale der »nationalen Identität« ausgegeben werden. Mit dieser Historisierung, die zugleich eine Objektivierung der voluntaristisch gesetzten Wirklichkeit der »Nation« darstellt, gelingt es dem Nationalismus, das Ziel all seines Strebens als »Schicksal« oder als »Notwendigkeit« gesellschaftlich und damit auch politisch zu immunisieren.
Der Nationalismus ist zweierlei: Er ist zunächst eine von einer gesellschaftlichen Minorität oder »Elite« getragene politische Bewegung, die vorrangig das Ziel verfolgt, Macht zu erringen und auszuüben, und er ist zum weiteren eine Ideologie, die dazu bestimmt ist, die Unterstützung anderer gesellschaftlicher Gruppen, vorzüglich der »unpolitischen Massen«, für dieses Ziel zu erhalten.
Der Nationalismus als eine politische Bewegung entfaltete sich erst im historischen Kontext der Moderne, als deren kennzeichnendes Merkmal das Auseinandertreten von Privatsphäre und Öffentlichkeit, von Gesellschaft und Staat angesehen werden kann. Seinem Charakter nach steht der Nationalismus in Opposition zu dieser Moderne, insofern er bestrebt ist, jene Kluft zuzuschütten und Staat und Gesellschaft in eine neue Einheit zu überführen. Als diese neue Einheit figuriert dem Nationalismus die politische »Nation«, deren eigentliches Wesen sich in der im »Nationalstaat« konzentrierten Macht nach außen, der Souveränität, erfüllt. »Allein in erster Linie«, so meint Jacob Burckhardt in den Weltgeschichtlichen Betrachtungen weit über seine Zeit hinausschauend, »will die Nation (scheinbar oder wirklich) vor Allem Macht; das kleinstaatliche Dasein wird wie eine bisherige Schande perhorrescirt, alle Thätigkeit für dasselbe genügt den treibenden Individuen nicht; man will nur etwas Großem gehören und verräth damit deutlich, daß die Macht das erste, die Cultur höchstens ein ganz secundäres Ziel ist. Ganz besonders will man den Gesamtwillen nach außen geltend machen, andern Völkern zum Trotze.«
Der Nationalismus als politische Doktrin und Bewegung trat als eine die wirklichen Bewegungsabläufe beeinflussende Kraft in der deutschen Geschichte im 19. Jahrhundert erst relativ spät in Erscheinung. Recht eigentlich muß man feststellen, daß der Nationalismus als Folge der vermeintlich nationalstaatlichen Einigung Deutschlands durch Bismarck weitaus bedeutsamer war denn als Ursache. Dem deutschen Nationalismus, der deutschen Nationalbewegung eignete bei der Reichsgründung lediglich eine akzessorische Funktion: Der Nationalismus lieferte die nachträgliche Legitimation für eine Schöpfung, die so, wie sie entstanden war, seinen eigenen Intentionen völlig zuwiderlief. Mit anderen Worten: Der deutsche »Nationalstaat« und die deutsche »Nation« wurden durch das Faktum der Reichsgründung von 1871 keineswegs erfüllt, sondern durch diese erst zu einem Problem, das, weil es damals nicht gelöst wurde, seither unlösbar geworden ist. Die Misere des deutschen Nationalismus fiel von da an immer mit diesem zusammen, was aber nicht zu verhindern vermochte, daß er weiter existieren wird und muß, solange es eine deutsche Geschichte gibt.
Bismarcks tollkühner Versuch, mit der Reichseinigung »von oben« die politische »Nation« und den deutschen »Nationalstaat«, jene wahrhaft revolutionären Gebilde, zu vereiteln, die Preußen, dessen Interessen er sich einzig und allein verpflichtet wußte, notwendigerweise verschlingen würden, ist völlig mißlungen: Der Mythos der »Nation« wurde nicht von der Wirklichkeit des Bismarckreichs verzehrt, sondern politisch in dem Maß erinnert, wie das Deutsche Reich immer weniger jener zentrifugalen Kräfte Herr werden konnte, die von den tiefgreifenden sozioökonomischen Wandlungsprozessen der »industriellen Revolution« freigesetzt wurden. Im unerfüllten Mythos der »Nation«, im »Nationalismus ohne Nation«, der schließlich seinerseits dieses Deutsche Reich verschlang, scheint sich die Vergeblichkeit der deutschen Geschichte im 19. Jahrhundert zu erweisen.
Kann Geschichte aber vergeblich sein? Verhält es sich nicht vielmehr so, daß jene vermeintliche Vergeblichkeit der deutschen Geschichte im 19. Jahrhundert im Lichte unserer Erfahrung nichts anderes ist als ein perspektivischer Irrtum, Konsequenz und Ergebnis einer auch nur noch historischen Sinngebung, die uns Heutigen mit Notwendigkeit als sinnlos erscheint!?
Es gibt keine endgültige Geschichte. Rankes berühmte Maxime, Geschichte so zu schreiben, »wie es eigentlich gewesen«, verrät eine Sicherheit, die wir längst nicht mehr besitzen. Jede Geschichtsschreibung ist ihrer Zeit und den diese prägenden Erfahrungen verhaftet; jede Geschichtsschreibung von Rang ist mithin Programm, kann folglich auch nicht »sine ira et studio« ausgeführt werden. Dies leugnen zu wollen wäre Torheit.
Ein weitverbreiteter Irrtum wähnt, Geschichte sei allein das, was gewesen ist. Wenn es sich wirklich so verhielte, dann wäre jede Beschäftigung mit Geschichte völlig sinnlos, wäre diese lediglich museales Relikt, ein Stück altes Ägypten, an dessen kunsthandwerklicher Fertigkeit sich die Öffentlichkeit allenfalls noch ergötzen könnte. Nein, Geschichte ist nicht nur das, was gewesen ist, sondern auch das, was ist, ja sogar das, was sein wird. Geschichte ist nicht tot; sie lebt, indem sie in mannigfacher Weise unser aller Leben prägt; Geschichte erfüllt sich in uns und wird auch noch nach uns sein, wenn das, was uns heute beschäftigt und umtreibt, wenn wir selbst nur noch Vergangenheit sind.
Die Maßstäbe, nach denen ein Historiker urteilt, die Farben und Proportionen, mit denen er seinen Stoff gestaltet, sind beeinflußt von seinem Talent, seinen Erfahrungen und seinem Temperament. Was Geschichtsschreibung ist, hat Bernhard Guttmann einmal in einer schönen Analogie folgendermaßen ausgedrückt: »Man nannte das Kunstwerk ein Stück Natur, gesehen durch ein Temperament. Anklingend ließe sich sagen, ein Buch Geschichte sei aus dem Grabe aufsteigendes Schicksal, nacherlitten in einem Charakter.« Geschichte ist trotz aller überpersonalen Faktoren, die ihren Verlauf mit beeinflussen, vor allem Menschenwerk; sie zu erzählen, sie zu interpretieren nicht minder. Eine »objektive« Geschichtsschreibung ist und bleibt Fiktion. Mehr nicht. In seiner radikalen Einseitigkeit, in der Parteilichkeit seiner Perspektive fühlt sich der Verfasser des vorliegenden Buches der Schopenhauerschen Maxime verpflichtet, daß erst durch die Geschichte ein Volk sich seiner selbst vollständig bewußt wird. Dazu einen Beitrag zu leisten, erheischt das Ethos des Historikers, verlangt sein »Beruf«, von dem Johann Gustav Droysen am 12. Dezember 1865 an Heinrich von Treitschke schrieb: »Einem Volk das Bild seiner selbst geben, ist der Beruf und die Pflicht der Historiker, und zumal einem so irregeleiteten, gedankenlos faselnden und toastenden Volk, wie unser deutsches ist.«
Die vorliegende Darstellung wurde von vornherein als Thesengeschichte konzipiert, das heißt, sie erhebt keinerlei Anspruch darauf, die Totalität der Geschehensabläufe und der Ereignisse der deutschen Geschichte im 19. Jahrhundert vor ihrem Leser auszubreiten. Es wäre dies sowieso ein unmögliches Unterfangen, dem auch eine wesentlich umfangreichere Abhandlung als diese nicht gerecht werden könnte. Der Historiker muß, ob er dies nun offen eingesteht oder es stillschweigend tut, aus der Überfülle vergangener Ereignisse und Gestalten, aus all jenen Zeugnissen und Büchern, die sich vor ihm zu wahren Gebirgsmassiven auftürmen, nach bestem Wissen und Gewissen eine Auswahl treffen. Jede Geschichtsschreibung ist deshalb zunächst bestimmt durch diesen Prozeß einer stetigen Auswahl, stellt mithin eine ganze Kette von Einzelentscheidungen dar, die der Historiker trifft, um die Fülle des Stoffs, in der er sonst ertrinken würde, sinnvoll zu reduzieren. Keineswegs aber darf es schiere Willkür sein, mit der der Historiker dieses Geschäft des Sichtens und Sortierens betreibt; vielmehr orientiert er sich dabei an dem, was Jürgen Habermas als das »erkenntnisleitende Interesse« bezeichnete. Aus diesem »erkenntnisleitenden Interesse« gewinnt der Historiker seine These, seine List der Vernunft, um sich solchermaßen die Bedingung der Möglichkeit zu verschaffen, Einsicht in die verwirrende Vielfalt all dessen zu bekommen, was war. Die These ist für den Autor wie für seinen Leser gleichsam der Faden der Ariadne, mit dessen Hilfe sie beide durch das dunkle Labyrinth der Vergangenheit wieder sicher zur Helle ihrer Tage gelangen.
Keineswegs also hat der Autor alle Quellen und Darstellungen, die für die von ihm geschilderte Epoche von Belang waren, durchgesehen, gelesen und ausgewertet; er hat vielmehr nur einen kleinen Bruchteil all jener Zeugnisse, die für sein Thema relevant waren, eingesehen und für sein Werk benutzt; die Anmerkungen geben im einzelnen Rechenschaft davon. Der Laie mag ein solches Verfahren bedenklich finden, während der Fachkundige seine überlegene Kenntnis dadurch zu beweisen suchen wird, daß er darauf aufmerksam macht, diese oder jene wichtige Quelle oder Darstellung sei vom Verfasser nicht »herangezogen« worden. Doch gemach. Auch wenn die Quellenvergötzung, in der die Fachhistorie bisweilen gerne »indulgiert«, fast so alt ist wie diese selbst, beweist dies wenig. Gewiß doch: Ohne ausreichende Quellenkenntnis ist Geschichtsschreibung nicht denkbar. Aber das einzelne Dokument ist bestenfalls ein Steinchen im großen Mosaik einer Epoche, und die genaueste Quellenkenntnis wird bei der Schilderung einer Zeitspanne von mehr als einhundert Jahren nur einzelne Akzente etwas anders setzen, die eine oder die andere der handelnden Figuren in ein anderes Licht tauchen können. Überdies läßt sich für vieles und nicht selten gerade für das, was der Historiker als entscheidend erkennt, keine Quelle, kein positiver Beleg finden, der eindeutigen Aufschluß gäbe. Die bekannte Kontroverse über die unmittelbaren Ursachen, die zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs führten, anläßlich der sich noch vor wenigen Jahren die Gemüter der Fachwelt erhitzten, ist dafür nur ein Beispiel. Und außerdem: Keine Quelle, auch nicht die umfangreichste politische Denkschrift Bismarcks beispielsweise, gibt alle jene Überlegungen wieder, ist nicht schwarz auf weiß ein Katalog all jener Motive, die den, der sie abfaßte, bei seiner Niederschrift bewegten und umtrieben. Jedem Zeugnis, sei es nun ein Aktenstück, ein Brief, ein Memorandum, eine Tagebucheintragung, eine Rede oder ein Lebensbekenntnis, muß der Historiker deshalb mit Mißtrauen gegenübertreten; erst durch seine kritische Interpretation werden die Quellen »zum Sprechen« gebracht. Dies zu leisten ist sein Handwerk.
Wäre Geschichte nichts anderes als die Summe dessen, was in allen Quellen zu finden ist, dann wäre sie auch nichts anderes als antiquarisches Gerümpel. Im übrigen gilt Goethes skeptische Maxime: »Die Pflicht des Historikers ist zwiefach: erst gegen sich selbst, dann gegen den Leser. Bei sich selbst muß er genau prüfen, was wohl geschehen sein könnte, und um des Lesers willen muß er festsetzen, was geschehen sei. Wie er mit sich selbst handelt, mag er mit seinen Kollegen ausmachen; das Publikum muß aber nicht ins Geheimnis hineinsehen, wie wenig in der Geschichte als entschieden ausgemacht kann angesprochen werden.«
Die vorliegende Darstellung der deutschen Geschichte im 19. Jahrhundert ist zum weiteren auch lediglich auf eine Schilderung des politischen, wirtschaftlichen und sozialen Geschehens dieser Epoche beschränkt; alle kulturhistorischen Bezüge wurden konsequent ausgeklammert. Der Verfasser entschloß sich dazu, nicht weil er etwa der »Kulturgeschichte« keine Bedeutung beimäße oder dieser gar sein Interesse nicht gälte, sondern aus dem genau gegenteiligen Grunde: Er hält die Kulturgeschichte dieser Epoche für ein viel zu wichtiges Thema, als daß er glaubte, sich damit bescheiden zu können, ihr, wie dies sonst bei vergleichbaren historischen Schilderungen üblich ist, im Rahmen seiner Darstellung eine letztlich bloß farbige Kulisse bleibende Bedeutung zu geben. Aber auch sonst war »Vollständigkeit« keineswegs sein Ziel und Streben. Die Plausibilität seiner Akzentsetzung, die Verteilung der Gewichte, die er vornahm, orientierte sich vor allem an seiner These, die ihn diesen oder jenen Personen, Bewegungskräften oder Ereignissen bisweilen eine andere Bedeutung zumessen ließ, als dies sonst der Fall ist. Ausschlaggebend dafür war ferner der Umstand, daß auch die Geschichtsschreibung nicht frei von »Moden« ist. Die Geschichte der deutschen Sozialdemokratie und im Zusammenhang damit die bismarcksche Sozialgesetzgebung oder die unmittelbare Vorgeschichte des Ersten Weltkriegs und die Kanzlerschaft Bethmann Hollwegs sind beispielsweise in den letzten Jahren ausführlich und kontrovers erörtert worden. Der Verfasser war deshalb um so geneigter, auf diese Einzelthemen nur insoweit einzugehen, wie ihm dies für das Verständnis des Ganzen absolut unerläßlich zu sein schien.
Die Verteilung der Gewichte, die Gliederung der Stoffmassen innerhalb eines erzählenden Geschichtswerks muß nicht zuletzt auch dramaturgisch-erzählerischen Gesichtspunkten genügen. Die Lektüre eines Buches sollte keinem Leser schwerer gemacht werden, als dies durch die Sprödigkeit und die Schwierigkeit des Stoffes unabdingbar erscheint. Das gilt namentlich für eine Geschichtsdarstellung, die weniger ein Produkt der Phantasie ihres Verfassers als der nüchternen Faktizität des Gewesenen ist. Der Autor hat sich deshalb auch stets darum bemüht, sich so einfach und so bestimmt zu äußern, wie dies der jeweilige Sachverhalt irgend zuließ.
Und noch ein Letztes bedarf einer Erklärung: Der Verfasser hat ausführlicher und häufiger, als dies sonst üblich ist, die Akteure der Zeit, wann immer sich dies als sinnvoll anbot, selbst zu Wort kommen lassen. Das Melos der Sprache einer versunkenen Epoche vermittelt eine eigene Sinnlichkeit, die dem Verfasser ein Genuß war, den er seinem Leser nicht vorenthalten wollte.
FRANKFURT AM MAIN, im März 1983
JOHANNES WILLMS
1. Kapitel Heiliges Römisches Reich
Das Reich, das Heilige Römische Reich Deutscher Nation, wie es zuletzt hieß, hat nie, wie man so sagt, eine »gute Presse« gehabt, weder in der zeitgenössischen Publizistik noch in der späteren Geschichtsschreibung, die im Reich nur Chaos, Verfall und politische Ohnmacht sah. Der schlechte Ruf, der dem alten Reich bis zum heutigen Tag anhaftet, hat mannigfache Ursachen. Als Hauptursache kann dabei gerade das gelten, was dem Reich seinen Charakter und die Garantie seines fast tausendjährigen Bestandes verlieh: seine Universalität. Diese Territorien und Konfessionen umspannende und übergreifende Universalität des alten Reichs ist heutigem Verständnis, das die Welt und die Wirklichkeit nur in nationalen Antagonismen oder in den Gegensätzen unterschiedlicher Gesellschaftssysteme zu erkennen vermag, derart fremd und unverständlich geworden, daß man gelegentlich sogar glaubte, das alte Reich als Hirngespinst, als »Phantasmagorie« abtun zu können.[1] Gegen diese Ansicht spricht allein schon seine Lebensdauer, die nicht allein durch das zähe Festhalten an einem Traum erklärt werden kann, sondern eben auch in der Wirklichkeit begründet gewesen sein mußte. Die historische Wahrheit über das alte Reich ist nicht einfach: Traum und Wirklichkeit, Ohnmacht und Größe sind in ihr in einer für heutiges Verständnis widrigen, ja geradezu widersinnigen Weise miteinander vermischt. Und noch etwas anderes war und ist geeignet, uns das Verständnis für das alte Reich einzutrüben: die Geschichtsschreibung der Neuzeit, deren Gegenstand der Nationalstaat ist.
Vor diesem Hintergrund wird nur allzu deutlich, warum die Geschichtsschreibung bis in unsere Tage hinein es unterlassen hat, eine umfassende Darstellung des Wesens und der Geschichte des Heiligen Römischen Reichs zu geben.[2] Die Frage, die Leopold von Ranke im fünften Band seiner Preußischen Geschichte aufwarf, »ob wohl unsere Reichshistorie jemals bis ins 18. Jahrhundert vordringen wird?«, blieb bis heute unbeantwortet.[3] Die Geschichte des Reichs verschwindet noch immer hinter der seiner Territorien, insbesondere hinter der Österreichs und vor allem der Preußens. Gerade die Bevorzugung Preußens, die sich aus der Bedeutung dieses Landes für die deutsche nationalstaatliche Geschichte im 19. Jahrhundert ergibt, war und ist Ursache für eine Reihe ärgerlicher Überzeichnungen und Verzerrungen.
Der Aufstieg Preußens zum Rang einer europäischen Großmacht vollzog sich im 18. Jahrhundert außerhalb, und das heißt völlig unabhängig vom Reich. Preußens Aufstieg unterlag gänzlich anderen Voraussetzungen und Konstellationen, als es die waren, die zur selben Zeit das Reich und seine Geschicke beeinflußten. Beide, Preußen und das Reich, waren nur sehr entfernt und auch nur sehr einseitig aufeinander bezogen. Denn die Existenz des Reichs in seiner verwirrend bunten Vielfalt war eine entscheidende Voraussetzung für den machtpolitischen Aufstieg Preußens, während umgekehrt das Reich auch ohne Preußen vorzüglich hätte existieren können. Insofern ist es völlig unhistorisch, den machtpolitischen Aufstieg Preußens zum machtpolitischen Niedergang des Reichs in Kontrast zu setzen. Aus einem solchen Vergleich ergibt sich dann das zwar einleuchtende, aber gleichwohl falsche Bild, daß in Preußen schon im 18. Jahrhundert all jene Kräfte in schöner vollzähliger Ordnung versammelt gewesen seien, welche die Zukunft der deutschen Nation und des deutschen Staates gestalten sollten, während das Reich als Hort finsterster Rückständigkeit, politischer Zersplitterung und biederer Unfähigkeit seinem unvermeidlich nahen Ende entgegendämmerte. Diese Anschauung – hier das moderne Preußen, da das heillos verkommene Reich – hat mit der historischen Wirklichkeit des 18. Jahrhunderts deshalb wenig oder nichts gemein, weil sie allzusehr von einer Erfahrung bestimmt wird, die erst aus dem Verlauf, den die Geschichte der Deutschen im 19. Jahrhundert nahm, gewonnen werden konnte. Die Sinngebung der preußischen Geschichte, welche die nationale Geschichtsschreibung des späten 19. Jahrhunderts in der Gründung des deutschen Nationalstaates zu erkennen glaubte, wurde gewaltsam der gesamten preußischen Geschichte übergestülpt. In der Reichseinigung erkannte diese Interpretation die Krönung der preußischen Geschichte schlechthin. Daß eine solche Deutung einer gerechten Behandlung und Darstellung der Geschichte des alten Reiches alles andere als förderlich war, liegt auf der Hand. Welchen Sinn hätte es auch gehabt, sich mit etwas auseinanderzusetzen, das für die weitere Entwicklung der Dinge erwiesenermaßen ohne Bedeutung gewesen ist? – Das Versäumte – diese Vernachlässigung der Geschichte des alten Reichs im 18. Jahrhundert – kann und soll hier nicht nachgeholt werden. Dennoch ist es angezeigt, das Wesen dieses Heiligen Römischen Reichs, das uns so fern zu sein scheint und das uns gleichzeitig aber auch um so vieles näher ist als jenes Preußen, dessen Aktualität heute wieder vielfach beschworen wird, in wenigen Strichen zu skizzieren.
Häufig ist zu lesen, das alte Reich sei im Jahre 1789 in genau eintausendsiebenhundertneunundachtzig selbständige Obrigkeiten und Territorien, Länder, Ländchen und Herrschaften zerfallen.[4] Die territoriale Zersplitterung, die dem alten Reich stets als sein Grundübel angekreidet worden ist, wird damit in ein hübsches, aber gleichwohl unstimmiges Zahlenspiel gekleidet. Denn tatsächlich dürften es fast eintausendneunhundert selbständige Obrigkeiten gewesen sein, in welche die politische Wirklichkeit des alten Reichs im Ausgang des 18. Jahrhunderts facettiert war. Genau läßt sich deren Zahl nicht bestimmen, da die territorialen und herrschaftsrechtlichen Verhältnisse im alten Reich durch Erbfälle beständig in Fluß gehalten wurden. Häufig liest man auch die Behauptung, das Reichsgebiet habe sich über die Zeit in immer kleinere Gebietsfetzen aufgesplittert. Auch diese Ansicht ist nicht zutreffend. Eher war das Gegenteil der Fall, eine zwar langsame, aber dennoch deutlich feststellbare Konzentration der Herrschaftsgebiete. Die Ursache für diese der gängigen Ansicht widersprechende Tendenz ist in der Primogeniturgesetzgebung zu sehen, die seit dem Ende des 15. Jahrhunderts so gut wie allgemeine Gültigkeit in Erbfällen hatte. Von den 405 reichsständischen Territorien, die in der Wormser Reichsmatrikel von 1521 genannt wurden, existierten im Jahre 1780 beispielsweise nur noch 314.[5]
Die Zahl von 1789 oder von rund 1900 selbständigen Obrigkeiten ist überdies geeignet, den durchaus falschen Eindruck zu erwecken, es habe sich dabei um Herrschaften von miteinander vergleichbarer machtpolitischer Bedeutung gehandelt. Dem war aber ganz und gar nicht so, denn die große Masse aller selbständigen Obrigkeiten, sieht man einmal von jenen 314 reichsständischen Territorien ab, die in ihrer machtpolitischen Bedeutung ebenfalls stark voneinander unterschieden waren, bildeten die für sich genommen unbedeutenden Herrschaften der Reichsgrafen, Reichsstädte und Reichsritter, die, wie Karl Otmar von Aretin zu Recht anführt, als Reichslande angesehen werden müssen, da sie ihre Existenz ausschließlich dem Reich verdankten. »Sie bildeten den Mörtel des Reichs zwischen den Quadern der größeren Stände.«[6] Insbesondere Mitteldeutschland galt als Zone größter Zersplitterung im alten Reich. Hier waren Herrschaftsgebiete anzutreffen, von denen Heinrich Heine nach einer Wanderung über die aufgeweichten Straßen eines solchen Ländchens spotten konnte, daß ihm das ganze Fürstentum an den Schuhsohlen klebengeblieben sei …
Die eigentliche politische Bedeutung dieser kleineren Reichsstände, deren Herrschaftsgebiet das ganze Reich durchzogen und die diesem das ihm im Kartenbild eigentümliche Aussehen verwirrender Buntscheckigkeit verliehen, bestand darin, daß sie die Entwicklung der größeren Reichsstände zu völliger staatlicher Souveränität verhinderten. Daß es lediglich Brandenburg-Preußen und Österreich gelang, sich schon lange vor der Auflösung des alten Reichs zu souveränen Staaten zu entwickeln, erklärt sich nicht zuletzt daraus, daß wesentliche Gebiete dieser Staaten außerhalb der Grenzen des Reichs und damit außerhalb des Geltungsbereichs der Reichsverfassung lagen, die den Status quo territorialer Herrschaft im Reich stets erfolgreich garantierte. Die Wirksamkeit der Reichsverfassung beruhte gerade auf der politischen Ohnmacht des Reichs. Und es war einzig und allein die Eifersucht, mit der die einzelnen Reichsstände über die Wahrung ihrer Rechte wachten, die den inneren Bestand und den Zusammenhalt des Reichs gewährleistete.
Das politische Wesen des Reichs ließ sich zu keiner Zeit über jene einfachen Leisten der aristotelischen Kategorien des Staatsrechts schlagen. Daran verzweifelte schon der Völkerrechtler des 17. Jahrhunderts, Samuel von Pufendorf, der in seinem 1667 erschienenen Werk De statu imperii Germanici zu dem Schluß gelangte, das Reich sei recht eigentlich ein Ungeheuer, ein »monstro simile«. Die Ansicht, das Reich sei ein Monstrum oder ein bloßer Schatten gewesen, während die lebendige Kraft der politischen Realität ihren Sitz in den territorialen Herrschaften gehabt habe, ist richtig und falsch zugleich. Sie ist richtig, insofern sie einen Prozeß beschreibt, und falsch, wollte sie das Bild eines Zustandes wiedergeben. Denn trotz der Ohnmacht, die für das Reich in seiner letzten Phase charakteristisch war, war es keineswegs ein leerer Traum, sondern immer noch eine in ihren Lebensäußerungen zwar matter und schwächer werdende, aber gleichwohl lebendige politische Realität, mit der man rechnen mußte, wollte man in Deutschland oder auch in Europa Politik machen.
Wäre das Reich wirklich nur noch Gerümpel gewesen, wie es eine weitverbreitete Anschauung behauptet, und wären es wirklich die territorialen Herrschaften gewesen, »welche … alle politische Realität in sich aufsogen und darstellten« (Golo Mann), wie ließe es sich dann erklären, daß die Stände des Reichs, die einzelnen territorialen Gewalten bis zuletzt mit solcher Zähigkeit ihre Privilegien und ihre nackte Existenz gegen Kaiser und Reich verteidigten? Und auch die wechselvolle Reichspolitik, welche die beiden deutschen Großmächte Österreich und Preußen mit dem Ziel trieben, den Einfluß des jeweils anderen im Reich auszuschalten, kann sich ja kaum auf Hegels Einsicht gegründet haben, »was nicht mehr begriffen werden kann, ist nicht mehr«.[7] Der endgültige Untergang des Reichs war vielmehr das Ergebnis dieser Rivalität. Durch die beiden deutschen Großmächte ist das Reich in zwei Lager geteilt worden, eine Situation, welche die Verfassungswirklichkeit des alten Reiches vor eine unlösbare Aufgabe stellte.
Diese Verfassung war ein äußerst komplexes Konglomerat von Privilegien und Rechten, welche die Reichsstände zu unterschiedlichen Zeiten und bei unterschiedlichen Gelegenheiten dem Kaiser abgetrotzt oder abgehandelt hatten. Die Tatsache, daß J.J. Mosers Neues Teutsches Staatsrecht, das von 1766 bis 1775 erschien, zwanzig Teile umfaßte, zu denen noch 1781 drei Ergänzungsbände hinzukamen, gibt einen ungefähren Eindruck von dem Umfang, den seine Kodifizierung in Anspruch nahm. Im wesentlichen gründete sich die Reichsverfassung gegen Ende des 18. Jahrhunderts auf die folgenden Grundartikel: die Goldene Bulle, die Concordata nationis Germanicae, den Ewigen Landfrieden, die Wormser Reichsmatrikel, die Reichsexekutionsordnung, die Reichskammergerichtsordnung, die kaiserlichen Wahlkapitulationen, den Westfälischen Frieden, die Reichsfriedensverträge des 17. und 18. Jahrhunderts und die Reichsabschiede. Der für die Verfassung des Reichs wichtigste Grundartikel ist in den Bestimmungen des Westfälischen Friedens von 1648 zu sehen, mit denen die Koexistenz der beiden Konfessionen im Reich garantiert und so dessen politische Spaltung vermieden wurde. Die Reichsverfassung hatte seither den Charakter einer Friedensordnung. Daraus erklärt sich auch, daß die Reichsverfassung, die als allgemeinverbindliche Rechtsordnung nicht nur das Miteinander unterschiedlicher Konfessionen, sondern auch das Zusammenleben machtpolitisch höchst unterschiedlicher Obrigkeiten regelte, bis zum Ende des Reichs im großen und ganzen unverändert blieb. Seele und Sinn der Reichsverfassung war die Gewährung des Rechtsschutzes, der jedem Reichsstand und auch dem geringsten Reichsritter und dem ärmsten Reichsdorf seine Rechte gegen den mächtigeren Nachbarn sicherte, der oft nur zu gern sein Territorium arrondiert hätte. Wenn Hegel in seiner um 1800 entstandenen Schrift Die Verfassung Deutschlands spottet: »Wenn Deutschland als eigener, unabhängiger Staat, wie es allen Anschein hat, und die deutsche Nation als Volk vollends ganz zugrunde geht, so gewährt es immer noch einen erfreulichen Anblick, unter den zerstörenden Geistern die Scheu vor dem Recht voran zu erblicken«,[8] so scheinen selbst noch in diesem Spott die ganze Größe und die Tragik des alten Reichs auf. Denn die Größe des Reichs war es, bis zu seinem Ende unverbrüchlich an dieser Idee des Rechts, die der Kern seiner Verfassung war, festgehalten zu haben, während es gleichzeitig seine Tragik war, eben durch dieses Festhalten an der Idee des Rechts nicht zur Entfaltung von Macht gekommen zu sein.
Gelegentlich ist zu lesen, das Reich sei zu einer Reform unfähig gewesen. Dieser Vorwurf ergibt keinen Sinn. Denn jede politische Reform des Reichs, die Schaffung verschiedener, aus eigener Kraft lebensfähiger Mittelstaaten innerhalb des Reichsgebiets beispielsweise, wie sie dann im Ergebnis der napoleonischen Neuordnung Mitteleuropas entstanden, wäre mit dem Grundgedanken des Reichs, mit seiner Idee des Rechts nicht vereinbar gewesen. Der Vorwurf, das Reich sei zu einer Reform, die allein seinen Fortbestand hätte gewährleisten können, nicht fähig gewesen, ist aber noch in anderer Hinsicht unhaltbar. Denn das Reich war in seiner traditionellen Gestalt verfaßter machtpolitischer Ohnmacht gleichzeitig auch ein Garant für die Stabilität der europäischen Ordnung seit 1648. Diese Bedeutung, auf die nicht zuletzt Rousseau hinwies,[9] verlor das alte Reich erst mit Ausbruch der Französischen Revolution und deren Übergreifen auf Europa. Das Reich ging unter, als seine Garantiefunktion für die Stabilität der europäischen Ordnung überflüssig geworden war.
Benedetto Croce hat das 18. Jahrhundert einmal als das »dritte Zeitalter« nach dem perikleischen und dem der italienischen Renaissance bezeichnet. In der Tat scheinen zu keiner Epoche davor oder danach raffinierter Lebensgenuß, Kunst, Literatur und Philosophie in Deutschland so allgemein verbreitet und auf solcher Höhe gewesen zu sein wie in jenen späten Herbsttagen des alten Reichs. Gerade an den kleineren Höfen, aber auch in den vielgeschmähten geistlichen Territorien des alten Reichs entfaltete sich diese Kultur einer aufgeklärten, weltgewandten Humanität in schönster Pracht. Goethe, der zeit seines Lebens in der beschränkten Idylle des kleinen Weimarer Hofes alles in allem doch sehr glücklich war, definierte das Reich einmal als einen »Zustand, in welchem sich zur Friedenszeit jedermann wohlbefinden konnte«. Solches Wohlbefinden ist von einer späteren Zeit, welche in der bloßen Macht und Größe des Staates die Erfüllung aller Ideale erblickte, vielfach geschmäht worden. Wie unrecht die Kritiker des Reichs mit ihrem Urteil hatten, wissen wir heute. Gewiß, jene Jahre vor 1789, an die sich ein Friedrich Gentz später wie an einen verlorenen Schatz zurückerinnerte, waren nicht ohne Beschwernisse und Plage. Besonders das Landvolk hatte unter den Abgaben und Feudallasten zu leiden. In den Reichsstädten führten die Zünfte ein korruptes Regiment. Aber dies alles war nicht bloß dem alten Reich eigentümlich. Die Sozialordnung jenes uns heute als so fortschrittlich geschilderten Preußen des 18. Jahrhunderts war, wie noch beschrieben werden soll, weitaus kälter und bedrückender als jene patriarchalische Ordnung, die in den Territorien des alten Reichs galt. Ulrich Bräkers Lebensgeschichte und Natürliche Abenteuer des Armen Mannes im Tockenburg – der Autor kannte die sozialen Zustände im alten Reich ebenso aus eigener Anschauung wie die des friderizianischen Preußen – ist dafür eine aufschlußreiche Lektüre.
2. Kapitel Preußen und die Vernichtung Polens
In den Jahrzehnten vor Ausbruch der Französischen Revolution sah es so aus, als wollten die Fürsten selbst Revolution machen. In seltener Eintracht vernichteten die Herrscher von Rußland, Österreich und Preußen einen alten europäischen Staat, der sich wie kaum ein anderer Verdienste erworben hatte bei der Verteidigung des christlichen Abendlandes gegen die türkische Bedrohung. Der Widerschein der polnischen Teilungen tauchte das alte Reich in das fahle Licht der Götzendämmerung. In der Komplizenschaft von Rußland, Österreich und Preußen, die, von der Logik ihres revolutionären Tuns getrieben, in weniger als 25 Jahren Polen liquidierten, schien das Schicksal, dem das alte Reich entgegenging, vorgezeichnet zu sein. Daß das Reich dann aber doch nicht zwischen den beiden deutschen Großmächten Preußen und Österreich aufgeteilt wurde, verhinderte der europäische Siegeszug der Französischen Revolution.
Die Annexion von Polnisch-Preußen, wie in Preußen in leicht durchschaubarer Absicht jener polnische Gebietsstreifen genannt wurde, der wie ein Keil Pommern von Ostpreußen trennte, hatte schon Friedrich II. in seinem politischen Testament von 1752 als vordringliche Aufgabe angesehen, die es im Interesse einer Arrondierung und Konsolidierung der preußischen Staaten zu lösen gelte. Die Verwirklichung dieses Wunsches mußte aber, so sah es Friedrich, vertagt werden, bis Rußland, das in Polen über den größten Einfluß gebot, in einer Periode der Schwäche auf Preußens Unterstützung angewiesen sein würde. Diese Situation, auf die Friedrich geduldig lauerte, schien sich 1768/1769 einzustellen. Rußland war in einen Krieg mit der Türkei verwickelt, in dem es rasch Fortschritte machte, die aber für Österreichs Machtinteressen im südöstlichen Europa immer bedrohlicher wurden. Damit ergab sich die Gefahr eines großen russisch-österreichischen Krieges, in den Preußen hineingezogen zu werden fürchten mußte. Um dies zu vermeiden, verfiel Friedrich auf den Plan, Rußlands Annexionsgelüste anderenorts zu stillen. Gleichzeitig galt es, Österreich an diesem Schacher zu beteiligen, um das politische Gleichgewicht zwischen den Mächten zu erhalten und sie überdies durch das feste Band der Komplizenschaft zu verknüpfen. Außerdem wollte er, und darin ist die wirkliche Absicht dieses Planes zu erkennen, der Krone Preußens, die als »ehrlicher Makler« bei dem Handel fungierte, ebenfalls eine angemessene Entschädigung verschaffen. Der preußische Plan, der eine Aufteilung polnischen Gebiets unter den drei Mächten vorsah, wurde schon 1769 am russischen Hof erörtert. Aber weder in Petersburg noch in Wien zeigte man anfänglich Interesse, darauf einzugehen. Der Vorschlag stieß zunächst einmal auf Ablehnung. Die Gründe für dieses Desinteresse liegen auf der Hand. Denn sowohl in Petersburg wie in Wien war man sich dessen bewußt, daß vor allem Preußen der große Gewinner bei der von ihm vorgeschlagenen Aufteilung polnischen Gebietes sein würde, insofern es in Besitz eben jener Landbrücke zwischen Pommern und Ostpreußen gelangte, auf die es schon so lange mit kaum verhohlener Begehrlichkeit gestarrt hatte. Außerdem sah man in Petersburg in der Annexion polnischen Gebietes durch Rußland keinen rechten Sinn, da man sowieso überzeugt war, die Dinge in Polen zu kontrollieren. Und in Wien schließlich hatte man eine allzu feine Witterung für den Hintersinn, den Friedrich II. mit seinem Vorschlag verband, Österreich an der Aufteilung polnischen Gebiets zu beteiligen. Denn Österreichs Anteil an der polnischen Beute stiftete nicht nur für alle Fälle ein Gegengewicht gegen Rußland, sondern er bedeutete gleichzeitig auch, daß sich Wien in die Schmach teilte, die sich die Mächte mit dem Raub polnischen Gebiets aufluden. Dagegen aber sträubte sich Maria Theresia: »In dieser Sach, wo nit allein das offenbare Recht himmelschreiend wider uns, sondern auch alle Billigkeit und die gesunde Vernunft wider uns ist, muß bekennen, daß zeitlebens nit so beängstigt mich befunden und mich sehen zu lassen schäme. Bedenk der Fürst, was wir aller Welt für ein Exempel geben, wenn wir um ein elendes Stück Polen oder von der Moldau und Wallachei unser Ehr und Reputation in die Schanz schlagen.«[10] Es gelang Preußen dann aber doch, das Zaudern des russischen Hofs zu überwinden und Katharina II. für die vorgeschlagene Aufteilung Polens zu gewinnen. Mit dem separaten Teilungsvertrag, den beide Mächte am 19. Februar 1772 abschlossen, wurde Österreich vor die Wahl gestellt, der polnischen Teilung beizutreten oder sich die Gegnerschaft Preußens und Rußlands einzuhandeln. Trotz dieses ultimativen Ansinnens verwahrte sich Maria Theresia immer noch hartnäckig dagegen, »einen Unschuldigen zu berauben« und aus Gründen der bloßen Zweckmäßigkeit »die gleiche Ungerechtigkeit« zu begehen, die zwei andere verabredet hatten. Allein, ihr Mitregent, der spätere Kaiser Joseph II., überredete sie schließlich dazu, in einen Beitritt Österreichs zu dem Teilungsvertrag einzuwilligen.
Die erste Teilung Polens von 1772 lieferte ein Beispiel an Verlogenheit, dessen stilbildende Wirkung bis heute fortdauert. Dem ebenso schlichten wie verbrecherischen Vorgang des gemeinschaftlichen Landraubs an Polen, bei dem Preußen den Anstifter spielte, Rußland und Österreich eher unwillige Komplizen waren, wurde bereits im Petersburger Teilungsvertrag ein Etikett aufgeklebt, das den Handel »ehrlich« machen sollte: In dem Teilungsvertrag wird der Raub polnischen Gebiets als notwendige Maßnahme für die Befriedung Polens ausgegeben! Seither rauben und kriegen die Staaten nur noch zum Wohle der Beraubten und Bekriegten. Die französischen Revolutionsheere, die zwei Jahrzehnte später Europa mit Krieg überziehen sollten, rechtfertigten dies damit, daß sie der Menschheit die Errungenschaften der Revolution brächten.
Die polnischen Teilungen des 18. Jahrhunderts, an denen Preußen jeweils maßgeblichen Anteil hatte, sind kein Ruhmesblatt der preußischen Geschichte.[11] Das Exempel der ersten polnischen Teilung war, daß der Eigennutz der Staaten die verbrieften Rechte der Schwächeren mit Füßen treten konnte. Aber gerade die unbedingte Respektierung des Rechts war es, die nicht nur die Grundlage für den Fortbestand des alten Reichs seit dem Westfälischen Frieden von 1648 bildete, sondern auch das Fundament darstellte, auf dem die Staatenordnung der europäischen Monarchien beruhte. Die Monarchen, die eben dieses Rechtsfundament der europäischen Ordnung durch die Teilung Polens verletzt hatten, legten damit die Axt an die Wurzeln jenes Baumes, auf dessen Ästen sie allesamt saßen. Preußen, Rußland und Österreich gaben mit der polnischen Teilung von 1772 den ersten Anschauungsunterricht in Sachen Revolution.
Die erste polnische Teilung lieferte zudem einen Musterentwurf für die zukünftige Gestaltung des alten Reichs. Das Reich nach polnischem Vorbild aufzuteilen, dazu bedurfte es nur einer Verständigung zwischen Österreich und Preußen über die wechselseitigen Gebietsansprüche. Tatsächlich aber ist eine solche Verständigung, die von beiden Seiten immer wieder erwogen wurde, nie ernsthaft versucht worden. Das Mißtrauen und die Furcht, dabei vom anderen übervorteilt zu werden, erwiesen sich stets als stärker. Auch die Chance, die lange schwelenden Auseinandersetzungen um die bayerische Erbfolge nach polnischem Vorbild »beizulegen« und nach diesem Muster eine Neuordnung des Reichs einzuleiten, blieb ungenutzt. Nicht, weil man eine solche Möglichkeit nicht gesehen hätte. Im Oktober 1777 schrieb Prinz Heinrich von Preußen an Friedrich II.: »Wenn Du mein lieber Bruder und der Kaiser es gemeinsam plantet, ihr würdet Deutschland haben, ehe daß irgend jemand etwas gegen so überlegene Kräfte vermöchte.«[12] Und es war auch nicht der Respekt vor dem Reich, über dessen innere Schwäche man sich in Wien und Berlin keine falschen Vorstellungen machte, der beide Mächte vor diesem an sich logischen Schritt zurückhielt. Auch die Furcht vor einer Intervention Frankreichs, der traditionellen Garantiemacht der Buntheit deutscher Verhältnisse, spielte bei dieser Scheu keine Rolle: Frankreich war zu dieser Zeit zu sehr erschöpft und von inneren Wirren erschüttert, als daß es einen großen Krieg zur Verteidigung des Status quo in Mitteleuropa hätte führen können. Nein, der Grund, der Preußen und Österreich veranlaßte, diese Chance nicht wahrzunehmen, das Reich im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts in schöner Eintracht und zu beiderseitigem Gewinn zu liquidieren, ist vielmehr in einem Umstand zu erkennen, dessen Bedeutung zu würdigen uns heute schwerfällt: Der Schwerpunkt der Machtinteressen Preußens und Österreichs war zu dieser Zeit eindeutig auf den Osten und Südosten Europas konzentriert. Hier lagen zwei große Reiche, Polen und die Türkei, deren beständig fortschreitender innerer Machtzerfall Rußland, Preußen und Österreich unwiderstehlich anlockte. Die Gier und die Eifersucht, mit der vor allem Preußen und Österreich beständig darüber wachten, daß sie nicht von dem einen oder einer Koalition von zweien bei der Verteilung dieser scheinbar bequemen Beute übervorteilt würden, machte sie blind für andere Entwürfe. Rußland, das von allen drei Mächten den längsten Atem hatte, ist Sieger geblieben in diesem Ringen um die Vorherrschaft in Osteuropa. Die Grenzen, die seit 1945 Europa in seiner Mitte von Nord nach Süd durchschneiden, sind das Ergebnis einer Entwicklung, die damals begann.
Preußens kometengleicher Aufstieg zu einer Macht von europäischem Rang vollzog sich, es ist darauf schon hingewiesen worden, vor allem außerhalb des Reichs oder, denkt man an die Eroberung Schlesiens durch Friedrich II., sogar gegen das Reich. Die Grundlage preußischer Machtstellung war die Armee, die in dieser Größe zu unterhalten die dauernde Anspannung aller Kräfte des weder mit natürlichen Schätzen noch mit Bevölkerungsreichtum gesegneten Landes verlangte. Friedrichs Toleranzpolitik gegenüber aus religiösen Gründen verfolgten Minderheiten, die er wie die Hugenotten und die Salzburger Protestanten in großer Zahl in den preußischen Staaten aufnahm, hatte in diesem Menschenmangel ihre materielle Wurzel. Daß aber eine solche Anspannung aller sozialen und wirtschaftlichen Kräfte, wie sie vor allem in der Zeit der schlesischen Kriege notwendig geworden war, auf Dauer den Ruin des Staates bedeutete, war abzusehen. Deshalb mußte Preußen, wollte es nicht mit seiner gleichsam hochstaplerischen Machtpolitik über kurz oder lang Schiffbruch erleiden, seine Operationsbasis verbreitern. Dies bedeutete für das merkantilistisch-absolutistische Staats- und Gesellschaftssystem Preußens, das aufgrund seiner sozialen Rahmenbedingungen nur eine geringfügige Produktivitätssteigerung zuließ, daß man expandierte. Weitere Gebiete und Untertanen sollten dem eigenen Einflußbereich einverleibt werden. Im Nordwesten, Westen, Süden und Südosten grenzte Preußen aber an so mächtige Reichsstände wie Mecklenburg-Schwerin, das Kurfürstentum Hannover, das in Personalunion mit der Krone Englands verbunden war, an das Kurfürstentum Sachsen und an Österreich. Der Versuch, sich hier auszudehnen, hätte – die schlesischen Kriege lieferten dafür den Beweis – einen großen europäischen Konflikt ausgelöst, aus dem Preußen wahrscheinlich nicht ein weiteres Mal als Sieger hervorgegangen wäre. Deshalb mußte Preußen seine begehrlichen Blicke nach Osten richten und hier seinen Land- und Menschenhunger stillen. Außerdem hatte es gar kein ausgeprägtes Interesse, sich nach Westen und Südwesten in das alte Reich hinein auszudehnen. Die »deutsche Mission«, welche Preußen nachgesagt wurde, ist eine nationale Legende. Denn erst, als im Zuge der europäischen Neuordnung durch den Wiener Kongreß Preußen für den Verlust seiner polnischen Erwerbungen im Osten im Reich mit Westfalen und dem Rheinland entschädigt wurde, begann sich der Schwerpunkt der preußischen Interessen ganz allmählich nach Westen zu verlagern.
Für Österreichs Orientierung nach Osten und Südosten können ganz ähnliche Motive angeführt werden. Die Schirmherrschaft über das Reich, welche die Habsburgerkaiser innehatten, war eher ein Hindernis als eine Stütze für die europäische Machtpolitik der Hofburg. Wie Preußen strebte deshalb auch Österreich danach, seine Machtgrundlage zu verbreitern, und wie Preußen tat es dies vornehmlich im Osten und Südosten. Am schleichenden Leichengift des zerfallenden osmanischen Großreichs auf dem Balkan, aus dem es sich bis zuletzt immer wieder Stücke herausriß, ist Österreich schließlich zugrunde gegangen.
Geht man von diesen Voraussetzungen aus, dann wird deutlich, daß die von Friedrich II. und seinen beiden Nachfolgern betriebene preußische Reichspolitik das Reich nur als ein Mittel ansah, Österreich im Osten in Schach zu halten, und daß sich Österreich andererseits dieses Umstandes immer bewußt war. Daran ändert weder die aufsehenerregende Verständigung etwas, die beide Mächte im Reichenbacher Vertrag von 1790 erzielten, noch die gemeinsam mit so großen Worten geschlossene Allianz, deren Ziel es war, die Französische Revolution zu bekämpfen.
Man kann es als das Verhängnis der deutschen Geschichte bezeichnen, daß Deutschland, das alte Reich, gleichzeitig Ost und West war. Der Knoten dieses Verhängnisses wurde aber erst im ausgehenden 18. Jahrhundert mit den Teilungen Polens geschürzt, die entschieden weitreichendere Folgen hatten als alle anderen Entscheidungen der spätabsolutistischen Kabinettspolitik dieser Jahre.
Lassen sich die preußischen Erwerbungen im Rahmen der ersten polnischen Teilung noch notdürftig aus der Sicht der preußischen Staatsräson rechtfertigen, weil mit ihnen eine feste Landverbindung zwischen Pommern und Ostpreußen geschaffen wurde, so kann dieses Argument zur Erklärung des preußischen Anteils an der zweiten und dritten Teilung Polens nicht mehr ins Feld geführt werden. Es war dies nur noch schiere Raffgier, die sich nahm, was sie kriegen konnte, und die nicht danach fragte, was damit sinnvollerweise anzufangen war. Gleichwohl blieb Preußen auch bei der zweiten und dritten Teilung Polens die treibende Kraft.
Ein Anlaß, gegen Polen erneut vorzugehen, war bald gefunden. In Polen war es unterdessen zu einer tiefgreifenden Verfassungsreform gekommen, mit der die polnische Patriotenpartei das Ziel verfolgte, das Land politisch zu stabilisieren und seine territoriale Integrität gegen weitere Teilungsgelüste der Großmächte wirksam zu verteidigen. Die Verfassungsreform, die der polnische König Stanislaus August am 3. Mai 1791 vor dem polnischen Reichstag verkündete, sah vor, die bisherige Wahlmonarchie durch eine Erbmonarchie abzulösen.[13] Außerdem wurden die Einführung des Mehrheitsprinzips bei der künftigen polnischen Nationalversammlung, die parlamentarische Ministerverantwortlichkeit und eine erhebliche Stärkung der Befugnisse der Exekutive versprochen.
Hätte sich diese Reformverfassung durchsetzen lassen, wäre Polen eine moderne und konstitutionelle Monarchie geworden. Daß es dazu nicht kam, dafür trug man schon in Berlin und Petersburg Sorge, während man in Wien dieser Reformverfassung durchaus wohlwollend gegenüberstand. Der österreichische Staatskanzler Kaunitz hatte sogar vor, die neue polnische Verfassung sowie die Unverletzlichkeit des polnischen Territoriums durch die drei Teilungsmächte Österreich, Preußen und Rußland garantieren zu lassen. Während man diesem österreichischen Plan in Petersburg von Anfang an mit offener Ablehnung begegnete und ziemlich unverhohlen zu erkennen gab, daß man die polnische Frage auf andere Weise zu regeln gedächte – bereits im Sommer 1791 ließ der russische Gesandte in Wien die Bemerkung fallen, »jeder der beiden Kaiserhöfe habe seine Gegenrevolution auszuführen, der eine in Paris, der andere in Warschau«[14] –, wollte man in Wien vor allem Preußen in dieser Frage als Partner gewinnen. Tatsächlich gelang es der österreichischen Diplomatie, in den mit Preußen am 7. Februar 1792 geschlossenen Bündnisvertrag, der die gemeinsame Bekämpfung der Französischen Revolution vorsah, eine Klausel aufzunehmen, in der von der Integrität Polens die Rede war. Doch diese Worte waren nicht einmal das Papier wert, auf dem sie geschrieben standen; Friedrich Wilhelm II. dachte gar nicht daran, den Nachbarn im Osten unangetastet zu lassen. Vielmehr wiegte er sich in der Hoffnung, nach einem Waffenerfolg im Kampf gegen die Französische Revolution die Zustimmung des Kaisers zu weiteren preußischen Erwerbungen in Polen zu erhalten. Aber die Dinge entwickelten sich rascher und vor allem ganz anders, als sich dies Friedrich Wilhelm II. gedacht haben mochte. Und nicht zum letztenmal in seiner Geschichte entschied sich damals Polens Schicksal im Westen.
Am 20. Februar 1792 erklärte der französische Nationalkonvent den Alliierten Preußen und Österreich den Krieg, den diese nun, obwohl von ihm immer in großen Worten die Rede gewesen war, eher widerstrebend annehmen mußten. Die Fesselung Österreichs im Westen nutzte Katharina II. von Rußland sofort für ihre polnischen Pläne aus. Zwar war gerade sie es gewesen, die den Krieg gegen die Französische Revolution immer fleißig geschürt und nie versäumt hatte, in ihren Briefen ihrem Abscheu vor der »blutigen Kloake Paris« drastisch Ausdruck zu verleihen. Aber gleichzeitig hatte sie sich stets zurückgehalten, einen aktiven Beitrag zur Bekämpfung dieser Revolution zu leisten. Bereits im März 1792 teilte Katharina II. Friedrich Wilhelm II. mit, daß Rußland die polnische »Revolution«, wie die Reformverfassung apostrophiert wurde, als gegen seine Interessen gerichtet ansehe und man ihm deshalb die Einleitung gemeinsamer Schritte vorschlage. Einiges sprach dafür, daß Katharina II. sich auch mit einer Wiederherstellung des Status quo ante in Polen zufriedengegegen hätte, bei dem Rußland seinen alten Einfluß auf die inneren polnischen Angelegenheiten wiedergewonnen hätte; doch Friedrich Wilhelm II. witterte in diesem Vorschlag vor allem die Chance, sich endlich seine lang gehegten Annexionswünsche erfüllen zu können. Unter dem Datum des 12. März 1792 schrieb er seinen Beratern: »Rußland ist nicht weit von dem Gedanken einer neuen Teilung entfernt. Das wäre freilich das wirksamste Mittel, die Macht eines polnischen Königs zu beschränken, sei er nun erblich oder wählbar … Wenn es gelänge, eine angemessene Entschädigung für Preußen zu finden, wäre der russische Plan der günstigste für Preußen, wohl bemerkt, daß Preußen dabei das ganze linke Ufer der Weichsel empfänge und diese weite, jetzt schwer zu deckende Grenze sich dann wohl abgerundet fände. Das ist mein Urteil über die polnische Sache.«[15] Bereits im Mai 1792 schuf Katharina II. in Polen ein Fait accompli, indem sie russische Truppen in das freie Polen einrücken ließ. Den Vorwand für diese Intervention lieferte ihr ein »Hilferuf« der konservativen polnischen Kräfte, die sich in der Konföderation von Targowitsch zusammengeschlossen hatten und die offen gegen die polnische Reformverfassung vom Mai 1791 Stellung bezogen. Innerhalb weniger Wochen war Polen von den weit überlegenen russischen Truppen überrannt, die Reformverfassung außer Kraft gesetzt.
Gegen diese neuerliche russische Unterdrückung der polnischen Freiheit begann, insbesondere unter dem polnischen Klerus und Adel, bald Unmut laut zu werden, regte sich offener Widerstand. Als im Herbst 1792 die Aussichten Preußens immer trüber wurden, im Krieg gegen die Revolution im Westen Danzig und Thorn im Osten zu erobern, bestand die preußische Diplomatie in Petersburg um so heftiger auf einer »Entschädigung« Preußens in Polen, die man nun auf direktem Wege zu erreichen suchte. Zur gleichen Zeit wurde auch immer deutlicher, daß die Konföderierten von Targowitsch bei weitem nicht jenen Rückhalt in der Bevölkerung besaßen, der es ihnen erlaubt hätte, das Land in Übereinstimmung mit den russischen Hegemonialinteressen zu regieren. Angesichts dieser Situation schien es Katharina II. letztlich doch ratsam zu sein, sich den preußischen Wünschen anzuschließen und eine weitere Teilung Polens ins Auge zu fassen.
Tief widerwärtig und in ihrer heuchlerischen Verlogenheit ein Vorbild für manch spätere Rechtfertigung offenkundigen Unrechts ist die »Deklaration Sr. Majestaet des Königs von Preußen, den Einmarsch der preußischen Truppen in Polen betreffend«, vom 6. Januar 1793, mit der Friedrich Wilhelm II. Preußens Intervention begründete. In dieser Erklärung werden die Konföderierten von Targowitsch unter anderem als die wohlgesinnten Beschützer der alten Regierungsreform, die Verteidiger und Anhänger der Reformverfassung dagegen als »Proselyten der abscheulichen jakobinischen Emissäre« bezeichnet. Es dürfe nicht geduldet werden, daß diese Minderheit des polnischen Volkes den Umsturz der öffentlichen Ordnung plane und immer aufs neue den preußischen Staat durch Gebietsverletzungen und auf andere Weise schädige und beleidige. Da ein zweiter Feldzug gegen Frankreich notwendig sei, könne nicht ein gefährlicher Feind im Rücken zurückgelassen werden. Deshalb habe sich Preußen mit den Höfen von Wien und Petersburg zur Intervention gegen die polnischen Aufwiegler vereinigt. Die Besetzung einiger großpolnischer Distrikte durch preußische Truppen sei also nur eine Vorsichtsmaßregel, um das eigene Grenzgebiet zu schützen, die Aufständischen zu zügeln und die öffentliche Ordnung wiederherzustellen.[16]
Diese Deklaration wurde am 16. Januar 1793 in Warschau übergeben. Wenige Tage später überschritten preußische Truppen die polnische Westgrenze. Am 23. Januar 1793 wurde in Petersburg der preußischrussische Vertrag unterzeichnet, der die zweite polnische Teilung besiegelte. In diesem Vertrag verpflichtete sich Rußland, seine Truppen so lange mobilisiert zu halten, wie die Unruhen in Polen und Frankreich andauerten. Als Entschädigung für die dadurch entstehenden Kosten und Aufwendungen erhielt das Zarenreich einen Teil von Litauen sowie die gesamte polnische Ukraine, insgesamt ein Gebiet mit ungefähr drei Millionen Einwohnern. Preußen verpflichtete sich seinerseits, den Krieg gegen das revolutionäre Frankreich so lange fortzuführen, bis das im Bündnisvertrag vom 7. Februar 1792 gesetzte Ziel, die Niederwerfung der Revolution und die Wiederherstellung der legitimen monarchischen Ordnung in Frankreich, erreicht worden sei. Preußen wurde für die dabei anfallenden Kriegskosten mit dem zwischen Oder und Weichsel gelegenen polnischen Gebiet, dem späteren Südpreußen, entschädigt. Außerdem erhielt es die schon seit langem begehrten Städte Thorn und Danzig. Preußen erwarb damit in der zweiten polnischen Teilung ein Gebiet, in dem über drei Millionen Menschen lebten und das seiner Ausdehnung nach fast doppelt so groß war wie das Territorium, das es bereits 1772 annektiert hatte.
Das Vorgehen insbesondere Preußens gegen Polen stieß auf nahezu einhellige Empörung und Ablehnung. Der Brief, den der preußische Historiker August Wilhelm von Schlözer damals an den Grafen Hertzberg richtete, trifft den Nagel auf den Kopf: »Gott im Himmel, quo titulo juris [mit welchem Rechtanspruch] werden Danzig und Thorn genommen? Führen die Kabinette das Droit de convenance ein, so ist alles recht, was die convention nationale thut … Was wird die Nachwelt sagen?«[17] In der Tat, die Monarchen, die feierlich ausgezogen waren, die Revolution zu vernichten, handelten nicht minder revolutionär. Und obendrein machten sie sich noch, allen voran Preußen, der Lüge und Heuchelei schuldig. Otto Hintze und erst jüngst wieder Sebastian Haffner haben versucht, Preußens Handlungsweise gegenüber Polen mit dem Hinweis zu rechtfertigen, »daß der Gedanke des Nationalstaates, der seit dem 19. Jahrhundert das Staatsleben Europas beherrscht, damals noch nicht lebendig war«.[18] Dieser Einwand, so zutreffend er in sich ist, geht aber gleichwohl an dem Vorwurf, den man Preußen nicht ersparen kann, vorbei. Denn es waren die »heiligen Rechte« der Staaten, die sich auf die legitimen Ordnungen in ihrem Inneren gründeten, die hier mit Füßen getreten wurden. Und eben dies war ein wahrhaft revolutionärer Vorgang, der seine Entsprechung damals nur in der Hinrichtung Ludwigs XVI. fand.
Diese zweite Teilung Polens, die Rußland und Preußen unter sich ausgemacht hatten und bei der Österreich leer ausgegangen war, belastete die österreichisch-preußische Allianz im Westen schwer.[19] Von nun an herrschte nur noch Zwietracht zwischen den Verbündeten, die so feierlich ausgezogen waren, das Feuer der Revolution zu ersticken. Das Mißtrauen, das beide Verbündete fortan gegeneinander hegten, wirkte sich auch ursächlich auf den keineswegs erfolgreichen Verlauf ihrer Kriegführung aus. Man kann sogar sagen, daß Katharina II., die es Preußen zur Bedingung gemacht hatte, den Vertrag über die zweite Teilung Polens vom 23. Januar 1793 ohne ein vorheriges Arrangement mit Österreich abzuschließen, und die eben damit die österreichisch-preußischen Gegensätze zu verschärfen half, die Französische Revolution gerettet hat. Denn Frankreich war 1792/1793 durch innere Unruhen und Aufstände, durch Hungersnöte und eine andauernde Wirtschaftsmisere derartig geschwächt, daß es einem entschlossenen Vorrücken der Interventionstruppen kaum ernsthaften Widerstand hätte entgegensetzen können. Preußens Gier auf einige Fetzen polnischen Landes verschafften der Revolution in Frankreich jene Atempause, die es ihr ermöglichte, wieder zu Kräften zu kommen und die entschlußlosen und untereinander zerstrittenen Angreifer zu vernichten. Vom preußisch-russischen Vertrag über die zweite Teilung Polens vom 23. Januar 1793 führt eine gerade Linie über den Basler Sonderfrieden, mit dem Preußen aus dem Krieg gegen die Französische Revolution im April 1795 eigenmächtig ausschied, die dritte Teilung Polens, die im gleichen Jahr erfolgte, hin zum Frieden von Tilsit von 1807, mit dem sich Preußen Napoleon unterwerfen mußte und zu einer Macht dritten Ranges wurde.
Nachdem Preußen und Rußland jene polnischen Gebiete, die sie sich im zweiten Teilungsvertrag gegenseitig als »Entschädigung« zugestanden hatten, militärisch besetzt hatten, kannte ihr Übermut keine Grenzen mehr: Die Polen sollten nun noch feierlich ihre Zustimmung zu diesen Annexionen erteilen und damit gleichsam jene Hände segnen, die sie verstümmelt hatten. Am 9. April 1793 ließ die Zarin der polnischen Marionettenregierung eine Erklärung zukommen, in der es unter anderem hieß: Da von den Anhängern und Urhebern der Revolutionen vom 3. Mai 1791 noch immer auf geheime Komplotte gesonnen, ja, sogar den wahren Freunden Polens mit einer »Sizilischen Vesper« gedroht werde, habe von Rußlands und Preußens Monarchen der Beschluß gefaßt werden müssen, die Republik in engere Grenzen einzuschnüren. Die Nation möge das Geschäftliche der notwendigen Gebietsabtretungen auf einem Reichstag freundschaftlich erledigen.[20]
Nicht nur der blanke Zynismus der Macht, wie er in diesem Ansinnen hervortritt, den russisch-preußischen Annexionen den Schein der Rechtmäßigkeit zu geben, sondern noch so manches andere, das sich im Zusammenhang mit den polnischen Teilungen ereignete, hat seither Nachahmer gefunden. Im Mai 1793 trat ein polnischer Reichstag in Grodno zusammen, der sich aber nach sechs Wochen trotz aller Versprechungen und Drohungen, mit denen man ihn einschüchterte, nicht dazu bereit fand, die preußisch-russischen Annexionen förmlich zu ratifizieren. Erst als der russische Bevollmächtigte erklärte, jede weitere Verzögerung dieser Ratifizierung werde unweigerlich einen neuen Krieg und den Untergang ganz Polens zur Folge haben, wurde der Abtretungsvertrag mit Rußland, das, wie es im Vertragstext hieß, »für seine Vermittlung zu Gunsten der Republik« gerechten Anspruch auf Entschädigung habe, unterzeichnet. Auf die Frage des russischen Bevollmächtigten, ob der Reichstag auch dem Vertrag mit Preußen zustimme, erfolgte keine Antwort. Daraufhin erklärte der russische Vertreter, daß auch der Vertrag mit Preußen als angenommen zu gelten habe, da kein Widerspruch eingelegt worden sei.[21]
Der nächste und fürs erste letzte Akt in der preußisch-polnischen Geschichte beginnt in Basel im April 1795. Über den Sonderfrieden, den Preußen am 5. April 1795 mit der Französischen Republik in Basel abschloß und mit dem es sich aus dem gemeinsam mit Österreich und dem Reich nur noch matt und lustlos geführten Krieg gegen die Revolution davonstahl, ist seither viel gestritten worden. Preußische Historiker, allen voran Sybel, bezichtigten Österreich des »Verrats«, während österreichische Historiker umgekehrt Preußen diesen Vorwurf machten. Dieser Historikerstreit über den Sonderfrieden von Basel ist nichts anderes als das späte Echo jenes Geschreis, zu dem betrogene Betrüger stets anheben, sobald sie entlarvt sind. Gemessen und gewogen stellt der Basler Frieden eher einen Verrat Preußens an seinen Bundesgenossen und an der gemeinsam mit diesen so feierlich beschworenen Sache dar. Preußen ließ sich in Basel von Eigennutz leiten. So hat es immer gehandelt, und darauf gründete sich auch seine Größe. Diesmal aber war sein Vorgehen nicht durch Ziele bestimmt, denen sein Staatsinteresse seit je verpflichtet war, sondern diktiert von Schwäche und Ratlosigkeit. Preußen war einfach dem Ende nahe: wirtschaftlich, militärisch, moralisch; aber nicht, weil es, wie immer wieder gesagt wird, von den Alliierten, von Österreich und dem Reich, nur mangelhaft unterstützt worden sei – das ist zwar richtig, gilt aber umgekehrt genauso –, sondern, weil es zu lange es selbst gewesen war, weil es zu lange und zu ausgiebig dem gefrönt hatte, was man später als sein »Lebensgesetz« bezeichnet hat: dauernd zu expandieren, ständig sich zu vergrößern. Zu tief war es bereits in die polnischen Angelegenheiten verstrickt, und aus diesem Sumpf gab es kein Entrinnen mehr.
In Polen waren im Frühjahr 1794 Aufstände ausgebrochen, mit denen Rußland nicht allein fertig werden konnte oder wollte. Jedenfalls wurde Preußen zur militärischen Hilfeleistung aufgefordert, der es auch nachkam. Die Kämpfe mit den Aufständischen gestalteten sich wechselvoll und erbittert. Eine von den preußischen Truppen im Juli 1794 begonnene Belagerung Warschaus mußte bereits im August ergebnislos beendet werden, da nun auch in Posen und anderen Städten Preußisch-Polens Aufstände ausbrachen. Der Brocken, den man in der ersten und zweiten polnischen Teilung verschlungen hatte, war, das begann man jetzt in Berlin allmählich zu ahnen, vergiftet gewesen. Die russische Gefahr, von der man meinte, sie sich durch den Erwerb polnischen Gebiets besser vom Leibe halten zu können, war nur noch näher gerückt, eine Erkenntnis, die man schon früher hätte gewinnen können, wenn einen die Gier nach Landerwerb nicht so verblendet hätte. Denn ohne massiven russischen Druck auf Polen wäre ja schon jener merkwürdige Vertrag, mit dem der Reichstag von Grodno durch sein Schweigen der Abtretung polnischen Gebiets an Preußen »zustimmte«, nicht möglich gewesen. »Ich bin hier«, schrieb der preußische Gesandte Buchholz damals, »ohne Beistand Rußlands völlig isoliert, habe also alles mit dem russischen Gesandten und durch ihn bewirken müssen, denn der Name ›Preuße‹ ist hier äußerst verhaßt, weil man uns die vorige und die jetzige Teilung Polens zur Last legt.«[22]
Rußland half, gab aber auch gleichzeitig zu verstehen, daß diese Hilfe nicht grenzenlos sei und daß es insbesondere seine Vormachtstellung in Polen mit niemandem teilen wolle. Das war deutlich, aber offensichtlich noch nicht deutlich genug. Denn in Berlin hegte man weiter die Illusion, daß man mit der Einverleibung polnischen Gebiets eine schöne Beute gemacht habe. Erst die Aufstände in Polen und in den ehemals polnischen Gebieten Preußens öffneten einigen die Augen zu der Einsicht, daß ein starker und autonomer polnischer Pufferstaat eine bessere Garantie der preußischen Grenzen gegen Rußland gewesen wäre als jene schimpflichen, das Recht mit den Füßen tretenden Annexionen polnischen Gebiets, auf die man sich eingelassen hatte. Der anonyme Verfasser einer Flugschrift aus dem Jahre 1794, die den Titel trägt Versuch eines Beweises, daß die Kaiserin von Rußland den Westfälischen Frieden weder garantieren könne, noch dürfe, spricht eben diesen Sachverhalt aus: »Wenn der russische Koloß über kurz oder lang unter seiner eigenen Größe erliegt, wenn er dann, da Polen nicht mehr der Schlagbaum ist zwischen uns und Rußland, nicht auf uns fällt, so werde ich mich freuen, zuviel gefürchtet zu haben.«[23]
Aber nun gab es für Preußen kein Zurück mehr. Aus den Aufständen in Polen, über die Rußland und Preußen erst im Herbst 1794 mühsam Herr werden konnten, zog man an beiden Höfen die Lehre, daß nur eine restlose Zerschlagung Polens, das heißt seine völlige völkerrechtliche Vernichtung, in Zukunft Ruhe gewährleistete. Bereits seit August 1794