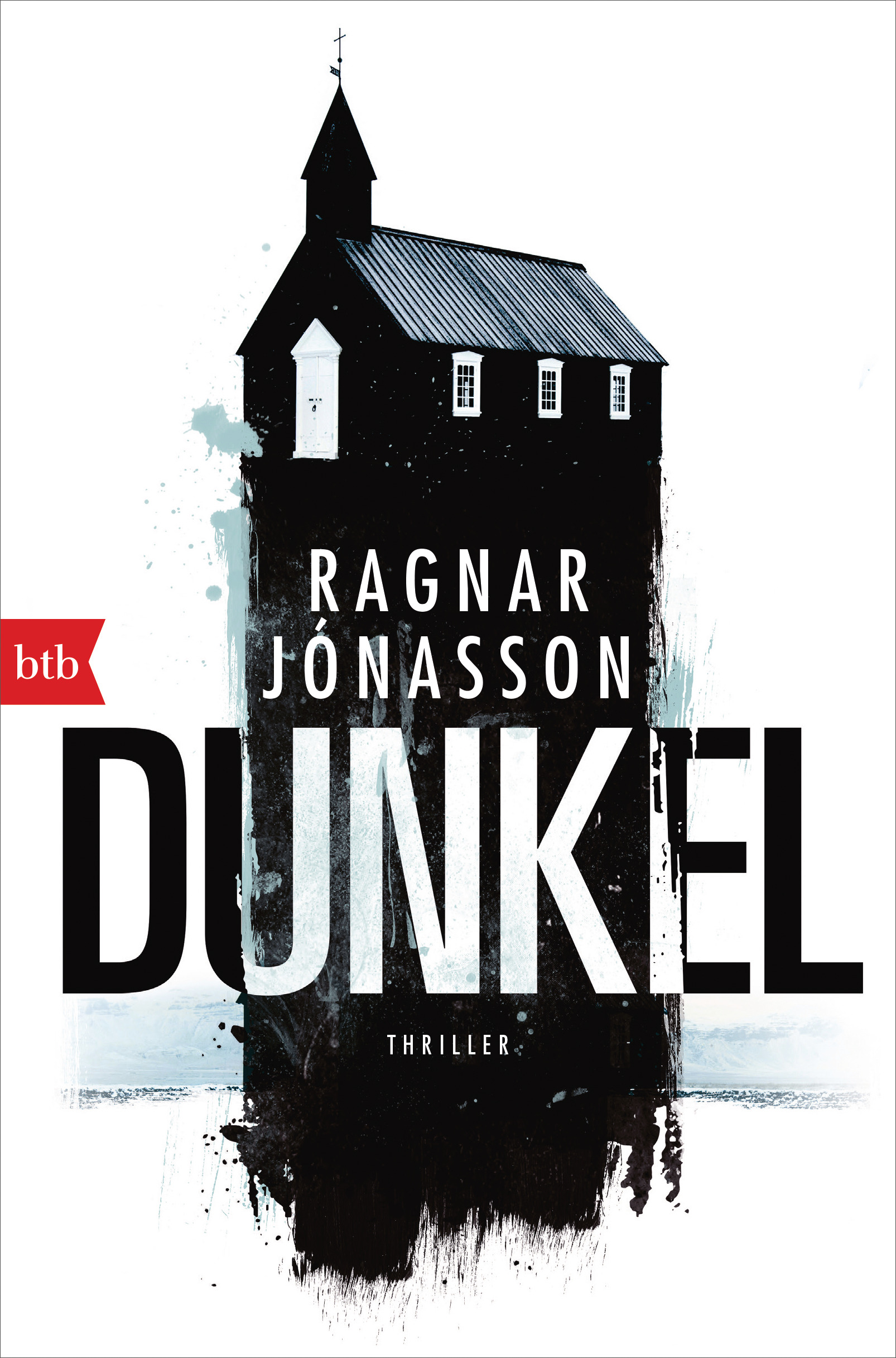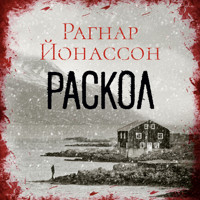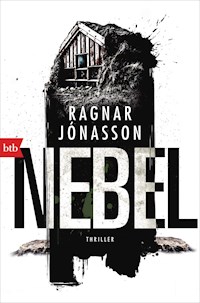
11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die HULDA Trilogie
- Sprache: Deutsch
Hulda Hermannsdóttir, Kommissarin bei der Polizei Reykjavík, kehrt nach einem Schicksalsschlag gerade wieder in ihren Beruf zurück. Um sie bei der Wiederaufnahme der Arbeit zu unterstützen, wird Hulda von ihrem Chef mit einem neuen Fall betraut: Mehrere Leichen wurden in einem abgelegenen Bauernhaus im Osten des Landes gefunden, und alles deutet darauf hin, dass sie dort schon seit einigen Wochen liegen. Was ist während der Weihnachtstage geschehen, als das Bauernhaus durch einen Schneesturm vom Rest der Welt abgeschnitten war? Und gibt es ein Entkommen vor der eigenen Schuld?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 354
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Zum Buch
Ein einsames Bauernhaus – und ein verhängnisvoller Besuch.
Hulda Hermannsdóttir, Kommissarin bei der Polizei Reykjavík, kehrt nach einem Schicksalsschlag gerade wieder in ihren Beruf zurück. Um sie bei der Wiederaufnahme der Arbeit zu unterstützen, wird Hulda von ihrem Chef mit einem neuen Fall betraut: Mehrere Leichen wurden in einem abgelegenen Bauernhaus im Osten des Landes gefunden, und alles deutet darauf hin, dass sie dort schon seit einigen Wochen liegen. Was ist während der Weihnachtstage geschehen, als das Bauernhaus durch einen Schneesturm vom Rest der Welt abgeschnitten war? Und gibt es ein Entkommen vor der eigenen Schuld?
Zum Autor
Ragnar Jónasson, 1976 in Reykjavík geboren, ist Mitglied der britischen Crime Writers’ Association und Mitbegründer des »Iceland Noir«, dem Reykjavík International Crime Writing Festival. Seine Bücher werden in 21 Sprachen in über 30 Ländern veröffentlicht und von Zeitungen wie der New York Times und Washington Post gefeiert.
Ragnar Jónasson lebt und arbeitet als Schriftsteller und Investmentbanker in der isländischen Hauptstadt. An der Universität Reykjavík lehrt er außerdem Rechtswissenschaften. Die preisgekrönte Hulda-Trilogie erscheint bei btb erstmals auf Deutsch.
Ragnar Jónasson
NEBEL
Thriller
Aus dem Englischen von Andreas Jäger
Die isländische Originalausgabe erschien 2017 unter dem Titel »Mistur« bei Veröld, Reykjavík.Übersetzt wurde von der englischen Ausgabe, © Victoria Cribb, erschienen 2020 unter dem Titel »The Mist« bei Michael Joseph, einem Imprint der Penguin Books Ltd., London.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstausgabe September 2020 Copyright der Originalausgabe © 2017 by Ragnar Jónasson Published by Agreement with Copenhagen Literary Agency ApS, Copenhagen Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2020 by btb Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München Covergestaltung: semper smile, München Covermotiv: © Shutterstock/Strannik_fox; Shauna Cohoe; alanadesign; Podursky Satz und E-Book: GGP Media GmbH, Pößneck Alle Rechte vorbehalten
Für Kira und Natalía
»Die Tage vergingen langsam, doch die Jahre flogen vorüber, und immer noch sprach ich zu dir in meiner Leere.«
Ólafur Jóhann Ólafsson
aus »Almanakið«,2015
PROLOG
FEBRUAR 1988
Hulda Hermannsdóttir schlug die Augen auf.
Das Gefühl der Lethargie, das sie niederdrückte, war so schwer und überwältigend, dass es ihr vorkam, als hätte ihr jemand K.-o.-Tropfen verabreicht. Sie hätte den ganzen Tag durchschlafen können, sogar hier auf dem harten Schreibtischstuhl. Ein Glück, dass ihr als Kriminalbeamtin ein eigenes Büro zustand. So konnte sie einfach die Tür zumachen, die Welt aussperren und darauf warten, dass die Stunden vergingen, indem sie ins Leere starrte oder einfach zuließ, dass ihr die Augen zufielen. Inzwischen stapelten sich die Akten auf ihrem Schreibtisch. Seit sie zwei Wochen zuvor aus dem Sonderurlaub zurückgekehrt war, hatte sie keinen einzigen Fall richtig in Angriff genommen.
Dieses Versäumnis war auch ihrem Chef Snorri aufgefallen, doch musste sie ihm zugutehalten, dass er sich ihr gegenüber geduldig und verständnisvoll zeigte. Sie hatte einfach wieder ins Büro kommen müssen, weil sie es nicht ertragen hätte, auch nur eine Minute länger mit Jón im Haus festzusitzen. Nicht mal die atemberaubend schöne Natur auf Álftanes, wo sie wohnten, konnte ihr noch Trost spenden. Sie war taub für das Seufzen der Wellen, blind für die Sterne und die Nordlichter, die am Himmel schimmerten. Sie und Jón redeten kaum noch miteinander – sie antwortete zwar, wenn er sie direkt ansprach, hatte es aber aufgegeben, von sich aus ein Gespräch anzufangen.
Das Februardunkel machte es nicht einfacher. Es war die kälteste, graueste Zeit des Jahres. Mit jedem Tag schien das Wetter noch ein bisschen schlechter zu werden. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, hatten in diesem Monat auch noch heftige Schneefälle die Stadt unter einer weißen Decke begraben, die alle Geräusche dämpfte und die Verkehrsadern verstopfte. Autos blieben in den Straßen liegen, und auch mit den vorschriftsmäßigen Spikes-Reifen musste Hulda all ihre Fahrkünste aufbringen, um mit ihrem Skoda die Nebenstraßen von Álftanes zu bewältigen, die nicht geräumt wurden, und es wohlbehalten bis zur Hauptstraße von Kópavogur zu schaffen.
Je wieder arbeiten zu können war ihr in der ersten Zeit unmöglich vorgekommen. Sie war sich nicht sicher gewesen, ob sie jemals wieder das Haus verlassen oder auch nur die Kraft aufbringen würde, unter der Bettdecke hervorzukriechen. Aber am Ende hatte sie nur zwei Möglichkeiten gehabt: zu Hause bei Jón zu bleiben oder von morgens bis abends im Büro zu sitzen, selbst wenn sie dort kaum etwas erledigt bekam.
Seit sie sich für das Büro entschieden hatte, hatte sie feststellen müssen, dass es ihr schwerfiel, sich zu konzentrieren. Sie brachte ihre Arbeitstage mehr oder weniger damit zu, Akten und Berichte von einem Stapel zu nehmen und nach einem halbherzigen Versuch, sie zu lesen, auf dem nächsten abzulegen.
So konnte es nicht weitergehen, sagte sie sich. Es musste doch irgendwann besser werden. Sie würde nie über die Schuldgefühle hinwegkommen, das war ihr klar – aber zumindest der Schmerz würde doch mit der Zeit abklingen? Auf jeden Fall konnte sie sich an diese Hoffnung klammern. Nur ihr Zorn auf Jón war weit davon entfernt zu verrauchen, im Gegenteil, er schwärte und wuchs weiter an. Mit jedem neuen Tag spürte sie, wie dieser Zorn und der Hass immer mehr an ihr nagten, und sosehr ihr bewusst war, dass es ihr nicht guttat, musste sie feststellen, dass sie ihre Gefühle einfach nicht unter Kontrolle hatte. Sie musste irgendein Ventil dafür finden …
Als das Telefon auf ihrem Schreibtisch klingelte, reagierte sie nicht. Verloren in ihrer eigenen düsteren Welt hob sie nicht mal den Blick, ehe es mehrmals geläutet hatte. Irgendwann griff sie mit einer trägen, schwerfälligen Bewegung, als wäre sie unter Wasser, zum Telefonhörer.
»Ja?«
»Hallo, Hulda, Snorri hier.«
Sie war schlagartig unruhig. Ihr Chef rief normalerweise nur an, wenn es dringend war. Ihr Kontakt beschränkte sich zumeist auf die morgendliche Dienstbesprechung, und in der Regel mischte er sich so gut wie gar nicht in ihre laufenden Ermittlungen ein.
»Oh, hallo«, sagte sie nach kurzem Zögern.
»Könnten Sie zu mir ins Büro kommen? Es ist was reingekommen.«
»Bin schon unterwegs.« Sie legte den Hörer zurück auf die Gabel, stand auf und überprüfte ihr Aussehen in dem kleinen Spiegel, den sie immer in der Handtasche hatte. So furchtbar sie sich auch fühlte – sie war fest entschlossen, bei der Arbeit keine Schwäche zu zeigen. Zwar dürfte keiner ihrer Kollegen irgendeinen Zweifel haben, was ihren Zustand betraf, trotzdem fürchtete sie mehr als alles andere, wieder vom Dienst freigestellt zu werden. Sich in die Arbeit zu stürzen war der einzige Weg, nicht völlig den Verstand zu verlieren.
Snorri begrüßte sie mit einem Lächeln, als sie sein Büro betrat, das so viel größer war als ihres. Sie spürte das Mitgefühl in seinem Blick und fluchte innerlich, weil sie befürchtete, dass seine Freundlichkeit ihre hart erkämpfte Selbstbeherrschung unterminieren könnte.
»Wie geht es Ihnen, Hulda?« Mit einer Handbewegung forderte er sie auf, Platz zu nehmen.
»Gut, gut, angesichts der Umstände.«
»Wie ist es für Sie, wieder im Büro zu sein?«
»Ich komme langsam wieder auf Touren. Ich hab mir ein paar Fälle vom vorigen Jahr vorgenommen und versuche noch, ein paar offene Fragen zu klären. Es läuft ganz okay.«
»Sind Sie sich wirklich sicher, dass Sie schon bereit dazu sind?«, fragte Snorri. »Ich hätte überhaupt kein Problem damit, Ihnen weiter Urlaub zu genehmigen, falls Sie ihn brauchen sollten. Natürlich brauchen wir Sie hier auch, das wissen Sie, aber wir wollen sichergehen, dass Sie sich in der Lage fühlen, auch die schwierigeren Fälle anzugehen.«
»Das verstehe ich.«
»Und sind Sie es?«
»Bin ich was?«
»In der Lage dazu.«
»Ja«, log sie und sah ihm dabei unverwandt in die Augen.
»Also gut, wenn das so ist … Wir haben da nämlich was reingekriegt, und ich möchte, dass Sie sich das ansehen, Hulda.«
»Aha?«
»Eine hässliche Geschichte.« Er hielt einen Moment lang inne, dann runzelte er die Stirn und unterstrich seine Worte mit einer ausladenden Geste. »Verdammt hässlich, um genau zu sein. Ein mutmaßlicher Mord draußen im Osten. Wir müssen sofort jemanden hinschicken. Tut mir leid, dass ich Ihnen so kurz nach Ihrer Rückkehr damit komme. Aber es ist zurzeit niemand sonst mit Ihrer Erfahrung verfügbar.«
Er hätte sich wirklich mehr Mühe geben dürfen, das Ganze als Kompliment zu verpacken, dachte Hulda, aber die gute Absicht zählte.
»Natürlich kann ich hinfahren. Ich bin absolut in der Lage dazu«, erwiderte sie, obwohl ihr nur zu bewusst war, dass das gelogen war. »Wo im Osten?«
»Oh, irgendein Bauernhof, ziemlich abgelegen. Unglaublich, dass es immer noch Leute gibt, die sich da draußen mit Landwirtschaft durchschlagen.«
»Wer ist das Opfer? Wissen wir das schon?«
»Das Opfer? Ach, entschuldigen Sie, Hulda, ich hab Ihnen nicht die ganze Geschichte erzählt. Wir reden nicht bloß von einer Leiche …« Er hielt inne. »Offenbar ist es ein richtig scheußlicher Anblick. Es ist nicht ganz klar, wie lange die Leichen schon dort liegen, aber sie schätzen, mindestens seit Weihnachten …«
TEIL EINS
Zwei Monate zuvor – kurz vor Weihnachten 1987
I
Ende.
Erla legte ihr Buch weg und lehnte sich mit einem tiefen Seufzer in dem verschlissenen Sessel zurück.
Sie hatte keine Ahnung, wie spät es war. Die Standuhr im Wohnzimmer hatte schon vor Langem den Geist aufgegeben – es musste Jahre her sein. Sie wussten beide nicht, wie sie sie selbst reparieren sollten, und die Uhr war so schwer und sperrig, dass sie nie ernsthaft in Erwägung gezogen hatten, sie zu ihrem alten Jeep hinauszuschleppen und über die lange, holprige Straße ins Dorf zu fahren. Sie waren sich nicht einmal sicher, ob die Uhr überhaupt ins Auto passte oder ob es im Dorf jemanden gab, der in der Lage war, so einen uralten Mechanismus zu reparieren. Also ließen sie sie einfach stehen, wo sie war, auch wenn sie seither nur noch der Dekoration diente. Die Uhr hatte Einars Großvater gehört. Angeblich hatte er sie aus Dänemark mitgebracht, wo er die Landwirtschaftsschule besucht hatte, bevor er nach Hause zurückgekehrt war, um den Hof zu übernehmen. So sei es von ihm erwartet worden, wie Einar gern betonte. Später war dann sein Vater an der Reihe gewesen, ehe der Staffelstab schließlich an Einar selbst weitergereicht worden war. Sein Großvater war längst tot und auch sein Vater, der recht jung verstorben war. Hier draußen einen Hof zu bewirtschaften, ja nur hier zu leben forderte von Körper und Psyche einen hohen Tribut.
Erst jetzt spürte sie, dass es eiskalt im Zimmer war. Das war zu dieser Jahreszeit natürlich nicht anders zu erwarten. Das Haus war in die Jahre gekommen, und wenn der Wind aus einer bestimmten Richtung wehte, konnte man sich in manchen Zimmern – wie hier im Wohnzimmer – nur warm halten, indem man sich in eine dicke Decke wickelte, so wie sie es getan hatte. Auf diese Weise blieb ihr angenehm warm, nur ihre Hände, die unter der Decke hervorschauten, waren so eiskalt, dass sie kaum die Seiten umblättern konnte. Aber das nahm sie gerne in Kauf. Nichts bereitete ihr so viel Genuss wie das Lesen. Ein gutes Buch konnte sie weit, weit weg in eine andere Welt entführen, in ein anderes Land, eine andere Kultur, wo das Klima wärmer und das Leben leichter war. Das sollte nicht heißen, dass sie undankbar oder unzufrieden mit dem Hof oder seiner Lage war. Immerhin war es Einars Elternhaus, also blieb ihr gar nichts anderes übrig, als die Zähne zusammenzubeißen und das Beste daraus zu machen. Als junges Mädchen im Reykjavík der Nachkriegszeit hätte Erla sich nie träumen lassen, dass sie mal als Bauersfrau im wilden Hochland von Island leben würde, doch dann hatte sie Einar kennengelernt, und er hatte ihr Herz im Sturm erobert. Und bald darauf – sie waren beide gerade Anfang zwanzig gewesen – hatte sie Anna bekommen.
Sie dachte an Anna, deren Haus in einem etwas besseren Zustand war als ihres. Es war viel später erbaut worden, in einiger Entfernung von ihrem Hof, ursprünglich als Unterkunft für Pachtbauern. Das Schlimmste an der Entfernung war, dass sie einander nicht einfach spontan besuchen konnten, wenn das schlechte Wetter sich so festsetzte wie jetzt, oder jedenfalls nur unter beträchtlichen Schwierigkeiten. Einar ließ den Jeep während der härtesten Wintermonate für gewöhnlich stehen, weil selbst der Vierradantrieb, die Spikes-Reifen und die Schneeketten wenig halfen, wenn es tagelang schneite. Bei solchem Wetter kam man besser zu Fuß oder auf Langlaufskiern vom Fleck – und zum Glück waren sie und Einar beide passable Skifahrer. Nur schade, dass sie nicht öfter die Gelegenheit gehabt hatten, ihr Geschick auf richtigen Abfahrtspisten zu beweisen, aber für solche Dinge war nie viel Zeit gewesen. Auch das Geld war immer knapp – der Hof arbeitete gerade kostendeckend, aber viel für Freizeitaktivitäten oder Reisen auszugeben konnten sie sich nicht leisten. Sie redeten nur selten darüber. Es ging immer nur darum, sich über Wasser zu halten, den Hof am Laufen und wenn möglich in den schwarzen Zahlen zu halten. Sie wusste, dass für Einar die Familienehre auf dem Spiel stand. Er hatte ein schweres Erbe angetreten, und es war, als wären die Geister seiner Ahnen ständig anwesend und beobachteten ihn aus den dunklen Ecken heraus.
Sein Großvater, Einar Einarsson I., wachte über den ältesten Teil des Hauses, wo Erla jetzt saß – dem ursprünglichen Holzhaus, das er »mit eigenen Händen, mit Blut, Schweiß und Tränen« gebaut hatte, wie ihr Mann es einmal ausgedrückt hatte. Einars Vater, Einar Einarsson II., herrschte über den neuen Flügel, wie Erla ihn nannte, den Anbau aus Beton, in dem jetzt die Schlafzimmer lagen – erbaut, als ihr Mann, Einar Einarsson III., noch ein Kind gewesen war.
Vor ihren eigenen Vorfahren empfand Erla nicht annähernd so viel Ehrfurcht. Sie sprach auch kaum von ihnen. Ihre Eltern waren geschieden und lebten unten im Süden, und ihre drei Schwestern sah sie so gut wie nie. Die räumliche Entfernung spielte natürlich eine Rolle, aber in Wahrheit waren ihre Familienbande nie besonders stark gewesen. Nach der Trennung der Eltern hatten Erlas Schwestern sich nicht mehr viel Mühe gegeben, den Kontakt aufrechtzuhalten, und Familientreffen gab es nur alle Jubeljahre. Tränen vergoss Erla deswegen kaum. Es wäre schön gewesen, sich für den Fall der Fälle auf ihr eigenes Netzwerk verlassen zu können, doch jetzt gehörte sie stattdessen zu Einars Familie und konzentrierte sich darauf, die Beziehung zu seinen Verwandten zu pflegen.
Erla blieb in ihrem Sessel sitzen. Fürs Aufstehen brachte sie einfach noch nicht die Energie auf. Außerdem würde sie ohnehin nirgends hingehen können außer ins Bett, und sie wollte noch ein wenig länger aufbleiben und die Ruhe genießen. Einar war schon vor Stunden eingeschlafen. Seiner Ansicht nach war es eine Tugend, früh aufzustehen, außerdem musste er ohnehin die Schafe füttern. Aber um diese Jahreszeit, kurz vor Weihnachten, wenn die Tage am kürzesten waren, sah Erla keinen vernünftigen Grund, sich in aller Herrgottsfrühe aus dem Bett zu quälen, solange es draußen noch stockdunkel war. Es wurde erst gegen elf richtig hell, und sie fand, dass das im Dezember allemal früh genug zum Aufstehen war. Sie und Einar hatten im Laufe der Jahre gelernt, sich wegen Banalitäten wie der Frage, wann man aufstehen sollte, nicht in die Haare zu kriegen. Es war ja nicht so, als bekämen sie hier draußen viel Besuch, also hatten sie keine andere Wahl, als miteinander auszukommen. Und sie liebten einander immer noch – vielleicht nicht mehr auf dieselbe Weise wie damals, als sie sich kennengelernt hatten, aber ihre Liebe war gereift, ihre Beziehung tiefer geworden.
Erla bedauerte fast, dass sie das Buch so schnell verschlungen hatte – sie hätte es sich besser einteilen sollen. Das letzte Mal, als sie ins Dorf gefahren waren, hatte sie in der Bücherei fünfzehn Romane ausgeliehen. Das war über dem Limit, aber für sie machte man eine Ausnahme, was angesichts der Umstände nur selbstverständlich war. Sie durfte die Bücher auch über die normale Frist hinaus ausleihen, manchmal sogar zwei oder drei Monate, wenn das Wetter besonders schlecht war. Nun hatte sie aber alle fünfzehn ausgelesen – dieses hier war das letzte gewesen. Sie hatte sie ungewöhnlich schnell durchgehabt, obwohl es unmöglich abzusehen gewesen war, wann sie es das nächste Mal zur Bücherei schaffen würden. Und es wäre unfair gewesen, von Einar zu verlangen, dass er ihr noch mehr Bücher mitbrächte, als er vor ein paar Tagen auf Skiern ins Dorf gefahren war – er hatte auch so schon genug zu schleppen gehabt. Das vertraute Gefühl der Leere beschlich sie, wie immer, wenn ihr etwas ausging und sie keine Möglichkeit hatte, sich Nachschub zu besorgen. Sie saß hier fest. Leere war eigentlich gar nicht der richtige Ausdruck für dieses Gefühl – es war eher so, dass sie sich hier oben in der Wildnis wie eine Gefangene vorkam.
Aber ein Wort wie »Klaustrophobie« durfte man hier auf dem Hof nicht in den Mund nehmen. Es war ein Gefühl, das sie ignorieren musste, sonst konnte es allzu leicht passieren, dass es unerträglich wurde.
Erstickend …
Ja, es war wirklich ein gutes Buch gewesen, das beste von den fünfzehn. Aber nicht so gut, dass sie es über sich gebracht hätte, es gleich noch einmal zu lesen. Alle anderen Bücher im Haus hatte sie auch schon gelesen – die, die sie gekauft hatten, und die, die sie mit dem Haus geerbt hatten. Manche sogar mehrmals.
Ihr Blick fiel auf die Tanne, die in der Wohnzimmerecke stand. Dieses Jahr hatte sich Einar ausnahmsweise Mühe gegeben, einen schönen Baum auszusuchen. Der würzige Duft, der durch das kleine Zimmer wehte, erzeugte eine behagliche vorweihnachtliche Stimmung. In der Weihnachtszeit taten sie stets ihr Bestes, um die Dunkelheit zu verjagen – sei es auch nur für kurze Zeit – und die Einsamkeit in willkommene Abgeschiedenheit zu verwandeln. Erla freute sich darauf, dass sie in dieser stillen Zeit des Ausruhens von der schweren Arbeit ungestört bleiben würden, weil bei so viel Schnee unter Garantie niemand so weit ins Landesinnere vordringen würde, es sei denn, er oder sie wäre ungewöhnlich fest entschlossen. Aber bisher war das nie vorgekommen.
Der Baum war noch nicht geschmückt. Der Familientradition zufolge würden sie das am 23. Dezember tun, am Thórláksmesstag, aber es lagen schon ein paar Päckchen darunter. Die Geschenke voreinander zu verstecken wäre sinnlos gewesen, da sie alle schon vor langer Zeit gekauft worden waren. Es war ja nicht so, als könnten sie an Heiligabend noch schnell zum Einkaufen fahren, wenn sie vergessen hätten, etwas zu besorgen, wie etwa ein letztes Geschenk oder Sahne für die Bratensoße.
Es lagen Bücher unterm Baum, das wusste sie sicher, und der Gedanke, eines davon sofort auszupacken, war verlockend. Einar schenkte ihr immer einen Roman, manchmal auch zwei, und auf nichts freute sie sich an Weihnachten so sehr wie darauf, ihre neuen Bücher auszupacken und es sich dann mit einer Schachtel Pralinen und einem traditionellen Malzbier im Sessel gemütlich zu machen, um bis in die Puppen zu lesen. Sämtliche Vorbereitungen waren abgeschlossen. Die Pralinenschachtel lag bereits auf dem Esstisch. Das Orangen-Malzbier stand in der Speisekammer, niemand durfte es vor dem offiziellen Beginn des Weihnachtsfests anrühren, was nach isländischer Tradition am Vierundzwanzigsten um achtzehn Uhr der Fall war, wenn die Glocken zur Christmette läuteten. Es verstand sich von selbst, dass es an Heiligabend wie immer hangikjöt gäbe – geräuchertes Lammfleisch. Wie letztes Jahr und das Jahr davor, wie jedes Jahr …
Erla stand auf. Sie war ein wenig steif, und die Kälte ging ihr durch Mark und Bein, sobald sie aus ihrem warmen Kokon hervorkam. Sie trat ans Wohnzimmerfenster, zog die Gardine zurück und spähte in die Dunkelheit. Es schneite. Aber das wusste sie ja schon. Hier schneite es im Winter immer. Was konnte man in Island anderes erwarten, wenn man so weit im Landesinneren wohnte, so hoch über dem Meeresspiegel? Sie lächelte leicht verbittert: Dies hier war kein Ort für Menschen, nicht zu dieser Jahreszeit. Die Hartnäckigkeit von Einars Vorfahren war in gewisser Weise bewundernswert, aber Erla hatte inzwischen das Gefühl, dass sie für deren Entscheidungen bestraft wurde. Ihnen hatte sie es zu verdanken, dass sie hier festsaß.
Der Hof musste weitergeführt werden, koste es, was es wolle. Nicht dass sie sich beklagte – natürlich nicht. Mehrere Höfe in der Nachbarschaft – wenn man in einer so dünn besiedelten Gegend überhaupt von Nachbarschaft sprechen konnte – waren in den vergangenen zehn Jahren aufgegeben worden, und Einars Reaktion war jedes Mal die gleiche gewesen: Er hatte die Feigheit derjenigen verflucht, die so schnell das Handtuch warfen. Und wovon sollten sie auch leben, wenn sie den Hof aufgäben? Sie konnten sich schließlich nicht sicher sein, dass sie für das Land überhaupt noch etwas bekommen würden, wenn sie es verkauften, und hier in der Gegend gab es kaum andere Arbeit. Sie konnte sich auch gar nicht vorstellen, dass Einar je freiwillig für jemand anderen würde arbeiten wollen, nachdem er fast sein ganzes Leben lang sein eigener Herr gewesen war.
»Erla«, hörte sie ihn aus dem Schlafzimmer rufen. Seine Stimme klang heiser. Sie war sich sicher, dass sie ihn zuvor hatte schnarchen hören. »Warum kommst du nicht ins Bett?«
»Bin schon unterwegs.« Sie knipste das Licht im Wohnzimmer aus. Dann blies sie die Kerze aus, die sie auf dem Tischchen neben dem Sessel angezündet hatte, um es sich für ihren Leseabend gemütlich zu machen.
Einar hatte seine Nachttischlampe eingeschaltet. Er lag auf seiner Seite des Betts – wie immer ganz Gewohnheitsmensch: auf dem Nachttisch ein Glas Wasser, der Wecker und sein Laxness-Roman. Erla kannte ihn gut genug, um zu wissen, dass er einfach nur fand, es mache sich gut, einen Klassiker wie Laxness am Bett liegen zu haben, obwohl er in Wahrheit immer schon nach ein paar Seiten darüber einschlief. Sie besaßen fast alles von Halldór Laxness, und Erla hatte sämtliche Bücher mehr als einmal gelesen. Einar hingegen las in letzter Zeit eher alte Zeitungen und Zeitschriften oder Artikel über paranormale Phänomene. Natürlich waren ihre Zeitungen nie aktuell, gerade in dieser Jahreszeit konnten Monate dazwischenliegen, bis die nächste Ausgabe kam. Trotzdem hatten sie weiter die Parteizeitung abonniert, von der bei jedem Besuch im Postamt schon ein ganzer Stapel auf sie wartete – und auch mehrere Zeitschriften, wie etwa die isländische Ausgabe des Reader’s Digest.
Einars Interesse am Tagesgeschehen war absolut verständlich, aber was ihn an Gespenstergeschichten oder Büchern von Mittlern zur Geisterwelt so faszinierte, war für sie beim besten Willen nicht zu begreifen – als wäre es nicht schon unheimlich genug, an diesem gottverlassenen Ort zu wohnen.
Im Winter verging kein Tag, an dem sie nicht irgendetwas erlebte, was ihr einen Schauer über den Rücken jagte. Sie glaubte nicht an Geister, aber die Abgeschiedenheit, die Stille, diese verfluchte Dunkelheit – all das zusammen verstärkte die Wirkung jedes Knarrens der Dielen, jedes Knackens in den Wänden, das Heulen des Windes und das Flackern von Licht und Schatten, und zwar so sehr, dass sie sich manchmal fragte, ob sie nicht doch an Geister glauben sollte; ob das ihr Leben nicht vielleicht erträglicher machen würde.
Nur wenn sie bei Kerzenschein in ihrem Sessel saß und ein Buch las, wenn sie völlig in eine fremde Welt eintauchen konnte, jagten ihr die Spukgebilde in ihrem Kopf keine Angst mehr ein.
Erla stieg ins Bett und versuchte es sich bequem zu machen. Sie hätte sich liebend gern auf den morgigen Tag gefreut, aber das war nicht ganz leicht; sie hätte gerne den Zauber dieses Orts verspürt, den Reiz seiner Abgeschiedenheit, so wie Einar es tat, aber sie konnte es beim besten Willen nicht so empfinden – nicht mehr. Sie wusste, dass es morgen nicht besser würde, dass der kommende Tag nicht anders wäre als derjenige, der gerade zu Ende ging. Weihnachten bescherte ihnen zwar ein wenig Abwechslung von der Routine, aber das war auch schon alles. Neujahr war auch nur ein Tag wie jeder andere, obwohl es auch da ein besonderes Essen gäbe – geräuchertes Lamm, wie an Heiligabend. Aber ein Feuerwerk hatten sie schon seit Ewigkeiten nicht mehr abgebrannt. Weil von Feuerwerkskörpern Gefahren ausgehen konnten, durften sie nur in einem begrenzten Zeitraum verkauft werden, und das bedeutete, dass sie nie zu haben waren, wenn sie und Einar ihre Weihnachtseinkäufe machten und ihre Vorräte auffüllten – üblicherweise schon im November, rechtzeitig vor den heftigsten Schneefällen, und es wäre kaum zu rechtfertigen gewesen, im tiefsten Winter erneut aufzubrechen, nur um ein paar Raketen und Wunderkerzen zu kaufen. Außerdem waren sie sich einig, dass es halbwegs witzlos war, in dieser Einöde ein Feuerwerk zu veranstalten. Jedenfalls hatte Einar es so ausgedrückt, und sie hatte sich wie üblich seinem Willen gefügt, obwohl sie die Explosionen von Licht und Farben insgeheim vermisste, mit denen sie früher das neue Jahr begrüßt hatten.
»Warum bist du denn so lange aufgeblieben, Schatz?«, fragte er zärtlich.
Sie warf einen Blick auf den Wecker. Es war noch nicht einmal elf, aber hier in dieser ewigen Dunkelheit hatte Zeit wenig Bedeutung. Sie lebten nach ihrem eigenen Rhythmus, gingen viel zu früh zu Bett und wachten viel zu früh auf. Sie rebellierte stumm, indem sie länger aufblieb und las, aber damit erreichte sie gar nichts.
»Ich habe nur noch mein Buch ausgelesen«, sagte sie. »Ich war einfach nicht müde. Und ich habe mich gefragt, ob wir nicht Anna anrufen und fragen sollten, ob bei ihr alles in Ordnung ist.« Dann beantwortete sie ihre eigene Frage, indem sie hinzufügte: »Aber jetzt ist es wahrscheinlich zu spät, um noch anzurufen.«
»Kann ich das Licht ausmachen?«
»Ja, mach nur«, sagte sie widerwillig.
Er betätigte den Schalter, und Dunkelheit hüllte sie ein. So absolut wie die Stille. Nirgends auch nur der leiseste Lichtschein. Sie spürte, wie draußen der Schnee fiel, und wusste, dass sie so bald nirgends hingehen würden. Das war das Leben, das sie sich ausgesucht hatten. Es blieb ihr nichts anderes übrig, als es zu ertragen.
II
Es war weit nach zehn Uhr abends. Hulda stand vor der Haustür und fluchte halblaut, während sie in ihrer Handtasche nach dem Schlüsselbund tastete. Sie konnte rein gar nichts sehen. Die Glühbirne über der Tür war durchgebrannt, und das Licht der Straßenlaternen war zu schwach, um ihr von Nutzen zu sein.
Jón hatte zwar versprochen, eine neue Birne zu besorgen, aber anscheinend war er noch nicht dazu gekommen. Hier draußen an der Küste der Álftanes-Halbinsel lebten sie mehr oder weniger auf dem Land – weit weg von den hellen Lichtern der Stadt. Sie hatte immer gefunden, dass es sich hier gut leben ließ, doch seit ein paar Monaten schien eine schwermütige Stimmung auf der Familie zu lasten wie eine dichte Wolkendecke.
Endlich fand Hulda die Schlüssel. Sie hatte nicht klingeln wollen, um Jón und Dimma nicht zu wecken, falls sie schon schliefen. Normalerweise wäre sie sogar noch später nach Hause gekommen, weil sie für die Nachtschicht eingeteilt gewesen war, aber ausnahmsweise war alles ruhig geblieben, also hatte Snorri sie früher gehen lassen. Er war einfühlsam, das musste sie ihm lassen, und er spürte wohl, dass bei ihr zu Hause etwas nicht ganz in Ordnung war. Sie und ihr Mann Jón arbeiteten beide zu viel, und das nicht unbedingt zu den üblichen Bürozeiten. Jón war Großhandelskaufmann und selbstständiger Investor, was ihm theoretisch erlaubte, frei über seine Zeit zu verfügen; tatsächlich aber verbrachte er Stunde um Stunde zu Hause in seinem Arbeitszimmer oder bei Besprechungen in der Stadt. Von Hulda wiederum wurde erwartet, dass sie Überstunden machte, wenn viel los war; sie musste regelmäßig Spät- und Nachtschichten einlegen und auch öfter an Feiertagen arbeiten. Dieses Jahr zum Beispiel war sie für den ersten Weihnachtsfeiertag eingeteilt. Aber mit ein bisschen Glück gäbe es nichts zu tun, und sie könnte einigermaßen rechtzeitig zu Hause sein.
Im Haus war alles still. Weder im Wohnzimmer noch in der Küche brannte Licht, und Hulda fiel sofort auf, dass es nicht nach Essen roch. Anscheinend hatte Jón es wieder mal nicht für nötig befunden, Abendessen für sich und ihre Tochter zu kochen. Er sollte eigentlich darauf achten, dass Dimma vernünftig aß – sie konnte sich doch nicht ausschließlich von Haferflocken zum Frühstück und zum Abendessen ernähren. Wie sollte sich ihre Laune bessern, wenn sie nie eine anständige Mahlzeit bekam? Und in letzter Zeit war sie wirklich schwierig genug gewesen. Sie war dreizehn, und sie schien den Teenager-Blues voll erwischt zu haben. Sie ließ den Kontakt zu ihren Schulfreundinnen schleifen und verbrachte die Abende zu Hause eingeschlossen in ihrem Zimmer. Hulda hatte immer gedacht, Álftanes sei der ideale Ort, um ein Kind großzuziehen, eine gute Mischung aus Stadt und Land, nicht allzu weit von Reykjavík entfernt und doch mit viel unberührter Natur direkt vor der Haustür und jeder Menge sauberer, gesunder Seeluft. Inzwischen jedoch musste sie sich eingestehen, dass die Entscheidung, sich hier niederzulassen, möglicherweise ein Fehler gewesen war. Vielleicht hätten sie näher ans Stadtzentrum ziehen sollen, um ihrer Tochter mehr Sozialkontakte zu ermöglichen.
Hulda stand in der Diele, als plötzlich Dimmas Zimmertür aufging und Jón herauskam.
»Schon zurück?«, fragte er und erwiderte ihren Blick mit einem Lächeln. »So früh? Ich dachte, ich müsste bis spätnachts aufbleiben, wenn ich dich noch sehen will.«
»Was machst du denn in Dimmas Zimmer? Schläft sie?«
»Ja, tief und fest. Ich habe gerade nach ihr geschaut. Sie wirkte ein bisschen angeschlagen. Ich wollte mich nur vergewissern, dass alles in Ordnung ist.«
»Ach? Hat sie Fieber?«
»Nein, nichts dergleichen. Ihre Stirn fühlt sich ganz kühl an. Ich denke, wir lassen sie am besten einfach schlafen. Sie macht zurzeit so einen niedergeschlagenen Eindruck.« Jón kam auf sie zu, legte ihr den Arm um die Schultern und dirigierte sie mehr oder weniger ins Wohnzimmer. »Wie wär’s, wenn wir uns ein Glas Wein gönnen, Schatz? Ich war heute im Ríki und habe zwei Flaschen Roten gekauft.«
Hulda zögerte. Sie machte sich Sorgen um Dimma. Irgendetwas schien da nicht zu stimmen. Dann schob sie den Gedanken beiseite. Tatsache war, dass sie einen anstrengenden Arbeitstag hinter sich hatte und dringend ausspannen musste. Ihr Job nahm sie schon genug in Anspruch, da durfte sie sich nicht auch noch zu Hause über alles Mögliche aufregen. Vielleicht hatte Jón ja recht, vielleicht brauchte sie nur einen Drink für die nötige Bettschwere.
Sie zog ihre Jacke aus, warf sie über die Sofalehne und setzte sich. Jón ging in die Küche und kam mit einer Flasche und zwei Gläsern zurück, die Huldas Großeltern gehört hatten. Mit einiger Mühe entkorkte er die Flasche und schenkte ein. Ein ungewohnter Luxus – nicht nur wegen der exorbitant hohen Alkoholsteuer, sondern auch weil sie wegen der eingeschränkten Öffnungszeiten beide selten dazu kamen, im Ríki, dem staatlichen Spirituosengeschäft, einzukaufen.
»Rotwein! Sind wir aber nobel heute! Was gibt es denn zu feiern?«
»Dass ich einen guten Tag hatte«, antwortete er. »Ich glaube, es ist mir endlich gelungen, dieses Haus in der Hverfisgata zu verkaufen, das ich ewig nicht losgeworden bin. Die Bank saß mir schon im Nacken und hat mit Zwangsenteignung gedroht. Verdammte Erbsenzähler, alle miteinander – die haben doch keine Ahnung, wie man Geschäfte macht. Na, wie dem auch sei – skál!«
»Skál.«
»Es gibt Momente, da wünschte ich mir, wir würden in einem anderen Land leben – einem mit richtigen Banken. Es ist so frustrierend, in einem Umfeld zu arbeiten, wo alles von der Politik bestimmt wird und auch die Banken von ehemaligen Politikern geleitet werden. Es ist doch verrückt – ich bin einfach in der falschen Partei, und das lässt man mich ständig spüren.« Er seufzte betrübt.
Hulda hörte nur mit halbem Ohr hin. Sie hatte nicht die Geduld, den endlosen Verwicklungen von Jóns finanziellen Transaktionen bis ins Detail zu folgen. Sie hatte selbst genug Probleme bei der Arbeit, hielt sich aber im Gegensatz zu ihm strikt an den Grundsatz, nichts davon mit nach Hause zu nehmen. Sie hatte volles Vertrauen in sein Geschäftsgeschick – er schien sämtliche Tricks zu kennen. Er kaufte zum Beispiel eine Luxusimmobilie, und ehe sie sich’s versah, hatte er sie mit einem satten Profit wieder abgestoßen. Die restliche Zeit beschäftigte er sich mit dem Aufbau seines Großhandelsgeschäfts. Das musste sie ihm lassen – er hatte dafür gesorgt, dass sie die ganzen Jahre ein komfortables Einkommen gehabt hatten. Sie besaßen dieses ansehnliche freistehende Haus und zwei Autos, und sie konnten sich den einen oder anderen Luxus leisten, wie zum Beispiel zweimal im Monat mit Dimma essen zu gehen, meist in ihrem Lieblings-Hamburgerlokal. Nach Reykjavík waren es mit dem Auto nur zehn Minuten, aber es gab dort so wenige Restaurants, dass selbst ein Besuch in einem Fast-Food-Lokal als besonderer Anlass zählte. Wenn sie es sich recht überlegte, war es schon eine ganze Weile her, dass sie zuletzt zusammen auswärts gegessen hatten. Dimma schien allmählich aus dem Alter raus zu sein, in dem sie Zeit mit ihren Eltern verbringen wollte, und sie hatte in den vergangenen Wochen und Monaten mehrere Einladungen ausgeschlagen, etwas mit ihnen zu unternehmen.
»Jón, wie wär’s, wenn wir morgen mal wieder essen gehen?«
»Am Thórláksmesstag? Da wird es überall voll sein.«
»Ich dachte einfach nur an unser übliches Lokal – auf einen Burger mit Pommes.«
»Hm …« Nach einer kurzen Pause sagte er: »Mal sehen. Es ist bestimmt viel los, und der Berufsverkehr ist so kurz vor Weihnachten immer besonders schlimm. Vergiss nicht, dass wir auch noch den Baum schmücken müssen.«
»Oh, verdammt«, rief sie, »ich hab vergessen, dass ich heute einen mitbringen wollte!«
»Hulda! Du hast doch versprochen, dass du dich darum kümmerst! Gibt es nicht einen Weihnachtsbaumverkauf ganz in der Nähe von deinem Büro?«
»Ja, ich fahre jeden Tag daran vorbei.«
»Wie wär’s dann, wenn du gleich morgen früh einen besorgst? Allerdings sind inzwischen bestimmt nur noch ein paar verkrüppelte Exemplare übrig.«
Nach kurzem Schweigen wechselte Hulda das Thema. »Hast du noch etwas anderes für Dimma? Wir haben doch darüber gesprochen, ihr Schmuck zu schenken. Ich habe das Buch besorgt, von dem ich glaube, dass sie es sich wünscht – jedenfalls hat sie früher an Weihnachten immer gerne gelesen. Und ich weiß zufällig, dass meine Mutter ihr einen Pullover gestrickt hat. Also ist sie wenigstens sicher vor der Weihnachtskatze.« Hulda grinste über ihren eigenen Witz – eine Anspielung auf den Volksglauben, wonach eine böse Katze isländische Kinder auffraß, die zu Weihnachten keine neuen Klamotten bekommen hatten.
»Keine Ahnung, was sie sich wünscht«, sagte Jón. »Sie hat nichts angedeutet. Aber ich kümmere mich morgen darum.« Dann fügte er lachend hinzu: »Glaubst du ernsthaft, dass sie einen Pullover anzieht, den deine Mutter gestrickt hat?« Ehe Hulda etwas erwidern konnte, fuhr er fort: »Das ist ein richtig guter Wein, findest du nicht? Teuer genug war er allemal.«
»Ja, er ist nicht schlecht«, pflichtete sie ihm bei, obwohl sie in ihrem Leben viel zu wenig Rotwein getrunken hatte, um den Unterschied zwischen Plörre und einem wirklich edlen Tropfen zu schmecken. »Mach dich nicht lustig über meine Mutter, sie tut ihr Bestes.« Obwohl Huldas Verhältnis zu ihrer Mutter längst nicht so eng war, wie sie es sich gewünscht hätte, verletzte es sie, wie Jón manchmal über sie redete. Sie selbst hatte stets darauf geachtet, dass Dimma ihre Großmutter richtig kennenlernte, und wenigstens das hatte gut funktioniert.
»Deine Mutter hat sich hier seit Ewigkeiten nicht mehr blicken lassen, oder?«, bemerkte Jón, und Hulda ahnte, dass hinter dem beiläufigen, spöttischen Ton unausgesprochene Kritik lauerte, obwohl sie sich nicht sicher war, ob an ihr oder an ihrer Mutter. Vielleicht an ihnen beiden.
»Nein, und das ist meine Schuld. Ich war so beschäftigt, dass ich ehrlich gesagt gar nicht dazu gekommen bin, sie einzuladen.«
Das war nur die halbe Wahrheit. Tatsache war, dass sie sich in Gegenwart ihrer Mutter nicht besonders wohlfühlte. Ihre Beziehung war immer schon ein wenig verkrampft gewesen, und ihre Mutter konnte sehr anstrengend sein, wenn sie Hulda partout nicht von der Seite weichen wollte. Dabei war es nicht so, als würden sie je über etwas Wichtiges reden.
Hulda hatte die ersten knapp zwei Jahre ihres Lebens in einem Kinderheim verbracht, und sie hätte zu gern mit ihrer Mutter über die Vergangenheit gesprochen und sie gefragt, warum man sie dorthin abgeschoben hatte. Sie vermutete, dass hauptsächlich ihre Großeltern dafür verantwortlich gewesen waren, und doch war es ihr irgendwie leichter gefallen, ihnen zu verzeihen als ihrer eigenen Mutter. Sie war natürlich zu klein gewesen, um noch irgendwelche Erinnerungen an die Zeit im Heim zu haben, aber seit ihr Großvater es ihr erzählt hatte, ließ ihr all das keine Ruhe mehr. Vielleicht erklärte das ja ihre Unfähigkeit, eine tiefere Bindung zu ihrer Mutter zu entwickeln; das Gefühl, im Stich gelassen worden zu sein, nicht geliebt worden zu sein, war einfach schwer zu ertragen.
Sie nahm noch einen Schluck von Jóns teurem Wein. Wenigstens wurde sie jetzt geliebt. War glücklich verheiratet mit Jón und Mutter einer reizenden Tochter. Sie hoffte inständig, dass Dimma ihre düstere Stimmung über Weihnachten abschütteln würde.
Im selben Moment hörte sie ein Geräusch vom Flur.
»Ist sie wach?«, fragte Hulda und machte Anstalten aufzustehen.
»Bleib sitzen, Schatz.« Jón legte ihr die Hand auf den Oberschenkel. Sie fand, dass er unnötig fest zudrückte, aber sie protestierte nicht.
Dann hörte sie, wie eine Tür zuging, und anschließend das Klicken eines Schlosses.
»Sie ist nur aufs Klo gegangen. Beruhige dich, Schatz. Wir müssen ihr ein bisschen Freiraum lassen. Sie wird so schnell erwachsen.«
Natürlich hatte er recht. Die Pubertät brachte große Veränderungen mit sich, und zweifellos hatte jedes Kind seine eigene Art, damit fertigzuwerden. Die Phase würde vorübergehen, und vielleicht musste Hulda sich einfach nur ein wenig zurücknehmen. Als Mutter ließ sie sich möglicherweise zu sehr von ihren Gefühlen leiten, obwohl ihr bewusst war, dass es manchmal besser war, sich einfach zu entspannen und den Dingen ihren Lauf zu lassen.
Sie saßen eine Weile in einträchtigem Schweigen zusammen – das hatten sie schon immer gut gekonnt. Jón schenkte ihr nach, obwohl sie noch nicht ausgetrunken hatte, und sie bedankte sich bei ihm.
»Sollten wir nicht für Heiligabend einen Räucherschinken besorgen, wie immer?«, fragte Jón. Er hatte offenbar nicht gesehen, dass bereits einer im Kühlschrank lag.
»Habt ihr gar nicht zu Abend gegessen?«, gab Hulda zurück. »Und ja, ich habe den Schinken schon besorgt.«
»Es war keine Zeit … Ich habe mir auf dem Nachhauseweg ein Sandwich geholt, und Dimma ist es gewohnt, für sich selbst zu sorgen. Es ist doch immer Skyr oder so im Kühlschrank, oder?«
Hulda nickte.
»War viel los bei der Arbeit?«, fragte er betont freundlich, um das Thema zu wechseln.
»Allerdings. Es sind immer zu viele Fälle auf einmal. Wir haben einfach nicht genug Personal.«
»Ach, ich bitte dich, wir leben doch im friedlichsten Land der Welt.«
Sie lächelte nur, um nicht weiter darauf eingehen zu müssen. Manche Fälle, mit denen sie zu tun hatte, waren sehr belastend, und sie hatte keine Lust, mit ihm darüber zu sprechen. Besonders nicht über den Vorfall, der sie immer noch beschäftigte, obwohl es bereits im Herbst passiert war: die junge Frau, die in Selfoss verschwunden war. Es konnte sicher nicht schaden, wenn sie sich morgen die Akte noch einmal vornähme.
Wieder war vom Flur ein Geräusch zu hören. Hulda stand auf, ohne auf Jóns Protest einzugehen.
Sie trat hinaus auf den Flur und sah ihre Tochter an deren Zimmertür stehen. Sie war drauf und dran hineinzugehen, hielt dann aber inne und wandte sich zu ihrer Mutter um, allerdings mit leerem Blick, als wäre sie in ihrer eigenen Welt.
»Dimma, Liebling, bist du noch wach? Ist alles in Ordnung?«, fragte Hulda und hörte selbst, wie verzweifelt sie klang.
Sie zuckte zusammen, als Jón ihr plötzlich den Arm um die Schultern legte und sie festhielt. Dimma sah sie beide abwechselnd an. Dann verschwand sie wortlos in ihrem Zimmer.
III
Erla saß Einar am Küchentisch gegenüber. Im Hintergrund kämpfte die Stimme der Nachrichtensprecherin gegen das Rauschen im Langwellenradio an. Hier draußen war der Empfang immer schon schlecht gewesen, und man hatte ihnen erklärt, sie sollten froh sein, überhaupt Radio hören zu können. Doch trotz der schwankenden Qualität war normalerweise zu verstehen, was da gesagt wurde, selbst wenn die Interferenzen am schlimmsten waren. Für Erla war das Radio ein Rettungsanker, beinahe eine Bedingung dafür, dass sie weiter hier wohnen blieben. So gerne sie las – und sie las viel –, konnte sie sich nicht vorstellen, den langen, kalten und dunklen Winter ohne das Radio durchzustehen. Am liebsten hörte sie Hörspiele und Serien – einfach alles, was sie auf andere Gedanken brachte. Das Mittagessen tischte sie für gewöhnlich auf, während gerade das letzte Musikstück vor den Nachrichten lief; dann setzten sie sich zum Essen hin und hörten dabei die Zwölf-Uhr-Meldungen, was ihre Unterhaltung auf ein Minimum beschränkte. Das Mittagessen variierte kaum: Roggenbrot, Sauermolke zum Trinken und die aufgewärmten Reste vom Vorabend, diesmal in Form eines Eintopfs mit Fleisch, dessen köstlicher, würziger Duft durch die Küche wehte.
Erla betrachtete ihren Mann. Er sah müde aus, mit dunklen Schatten unter den Augen und tiefen Furchen in der Stirn, obwohl er erst Anfang fünfzig war. Er hatte sein Leben lang hart gearbeitet, und noch immer war kein Ende seiner Mühen in Sicht. Sie hatten es sich nach und nach abgewöhnt, sich mit alten Freunden und Bekannten aus ihrem Bezirk zu treffen, und durch den Zustand der Straßen waren sie ohnehin Jahr für Jahr mehrere Monate lang von der Außenwelt abgeschnitten. Einar war immer politisch aktiv gewesen, doch inzwischen beschränkte er sich darauf, die Parteizeitung zu kaufen und wählen zu gehen. Er regte sich kaum noch über das Tagesgeschehen auf und hatte es komplett aufgegeben, über Politik zu streiten. Aber weil er und Erla in den meisten Punkten ohnehin einer Meinung waren, gab es auch niemanden, mit dem er hätte streiten können – außer vielleicht das Radio.
Den ewigen Versprechungen zum Trotz hatten sie immer noch keinen Fernsehempfang. Jedes Jahr kam es deswegen zu Diskussionen mit den Verantwortlichen, aber bislang deckte immer noch kein Sender ihr Gebiet ab. Andererseits war es vielleicht ganz gut, dass sie diesem Medium noch nicht verfallen waren. So konnten sie noch ein bisschen länger in der Vergangenheit leben – das versuchte Erla sich jedenfalls einzureden. Insgeheim träumte sie sehr wohl davon, es sich abends vor dem Fernseher gemütlich zu machen und die Nachrichten und diese ganzen Serien anzuschauen, von denen sie in der Zeitung las. Es gab neuerdings sogar ein zweites Programm, aber dass sie das in diesem entlegenen Tal je würden empfangen können, war nichts weiter als ein frommer Wunsch.
»Es wird kälter, sagen sie«, murmelte Einar nach der Wettervorhersage. Ihre Gespräche am Mittagstisch drehten sich oft nur ums Wetter. Natürlich war das wichtig, aber manchmal wünschte sich Erla, über ernsthaftere Themen sprechen zu können.
»Mhm«, gab sie zurück, ohne richtig zuzuhören.
»Und wieder ein verdammter Sturm im Anzug. In diesem Winter ist uns einfach keine Atempause gegönnt – nur Schnee, Schnee und noch mehr Schnee. Wenn es so weitergeht, weiß ich nicht, wie unser Heuvorrat bis zum Frühjahr reichen soll.«
»So ist es nun mal, Einar. Was erwartest du denn? Ich meine, so ist es doch jedes Jahr. Wir sind hier gefangen.«
»Na ja, gefangen