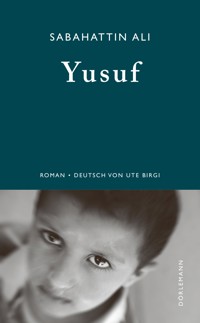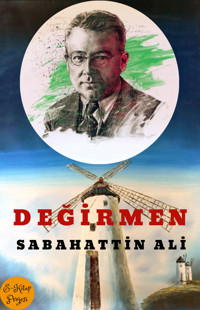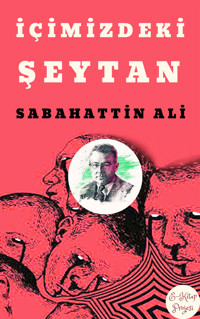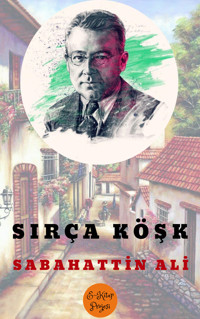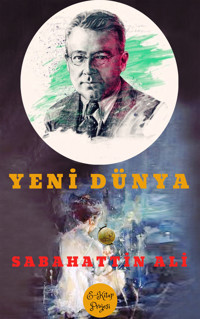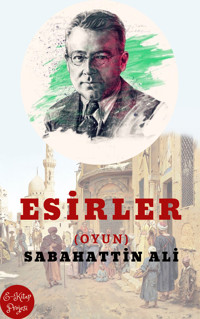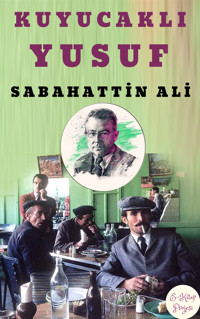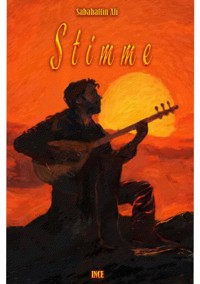8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Herzstück der Sammlung ist die Legende „Hasanboğuldu“: eine Liebes- und Verlustgeschichte, deren Echo in Wasserfällen, Kiefernwäldern und Bergpfaden nachhallt. Doch auch abseits dieser Ballade leuchten die Erzählungen—mal herb, mal komisch, immer menschennah. Alis Prosa öffnet Fenster in eine „neue Welt“, die zugleich fern und erschreckend gegenwärtig ist: soziale Brüche, die Härte des Alltags, die Sehnsucht nach Würde.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 219
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Sabahattin Ali
Neu Welt
Eine Welt, wo Neues leise wächst
Übersetzung
INCE
Inhalt
Asphaltierte Straße
Sängerin Melek
Teekanne
Ayran
Um zu wärmen
Schlaf
Gruß
Der Beginn eines Berufs
Eine Konferenz
Neue Welt
Zwei Frauen
Sulfat
Hasan ist Ertrunken
Impressum
Asphaltierte Straße
Der Lastwagen, der von der Station aus in die Provinzhauptstadt fuhr, hatte mich nach etwa zwei Stunden des heftigen Rüttelns am Anfang des Weges abgesetzt, der in das Dorf führte, zu dem ich unterwegs war. Ich war nicht einmal in der Lage, zwei Schritte zu gehen. Ich nahm meine Tasche und setzte mich auf einen Stein, von dessen Rändern grünes Gras emporwuchs. Dabei begann ich, dem Brummen in meinem Kopf zu lauschen.
Der Lastwagen, der innen von einer Mischung aus Staub und Schweiß durchdrungen roch, hatte uns auf dieser kaputtesten Straße der Welt so sehr durchgeschüttelt, dass wir zu Boden geworfen wurden.
Plötzlich kamen Stopps und Erschütterungen, als würde man in einen Abgrund stürzen. Sie ließen mich vergessen, wo ich war, und versetzten mich in eine dunkle Traumwelt. Nun versuchte ich, von diesem Traum wieder klarzukommen, während ich auf jenem Stein saß. Der Fahrer hatte mir das Dorf gezeigt, in das ich gehen wollte. Es lag etwa eine halbe Stunde von dem Ort entfernt, an dem ich verweilte, und bestand aus einem Haufen aschgrauer Ziegel. An einer Seite erhoben sich einige schmal und fein aus dem gleichen aschgrauen Ziegelmaterial wirkende Pappeln, die andeuteten, dass dort, wenn auch in winziger Menge, Wasser vorhanden war.
Vielleicht saß ich dort etwa eine Stunde an, ehe ich mich langsam und schwankend aufrichtete. Ich hob meine kleine Tasche auf und begann zu gehen. Da ich selbst aus einem Dorf komme, kenne ich die Dorfbewohner gut und hatte nicht das Gefühl, an einen fremden Ort zu gehen. Ich war mir sicher, dass ich in meiner ersten Aufgabe Erfolg haben würde.
Es begann, Abend zu werden. Als ich dem Dorf näherkam, breitete sich ein allumfassendes Rot über die Gegend aus. Auf den trockenen Steppengräsern, die sich wie ein rotes Meer funkelten und in Bewegung waren, lag mein langgezogener Schatten; und der obere Teil meines Schattens verlor sich in der Ferne zwischen jenen Gräsern, aus denen hier und da Heuschrecken hervorsprangen.
Als ich zu ein paar Häusern am Rande des Dorfes kam, roch ich den Geruch von brennendem Dung. Vor meinem inneren Auge sah ich einen Herd, auf dem dünne Fladen gebacken wurde, und barfüßige Kinder, die warteten.
Auf den Straßen liefen ein paar Kühe, die noch nicht nach Zuhause gefunden hatten, und sie schlugen mit ihren Schwänzen gegen ihre Hinterteile, während sie ab und zu ein Brüllen von sich gaben. Dieses Brüllen, glich fast einem tiefsinnigen Spruch, die man lang und bedacht, überlegt aussprach.
Ein stechender Geruch von Dung, der immer stärker wurde, zog mich näher an diesen Ort heran. Ein Dorf ist ein lebendiges, arbeitendes Wesen, und dieser Geruch ist der Geruch seines Schweißes. Kein Geruch der Welt hat mich je so umhüllt, und so viele Erinnerungen schossen, eine nach der anderen, durch den Kopf.
Vor dem Kaffeehaus war außer einigen alten Herren niemand mehr übriggeblieben. Als sie mich sahen, blickten sie regungslos auf mich, ohne aufzustehen. Ich ging zu ihnen, setzte mich und erklärte, wer ich sei.
Einer von ihnen, der Dorfoberhaupt, berichtete, dass seit dem Weggang meines Vorgängers als Lehrer bereits sechs Monate vergangen seien und die Schule seither geschlossen bliebe:
„Die Erntearbeiten ist noch nicht fertig, die Kinder kommen nicht zur Schule. Du kannst dich noch fünf bis zehn Tage ausruhen!“, sagte er.
Es war nicht schwer, die Kinder zu versammeln und den Unterricht zu ordnen. Die Dorfbewohner verstehen schnell diejenigen, die ihre eigene Sprache sprechen. Im Moment kann ich mich über nichts beschweren. Es gibt nur ein Straßenproblem, das ich selbst in die Hand genommen habe und an dem ich seit Monaten arbeite. Diese Straße, die mich am ersten Tag meiner Ankunft mit dem Lastwagen fast erschlagen hat, hat sich als das größte Problem der ganzen Provinz erwiesen.
Jeder musste seine Ernte, jeder Fahrgast, über diese Straße transportiert werden. Es gibt keine andere Straße, und sie als Straße zu bezeichnen, ist etwas übertrieben. Seltsamerweise ist dies die Straße, die das Zentrum der Provinz mit der sechzig Kilometer entfernten Eisenbahn verbindet! Ich vermute, dass wichtigere Dinge den Bau dieser Straße verzögert haben. Ich habe mich sowohl von unserem Dorf als auch von anderen Dörfern aus an die Provinz gewandt und so gut wie möglich erklärt, wie notwendig der Bau der Straße ist. Da die Regierungsbeamten lange Anträge nicht lesen, habe ich jede meiner Ideen in einen separaten Antrag geschrieben und sie von verschiedenen Dörfern aus eingereicht, damit sie alle gelesen werden. Ich habe auch viele Ideen vorgebracht, wie die Dorfbewohner beim Bau der Straße helfen könnten.
Vor Kurzem, als ich in die Stadt ging, behandelte mich der Bildungsdirektor etwas sonderbar – er schien verärgert zu sein, ohne dies offen zu zeigen, und bevorzugte stattdessen mich zu verspotten. Ich fragte mich, warum.
Dann, beiläufig, sagte er:
„Sie scheinen ja auch Zeit zu finden, sich mit außerschulischen Angelegenheiten zu beschäftigen – ist Ihre Schülerzahl etwa so gering?“
„Nicht gering, aber ist es nicht meine Aufgabe?", erwiderte ich.
Er ließ seinen spöttischen Blick über mich schweifen, sagte aber nichts weiter. Später hörte ich in einem Café von Freunden, dass der Bildungsdirektor auf mich verärgert gewesen sei. Ich hatte den Dorfbewohnern die Verfassung vorgelesen und erklärt. Ein Dorfbewohner, der in der Katasterverwaltung tätig war, hatte einen Bericht eingereicht und nach einiger Zeit um eine Antwort gebeten. Als man ihn fragte: „Welche Antwort?“, entgegnete er energisch: „Sie müssen einfach eine Antwort geben!
Das müssen Sie! Es gibt ein Gesetz!“. Als man erfuhr, dass er das Gesetz von mir gelernt hatte, reichte man beim Bildungsdirektor eine Beschwerde ein. Viele ärgern sich nun darüber, dass ich mich so sehr mit dieser Straßenangelegenheit beschäftige – nicht, weil sie etwas Persönliches daran hätten, sondern weil sie sich an der Sache selbst ärgern. In dem Dorf, in dem ich als Lehrer tätig bin, gibt es einen wohlhabenden Meister Rüstem, der in der Stadt einen Fuhrmannsladen betreibt und Federwagen sowie Ochsenwagen repariert.
Ich hörte, wie er zu den Dorfbewohnern ging und sich gegen mich aussprach. Das überraschte mich nicht. Bisher ist aus all meinen Bemühungen noch nichts geworden. Manchmal überlege ich, das Ganze ruhen zu lassen – denn Beamte in der Regierung, insbesondere jene im Nafıa in der Stadt, spotten offen über mich. Doch abends, wenn ich im Dorf die Zustände der von der Station zurückkehrenden Wagen, Ochsenkarren und armen Tiere sehe, schmerzt es mich; und ich sage zu mir selbst: „Lass das, was du angefangen hast, nicht unvollendet, mein Lieber – das passt nicht zu dir!“
Was für ein langwieriges Verfahren es doch ist. Es gab keinen Raum des Provinzgebäudes, an dem unsere Anträge nicht ein- und ausgingen; selbst die Dorfbewohner wunderten sich über meinen Eifer, und auch bei ihnen schien es keinerlei Hoffnung auf einen erfolgreichen Abschluss zu geben.
Noch immer ist nichts erreicht worden… Wahrscheinlich werden sie diese Straße nicht bauen. Auch die Dorfbewohner helfen mir nicht – sie sind wahrlich träge Geschöpfe… vielleicht aber auch sehr kluge Wesen, die sich nicht vergeblich mit solch einem Unterfangen abmühen wollen. In mir ist keinerlei Elan mehr übrig. Selbst wenn sie mir mit ein paar Worten antworteten – sei es „ja“ oder „nein“ – ist es, als hätten wir diese Anträge in einen tiefen Brunnen geworfen, aus dem kein Laut mehr zu hören ist.
Abends steige ich auf den Hügel neben dem Dorf und betrachte die weitläufige, staubverhangene Straße. Manchmal erscheint mir ein Lastwagen, der so weiß vom Staub ist und auf dessen Oberfläche, bedeckt mit Korbgebinde, es aussieht, als würde er – wie ein Mensch, der in einem Sumpf seine Knie anhebt und senkt – hin und her schwanken, als stünde er kurz vor dem Einsturz, und langsam voranschreitet.
Das ist ein so trauriger Anblick, dass man die Augen schließen muss, um nicht den Kampf zwischen dieser Maschine, einer der modernsten Ausdrucksformen der Technik, und dieser primitivsten Straße der Welt zu sehen. Manchmal verspüre ich den Drang, hinauszulaufen und den Weg mit meinen Handflächen zu ebnen, um meinen Teil dazu beizutragen, dass wenigstens fünf oder zehn Meter des Abschnitts endlich zu einer „Straße“ werden.
Unser Anliegen kam plötzlich in Schwung. Kürzlich kam einer unserer Ältesten in die Stadt. Egal, wie bequem sein Auto war, diese Straße muss sich wieder bemerkbar gemacht haben, denn er erwähnte sie bei einem Gespräch mit dem Gouverneur, und dieser schaltete sich sofort ein:
"Das ist eines der ersten Dinge, an die wir denken, wir wollen sie noch in diesem Jahr bauen lassen, die Projekte sind in Vorbereitung. Wir denken sogar daran, sie zu asphaltieren... Würden Sie unsere Stadt häufig beehren, wenn diese Straße asphaltiert würde?
Der Älteste erwiderte:
„Natürlich werde ich kommen …“
Und damit nahm das Asphalt-Thema Fahrt auf. Ich träume wohl, denn der Gouverneur sprach von Projekten. Es scheint, sie seien dieser Sache keineswegs gleichgültig, sondern finden es angemessener, die Bürger auf stille, unauffällige Weise zu bedienen.
Doch im Gegensatz zu dieser Stille wurde dieses Mal viel Aufhebens um die Arbeit gemacht. In der Wochenzeitung der Provinz – die fast so umfangreich ist wie ein Essensplan – füllte sich die Hälfte mit Meldungen über Asphaltstraßen. Auch im Dorf schien mein Ansehen zu steigen; die Art, wie unsere Dorfbewohner mit anderen Menschen umgehen, ist ohnehin wie ein Barometer. Meiner Meinung nach war es vorerst nicht nötig, die Straße zu asphaltieren. Denn es würden dreimal so hohe Kosten anfallen, und dieses Geld könnte an weitaus dringenderen Stellen eingesetzt werden.
Für uns würde ein einfacher, sauberer Weg völlig genügen. Doch vielleicht haben sie noch andere Vorstellungen – vielleicht wollen sie, dass alles vollkommen perfekt ist. Solche großangelegten Projekte übersteigen meinen Verstand. Ob es nun eine Straße ist oder, falls wir das Geld haben, gar ein Teppich verlegt wird … Der Gouverneur ist nach Ankara gefahren. Die Ingenieure, die die Vermessung vornahmen, berichteten, dass die Straße eine halbe Million kosten würde, während das Budget der Provinz 350 Tausend Lira betrug.
Um dieses Geld aufzutreiben, wurden Banken aufgesucht – doch diese wollten ohne die Garantie des Finanzministeriums kein Geld gewähren, und das Finanzministerium konnte ohne die Erlaubnis des Parlaments keinen Bürgschaftsvertrag eingehen. Kurzum, es war kompliziert.
Der Gouverneur machte es sich zur Aufgabe, all diese Hürden zu überwinden. Er hielt eine Rede, um von der Generalversammlung eine Bewilligung zu erhalten – das habe ich in der Provinzzeitung gelesen – ein eindrucksvolles Beispiel für Beredsamkeit. Er erklärte, es sei das Signal des Ältesten gewesen, das ihn dazu veranlasst habe, sich mit aller Kraft für diese Straße einzusetzen, und erinnerte daran, dass er versprochen habe, uns nach dem Bau der Straße wieder zu beehren.
In der Tat sehen unsere Ältesten alles und wecken die Schläfer mit einem einzigen Zeichen auf. Der Gouverneur erwähnte weder, dass es zahlreiche Anträge der Bevölkerung für diese Straße gab, noch sprach er davon, wie sehr die Straße den Dorfbewohnern nützen würde. Vielleicht, weil diese Dinge allgemein bekannt sind. Wie dem auch sei – ich bin froh, wenn ich auch nur einen kleinen Einfluss auf den Bau dieser Straße gehabt habe.
Die Bauarbeiten an der Straße haben bereits begonnen. Von den Banken wurde Geld geliehen – es wird wohl über mehrere Jahre hinweg abbezahlt werden. Um die Ratenzahlungen zu decken, wurde ein wenig aus dem Haushalt des Krankenhauses abgezweigt, und im kommenden Jahr wird der Bildungsdienst ein wenig gekürzt. Ich hätte niemals gedacht, dass es so weit kommen würde. Doch bisher gibt es noch nichts Konkretes. Wir sollten nicht voreilig in Panik verfallen. Wenn es darum geht, Geld aufzutreiben, gibt es viele Dinge, an die man vor der Bildung denken muss. Zum Beispiel könnte der Gouverneur – der diesem Straßenprojekt sehr verbunden ist – vorerst darauf verzichten, ein Gouverneurspalais errichten zu lassen …
Der Bau der Straße schreitet voran, und an der unserem Dorf zugewiesenen Ecke wird fieberhaft gearbeitet. Die Walzen kommen und gehen, und viele Arbeiter aus dem Dorf, in ihrer gefleckten Kleidung, arbeiten wie Ameisen. Diese Arbeit dauert bis zum späten Abend an, dann ziehen sie sich in die Zelte am Rand zurück und gehen zu Bett. Die meisten der Arbeiter schlafen im Freien.
Der Bauunternehmer konnte nicht genug Zelte besorgen. Im Morgengrauen geht die Arbeit wieder los. Es gibt auch Arbeiter aus unserem Dorf. Sie verdienen fünf oder zehn Groschen und bezahlen ihre Steuerschulden. Nachts kehren sie in ihr Dorf zurück, aber sie sind erschöpft. Der Beamte, den das Bauunternehmen für sie abgestellt hatte, konnte ihnen kaum zehn Minuten frei geben, um Brot zu essen.
Unsere Dorfbewohner waren anfangs sehr gleichgültig, aber als die Stein- und Asphaltarbeiten begannen, wurden sie neugierig. Sie können kaum akzeptieren, dass dieses schwarze Zeug, das in riesigen Kesseln gekocht und dann auf den Boden geschüttet wird, begehbar ist, geschweige denn, dass Lastwagen und Autos darauf fahren werden. Diejenigen, deren Felder auf dieser Seite liegen, hocken abends auf dem Rückweg im Graben am Straßenrand, rauchen ihre Zigaretten, beobachten die hin- und herfahrende Walze und unterhalten sich mit den ihnen bekannten Arbeitern über ihren Lohn.
Die Straße ist fertig. In ein paar Tagen wird es eine Eröffnungsfeier geben. Wenn man den Hügel in der Nähe des Dorfes hinaufschaut, leuchtet sie in der Ferne wie eine schwarze Schlange. Sie werden auf beiden Seiten Bäume pflanzen. Das ist eine wunderbare Sache. Wenn ich daran denke, wie alle Menschen aus der Provinz hier durchkommen werden, wie leicht sie den Bahnhof erreichen werden, macht etwas in mir einen Sprung. Es gibt Gerüchte über die Festigkeit der Straße... Es heißt, die Baufirma habe die Straße nicht richtig hinbekommen. Aber ich glaube, das ist nur ein Gerücht. Ich frage mich, wie man angesichts dieser furchtbar schönen Aussicht negative Gedanken haben kann.
Heute war der glücklichste Tag meines Lebens. Am Rande der Stadt waren Wagen geparkt, und alle Beamten erschienen in ihren offiziellen Kleidern. Sogar der Leiter der privaten Buchhaltung trug – über seinem beigen Mantel – einen Zylinderhut und nahm mit einer Körpergröße von 1,55 m im Vordergrund Platz ein. Ich selbst bügelte ein Hemd, zog es an und kam in gepflegtem Zustand. Der Bildungsdirektor sah zwar skeptisch, ja sogar missbilligend aus, aber was er auch sagte – wenn ich eines Tages das Dorf verlasse, bricht nicht gleich die Welt zusammen … diese Straße ist ein Stück meines Werkes … die Leute und Dorfbewohner sahen von weitem zu; ich ging zu ihnen, sprach mit ihnen, und es war, als wolle ich vor Freude alle in die Arme schließen.
Nachdem ich zu meinem Platz zurückgekehrt war, erinnerte ich mich und gab den Dorfbewohnern ein Zeichen, näher zu kommen, denn diese Straße gehört ihnen vor allen anderen. Diese Straße gehört in erster Linie ihnen. Einige wagten sich voran, wurden aber von den Gendarmen zurückgehalten; ich erhob zwar meine Stimme nicht, doch ein großer Teil meiner Freude entwich mir.
Der Gouverneur hielt eine lange Rede, ich konnte sie nicht gut hören, weil seine Stimme nicht sehr laut war, nur für meine Ohren: " Das Land, die gemeinnützige Arbeit... Unsere Vorbilder... Alles für das Volk...". Ein paar andere Leute sagten kurze Worte. Die Absperrung wurde durchbrochen, und eine Karawane von Autos, mit dem des Gouverneurs an der Spitze, fuhr vor. Nach ihm gingen die Beamten fünf oder zehn Schritte, alle schienen ihre Füße an den Asphalt zu gewöhnen. Die Dorfbewohner, vielleicht wegen ihrer Unerfahrenheit, vielleicht weil sie Angst hatten, etwas zu sagen, wagten es nicht, den Asphalt zu betreten, sondern gingen auf dem Dreck zu beiden Seiten der Straße und schauten mit großen Augen auf den Asphalt in der Mitte, auf dem die Spuren frischer Autoreifen nass und feucht glänzten.
Trotz allem kehrte ich wie ein siegreicher Feldherr ins Dorf zurück.
Am zehnten Tag der Eröffnung der Straße legten die wissenschaftlichen Mitarbeiter des Bauamtes der Provinz einen Bericht vor. Sie berichteten, dass Ochsenfuhrwerke, Rinderkarren und sogar andere Fuhrwerke den Asphalt stark beschädigt hatten. Sie erwähnten nicht, dass dies auch auf die schlechte Beschaffenheit der Straße zurückzuführen war, aber es blieben Schlaglöcher und Mängel an Stellen, an denen nicht nur Ochsenkarren, sondern auch leicht beladene Lastwagen vorbeifuhren.
Die Provinz war alarmiert. Angesichts der Gefahr, dass die noch nicht bezahlte Straße innerhalb von fünfzehn Tagen in ihren ursprünglichen Zustand zurückfallen würde, bevor der große Würdenträger die Stadt auch nur einmal beehrt hatte, trat man sofort zusammen und beschloss, die Durchfahrt von nicht bereiften Transportfahrzeugen auf der Asphaltstraße zu verbieten.
Niemand im Dorf wollte diese Nachricht glauben, aber als einige Dorfbewohner von den Gendarmen angehalten und gezwungen wurden, ihre Ochsenkarren von der Straße zu entfernen und durch die schlammigen Felder zurückzukehren, wurde allen klar, dass es ernst war. Dieses Verbot war äußerst streng. Da die Straße durch eine Meerenge zwischen zwei Bergen führte, mussten diejenigen, die zum Bahnhof wollten, nun um diesen Berg herumfahren und sechs Stunden verschwenden. Man versammelte sich, um eine Lösung zu finden, doch es war zunächst weder möglich, sich den Gendarmen entgegenzustellen, noch an den Ochsenkarren Gummireifen anzubringen. Sie würden einen Weg nehmen, der sechs Stunden länger dauern und um ein Vielfaches miserabler sein würde als der alte – den weg um den Berg herum … Keiner sprach noch mit mir; alle sahen mich mit feindlichen Augen an.
Eines Abends kam der Dorfvorsteher und sagte:
„Mein Sohn, wir waren zwar nicht unzufrieden mit dir, aber diese Straßenangelegenheit hat alles verändert. Die Dorfbewohner wissen, dass du der Grund für unsere Probleme bist, sie haben keine andere Meinung dazu. Mehrfach wollten sie dich zu verprügeln – ja, sogar noch weiter zu gehen –, aber ich konnte sie grade noch davon abhalten. Deine Feinde werden in anderen Dörfern immer zahlreicher. Eines Tages wird dir etwas zustoßen. Es ist besser, wenn du in Würde von hier gehst. Sei nicht traurig oder enttäuscht, lass es dir gut gehen!“
Daran habe ich auch gedacht.Angesichts der feindlichen Haltung der Dorfbewohner mir gegenüber konnte nichts Gutes mehr passieren. Ich packte einige meiner Habseligkeiten in meine Tasche, füllte den Rest in einen Beutel, und wie ich in dieses Dorf gekommen war, verließ ich es eines Abends.
So wie ich in dieses Dorf gekommen war, ließ ich den beißenden Geruch von Dung und Rauch hinter mir, während die Sonne die gelben Gräser erreichte und der Wind sie wie ein rotes Meer kräuselte.
Sängerin Melek
Neben der Tür, die zum Kaffeehaus führte, lag ein kleiner Teppich auf der Oberseite und ein alter Vorleger auf der Unterseite, der wie ein Podest aussah. Das Instrumentalensemble, bestehend aus drei Personen, saß mit unverkennbarem Ernst auf den heimischen Korbstühlen. Wenn einer von ihnen absteigen wollte, musste er von einer etwa einen Meter entfernten Stelle springen. In solchen Momenten rief Sängerin Melek den kleinen Kellner Hamdi zu Hilfe, stützte sich mit einer Hand auf seine Schulter und hielt mit der anderen seinen Rock fest, während sie ihre dünnen Beine nach unten streckte. Diese Momente waren wichtige Gelegenheiten für die ungehobelte Kundschaft, die in diesem Viertel saßen. Schwache, aber begierige Augen drehten sich sofort in diese Richtung, und der Schnurrbart wurde mit der Unterlippe abgeleckt, als ob man etwas Süßes gegessen hätte.
Die Fenster des Cafés waren durch Zigarettenrauch und Atemnebel so beschlagen, dass man nur das Geräusch des Regens hörte, der draußen fiel, und die Tropfen, die durch die Fenster fielen, konnte man von innen nicht sehen.
Die beiden Kellner, die in der Mitte herumliefen, konnten sich kaum einen Weg durch den überfüllten Saal bahnen. Ein schwerer Geruch, der von den schlammigen Schuhen herrührte, machte die Gäste, von denen mehr als die Hälfte betrunken war, schwindlig, und von Zeit zu Zeit kam ein so lauter Lärm von der Tür, die häufig geöffnet und geschlossen wurde, dass er die Laute übertönte.
Die Neuankömmlinge, sorgten überall, wo sie vorbeikamen, für Aufregung, weil sie die Mäntel, die hinter den Stühlen hingen, beim Umherirren auf dem Boden warfen und nachdem sie ein Platz gefunden hatten, nahmen sie ihre nassen Mützen ab, um sich am Kopf zu kratzen.
Die Geige, die Laute und Melek erhoben von Zeit zu Zeit ihre Stimmen, als wollten sie einen Vorstoß wagen. Dann entbrannte für einige Minuten ein regelrechter Kampf zwischen dem Lärm und der Musik. Manchmal gewann der Lärm die Oberhand, und das Instrument setzte sein Summen in beschämter Haltung fort; manchmal jedoch, wenn es den Anschein hatte, als würde das Publikum im Laufe dieses mit vollem Einsatz geführten Kampfes – beinahe wie ein Überlebenskampf – ein wenig verstummen, erhob das Instrument seine Stimme mit Freude. In solchen Momenten erfüllte Meleks feine, leicht heisere, aber eindringliche Stimme den Saal, und in den auf sie gerichteten Blicken zeigte sich ein Anflug von Interesse.
Die Tür mit dem Glasfenster öffnete sich langsam und Hüseyin Avni, der Anwalt, trat ein. Er schlug den Kragen seines schwarzen Mantels hoch und schob seinen gleichfarbigen Hut vor sich her. Nur ein kleiner Teil seines Gesichts und sein bärtiges Kinn waren zu sehen, denn seine kränklichen Augen wurden von der Brille mit Dampfrauch verdeckt. Er trug einen baufälligen Regenschirm, aus dessen Spitze Regenwasser tropfte.
Mit zaghaften Schritten, wobei er sich an den Rückenlehnen der Stühle festhielt, um nicht umzufallen, bewegte er sich vorwärts und kam zu einem Platz in der Nähe des Schilfs. Es waren keine leeren Stühle zu sehen. Er suchte mit seinen Augen. Die Beamten und alleinstehenden Lehrer, die sich in diesem Viertel niedergelassen hatten, hatten die Köpfe gesenkt oder waren in ihre Gespräche vertieft, um seinem Blick nicht zu begegnen und ihn nicht an ihren Tisch einladen zu müssen.
Drei Metzger, die um einen Tisch saßen und ihre Haschischzigaretten in ihren Handflächen versteckten, luden Hüseyin Avni an ihren Tisch ein. Sie wollten sich sowohl über den alten Betrunkenen lustig machen als auch der Sängerin zeigen, dass ein vornehmer Herr an ihrem Tisch saß, um damit Ansehen zu gewinnen.
Hüseyin Avni wischte mit dem Ärmel seiner Jacke den Nebel von seiner schwarzen Brille und schlug den Kragen seines Mantels herunter. Er nahm seinen Hut ab. Sein weißes Haar, das sehr dünn geworden war, klebte an der rissigen und fleckigen Haut seines Kopfes. Nachdem er es sich in dem hiesigen Korbstuhl mit niedriger Rückenlehne bequem gemacht hatte, drehte er den Kopf in Richtung des Instruments und lächelte. Dabei traten seine langen, spärlichen Zähne zusammen mit dem Mattrosa Zahnfleisch hervor, und aus seinen Lippenwinkeln tropfte Speichel.
Der dunkelhaarige junge Mann mit dem langen Kopf, der Geige spielte, erwiderte mit einer Verbeugung den Gruß des Anwalts. Melek machte mit dem Kopf eine kaum wahrnehmbare Geste. Der alte Künstler jedoch, der sich über die Laute in seinem Schoß beugte und aus voller Kehle sang, nahm von der Welt keine Notiz und fuhr mit seinem Lied fort.
Melek dachte: „Oh Gott, werde ich diesen Kerl nie los?“ Noch nie in ihrem Leben war ihr ein Mann so zuwider gewesen. Seit fünf Jahren verdiente sie ihren Lebensunterhalt mit ihrer Stimme, und wenn es darauf ankam, musste sie ihren Körper einsetzen, um dieser Stimme zu helfen. In diesem Beruf war es zwar nicht üblich, sich seine Kunden auszusuchen, aber es gab doch gewisse Grenzen. Hüseyin Avnis Gesicht spielte bei ihrer Abneigung ohnehin keine große Rolle. Was Melek wirklich erschreckte, waren seine aufdringlichen Bewegungen und sein Blick, der hinter seiner schwarzen Brille wie ein schmutziges Lumpen hin und her huschte.
Die junge Frau, die selbst den von anderen Liebhabern bestellten Tee nicht verschmähte und diesen großzügigen Lebemann mit einem Lächeln bezahlte, konnte die paar goldenen Armbänder, die Hüseyin Avni ihr nach wer weiß welch dramatischen Szenen in seinem Haus geschenkt hatte, einfach nicht anlegen.
Laut dem Kaffeehausbesitzer war dieser Mann früher Mitglied des Zivilgerichts gewesen, sei aber wegen seiner Trunksucht entlassen worden. Er erhalte eine sehr geringe Pension und versorge seine Frau und drei Kinder durch das Schreiben von Eingaben als Rechtsbeistand. Da er kein Jurastudium abgeschlossen hatte, sondern aus dem Beruf des Protokollführers hervorgegangen war und keinerlei Interesse an seiner Arbeit zeigte, kamen in seine Kanzlei kaum mehr als ein paar Bauern am Tag.
Kaffeehausbesitzer:
„Der Mann hat keinen Groschen in der Tasche, warum schenkt ihr ihm Aufmerksamkeit?“, sagte er. "Er schreibt täglich zwei Bitten für zwei Dorfbewohner und bekommt dafür sehr wenig Geld, das er bei Mahir, dem Gastwirt, in Raki umwandelt, während seine Frau und Kinder zu Hause hungern. Er schämt sich nicht für sein Alter, kümmert sich nicht um seinen weißen Bart und greift die sechzigjährigen Bäuerinnen an, die in sein Büro kommen. Es vergeht kein Tag, an dem er nicht Schläge bekommt. Hast du jemals gesehen, dass einer der Herren, die in unser Café kommen, ihm auch nur ein Blick geschenkt hat? Er ist ein Stück Dreck!"
Melek war nun seit zwei Monaten in dieser Kleinstadt, und Hüseyin Avni hatte seither keine einzige Nacht versäumt, ins Kaffeehaus zu kommen. Jeden Abend trank er, sei es im Büro oder im Restaurant, eine gewisse Menge Rakı und machte sich – oft schon nach dem zweiten Glas mit unsicheren Schritten – auf den Weg zur Kaffeehausbühne. Die leicht brüchige, aber leidenschaftliche Stimme dieser jungen, schmächtigen, dunkelhäutigen Frau trieb ihn beinahe in den Wahnsinn.
Doch es hätte nicht einmal dieses Grundes bedurft, damit er sich hartnäckig an eine Frau klammerte. Von allen Frauen – von der schönsten bis zur hässlichsten, von der jüngsten bis zur ältesten – ging ein gewisser Reiz aus. Diese Düfte, mal zart, mal so aufdringlich, dass sie Kopfschmerzen bereiteten, hatten trotz ihrer Verschiedenartigkeit eine gemeinsame Note. Sie breiteten sich in seinem zerfallenen Körper wie ein schmerzhafter Schock aus und beraubten den armen Mann sowohl des Schlafs als auch der Fähigkeit zu denken.
Mit tausend und einem Trick, den sein verdorbener Verstand auf geradezu verblüffende Weise ersann, belog er seine Frau, schnappte sich einige wertvolle Gegenstände, die in einer Truhe oder tief unten in einem Bündel zurückgeblieben waren, und ging damit ins Kaffeehaus. Dort ließ er einige Lieder spielen, die er sich wünschte, und schickte die mitgebrachten Sachen anschließend mit dem Lehrling Hamdi zu Melek.
Den Geiger hatte er mehrmals in seine Kanzlei eingeladen und ihm trockene Oliven und Rakı angeboten. Er hoffte, dass dieser junge Zigeuner, der stolz war, an einem Tisch mit einem "Efendi" zu sitzen, Melek zu seinen Gunsten beeinflussen könnte.
Doch nun war seine Geduld erschöpft: Abgesehen von halbherzigen Begrüßungen und den Worten „Wie geht es Ihnen, mein Herr?“, die der jungen Frau in Zeiten der Bedrängnis über die Lippen kamen.
Dabei waren die Anfälle von Begierde, die in unregelmäßigen Abständen durch seinen alten Körper peitschten, mittlerweile unerträglich geworden.