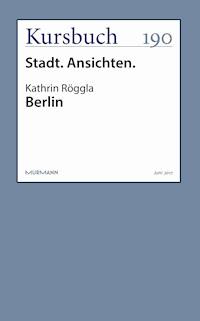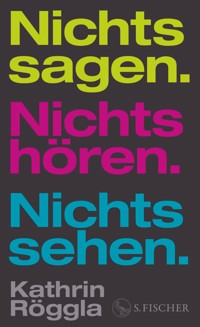
22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Eine hellwache Beobachterin unserer Gegenwart.« Jury des Else-Lasker-Schüler-Preises 2022 Beim »Reichsbürger«-Prozess in Frankfurt sitzen die Verfassungsfeinde längst überall im Publikum. An die Wände von Universitäten werden mitten in Deutschland antisemitische Parolen gesprayt. Und über den Klimawandel wird erstaunlich leise gesprochen. Alles ist hyperpolitisch, auch die Kunst. Aber hören wir überhaupt noch zu? Sehen wir die entscheidenden Dinge? Können wir noch miteinander sprechen? Wie immer in ihren Büchern streift Kathrin Röggla als engagierte Zeitgenossin durch unsere Gegenwart. Sie schaut hin, hört zu, befragt die Wörter und riskiert ihre Sätze, um zu neuen Erzählformen zu finden. Denn was in der sogenannten Polykrise auch in Frage steht, sind die Spielräume der Literatur.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 305
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Kathrin Röggla
Nichts sagen. Nichts hören. Nichts sehen.
Essays
Über dieses Buch
»Eine hellwache Beobachterin unserer Gegenwart.« Jury des Else-Lasker-Schüler-Preises 2022
Beim »Reichsbürger«-Prozess in Frankfurt sitzen die Verfassungsfeinde längst überall im Publikum. An die Wände von Universitäten werden mitten in Deutschland antisemitische Parolen gesprayt. Und über den Klimawandel wird erstaunlich leise gesprochen. Alles ist hyperpolitisch, auch die Kunst. Aber hören wir überhaupt noch zu? Sehen wir die entscheidenden Dinge? Können wir noch miteinander sprechen? Wie immer in ihren Büchern streift Kathrin Röggla als engagierte Zeitgenossin durch unsere Gegenwart. Sie schaut hin, hört zu, befragt die Wörter und riskiert ihre Sätze, um zu neuen Erzählformen zu finden. Denn was in der sogenannten Polykrise auch in Frage steht, sind die Spielräume der Literatur.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Kathrin Röggla, geboren in Salzburg, arbeitet als Prosa- und Theaterautorin und entwickelt Radiostücke. Für ihre literarischen Arbeiten wurde sie mit zahlreichen Literaturpreisen ausgezeichnet, u.a. mit dem Preis der SWR-Bestenliste (2004), dem Arthur-Schnitzler-Preis (2012) und dem Wortmeldungen-Literaturpreis (2020). Zuletzt erschienen von ihr »Nachtsendung. Unheimliche Geschichten« (2016) und der Roman »Laufendes Verfahren«, für den sie den Heinrich-Böll-Preis für Literatur (2023) erhalten hat. Kathrin Röggla ist seit 2020 Professorin für Literarisches Schreiben an der Kunsthochschule für Medien in Köln.
Inhalt
[Motto]
Die drei Affen stellen sich vor
Lucha Libre
Ganz Ohr
Mitschrift und Vorhalt
Vorauseilende Ohren, vermietete und vermiedene
Die drei Affen sind manchmal Tiere
Das Schneckentempo
Hanau besuchen
Der schreckliche Kopiervorgang
Überraschung!
Im Aussetzer wohnen
Die drei Affen bleiben nicht mehr auf Linie
Eine Sonnenfinsternis herstellen
Listening all Night to the Rain
Land unter (den Fokus verlieren)
Im Auserzählten
In die Irre gehen
Blinder Fleck
Die drei Affen tauchen überall auf und werden fadenscheinig
Nebelkerzen
Der Schwarzweißböll ist nicht mehr zu machen
Hundert Jahre Radio, 2 Minuten später
Über Unsagbarkeiten, Sprechverbote und grassierendes Schweigen
Wiedergefundene und verlorene Lautstärke
Steckengebliebenes Gelächter
Theater der Zukunft
Handlung
Handlung
Die drei Affen bewegen sich endlich
Editorische Notiz
»Ich habe mich daran gewöhnt dasz die meisten Menschen
mich
nicht zu Ende hören wollen.«
Friederike Mayröcker
Die drei Affen stellen sich vor
Nichts hören, nichts sehen, nichts sagen. Ich glaube, diese Reihenfolge war es. Die drei saßen zusammen, angeblich gab es einen vierten, einen, der nicht handelt, der war aber nicht zu sehen, nicht in meiner Erinnerung und auch nicht in den zahlreichen Abbildungen, die ich mir angesehen habe. Auf dem Regal meiner Großmutter waren sie streng nebeneinander platziert, eine figürliche Gruppe. Oder gab es da nur den einen Affen, der sich den Mund zuhielt? Nein, in meiner Erinnerung sitzen immer die drei in einem Verbund. Sie stellen einen Zusammenhang dar, in dem einer nichts sieht, der zweite nichts hört und der dritte nichts sagt. Oder andersrum. Gibt es eine Abfolge? Von links nach rechts, wie wir lesen, oder von rechts nach links, wie in anderen Schriftsprachen gelesen wird. Ist es: zuerst nichts zu hören, dann nichts zu sehen und schlussendlich nichts zu sagen? Oder ist es: Zuerst nichts zu sagen, dann nichts zu hören und letztendlich nichts mehr zu sehen, wie ich von links nach rechts lesend entdecke? Die Dramaturgie spielt jedenfalls eine große Rolle. Aber egal, wie rum ich es lese, immer verharrt das Nichthören in der Mitte, und das Handeln fällt stets aus dem Bild heraus.
Das mit dem Hören interessiert mich seit Jahren. Über das Hören nachzudenken ist uns nicht so vertraut wie die Reflexion über das Sehen. Wir wissen darüber schlicht weniger als über das Sehen, gemessen an der Literatur, die es über Blick, Perspektive, Überwachung und Sehsinn gibt. Dabei fällt uns gerade das Hören schwer, wobei »uns« zu sagen in dieser Fragestellung etwas waghalsig ist. Klar ist, wir leben in einer Zeit der kommunikativen Verwirrung und der gesellschaftlichen Wahrnehmungsstörung, bedingt auch durch Digitalisierung und KI, die wiederum Trollfabriken, hysterisch sich überschlagende Diskurse, gefakte Kommunikation ermöglichen – wir haben ein Problem mit dem Zuhören im übertragenen Sinn. Vielleicht erwächst auch daraus die Orientierungslosigkeit, die wir einem größeren historischen Zusammenhang zurechnen. Das globale Erstarken autoritärer Systeme inmitten der vielen Krisen, ökologischen, ökonomischen, weltpolitischen, die immer weniger beherrschbar wirken, die Retrotopien, die plötzlich massiv auftauchen, Sehnsüchte nach einer Zeit, die es niemals gab, wie der Soziologe Zygmunt Bauman sie beschrieben hat – die Flucht in eine fiktive Vergangenheit anstelle der Zuwendung an eine Zukunft als Möglichkeitsraum. Wie soll man da noch zuhören können?
Die Reparatur der Sinne als eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu verstehen, der wir uns stellen müssen, haben so unterschiedliche Menschen wie Joseph Beuys, Friederike Mayröcker oder Alexander Kluge unternommen, und dass die Künste, ja auch die Literatur, wesentlich daran beteiligt sind, versteht sich wie die Tatsache, dass das Konzept der Heilung auch ihre Schattenseite hat. Dies Reparatur-Unternehmen ist in den letzten zwanzig Jahren nach zahlreichen medialen und gesellschaftlichen Umbrüchen allerdings unendlich schwieriger geworden.
Angeblich drücken die drei Affen einen Gedanken von Konfuzius aus: Nichts Böses hören, nichts Böses sehen, nichts Böses sagen. Sie halten sich ja aktiv durch Handgesten von diesen sinnlichen Eindrücken fern. Warum sind sie aber in einer Linie nach vorne ausgerichtet? Kommt das Böse von vorne, von unserer Seite? Und warum sprechen die drei Affen nicht miteinander? Sie könnten sich vom Geschehen ja abwenden und miteinander beraten. Sie könnten sich zumindest ansehen, sich vergewissern, wie es den anderen damit geht. Warum wollen sie nicht gemeinsam hören, was los ist? Hier sind die Hände wirklich von Nöten, denn Hören kann man im Gegenteil zu anderen Wahrnehmungsformen nicht ohne Hilfsmittel unterdrücken. Man kann es einfach nicht ausschalten, wie alle die wissen, die an verkehrsreichen Straßen oder über einem Nachtlokal wohnen.
Während ich das schreibe, erreichen mich zahlreiche Werbemails für Hörgeräte, die anzeigen, dass es mittlerweile mehr als nur soziale und psychologische Widerstände sind, die uns am Hören hindern, sondern auch handfest physiologische. Die Schwerhörigkeit, bisher ein Problem der Älteren, muss sich in jüngere Altersgruppen ausgebreitet haben. Vielleicht liegt es an der Tatsache, dass unsere Ohren technisch überlastet sind, dass wir in einem Lärmkrieg stecken, und der kommt bekanntermaßen nicht von einer Seite, sondern nicht selten von allen. Aber jemandem nicht zuhören zu können oder zu wollen, das ist stets gerichtet. Und genau davon berichtet dieser eine Affe, dem ich zunächst in Mexiko begegnen werde, doch einzeln, in einer Vitrine für Touristen, die nicht einmal wissen, dass man alle drei auf einmal nehmen muss.
Ja, ich möchte mit dem Hören anfangen, dem Zuhören, von dem wir gesellschaftlich so wenig wissen, nicht einmal, ob man es eigentlich sieht, können wir mit Sicherheit feststellen. Sie mögen jetzt denken, das mit dem Nichthören versteht sich von selbst, und dass es weniger ein Nichthören als ein Nicht-Zuhören sei. Mal sehen, ob ich mich mit ihm befreunden kann.
Lucha Libre
Wer einmal in der Arena de México gesessen hat, hat erfahren, dass es mit dem Zuhören manchmal nicht so einfach ist. Es ist dort dazu auch einfach zu laut. Selbst an einem Dienstagabend ist die Arena in der mexikanischen Hauptstadt mit knapp 10000 Menschen gut besetzt, ganze Familien kommen dort hin, Menschen aus der Stadt, Geschäftsleute, Freunde und natürlich Touristinnen wie wir. Ähnlich wie bei anderen Sportereignissen geht man dort immer in Gruppen oder zu zweit hin, niemals alleine. Die Akustik ist hallig, sämtliche Geräusche hochgetuned. Es ist der Sound der Präsentation von Stars, des spektakulären Auftritts, in dem das einzelne Wort zur Klanggeste verkommt. Die einzelnen Kämpferinnen und Kämpfer, bereits durch riesige Banner angekündigt, schreiten die glitzernde Treppe herunter, steigen in den Ring und zeigen mit ausladenden Gesten, welche Rolle sie einnehmen wollen. Auftrumpfend, mit übersteigertem Selbstbewusstsein springen sie auch gerne auf die elastische Absperrung in Richtung Publikum und reißen die Arme hoch. Dieser Vorgang wiederholt sich sehr oft, denn es treten in den zwei bis drei Stunden der Kämpfe ungefähr sechs Teams auf, meist mit sechs Kämpfenden, die alle maskiert sind, ihre Rollen haben, wie sich dies in ihren teilweise mythischen Namen wie Bárbario Cavernario, Zeuxis, Mistico, Volador Jr., Blue Puma ausdrückt. Sie sind Stars oder Neuzugänge, und mit ihnen treten noch kleinwüchsige Maskottchen auf, die zwischen Tier und Comicfigur changieren und auch mal zuschlagen dürfen. Nein, es muss nicht verstanden werden, was gesprochen wird, es zählt das Wort nicht viel in diesem Kampf zwischen Gut und Böse, als den man die einzelnen Kämpfe immer wieder lesen kann. Dies antagonistische Prinzip wird sich durch den ganzen Abend ziehen, allerdings nicht als statisches Prinzip, sondern dynamisch. Im Ring steht bereits der Schiedsrichter, dessen Aufgabe es ist, die Kämpfer anzukündigen, während Showgirls den Weg weisen und Schilder hochhalten. Er wird ziemlich schnell zu der Figur werden, die mich am meisten fasziniert und beschäftigt. Wie spielt er sein Entsetzen? Wie schafft er es, seine Rolle souverän zu behaupten, auch wenn sie in Wirklichkeit überhaupt kein Gewicht hat und eigentlich eher lächerlich gemacht wird. Denn im Grunde bestehen die Kämpfe aus lauter Regelübertretungen, mehr noch, es geht um die Regelübertretung, auf die sowohl Publikum als auch Schiedsrichter mit gespieltem Entsetzen reagieren. Daumen runter! Pfiffe, Rufe, Schreien. Der Schiedsrichter, oder bei den Frauenkämpfen die Schiedsrichterin, kniet sich nicht selten dann direkt neben das Prügelgeschehen und ruft hinein, aber es ist klar, dass er oder sie sich nicht durchsetzen wird. Niemals greift er oder sie wirklich ein. Zumindest nicht an meinem Abend, der trotz abgekartetem Spiel oder gerade aufgrund seiner Gespieltheit erstaunlich spannend blieb. Wrestling ist auch ein äußerst theatrales Ereignis, alle wissen, dass die Kämpfenden sich nicht wirklich derartig schlagen (in die Geschlechtsteile treten, auf den Brustkorb springen, ins Gesicht schlagen etc., wie man annehmen könnte), und auch wenn Formen des authentischen Sichverprügelns wie im Ultrawrestling bereits existieren, ist diese Theatralität Reiz und Erleichterung für Zuschauende zugleich. Das Schauspiel besteht zu einem nicht unwesentlichen Teil in dem sich auflösenden Regelwerk und in der Aufkündigung von Fairness (man schlägt noch zu, wenn jemand bereits am Boden liegt), und die tragische Figur in ihm ist tatsächlich der Mensch, der zuständig ist für die Regeln, eine Richterfigur auf verlorenem Posten. Denn sein Kampf ist stets schon verloren, er ist von einer übergeordneten Macht – griechische Götter? – bereits verdammt zu dieser Sisyphusarbeit, und seine Anwesenheit erinnert nur daran, dass es einmal eine Zeit gab, in der Regeln Regeln waren, aber dieser Zustand ist längst vorbei, jetzt leben wir in einer Epoche des verdammten Krieges. Man kann sich natürlich fragen, warum diese Kämpfe nicht nur in Mexiko so eine derartige Beliebtheit haben, man könnte sie ja auch als nur entsetzlich beschreiben. Aber vielleicht kondensiert sich in ihnen eine kollektive Erfahrung der Auflösung oder Bedrohung eines Spiels, das wir als Demokratie beschreiben und in dem »Legitimation durch Verfahren«[1] angesagt ist. Recht verliert hier gegen das Prinzip der puren Willkür, der Machtgeste, man könnte es auch übersetzen in: Rechtsstaatlichkeit gegen Autokratie.
Es hat mich insofern kaum erstaunt, dass im amerikanischen Wahlkampf die demokratische Kandidatin von Popstars wie Taylor Swift oder Talkshowhosts wie Oprah Winfrey unterstützt wird, der republikanische Kandidat hingegen von Wrestlern, so etwa dem legendären »Undertaker«, in dessen Podcast Donald Trump auch tatsächlich aufgetreten ist.[2] Letzteres entspricht einfach seinem Prinzip der Polarisierung, der Inszenierung von Gut und Böse, mit dauernd changierenden Positionen, dem Spektakel der Überlegenheit und Unterlegenheit, dem Entertaining als politischem Prinzip. Das Wort bzw. die Sprache ist ihm unterworfen, niemals dient es dem Gespräch, der Aushandlung oder Kommunikation. Insofern muss man auch nicht so genau verstehen, was gesagt wird. Es entgeht einem nichts. Während im Gericht jedes Wort auf die Waagschale gelegt wird, ist hier Inszenierung, Lautstärke, Überraschung bzw. überraschende Volte alles. Oder Camouflage. Wir haben das in den letzten Monaten erlebt. Wertesysteme können einfach behauptet werden, ein hasserfüllter Auftritt zum »Fest der Liebe« umerklärt. Die Worte müssen nicht mehr so genau treffen und dienen alleine der Überspitzung und Emotionalisierung, es geht um die Nennung von Gegnern und Feinden, nicht um die praktischen politischen Fragen. So erklärte Kamala Harris auf ihrer Abschlusskundgebung treffend, dass ihr Gegner mit einer Feindesliste in das Weiße Haus einziehen würde, sie allerdings mit einer To-Do-Liste. Ich beginne diesen Text im Moment der Wahl, nicht ahnend, was sich in zwei Monaten vollziehen wird. Im damaligen Moment der Hoffnung, dass nicht der Lärm gewinnt.
Es heißt, man kann etwas nicht hören, weil es zu leise ist, aber genau das Gegenteil lässt sich auch behaupten. Ist etwas zu laut, verlieren sich die Semantiken. Worte werden ununterscheidbar, wer schreit, hat auch aus diesem Grund bereits unrecht, hieß es früher, heute bin ich mir da nicht mehr so sicher. Man könnte die Menschheitsgeschichte als eine Geschichte des Lärms beschreiben, wie es auch schon geschehen ist.[3] Der populistische Lärm klingt anders als eine heftige demokratische Geräuschkulisse. Die Bezeichnung Lärm ist, das muss ich zugeben, immer abwertend gemeint. Und eine Aufwertung dieser Vokabel ist selbst in diesen Tagen nicht zu erwarten, wenn sich auch seine Realität Macht verschafft hat. »Hier ist es so laut, wunderbar«, würde kaum jemand sagen. Und dennoch wird er gesucht. Es wird Lärm und vor allem Rauschen produziert, um uns abzulenken. Auch, um das einzelne Wort abzuwerten. Sprache gilt nichts mehr, sie ist nichts als Budenzauber, könnte man meinen. Was ich heute sage, gilt morgen nicht mehr. Es wird Lärm erzeugt, um in seinem Hintergrundrauschen einiges zu versenken. Sein Gegenprinzip liegt in der Rechtsprechung. Hier wird das Wort auf die Waagschale gelegt, aber es kann natürlich auch hier missbraucht werden, unter dem Schein der genauen Wortbetrachtung.
Derzeit bin ich in meiner Heimat Österreich mit einer radikalen Entwicklung konfrontiert, die sich in Wellenbewegungen über die letzten 25 Jahre bereits vollzieht. Sie als rechtsradikale Wende zu bezeichnen wäre insofern verkehrt. Ein Regierungsauftrag wird zwar der zahlenstärksten Partei, der FPÖ, nicht erteilt – niemand will mit ihnen zusammenarbeiten –, aber es mutet schon irrwitzig an, dass dies die Partei mit den meisten Wählerstimmen betrifft, was nicht heißt, dass sie eine Mehrheit vertritt. Es entsteht auch hier ein verstecktes antagonistisches Prinzip. Die demokratischen Parteien fungieren darin als eine Seite, die rechtsextreme Partei als die andere, politisch betrachtet ein falscher Antagonismus. Auf Sportarten übersetzt hieße das, es gibt nicht mehr die verschiedenen Vereine, die gegeneinander antreten, sondern aus allen Vereinen treten die gemeinsam an, die sich noch an die Regeln halten, gegen die, die darauf pfeifen. Kommt so noch ein Spiel zustande?
Klar ist, jemanden als rechtsextrem zu bezeichnen, ist leergelaufen. »Man nennt uns Nazis«, sagen die Nazis, und man glaubt, die Sache hat sich erledigt. Aber sie hat sich nicht erledigt. Die Nennung reicht nicht mehr. Das Wort genügt nicht mehr. Es ist auch hier das Auftrumpfende, Polarisierende, Entertainende, das erfolgreich ist. Wenn wir nach Deutschland blicken, fragen wir uns, was wird sich in diesem Jahr ereignen. Im Prinzip stellt sich diese Frage in allen mitteleuropäischen Ländern: Wie können demokratische Parteien noch Politik machen, wenn sie zu einer Front gegen den rechtsextremen Feind der Demokratie zusammengeschlossen werden? Werden sie nicht dazu verdammt, sich gegenseitig zu nivellieren? Wird daraus nicht wirklich eine technokratische Verwaltung der Politik, die gegen ein rechtsautoritäres Agieren steht, ein Zustand, aus dem sich eine unheilvolle Wellenbewegung ergibt, die der Soziologe Pierre Bourdieu schon in den 90er Jahren beschrieben hat, und auch, wenn derzeit es so aussieht, dass aus der letzten Welle der Sieger Autokratie heißt, ist der wirkliche Sieger immer trotz allem nationalstaatlichen Protektionismus der neoliberale Kurs, gegen den keine Seite etwas einzuwenden hat.
Oft wird mir gesagt, dass Rechtsextreme so viel Power hätten, so geschult wären und so schlagkräftig seien, aus ihrer Oppositionshaltung heraus. Nie wird beschrieben, warum vielleicht die ebenso geschulten demokratischen Positionen nicht mehr die gleiche Kraft dagegen haben. Sie sind die bereits Erschöpften. Ihre Stimme können sie nicht immer erheben, weil sie es manchmal nicht schaffen, gerade in der demokratischen Zivilgesellschaft, der ich mich zurechne und schon einige Ehrenämter innehatte. Burnout der Demokratie? Der Lärm war zu groß. Der Lärm der Prekarisierung und Kurzfristverträge, der Überlastung durch zahlreiche Ämter und Anfragen, der Lärm der Bürokratie, der allzu langsamen Aushandlungen und der vielen Gleichzeitigkeiten. Das ist kein Lärm, sagen Sie? Es gibt Momente, da nimmt man das so wahr. Zudem vollzieht sich andauernd ein identitätspolitisches Gewitter um uns. Wer etwas äußern darf und wer nicht, wird auf der einen Seite penibel abgefragt, die andere schert sich um gar nichts mehr. Es dürfen sich nur starke Männer äußern, oder sie müssen sich gar nicht äußern, weil allein ihr Wille zählt. Beides sind sehr unterschiedliche Zustände, nicht auf ein Einerseits-Andererseits zu bringen, wie es im Lärmgebiet gerne geschieht. Symmetrien zwischen Positionen herzustellen, die kategorial was völlig anderes sind. Auch das ist Lärm, weil es Unsinn ist. Die Arena mit ihren konstruierten antagonistischen Positionen zieht sich durch alle Bereiche. Gut gegen Böse, linksextrem vs. rechtsextrem, Klimawandel oder kein Klimawandel, und diese fake Antagonismen oder Alternativen sind so was wie Lärm. Sie werden gebraucht, um das Spektakel durchzuführen.
Hintergrundrauschen ist in diesen Zeiten beliebt, weil sich in ihm Dinge unterbringen lassen, an die man nicht gerne denkt. Die Kriegssituationen, die näher rücken, die Toten im Mittelmeer, die Deadstreams und kalten Tropfen des Klimawandels. Und wieder die Situation in Gaza, die vergessenen Geiseln, wieder die Toten des Mittelmeers, wieder die ökologisch bedingten Katastrophen in Spanien. Das, was bedrohlich näher rückt. Dieses Hintergrundrauschen ist insofern funktional. Viele haben zu viel um die Ohren, da benötigen wir ein ordentliches Rauschen, das sie nach innen klappen lässt.
In Mexiko saß ich, bewaffnet mit einem riesigen Plastikbecher Bier mit süßem Chilipastenrand, noch etwas gefasster und blickte über das große Familien- und Pärchenfest, das sich hier auch vollzog und durchaus in die Show miteinbezogen wurde. Ich versuchte gerade, die merkwürdige Rolle des Maskottchens einzuordnen, das so gar nicht dem chauvinistischen Körperbild entspricht, eine Gegenfigur, nicht wirklich ein Kind, eher ein Zwischenwesen, das den Kontrast zu der Männlichkeit herstellen soll und diese aufwerten, da fällt mir auf, wie laut wir selber sind. Am lautesten sind vermutlich die Schreie, die aus der massiven Menge kommen. Wir sind vielleicht nicht wirklich lauter als die Performance, aber sie muss sich auch gegen uns behaupten, es ist ein Ringen darum, wer akustisch das Sagen hat.
Tagsüber habe ich in einer Begegnung mit Studierenden und Künstler:innen gerade einiges erfahren über die Probleme der Hauptstadtregion, massive Umwelt- und Immobilienprobleme, der Region fehlt Wasser und saubere Luft, die letzten Naturrefugien verschwinden, werden vermarktet, angesichts von Drogenmafia und Korruption breitet sich ein Gefühl großer Machtlosigkeit aus, gleichzeitig gibt es zahlreiche Initiativen, die versuchen, etwas zu verbessern oder auch nur der Hunderttausenden Verschwundenen zu gedenken, mit denen man es in diesem Land zu tun hat.
In der mexikanischen Hauptstadt sind auch spontane Demonstrationen erlaubt. Das Demonstrationsrecht wird rechtlich höher gewertet als das Recht auf freie Bewegung. Insofern ist es angesichts der zahlreichen Manifestationen schwierig, von Punkt A nach Punkt B zu kommen, bewegt man sich mit dem Auto durch die Stadt, was so ungefähr die einzige Möglichkeit ist, auch wenn vereinzelte todesmutige Radfahrende immer wieder auftauchen. Man steht sich sozusagen im Auto durch die Stadt, die auch tatsächlich fast überall nach Benzin stinkt. Das Verkehrsrauschen ist das unaufhörliche Tages- und Nachtgeräusch, Teil jener Hintergrundkulisse, die alles verschluckt, was sich im Stadtraum akustisch äußern möchte. Kaum zu glauben, dass diese Verkehrsstadt auch Platz für Geister bietet. Aber in meiner Begegnung mit den Stadtbewohner:innen war auch die Geisterwelt sehr präsent – gerade begannen die Vorbereitungen der Feierlichkeiten zum Dia de los Muertos, die auch hier mit den typischen Accessoires von Halloween angereichert werden. Dass die Geister hier einfach die Wiederkehr der Toten bedeuten, dass sie sich unerkannt unter die Lebenden mischen können, als wäre nichts, hat auch der berühmte Roman von Juan Rulfo Pedro Páramo gezeigt, der mehr Volksethymologie ist, als mir vorher bewusst war. Auch die Toten sprechen nicht oder wenig, sie äußern sich im Gegensatz zu den Lebenden nie zu viel.
Am Ende meines Wrestlingerlebnisses kommt es zu einem finalen Showdown, das Böse gewinnt diesmal, das Maskottchen wird auf die Schultern eines Kämpfers gesetzt und reckt die Arme nach oben. Während ich rausgehe, gibt es tatsächlich diesen einen Moment, wo ich gar nichts mehr höre. Meine Ohren sind für einen Augenblick wie ausgeschaltet, man könnte sagen, eines der Veranstaltungsziele wurde momenthaft erreicht.
Ganz Ohr
Geht es Ihnen auch so: Sie können das nicht mehr hören. Nein, es fällt Ihnen zunehmend schwerer zuzuhören. Die Ohren bleiben einfach nicht offen, Sie schalten immer mehr ab. Zumindest mir geht es derzeit so. Da stehe ich beispielsweise mitten in einer ethnologischen Sammlung in Köln und finde eine künstlerische Installation, in die man hineingehen kann, einen white cube. Außen steht, dass sie sich dem Thema »Vorurteil und Kolonialismus« widmet. Drinnen sehe ich Schrift und Bild, aber ich nehme vor allem eine Stimme wahr. Eine junge Frauenstimme, die über das angekündigte Thema spricht, und die mich sofort in eine Falle bugsiert. Ich frage mich, wem höre ich mehr zu? Der Stimme, die betont leise und zurückhaltend etwas vorträgt, oder ihrem Vortrag, der eine Kritik neokolonialer Haltungen ist, eine Fürsprache der Unterdrückten. Eben gerade weil ich dieser Stimme und ihrem Duktus so viel zuschreiben möchte, in sie alles Mögliche hineinlegen – da sehe ich eine behütete junge, gebildete Frau vor mir –, gerade weil die Stimme mir in ihrer Materialität mehr Bildlichkeit gibt als der Inhalt, gehe ich sofort in die Vorurteilsrichtung: Sicher biodeutsch, sicher aus wohlhabendem Haus, denke ich mir. Der Inhalt des Gesagten wirkt wie auswendig vorgetragen, er ist ihr und mir wohlbekannt. Und es sind nicht wenige Auswendigkeiten, die uns gerade umgeben, gerade bei den brennendsten Themen. Unklar bleibt für mich, ob es eine persönliche Neuralgie ist oder eine sozial übergreifende. Und warum will ich eigentlich, dass man die Dinge immer neu überlegt, damit ich zuhören kann?
Ein anderes Mal passiert es in jenem verdunkelten Theaterraum, der pandemiebedingt zu einem Fernsehstudio umgebaut wurde. Auf der Bühne sehe ich neben mir dem Regisseur Milo Rau beim Zuhören zu. Ich ahne, er hört präziser und deutlicher zu, als ich das je könnte. Er ist sozusagen ganz Ohr. Er scheint auch alles zu verstehen, was gesagt wird, immer wieder nickt er zustimmend. Dann stellt er seine Fragen. Sie wirken stets relevant. Sein Gegenüber muss überlegen. Die Antwort wird vermutlich erstaunlich sein. Obwohl klar ist, dass der Regisseur seine Fragen schon sehr oft gestellt haben muss, dass ihm das überhaupt nicht neu sein kann, was da formuliert wird, wirkt es in jedem seiner Gespräche verblüffend erfrischend und anders. Man kann nun wirklich nicht sagen, er ist ein Zuhörerdarsteller. Doch gibt es so jemanden überhaupt? Denken Sie an gewisse Fernsehmoderator:innen, deren Professionalität schon etwas abgeschliffen ist. An Gegenüber in Interviews, die schon zu lange auf Sendung sind, Behördenmitarbeiter, die das Gehörte gleich wegordnen. Es gibt die Konkurrenz der Rede, aber selten eine Konkurrenz des Zuhörens. Einen Wettkampf, wer das jetzt besser macht, wer hat das schon erlebt? Und doch begegnen wir nicht selten einem ausgestellten Zuhören. Das sind die etwas überschießenden Inszenierungsgesten, das erwähnte Nicken, die Augenbrauen, die hochgezogen werden, die abwehrenden Handgesten. Es ist ein Zuhören, das mit Gesten mitreden will. Man fällt nicht ins Wort und zeigt doch einen Response. Zeigt, dass man noch da ist. Aber das ist ein Grenzgang, es könnte auch als Nichtwirklichzuhören wahrgenommen werden.
Bin ich noch da? Nein, ich werde schon von der nächsten Szene des Zuhörens unterbrochen. Das bin jetzt schon ich selbst. Sehen Sie, wie ich da vor dieser Gesprächspartnerin sitze in jener Rechtsanwaltskanzlei?[4] Eine Nebenklagevertreterin hat sich bereit erklärt, mit mir ein Gespräch über ihre Arbeit im NSU-Prozess zu führen. Dauernd will ich was sagen. Ich will dazwischenfahren. Ich weiß immer schon, wie der Satz ausgehen wird, ja ausgehen muss, den sie gerade bildet. Habe ich die Anwältin überhaupt zu Wort kommen lassen? Ich behaupte, Fragen zu stellen, aber vielleicht tue ich nur so? Klar ist, das Gefühl, nichts mehr erfahren zu können, kann sich erst im Gespräch einstellen und nicht schon davor, oder? Was ist los? Warum fallen mir in diesen letzten Begegnungen von vornherein dauernd die Ohren ab? Vielleicht liegt es ja am Stoff? Zur Tür komme ich noch herein mit vollem Schwung, setze mich, aber in dem Moment, in dem ich die Ohren aufsperren sollte, höre ich mich immer noch selbst reden. Mein Gegenüber scheint meinen Einführungsvortrag nicht weiter schlimm zu finden, es braucht ihn ja, um mein Interesse zu verstehen. Aber mich erinnert diese Szene trotzdem an jene in Alexander Kluges Chronik der Gefühle[5], in der ein Bundeskanzler seinem Referenten etwas über – ich glaube, es war die Braunkohleförderung – erzählt, von dessen aktueller Situation er eigentlich nichts wissen kann und ja auch deswegen zum Referenten gekommen ist. Kluges paradox anmutende Erklärung ist das Nichtzuhören des Kanzlers aus Zeitnot. Er hat zu wenig Zeit und beschließt, seinem Referenten lieber selbst zu erzählen, was dieser wissen muss und er selbst eigentlich nicht wissen kann – ein magischer Wissenstransfer. Habe ich Zeitnot? Diese Art der Zeitnot? Immer. Die Zeitnot der Bundeskanzler hat sich bekanntermaßen überallhin übertragen, mittlerweile selbst auf das schriftstellerische Gewerbe.
Vielleicht ist es der Stoff?, frage ich mich ein zweites Mal. Die Rechtsprechung, die Justiz ist ein Bereich, da möchte man eben nicht dauernd zuhören. Aber man muss es meist. Das dort Gesagte hat Bedeutung. Es ist der Ort des Herrschaftswissens. Verregelt. Autonom. Schwer durchschaubar. Also entsteht erst einmal Abwehr meinerseits. Zu viel gefühlte Erkläropas und Erklärtanten haben mich in den letzten Jahren unterbrochen und haben gesagt: »Das ist aber nicht so, weil in Paragraph schlagmichtot steht das und das.« – »Bei Gericht läuft das nicht so, da geht es nicht um Gerechtigkeit, sondern um Regeln.« – »Es werden doch alle enttäuscht vom Gericht. Naiv der, der etwas anderes erwartet.« Und so weiter und so fort. Warum sonst bleibe ich auch hier erst einmal stecken bei der Erläuterung des Kontexts meiner Fragen, bei der Aufbereitung des Terrains, bleibe sozusagen hängen auf meiner Platte. Als ob ich den Moment, in dem ich etwas erfahren könnte, hinauszögern wollte und mir so Zeit verschaffen. Nur wozu? Was soll in der Zeit erledigt werden? Die Ohren sind fest zugesperrt, währenddessen erzähle ich der Anwältin, mit wem ich alles schon gesprochen habe von den Leuten, die wir beide »aus dem Stoff« kennen. Bin ich etwa ein Gespenst geworden? Zum Gespenst passt, dass ich in diesem Zuhören noch schneller meine, alles bereits zu wissen. Zum Gespenst passt, dass ich gleichzeitig nicht das Gefühl habe, irgendetwas zu überblicken. Dieser Stoff hat mich bereits erschlagen. Nur wann? Schon vor langem, vor zwei oder vor fünf Jahren oder von vornherein? Dieses Gespenst, das heimsucht, muss allerdings harmlos sein, entdecke ich an den Reaktionen meiner Gegenüber, gut einzuordnen in die Reihe anderer Gespenster, und dennoch nicht so schlimm. Verschwörungstheoretiker, Irrläufer, Menschen, die plötzlich aufspringen und erzählen, dass sie das Terrortrio schon lange kennen und ihnen alles klar war, Menschen, die vom Zeugensterben zu erzählen beginnen, den Verfassungsschutz erwähnen, um bei irgendwelchen Verschwörungsmythen zu landen. Das mache ich nicht, habe ich mir zumindest vorgenommen. Keine leichte Aufgabe bei einem Prozess, der mehr Lücken offenbart als geschlossen hat.
Ja, wir reden vom »NSU-Prozess«, der nicht nur die deutsche Öffentlichkeit fünf Jahre in Atem gehalten hat, und dem man gleichzeitig so schwer folgen konnte. Zum Zuhören gehört nämlich, dass das, was da von vorne kommt, verständlich sein muss. Zuerst die Erklärung, wo man ist, dann, mit wem man es zu tun hat, und schließlich, was überhaupt passiert ist. Das Gericht hat die Anklageschrift zur Hand, um das zu klären. Sie schafft die grundlegende Ordnung, nach der ein Prozess zu erfolgen hat. Nun kann das eigentlich nicht funktionieren bei einem Geschehen dieser Größenordnung. 13 Jahre lang sind Terroristen durch Deutschland gezogen und haben zehn Menschen brutal ermordet, weitere verletzt, Bombenanschläge durchgeführt, Banken ausgeraubt, vermeintlich unbeobachtet. Das ist ein derart langer Zeitraum, der das »Wer« der Täterschaft zu einem umstrittenen Punkt macht und auch das »Was« der Taten – sind sie alle erfasst? Gibt es nicht noch zahlreiche falsch zugeordnete Verbrechen? Zudem ist die Sache schon eine ganze Weile her, also wird es mit der Wahrheitsfindung schwierig. Wie oft werden Zeugen ihre polizeilichen Aussagen von damals vorgehalten, und man nimmt ihnen ab, dass sie keine Ahnung mehr haben können?
Diese gerichtliche Aufarbeitung mündete jedenfalls in jenen Mammutprozess, bei dem ich in dessen letzten beiden Jahren immer wieder zugegen war, Gespräche mit Beteiligten geführt und sehr viel gelesen habe. Ich habe mich im Material verloren, habe einiges wieder vergessen – man kann das auch nicht alles behalten – und bin wieder nach München ins Oberlandesgericht gefahren. Schnell musste ich mich von der Annahme verabschieden, man müsse etwas vollständig verstanden haben, dann erst könne man darüber schreiben. Das Geschehen in München war auch nicht vollständig zu verstehen, eine Million Akten sind von keinem Menschen zu verstehen, zudem wurde durch das Schweigen der Zeugen, das Schweigen der Behörden und das Schweigen der Angeklagten die Wissensproduktion ad absurdum geführt. Für eine Mitschrift, dieser schöne Ausweg bei Überforderung, wie sie Rolf Dieter Brinkmann, Rainald Goetz und Wolfram Lotz gezeigt haben, wäre es ohnehin zu spät[6], entdeckte ich bald, allein die Reaktion Außenstehender war immer die Frage, warum ich nicht über einen aktuell laufenden Gerichtsprozess schreiben wolle? »Dieser ist doch längst ausdokumentiert.«
Ausdokumentiert ist einer der schönen Begriffe, die im Register des Nichtzuhörens zu finden sind. Oder aus dem Gespensterbereich. Denn diese Angelegenheit ist ja gleichzeitig ausdokumentiert und unterdokumentiert, wie ich feststellen musste, an- und abwesend gleichzeitig. Gespenster sind zudem auch immer zu spät, von vornherein. Sie haben etwas verpasst und müssen jetzt etwas nachholen. Oder etwas ist ihnen geschehen, und sie müssen mahnen, dass es zurechtgerückt wird von anderen. Gespenster geistern durch eine Zeit, die nicht die ihre ist. Ich muss zugeben, so fühlte es sich im Gerichtssaal an. Was habe ich da nicht mitgekriegt von meiner Zeit? Warum gibt es diese Zeugen, die rechtsextreme Äußerungen für normal halten oder meinen, aus der Mitte der Gesellschaft zu sprechen? Sind die meine Zeitgenoss:innen, wie sieht es mit meiner Zeitgenossenschaft überhaupt aus? Wieso habe ich wie so viele in der Zeit des NSU nichts mitbekommen und die Legende der sogenannten »Döner-Morde« akzeptiert? Gespenster sind auch nachträglich. Auch sie machen keine Erfahrung. Oder ist das etwa eine Erfahrung, die ich gemacht habe, damals im Winter 2017, als ich zum ersten Mal mit Erstaunen diese emotional hoch aufgeladenen Auseinandersetzungen um Fragen der Kopierverordnung und Verschriftlichung im Gericht vernahm? Mit heftiger Erregung wurden sie vor einem Publikum von rund 160 Leuten ausgetragen und erzeugten bei mir jene krasse Kollision von Erwartung und Zustand des Prozesses.
»An diesem Prozesstag wird sich nichts von dem zeigen, um was es eigentlich geht«, hat mich kürzlich ein oberster Richter vom OLG Frankfurt informiert, zu dessen Prozess ich mit Studierenden wollte. Zeigt das nicht jeder Tag? Sind nur spezifische Zeugenbefragungen für Nichtjurist:innen interessant? Die aufgeladenen Formalismen gehörten sehr wohl zum Zustand der NSU-Aufarbeitung. Die immer wieder erlebten affektbesetzten Auseinandersetzungen ragten wie die Spitze des Eisbergs aus einem Meer von Behördenschlamperei, Nichtzusammenarbeit, Bürokratie und Fehlstellen.
Warum überhaupt das Gericht, werden Sie sich fragen? Warum ausgerechnet »der Juristerei« zuhören? Warum diese Rechtsanwaltskanzleien, diese Untersuchungsausschüsse, gibt es nichts Schöneres, Lohnenderes für die Literatur? Dabei ist meine Hinwendung zur Rechtsprechung durchaus logisch für mein Gewerbe und unsere Zeit. Wer befindet sich in der Epoche der Symbolpolitiken und toxischen Debatten nicht auf der Suche nach Sprachmacht? Hier realisiert sich schließlich Handlung mit Sprache, sie gilt sozusagen. Im Gericht wird die Wahrheit festgestellt, d.h., sie erhält eine gewisse Gültigkeit mit echten Konsequenzen. Und ist sie einmal festgestellt, ist sie unumstößlich. D.h., wenn das Urteil revisionsfest ist. Dann gilt es auch rückwirkend. Man kann dann als Zeuge der Falschaussage bezichtigt werden, auch wenn man ehrlich ausgesagt hat, also das berichtet hat, was man wahrgenommen hat, weswegen eine meiner anwaltlichen Gesprächspartner:innen mir erläuterte, bei einem Prozess, welcher Verstöße des Demonstrationsrechts zum Gegenstand hat und sozusagen die Aussagen der Polizei gegen die der angeklagten Aktivist:innen stünden, würde sie eher davon absehen, andere Demonstrationsteilnehmer:innen als Zeugen laden zu lassen aufgrund dieser Gefahr der nachträglichen Falschaussage.
Im Gericht gibt es das Urteil, eine echte Entscheidung, die aber gleichzeitig dem Verfahren unterworfen ist, das, was Cornelia Vismann als theatrales Dispositiv des Gerichts bezeichnet und für den Soziologen Niklas Luhmann die legitimierende Grundlage der Demokratie darstellt. Und doch finden Entscheidungen auch während des Prozesses statt. Welchem Zeugen, welcher Zeugin glaubt der Richter? Das muss er begründen. Ein Argument in dieser richterlichen Entscheidung ist diesbezüglich das Lebensfremde. Wenn etwas als lebensfremd gilt, hält man es nicht für plausibel, wie bei einem der Angeklagten im NSU-Verfahren. Da sagte die richterliche Instanz plötzlich und unerwartet für alle Verfahrensbeteiligten, es sei lebensfremd anzunehmen, dass dieser mehr gewusst haben kann. Großes Aufatmen auf der einen Seite, Entsetzen auf der anderen. Im schreibenden Gewerbe wird eher positiv mit der Lebensnähe geurteilt, wenn etwas als besonders glaubwürdig und authentisch erzählt wird. »Aus dem Leben gegriffen.« Ganz so als kennten wir uns Schriftsteller:innen aus mit dem Lebensnahen, so wie richterliche Instanzen das Lebensfremde aufspüren können.
Doch zurück zu den Ohren! Nichts ist schwieriger als das Zuhören. Wann kann man nicht zuhören? Wenn man wiederholt das Gleiche hört. Wenn man etwas hört, was man nicht hören will. Wenn die Nebengeräusche extrem zugenommen haben, und das haben sie derzeit fast immer. Ist es nicht allgemein so, dass das politische Grundrauschen Hörverhältnisse erschwert, dass das Gehörte so schwer in das Umfeld zurückzubinden ist. Entweder man geht nah ran, um etwas zu verstehen, dann verliert man den Kontext oder es ist im Rauschen verschwunden. Nähe und Distanz des Hörens haben sich voneinander verabschiedet, auch hier ist eine Blasenkultur zu vermerken.
Man hört auch nicht zu, wenn man zu müde ist. Wenn man davon ausgeht, dass das Gegenüber lügt oder Unsinn redet. Wenn man nicht zuordnen kann, was gerade los ist. Wenn man zu viel zu tun hat. Wenn es zu irritierend wäre zuzuhören. Man überhört ja nicht einfach nur, sondern hört auch oft das Falsche, es heißt dann, man hat sich verhört. Manchmal sind das einzelne Buchstaben, die ausgewechselt werden. Manchmal ist es Wunschdenken… Man will endlich etwas anderes hören! Und dann gibt es natürlich Orte des Nichtzuhörens. Von Michel Foucault wissen wir, dass es auf jeden Fall die Disziplinarorte sind, und ich möchte hinzufügen, dass es auch Orte der Zeitnot sind, in denen zu schnell reagiert werden muss, als dass richtig zugehört werden könnte – Börsen? Krankenhäuser, Altersheime? Just-in-time-Gebetsorte, Institutionen, in denen alles so derart auf Kante genäht ist, dass fürs Zuhören keine Zeit bleibt. Und zuzuhören benötigt stets mehr Zeit als zuzusehen.
Institutionen sind heute stark herausgefordert oder gar im Krisenmodus. Die, in die ich alltäglich Einblick habe, haben gewaltige Legitimationskrisen, darüber hinaus Probleme mit Krankenstand, Überforderung, sehr genauer Öffentlichkeitsplanung, bürokratischer Aushöhlung, einer Gremienarbeit, die Entscheidungen auf sachlicher Ebene erschwert – zu lange Tagesordnungen, zu viele Beteiligte etc. Da ist z.B. ein öffentlicher Rundfunk mit feudalen Strukturen und steilen Hierarchien, einer Kultur der Angst und dessen ständiger Infragestellung von außen. In solchen Institutionen hält man potenzielle Kritiker beschäftigt, indem man Scheinverhandlungen durchführt und Stellvertreterkonflikte am Kochen hält. Aber ich kann diese Angst vor der Abschaffung demokratischer Instanzen nicht einfach verdoppeln, ich kann auch im Gericht dies Herrschaftswissen nicht einfach imitieren, mich quasi in eine Expertenposition hineinmogeln, gerade in diesem Prozess ist mir die Expertenperspektive nicht möglich, sondern die einer rechtsunkundigen Sicht, die der Leute, die dem machtvollen Wissen plötzlich unterworfen sind und es sich aneignen und dabei meist scheitern müssen. Und hat sich im NSU-Prozess nicht mehr Nichtwissen als Wissen gezeigt, so kann ich diesen Aspekt nicht einfach durch eine Rekonstruktion wegwischen, sondern wollte ihn wahrnehmbar, ja regelrecht hörbar machen. Aus einer Position, die sich erst einmal orientieren muss, die nicht schon immer alles weiß, aber ohne das Gericht zu verraten.
Zum Zuhören ist nicht viel publiziert worden. Es ist noch immer eher unser blinder Fleck als ein tauber. Wir sind auch filmisch mehr umgeben von Talking Heads als von Hörenden, nur selten, in der Traditionslinie von Jean-Luc Godard bis Bruno Dumont, gibt es markant Zuhörende, bei Alexander Kluge sind sie in seinen Fernsehgesprächen wieder verschwunden, wo sie in den Kinofilmen der 70er und 80er so markant da waren. Visionär Der Angriff der Gegenwart auf die übrige Zeit