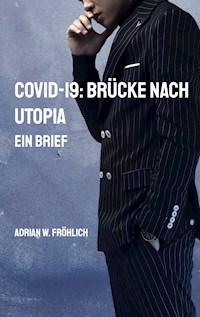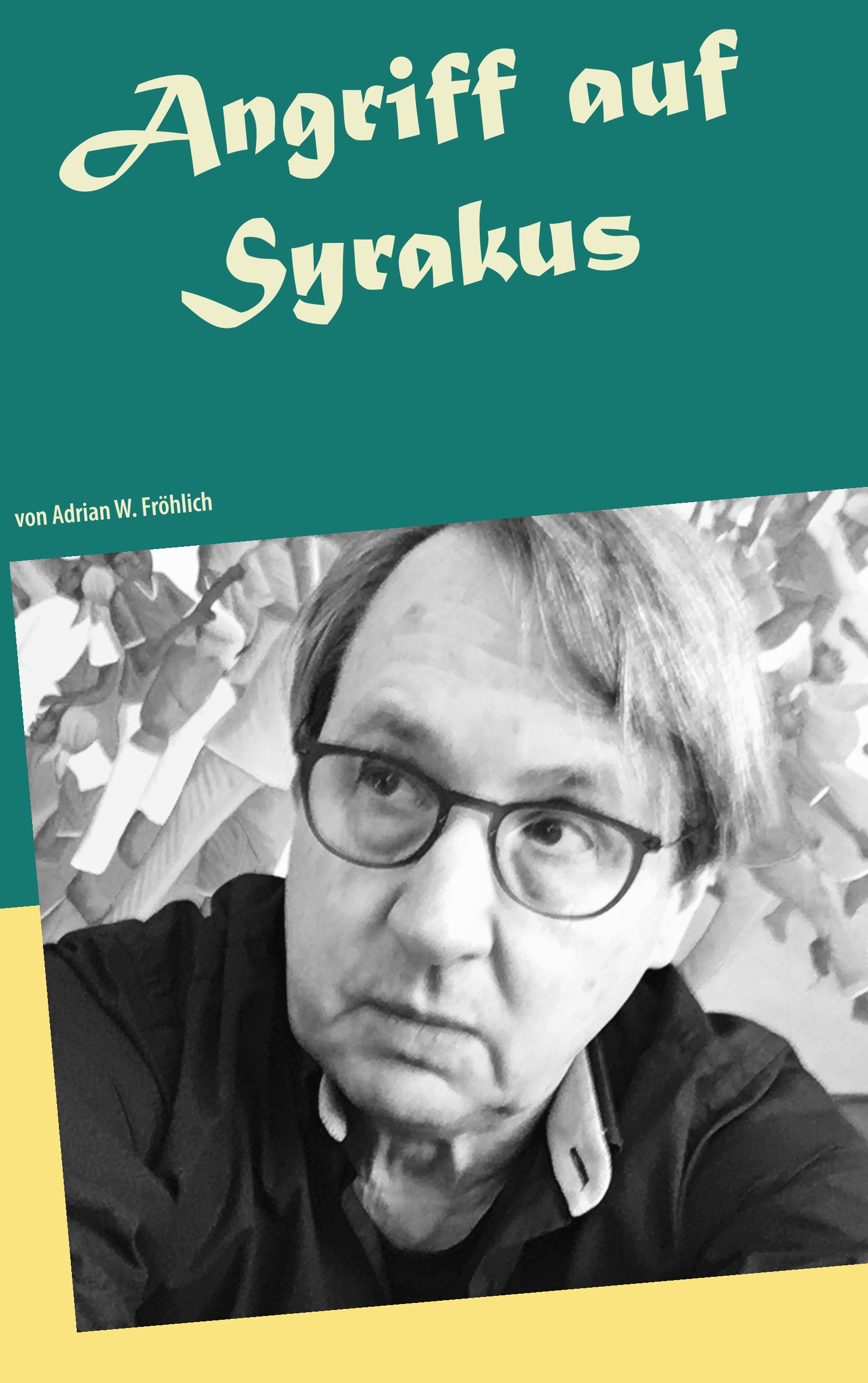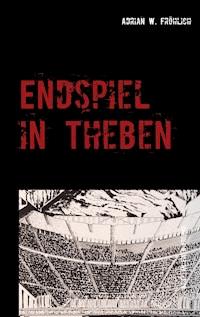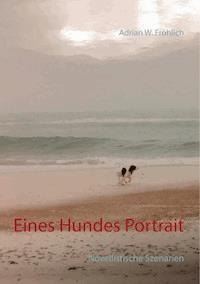8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Ausgewählte Texte zu Film und Drama, in den Achtziger- und Neunzigerjahren entstanden. Essayistische Skizzen zu Themen im Script Writing und zur Filmkritik.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 370
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Die Publikationsweise brachte es mit sich, dass der Text vom Autor korrigiert wurde. Auch enthält das Buch Helvetismen und verzichtet auf das Doppel-S. Auf die damit verbundenen Mängel des Buches sehe man, soweit zumutbar, nach Möglichkeit hinweg.
Das Publikum ist jetzt ungeduldig, fiebrig, verbildet.
Federico Fellini, über die Auswirkungen des Fernsehens, anlässlich der Premiere von Ginger e Fred.
Mein Herz zu öffnen für etwas, das fast in Vergessenheit geraten ist.
Federico Fellini, über das, was ihn bei seiner Arbeit zutiefst bewege, motiviere, fasziniere.
Inhaltsverzeichnis
«Die Story, der Plot, der Zorn»
V
ORBEMERKUNG
A
LLGEMEINES ZU
G
ESCHICHTEN
W
AS IST
T
HEATER
? W
AS BIN ICH
?
W
OODY
A
LLENS
I
NTERIORS
,
DIE PERFEKTE
G
ESCHICHTE
H
ÖLDERLINS
A
UFFASSUNG DES
D
RAMAS
Z
UR
A
NTIGONE
G
ESCHICHTE
, E
RZÄHLUNG
(N
ARRATION
)
B
EISPIELE
L
OGIK VON
G
ESCHICHTE
W
AS MAN VERSCHWEIGT
,
BLEIBT UNGESAGT
D
ER
T
RICK MIT DER
Z
ERSTÖRUNG
D
ER
H
IMMEL ÜBER
B
ERLIN
D
AS
G
EHEIMNIS DER
W
IEDERHOLUNG
T
HE
B
ELLY OF AN
A
RCHITECT
D
IE SCHWARZE
S
PINNE
A
NSTELLE EINES
N
ACHWORTS
Zwei Treatments
E
L
L
IBERTADOR
ANGIE
Auf ein Wort noch
F
ILME HABEN MICH GRENZENLOS FASZINIERT
Anhang
Sitz des Dionysospriesters im grossen Theater von Athen, des Repräsentanten des Grossen Befreiers des Menschen
Ungeheuer ist viel. Doch nichts
Ungeheurer als der Mensch.
Sophokles, Antigone
Wie alle meine Bücher ist auch dieses hier eines für ganz wenige Leser. Wieso macht der Autor das? Wieso schreibt er Zeug, das keiner liest? Wollen denn nicht alle Autoren Bestseller schreiben? Nein. Wollen nicht alle. Es gibt auch noch andere, so wie es auch Theatermacher und Filmregisseure gibt, die an den Gott ihres unendlich erhabenen und doch so furchtbaren Berufs denken, wenn sie arbeiten, an die Grossen des Fachs, nicht an die Ärsche der Zuschauer, an das heruntergekommene Massenbewusstsein und an den Nervenkitzel für Schwachsinnige. Und es gibt auch Leute, die interessieren sich noch für zerebrale Effekte, nicht nur für solche, für die es einen Supercomputer braucht. Zugegeben, es sind extrem wenige geworden. In ganz Europa hätten die wohl alle im selben Eisenbahnzug Platz. Die Subspezies ist beinahe ausgerottet. Das Schlimmste daran ist, dass die Anzahl derer, die glauben, von der Sache etwas zu verstehen, nicht abgenommen hat. An diese richte ich mich nicht, es wäre Zeitverschwendung. Ich richte mich an die Geist-Träumer und an die letzten Gebildeten, die den Weg noch finden, auch wenn die Dämmerung längst hereingebrochen ist. Doch will ich etwas von ihnen? Nein. Im Grunde interessiert uns der Andere heute nicht mehr. Denn jede Debatte würde uns schmerzlich vor Augen führen, was verloren ging, wie wenige wir geworden sind. Also schweigen wir. Wer dieses Buch zur Hand nimmt, ist selber schuld. Vermutlich versteht er nichts. Doch könnte es auch einen oder eine darunter haben, die trauern um all das Verlorene. Ihnen ein Gruss!
Kein Schriftsteller wird dadurch «besser», dass er gelesen wird. Es ist umgekehrt: Verhärtet er sich durch das, was gefällt, wird er sterblicher. Darum ist die grösste Kunst im Umgang mit Publikum und Ruhm die, so zu tun, als gäbe es beides nicht. Weder Rimbaud noch Rilke, weder Pindar noch Hölderlin schulten sich am Geschmack ihrer Leser und Zuhörer. Sie schulten sich allein am Geschmack anderer Genies und an der Natur selbst, was letztlich dasselbe ist. Wer sich an der Natur, anstatt am Nachbarn orientiert, ist nicht arrogant, sondern klug. Wer das NICHT tut, ist arrogant.
Auseinandersetzung mit der Kritik ist für die Kunst, was ein Dialog mit dem Klo wäre. Kritik ist, was resultiert, wenn der Unfähige das Genie nachahmt, sich dabei aber nicht auf die Natur stützt, sondern auf die Ausscheidungen der Künstler. Ein Interview ist dasselbe wie ein Toilettengang, und der Kritiker übernimmt dabei die Funktion des Papiers. Er sieht das Werk als eine Ausscheidung - ein Produkt -, das kunstvoll entsorgt, das sogenannt eingeordnet werden muss. Darum sind jene «Kritiker», die das Werk NICHT entsorgen und einordnen - also die Enthusiasten, die Aficionados -, die einzigen Kritiker, die Beachtung verdienen. Zwar sind auch sie unfruchtbar, aber sie geben - wie Hölderlins Götter – Hinweise und Winke.
Woran reift ein Künstler? An sich selbst, an sich selbst, an sich selbst! Am Leben, am Leben, am Leben! An der Sache, an der Sache, an der Sache! Genie ist in Wahrheit eine spezielle Form des Narzissmus, eine, welche die narzisstische Selbstspiegelung in der SACHE betreibt, während der normale Narzisst sie im ANDEREN vollzieht. Beides ist im Grunde Grenzüberschreitung und Missbrauch. Das Genie überschreitet die Grenze zur NATUR, der Missbrauch erscheint uns als Kunst, die entzückt, der normale Narzisst dagegen überschreitet die Grenze zur PERSON, dieser Missbrauch wirkt als haltlose Behauptung und empört.
Das erneuerte Theater des Dionysos um 400 v. Chr. Zeichnung des Autors (1980)
«Die Story, der Plot, der Zorn»
VORBEMERKUNG
(Husby Kirkeby, im Frühjahr 2020)
Die in diesem Hauptkapitel zitierten Aufsätze stammen aus den achtziger Jahren und wurden von mir damals unter dem obigen Titel 1988 kompiliert. Das Vorhaben und sein Titel erklären sich so, dass ich damals selbst in der Filmszene als Szenarist und Ideenlieferant aktiv war und auch zu tun hatte mit der Filmkritik. Diese Auseinandersetzung regte mich zwar einerseits an, andererseits aber betrübte sie mich, je mehr ich merkte, wie oberflächlich das Verständnis von Film und Theater in den Kreisen war, mit denen ich zu tun hatte. Die meisten darin verkehrenden Aficionados und selbsternannten Regisseure und Kritiker waren nicht nur bar jeglicher philosophischen und literarischen Bildung, sondern naiv-voluntaristisch eingestellt. Was sie wollten, das sollte werden. Sie alle zeichnete aus, dass sie davon überzeugt waren, dass es Aufgabe des Filmers und des Theatermachers sei, der Wirklichkeit Aufträge zu erteilen, sie zu belehren und zu korrigieren, als wäre sie ein ungezogenes Kind, und als wüssten nur sie, die Regisseure und Kritiker, was eigentlich Sache sei. Dabei verglichen sie sich gerne mit Genies wie Fellini, Artaud, Hitchcock und Tarkowskij, die das ja auch so machen würden. Der diesbezüglich fatal wirkende Marcello aus 8½ von Federico Fellini war ihr uneingestandener Heros, ein Dirigent im Chaos der Empfindungen und Wirklichkeiten, dem sich alle und alles zu fügen hat, wie sie glaubten, dessen Problem nicht nur die Suche nach Trüffeln sei, sondern ebenso sehr die Kujonierung der am Set Beteiligten, und dass Genialität darin bestehe, genau das zu tun, was kein Schwein voraussehen kann. Will ihnen jemand etwas erklären, so deuten sie - anstelle eines Verständnisses dessen, was sie hören - die Tatsache, dass er seine Hand beim Reden in der Hosentasche behält. Das bleibt natürlich beliebig und macht jeden genial, der diese intuitive Form der Dekonstruktion beherrscht. Dafür muss man nur impertinent und sehr von sich selbst überzeugt sein. Fellinis Marcello ist das ja auch, doch ist er viel mehr als das. Das ist er jedoch nicht als Marcello, sondern als Fellini, und genau diese Doppelgeborenheit des Ich begriffen diese Leute nicht, also den eigentlichen Trick dabei – die Kunst der Aussage -, das entging ihnen. Man kann nicht Marcello sein, ohne dass man Fellini ist. Und es ist nicht Marcello, der den Fellini herbeiholt, sondern umgekehrt. Wer den Marcello mimt, ist einfach nur ein Schnösel. Für mich war rasch klar, dass die herkömmliche Filmerszene und erst recht die Kritikerszene, die unbeschreiblich dumm ist, keine Ahnung davon haben, was sie eigentlich tun. Es ist eine narzisstische Szene voll mit Wichtigtuern, Möchtegernschauspielern und Set-Nutten, die von nichts eine Ahnung haben, aber Millionen verbraten. Allein die Tatsache, dass sie Filme machen, lässt sie glauben, dass sie Experten seien.
Das erste Hindernis war und ist also, dass man lernt zu verstehen, was Doppelgeborenheit oder ein Dithyrambus ist. Man muss die Urbewegung aller wahren Philosophie mitmachen, die Teilung des Einen zum Zweck seiner Konstitution als das Eine. Man muss begreifen, dass sich die Welt nicht beliebig zusammensetzt und zusammensetzen lässt, sondern dass sie einem «kalkulablen Gesetz» folgt, wie Hölderlin ihm sagte. Dieses ist tragisch, widerläufig, dialektisch, dithyrambisch, und es stellt uns vor die Tatsache, dass nicht wir es sind, welche die Story machen, dass der Plot nichts ist, was man zusammenschustert, sondern umgekehrt, dass der Plot uns zusammenschustert als die Story seines Begreifens. Es ist halt auch hier wie überall: Dummheit allein reicht nicht, um etwas zu verstehen, man muss auch noch gescheit sein. Bildungsferne ist kein Garant für echte Geschichten, man muss auch noch jener komplexe Apparat sein, der echte Geschichten überhaupt empfangen kann. Das heisst, man muss als Apparat überaus gebildet sein, auch wenn man nichts weiss. Doch wenn man das ist, saugt sich die Bildung in uns von selbst fest.
Damals überwältigte mich der Zorn über die Szene und ihren Voluntarismus, ihre Arroganz und ihre unglaubliche Rohheit an Bildung und an Empfänglichkeit. Er liess mich die in diesem Buch versammelten Aufsätze schreiben. Noch heute kann ich keine Filmkritik lesen. Ich lese nichts Dummes, Verblödetes, denn wollte ich mich mit solchem abgeben, wäre das Lesen eines Eisenbahnfahrplans bereits eine Steigerung des Niveaus. Ich weiss nicht, was der Kritiker wahrnimmt, wenn er ins Theater oder ins Kino geht, auf keinen Fall jedoch das, was sich dort tatsächlich abspielt. Das Gleiche liesse sich natürlich auch über Musikkritik oder Literaturkritik sagen, doch die lese ich sowieso nie. Wieso sollte man sie lesen? Der Informationsgehalt von Kaffeesatz ist grösser.
Ich habe in meinem Leben immer wieder bestätigt gefunden, dass man sich nur mit den Genies abgeben darf, in jeder Sparte, jedem Bildungsbereich. Alles andere ist zwecklos und Zeitverschwendung. Das Genie ist das einzige Wesen, das etwas ganz beschreiben oder erschaffen kann, so wie es sonst nur die Natur kann oder Gott selbst, falls man so gnädig ist, an ihn zu glauben, denn erst das erschafft ihn. Jedes Meisterwerk enthält immer alles, es ist das Ganze, selbst wenn es nur einen Bleistift zeigt. Das heisst, es stammt aus einem Geist, der die Widersprüche aushält, die sich in den Weg stellen, wenn es zum Ganzen kommt, der in ihnen die Bruchlinien des Unüberwindlichen erkennt, der sie nicht wegmachen will, was unmöglich ist, sondern miteinbezieht, und zwar so, dass am Ende das Werk sein Schöpfer ist, und der Schöpfer sein Werk. Es war wiederum Fellini, dem manche vorgeworfen haben, er drehe immer denselben Film. Ja, das tat er. Doch war es eben nicht derselbe Film, sobald es derselbe war. Dies hinzukriegen und auszuhalten und nicht übertreffen zu wollen, das kann nur das Genie. Man kann auch der Natur vorwerfen, sie erschaffe stets und überall dasselbe. Man kann es Gott vorwerfen. Und hier nun schliesst sich der Bogen zum Dummen, der auch immer denselben Film dreht, wenn er lebt, und nur darin ist er genial und liebenswert. Sobald er jedoch anfängt, Dinge zu erschaffen – zum Beispiel Filme -, wird er unerträglich. Dummheit ist geil, solange sie bloss gelebt wird. Wird sie schöpferisch tätig, sollten wir davonlaufen. Hier liegt der tiefe Grund zutage, weshalb Genies sehr oft dumme Partnerinnen haben. Denn diese sind ebenso perfekt wie sie, aber nur als Untätige, als das, was lebt. Auch das hat Fellini in 8½ treffsicher inszeniert, indem er Marcello ein geiles Flittchen zuteilte, das diesen, sehr zum Erstaunen des tumben Publikums, tatsächlich erregt und fasziniert, wo er doch viele angeblich gescheite Frauen hätte haben können. Doch waren diese ebenso dumm, aber leider mit kreativen Ansprüchen, was sie nicht nur für Marcello, sondern überhaupt entwertete. Mit anderen Worten ist das männliche Genie ein Macho und Sexist, und zwar zwangsläufig, geradezu notwendigerweise. Will man das ändern, verschwinden die Genies aus den Regalen der Epoche und sie zerfällt, degradiert, was aber erst viel später hervortritt. Bei weiblichen Genies ist es freilich ganz ähnlich, der Unterschied ist nicht sehr gross. Man betrachte nur Katharina die Grosse. Der wirklich grosse Geist duldet an seiner Seite keinen wirklich grossen Geist, sondern einen wirklich saftigen Leib. Nur so kann er schaffen. Das ist wiederum tragisch, ist wiederum eine Form des Dithyrambus, der Doppelgeborenheit des Einen.
Heute gehe ich kaum noch ins Kino, und ins Theater überhaupt nicht mehr. Nicht, weil sie schlechter geworden wären, sondern im subtilen Bewusstsein, dass ich damit kongruent zum Schicksal dieser Medien bin. Im Kino gibt es nur noch Dosenwürstchen, wie Rossellini einmal gesagt hat, und deren Produktion ist uferlos und technisch perfekt. Im Theater gibt es nichts Neues mehr, seit das wahre Theater im Internet stattfindet und in Millionen von One-Person-Shows endlich bei sich selbst angelangt ist. Die Informationstechnologie hat das Theater vernichtet, zugleich aber auch verallgegenwärtigt.
In der Freitagspredigt in der Moschee spielt sich eine ganz neue, sich wiedergebärende Form des Theaters heute ab, und es ist wieder jenes Einmannstück, mit dem die Dionysien begannen, und es erzählt wieder vom Gott und seinen tragischen Begebenheiten. In der Aufräucherung, in der Anathymiasis im Geist der Gläubigen, die in Reih und Glied vor dem Imam sitzen, entsteht der neue Dithyrambus, die Wiedergeburt (und Widergeburt!) des Einen. So und nicht anders begann das Theater in Athen, als ein Gottesdienst, der Trunkene, Begeisterte hervorbrachte, von sich selbst Trunkene und von sich selbst Ergriffene. Hier liegt die Zukunft, denn es liebt der Gott die Wandlung in so grossen Sprüngen, dass der Mensch ihnen nicht folgen kann, sondern überrumpelt wird. Der überrumpelte Mensch ist die Zukunft.
Die Aufsätze in diesem Büchlein beanspruchen keine thematische Vollständigkeit oder gar Exemplarität. Die brauchen wir nicht. Denn das Unvollständige ist das Vollständige, sobald es einen ergreift.
ALLGEMEINES ZU GESCHICHTEN
Liest man Brechts Betrachtungen zum nicht-aristotelischen Drama, so ergeben sich aus jener Position zwei dramatische Darstellungsformen des menschlichen Elends: die eigentlich dramatische (emotionale, aristotelische) und die epische (erzählende, nicht-aristotelische) des (damals) neuen Theaters Erwin Piscators und Bert Brechts.
Das dramatische Theater war darauf aus, die das Elend des Menschen bestimmenden Gesetze als ewige und endgültige zu erklären und zu feiern. Schuld als prinzipielle und endgültige Schuld, Untergang ihr zufolge als das Grundmuster allen Seins, als Schicksal. Innerhalb dieses Grundmusters vollzog sich der individuelle Aufstieg zu Glanz, Ruhm und Liebe und führte doch über die Klippe der Klimax in den Abgrund, in den klaffenden Widerspruch von Sein und Schein, Sein und Sollen, Wollen und Können, in die Katastrophe. Dieses Theater war grundphilosophisch.
Und seine Entwicklung folgte seinem eigenen Prinzip. Von Anfang an zum Untergang durch den in ihm anwesenden Widerspruch verdammt, den Weg alles Lebendigen, welches es ja so meisterhaft beschrieb, zu Ende zu gehen, verstieg es sich zum Leben selbst und zerfiel zu Staub. Und was Christus lebte und starb, kann man nur als die Apotheose des dramatischen Theaters bezeichnen, das zum Lebens- und Welttheater wird.
Davon nichts zu erzählen, war die Devise des epischen Theaters. Der Schicksalsablauf sollte nicht nur als ein von Menschen gemachter Prozess herausgestellt werden, sondern als nicht selbstverständlich, als nicht normal, als auffällig. Zu diesem Zweck liess man das Alltägliche und Selbstverständliche in fremdartiger Gestalt auftreten. Die berühmten Vorgänge hinter den Vorgängen sollten dabei als das eigentliche Reale, jene einfachen Vorgänge auf der Bühne aber als das Fremde und Falsche imponieren. Hier kam es zur Umkehrung der Wirklichkeit in ihr Gegenteil: Das Alltägliche wird absurd, das zunächst Absurde wird alltäglich. Das war und ist natürlich ein dramaturgischer Trick. Nur mit ihm konnte man die Schläfrigkeit des Zuschauers durchbrechen. Nur so konnte die jedes Mass sprengende Thematik der ZEIT in Form gefasst werden.
Das Theater hat ja immer die Aufgabe, uns das, was IN DER ZEIT ist, die Grundsituation unserer Aktualität als Menschen vorzuführen, jedoch - im Unterschied zur Literatur - so, dass der die Aktualität Wahrnehmende dadurch unter Vollzugszwang gerät. Eine erzählte Geschichte in einem Buch müssen wir uns erst vorstellen. Eine Geschichte im Theater hingegen beraubt uns der Vorstellung und ist selbst Vorstellung. Das hat den Vorteil, dass wir im Theater nur noch zu erkennen brauchen, was uns vorgestellt wird. Der Nachteil ist aber, dass der Zwang, der hier auf uns ausgeübt wird, auch und gerade ein zeitlicher ist. Wir sind entweder vorbereitet ins Theater gekommen und erkennen mit der geforderten Geschwindigkeit, oder wir müssen auf die Erkenntnis des Ganzen verzichten und schlittern mehr oder weniger ungelenkt durch die Hölle der Phänomene. Was heisst aber: Vorbereitet ins Theater kommen? Das könnte heissen, das Stück bereits gelesen zu haben, als Literatur, die eigene Vorstellung schon erlebt zu haben. Und im Film? Wer kommt ins Kino und hätte das Drehbuch gelesen? Vorbereitet sein heisst auch: Das Theater im eigenen Leben bereits begriffen zu haben. In diesem Sinne vorbereitet am Tatort aufzutauchen, würde bedeuten, zu wissen, dass man selbst ein Stück schreibt, in ihm eine Rolle spielt, diese gut zu spielen vermag und, dass man selbst sein eigener Zuschauer - und sein einziger! - ist. Zwar reden alle von der Rolle, die sie in ihrem Leben spielen, aber diese Rolle ist nicht gemeint. Gemeint ist die Rolle hinter dieser Rolle, die Rolle der Rolle überhaupt. Um also vorbereitet ins Theater oder ins Kino zu kommen, wird man entweder das Stück schon gelesen haben müssen (gelesen und NICHT gesehen), oder man ist gezwungen als Akteur zu erscheinen, als Zuschauer, als Regisseur, als Dichter - und als das Stück selbst.
Darum werde ich auch im Folgenden daran festhalten: Auf die Bühne, auf die Leinwand glotzen bedeutet, auf sich selbst glotzen. Ob ein Schwank von Nestroy oder ein Drama Shakespeares angesagt ist, ob man vor Denver oder Fellinis Casanova sitzt, macht hier keinen Unterschied: Man ist sich selbst angesagt und sitzt vor sich selbst. Das Problem scheint nun darin zu liegen, dass wir mehr als nur die Relevanz der Geschichte, die man uns erzählt, zu erkennen haben, dass wir zu erkennen haben, wer wir sind, und wo wir sind, und wie wir sind, und warum wir sind, wenn DAS IST, WAS GEZEIGT WIRD. Aber das ist auch schon alles.
Die Frage aller Fragen lautet: Wie funktioniert der Mensch? Jede Wissenschaft stellt diese Frage auf ihre eigene Weise. Wie ist sie im Theater, wie im Film zu stellen? Und wie geht diese Frage mit der Tatsache zusammen, dass Theater und Film vielleicht nichts anderes tun, als was jede Grossmutter tut: Geschichten erzählen? Konkrete Geschichten. Unphilosophische Geschichten. Triviale Geschichten. Kleine Begebenheiten, nicht DES Lebens, sondern wohl eher AUS dem Leben. Teilmengen von Teilmengen von Teilmengen. Und, falls die Frage aufkäme, wie der Mensch funktioniert, so auch die Fragen: wozu, worin, woher, und wann? Meine vorläufige Antwort ist diese: Der Mensch funktioniert, wenn seine Geschichte funktioniert. Und wir müssen herausfinden, was denn überhaupt eine Geschichte ist. Und das können wir herausfinden.
Normalerweise gehen wir so vor, dass wir unseren Werkzeugkasten der dramaturgischen Instrumente und Kriterien aufklappen, dass wir vor die Geschichte, die man uns erzählt hat, niederknien und sie planmässig demontieren, um sie später wiederum planmässig zusammenzubauen. Dabei gehen wir davon aus, dass das, was wir zerlegen und zusammensetzen, das ist, woran wir wirklich interessiert sind. So etwa, wie wenn jemand seine Kaffeemaschine auseinandernimmt, um herauszufinden, wie sie funktioniert, und dabei glaubt, dass das, was er dabei erfährt, wirklich jenes Wissen ausmache, das ihn instand setzen würde, selbst eine Kaffeemaschine zu bauen. Doch, wie Sie sehen, täuscht er sich. Denn versetzte man diesen Menschen auf die berühmte, einsame Insel, und brächte er nur jenes Wissen mit, so müsste er resignieren, falls es ihm in dem Sinne kommen sollte, tatsächlich eine Kaffeemaschine zu konstruieren. Er könnte nicht einmal das Material beschaffen. Er könnte es weder bearbeiten, noch würde ihm auch nur ein ganz kleiner Teil jenes Expertenwissens zur Verfügung stehen, das den Ingenieur auszeichnet, und ohne welches es keine funktionierenden Maschinen gibt.
Normalerweise beurteilen wir Geschichten nach Verfahren, wie sie die bisherige Theaterkritik ausgearbeitet hat. Wir gehen hierbei (unbewusst) davon aus, dass es Grundbestandteile, Grundstoffe und Grundmaterialien und Grundteilgeschichten gibt, die wir dann nur noch nach den zu lernenden Gesetzen der Theorie zusammenzubauen hätten. Ein solches Gesetz wäre etwa die Einheit der Handlung. Und die notwendigen Materialien sind, so glauben wir immer, einfach Sinneinheiten unserer Erfahrung, Mikrogeschichten, zum Beispiel das Öffnen einer Tür, das erstaunte Gesicht, die Ohrfeige, der sexuelle Akt. Wir nehmen den Sinn dieser Materialien gleichzeitig mit der Form wahr, in der sie auftauchen. Doch nun sind wir auf der einsamen Insel, im kosmischen Exil, und nun wollen wir eine Ohrfeige in den Kontext einer imaginierten Geschichte mit den Mitteln des Theaters oder des Films einbauen. Bitte!
Carl Spitteler hat einmal gesagt: Bringen Sie nur erst einmal Achilles durch eine Tür! Und, so fügen wir hier an, wenn Ihnen das gelungen ist, dann werden Sie uns bitte auch sagen, wie man eine Ohrfeige in einen Zusammenhang einbaut. Und Sie werden uns das nicht nur sagen, sondern eben zeigen, auf der Bühne, oder auf der Leinwand.
Sie werden dabei vermutlich rasch einsehen, dass es die Sinneinheit Ohrfeige so nicht gibt, wie Sie gemeint haben, Sie werden etwas als Problem wiederfinden, das für Sie bis anhin trivial war. Die Ohrfeige ist nämlich selbst schon die Inszenierung eines Kontexts. Die Ohrfeige ist eine Welt. Achilles, der durch die Tür schreitet, ist eine Welt, die einen welthistorischen Akt enthält. In Ihrer Geschichte, in der eine Ohrfeige vorkommen soll, gibt es plötzlich eine ebenso grosse Geschichte, nämlich die Ohrfeige selbst. Werden Sie also ein bisschen bescheidener, lösen Sie erst die Geschichte der Ohrfeige und suchen Sie nach den Sinneinheiten, mit der man sie erzählt!
Plötzlich sind Sie bei Dingen angelangt wie: Wo steht A, wenn sie gegen B die Hand hebt? Von wo sehe ich, wie sich was bewegt? Höre ich dazu Musik? Was hört man eigentlich, während jemand zu einer Ohrfeige ansetzt? Wie schnell spielt sich das Unternehmen Ohrfeige wirklich ab? Die Nachhaltigkeit einer Ohrfeige - ist sie eine Art Zeitdehnung oder was? Mit anderen Worten: Um herauszufinden, was Ihre Ohrfeige IST, müssen Sie wissen, wie man sie MACHT, und wie man sie ERLEBT.
Das erscheint Ihnen vielleicht immer noch trivial. Aber bedenken Sie Folgendes: Wenn Sie erst wissen müssen, wie etwas gemacht und erlebt wird, bevor Sie oder irgendwer sonst weiss, um was es sich dabei handelt, dann müssen Sie von einer liebgewordenen und immer wieder gehörten Idee Abschied nehmen, nämlich der Idee, dass man zuerst die Geschichte habe und danach ihre Inszenierung, dass man zuerst wissen müsse, um was es auf der Bühne und auf der Leinwand gehe, vielleicht, wie Theater- und Drehbuchautoren immer wieder empfehlen, dass man das Ende der Story vorauskennen soll, bevor man an die Form herangehen dürfe. Klar, Sie werden immer eine Art Geschichte vorauswissen müssen. Das soll und kann nicht bestritten werden. Die Geschichte aber, die Sie schliesslich erzählen - falls Ihnen so etwas denn gelingt -, hat mit jener vorausgewussten nichts zu tun. Sie können eine Ohrfeige NICHT in eine Geschichte einbauen! Und Achilles hat noch nie eine Tür, die Sie ihm in den Weg gestellt haben durchschritten! Sie können es nicht, und niemand kann es. Was ist nun also eine Geschichte?
Können Sie ins Kino gehen, ins Theater, und dort sähen und vernähmen Sie Geschichten? Und Sie könnten diese dann sogar mit den Kriterien der Dramaturgie zu Analysezwecken demontieren und probeweise wieder zusammensetzen?
Nein. Das, was Ihnen in die Hände fällt, ist nicht das, was Sie dafürhalten. Denn, wenn es das wäre, dann würde sich bei Ihnen während des Zuschauens und Zuhörens jede Szene in Regieanweisungen, Kameraeinstellungen, Geräuschkulisse, Diktion der Worte, und und und - ad nauseam - wie ein Gewebe auflösen lassen und auflösen. Und Sie würden dann sehen, fühlen, wissen, WIE es gemacht ist. Und hierbei würden Sie auch erkennen, WIE Sie selbst auf dieser Stufe, und auch auf jeder höheren Integrationsstufe, darauf reagierten und reagieren. Und Sie würden auch wissen, wie dieses mit jenem in jeder Mikrosekunde verknüpft ist. Wüssten Sie das alles, dann hätten Sie nicht nur jene Geschichte begriffen, um die es geht, sondern eben auch sich selbst. Und wenn jene Geschichte nicht funktionierte, so eben auch nicht Sie selbst. Und es wäre diese Geschichte dann keine Geschichte. Und Sie, diese Geschichte kennend, wären kein Mensch.
Nun haben Sie sich aber dafür entschieden, nicht so weit zu gehen. Sie sagen - und offenbar versteht man das, obschon nicht einzusehen ist, warum -, Sie sprächen doch nur über das, was man sehe und höre! Und umgekehrt spreche die Geschichte auch nicht über Sie, sondern über einen Anderen. Einen Unbekannten.
Zwar sei die Geschichte relevant auch für Sie, aber nur im Prinzip. Die Geschichte sei eine Möglichkeit, aber keine Wirklichkeit. Sie habe auch ganz anders verlaufen können. Um nun zu erklären, was Sie sehen und hören, erzählen Sie die Geschichte nach. Und Sie zeigen auf, indem Sie dramaturgische Kriterien ins Feld führen, wo was wie gemacht worden sei. Gleichzeitig aber tun Sie so, als wüssten Sie, was eine gute Geschichte ausmacht. Sie sind durchaus der Meinung, dass der Mann, der seine Kaffeemaschine auseinandernehmen kann und sie wieder zu einer funktionierenden Einheit zusammenzubauen wisse, auch wisse, wie man eine Kaffeemaschine baut. Sie würden zustimmen, wenn jemand behauptete, er wisse, wie man ein Kind macht. Sie sind völlig sicher, das Gesicht Ihres Partners aus allen Gesichtern der Welt herauszufinden. Und Sie glauben offenbar eben auch, dass dieses und kein anderes Wissen genüge, also eine notwendige und auch hinreichende Bedingung darstelle, um das Gesicht Ihres Partners zu machen. Sie schreiben ein Drehbuch und gehen dabei nach den bekannten dramaturgischen Kriterien vor, die Sie sich in Kursen und aus Büchern angeeignet haben und glauben, da alles sich zur Zufriedenheit angelassen hat, eine GESCHICHTE geschrieben zu haben. Sie haben mit einem Treatment begonnen, worin sie lediglich die Szenen beschrieben haben, also das, was sich abspielt. Danach haben Sie das Ganze zum Stück, zum Film ausgebaut. Sie haben Achill, und Sie haben eine Grossmutter und ein Zimmer mit einer Tür. Und dann ist die Grossmutter im Zimmer, und Achill kommt auf Besuch. Das gibt eine schöne Szene. Schon wissen Sie, was es zwischen dem Helden und der alten Frau zu reden geben SOLL. Denn Ihnen schwebt da eine Geschichte vor. Und darin muss man vorankommen.
Tarkowskij liest Ihre Szene und erhält den Auftrag, sie zu drehen. Ein Häuschen, mit einer Holztür, verschlossen. Eine lange Einstellung: im Vordergrund Achill, ein russischer Bauer, dann im Mittelfeld eine sanft abfallende, kahle Wiese. Dann, im Hintergrund, vor ein paar Bäumen und einem Felsen: die Hütte, die Tür. Stille. Stille? Dann Schnitt, und anstelle des Häuschens steht da jetzt die Grossmutter, lächelnd zu uns herüberschauend, an der Hand den kleinen Achill. Ende der Szene. Zwar sind die Elemente vorhanden, die Sie vorgeschlagen haben. Ja, eben: Sie sind da. Und insofern sie schon nur da sind, verdrängen sie Ihre Szene. Und wir kommen nicht einmal bis zur Grossmutter. Hätten Sie DIESE Szene gewollt, so würden Sie DIESE Szene geschrieben haben?
Nein. Denn: In Ihrer Szene waren die Dinge nicht da, Ihre Szene sollte etwas ausdrücken, was nicht da war, denn Sie hatten vor, die Dinge als Requisiten einzusetzen, nicht einmal als Zitate von Dingen. Ihre Szene hätte etwas MIT DEN MITTELN DER DRAMATURGIE UND DES FILMS ausdrücken sollen. Da waren die toten Dinge Achill, Häuschen mit Türe und Grossmutter. Da war das tote Etwas Dialog. Da ist eine Kompanie Soldaten. Sie wird im Kampf um den Hügel 456 eingesetzt. Die halbe Kompanie kommt um, der Rest flieht. Eine Kompanie von Schachfiguren. Von Zinnsoldaten. Von Zahlen.
Sie haben immer noch geglaubt, als Sie Ihre Szene schrieben, dass man MIT den Dingen eine GESCHICHTE vorantreiben könne.
In Tat und Wahrheit lässt sich kein einziges Ding gebrauchen, anfassen, filmen, sagen.
Nur die Schatten der Dinge lassen sich einsetzen. Die Schatten im Geist. Es gibt keine Mittel, und es gibt auch keinerlei Zweck. Ebenso wenig wie Ihr rechter Arm eines Ihrer Mittel ist, das Sie zum Leben brauchen, ist die Tür in jenem Häuschen so etwas wie ein erzählerisches Mittel. Lernen Sie zuerst einmal erkennen, dass eine Tür eine Tür ist. Lernen Sie die Geschichte kennen, die Sie Tür nennen. Selbstverständlich gehen Sie in Ihrem Alltag nach einem gewissen Plan vor. Ihre Arbeit erfolgt planmässig. Aber schauen Sie genauer hin. Überlegen Sie, was die Stahlschranktür links vom Eingang in die Personalgarderobe Ihnen jedes Mal zubrüllt, wenn Sie auf Sie zugehen! Und was brüllen Sie lautlos zurück?
Ich schlage Ihnen folgendes vor: Werden Sie erst einmal sich selbst, nämlich Hörer und Seher und Fühler und Taster und Reagierer. Und Sie erwachen alsbald in der schieren Hölle. Orkanartiger Geschichtensturm, Lärm aus tausend Momenten werden über Sie herfallen wie die Reiter der Apokalypse. Und es könnte Ihnen aufgehen, was sich hier eigentlich abspielt, während Sie immer glauben, zu sehen, was sich abspiele, wenn Sie gar nicht bei der Sache sind, sondern bei den Schatten, bei Ihrem eigenen Schatten.
Ich werde versuchen, die mehr theoretischen Überlegungen, die ich hier und im Folgenden anstelle, und die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben, mit einigen Filmbetrachtungen und einer kurzen Analyse eines Theaterstücks zu ergänzen und zu verdeutlichen. Dabei werde ich nicht immer auf Übereinstimmungen und Gesetze, so wie ich sie sehe, hinweisen. Zwei dieser Filme sind: (1) Woody Allens INTERIORS, und (2) Wim Wenders und Peter Handkes HIMMEL ÜBER BERLIN. Beim Theaterstück geht es um das ENDSPIEL von Samuel Beckett.
WAS IST THEATER? WAS BIN ICH?
Peter Sloterdijk hat in seiner Kritik der Zynischen Vernunft eine der Illustrationen so unterschrieben: «Das was man sieht, wo man nichts sieht, das regiert die Welt.» Was die Sache verbirgt, das macht sie erst aus. Ein Satz der uneingeschränkt sowohl für das Sein gilt, als auch für das nur notdürftig verhüllte Geschlechtsteil der Frau (um das es Sloterdijk zu tun war).
Der Satz drückt eine Art Gesetz aus. Ein Universalgesetz. Ein Theatergesetz, wie wir gleich sehen werden. Das Sichtbare ver- und enthüllt zugleich. Nein. Umgekehrt: WIR sind es, die zugleich ver- und enthüllen. Ist ES verhüllt und dadurch das Unsichtbare, so sind wir IHM ganz fern. Aber indem es am Ort des zu Enthüllenden, des Sichtbaren auftaucht, sind wir ihm ganz nahe. Machen wir einen Sprung und denken wir so: Man sitzt in einem Stuhl und tut zwei Dinge zugleich, man verschliesst sich all jenen Anderen, die um einen herum sind und enthüllt sich dabei einem ganz und gar fiktiven, imaginären Gegenüber. Dieses Phantom, dem wir uns auf diese Weise zeigen, sehen wir und sehen es doch niemals als wirkliche Person aus Fleisch und Blut. Das Gespenst seinerseits sieht uns - und doch wieder nicht. Dabei haben die wirklichen Menschen um mich herum keine Möglichkeit, MICH zu sehen, und ich verzichte ebenfalls darauf, SIE zu entdecken.
Die Situation ist vertrackt. Und doch ist sie ganz einfach. Für jenen Anderen, der neben mir sitzt, muss ich ein Gespenst sein, nur in Umrissen sichtbar. Umgekehrt ist auch er ein Phantom für mich. Möglich wird das aber nur dadurch, dass ich diese kaputte Beziehung inszeniere, indem ich - auf solche Art mit meinem Nachbarn nicht kommunizierend - gar nie auf den Nachbarn blicke, sondern auf einen ihn repräsentierenden Stellvertreter, wie er OHNE MICH agiert und ist, quasi durch ein Schlüsselloch angeschaut, während er, dieser Stellvertreter, zwar weiss, dass ich da bin, dass ich weiss - aber nicht mehr als das.
Unser Bestreben ist es, den Anderen so zu entdecken, wie er OHNE MICH ist, und das kann ich nur, indem ich ihm keinen Einblick in meine eigenen Akten gewähre, und er mich allenfalls, risse er die Tür, die uns trennt, auf, hinter dem Schlüsselloch finden würde. Trotzdem soll der Andere MIT MIR RECHNEN, wie mit einer festen Grösse, einem Faktum, das ich ihm zum Gebrauch überlasse. Ich zwinge den Anderen, sich mit einem Faktum zu unterhalten, mit einem Stein, von dem er aber weiss - da es ihm ähnlich ergeht wie mir -, dass es nur der Schatten dessen ist, mit dem er spricht. Die Situation ist pervers: Anstatt einer Unterhaltung von Ich zu Ich inszenieren wir eine solche von Ich zum Schatten des Ich des Andern. Damit vermeiden wir, dass der Andere uns IN AKTION, also NACKT sieht. Im Augenblick, wo wir SIND, wo wir PASSIEREN, soll man uns gerade nicht entdecken. Damit das nicht passiert, bedecken wir uns dauernd mit einem Abbild von uns, das wir nach Belieben stilisieren oder austauschen, ohne jemals dafür eine Begründung oder Erklärung abgeben zu müssen. Das verweist uns, über Sartre hinaus, auf Lacan.
Im Gefolge dieser fundamentalen Unaufrichtigkeit (der mauvaise foi, wie Sartre ihr sagt) verbergen sich beide, ich und der Andere, und beide erreichen wir unser Ziel nicht, den andern AN SICH anzutreffen. Das Spiel ist mythisch, brutal und unausweichlich. Im Moment, wo ich nach dem Anderen greife, um ihn ganz zu haben, hat auch er schon nach mir ausgegriffen. Im Moment, wo ich nach dem goldenen Apfel der Hesperiden greife, klappt das Maul des Drachens zu, und ich bin drin.
Sie sitzen im Theater. Der, den Sie im Auge und im Ohr haben, das bin nicht ich, obschon ich gerade neben Ihnen Platz genommen habe, und auch ich sehe nicht Sie an und lausche nicht Ihren Worten, sondern: Wir beide blicken und hören auf ein Gegenüber, das deutlich von uns abgetrennt auf einer Bühne steht und handelt, ALS WÄREN WIR NICHT DA. Und doch ist es nur da und handelt nur so, wie es handelt, WEIL WIR DA SIND. Der Schauspieler, den wir verfolgen, ist in unserer Welt, die nur bis an den Bühnenrand reicht, ein Phantom, ein Gespenst. Und umgekehrt sind wir in der seinigen, die ja auch am Bühnenrand ihre Grenze findet, selbst auch nur Phantome. Aber wir sind NUR FÜREINANDER da. Weil wir für ihn da sind, ist der Spieler, was er darstellt, und zwar so, als wären wir doch gerade nicht da.
Das Theater ist, wie Sie sehen, der Mythos der Unaufrichtigkeit. Wollte man die Unaufrichtigkeit der mauvaise foi ins Leben rufen, müsste man aufs Theater kommen. Derjenige, der mich von Ihnen entfremdet, jener Protagonist des Theaters nämlich, indem er mich meint und zu mir spricht, entdeckt mich doch nie auf die Art und Weise, wie Sie mich sehen könnten, wenn wir uns einander zuwendeten, und auch ich sehe ihn nicht so, wie ich Sie sehen könnte, wenn ich mich Ihnen nur erst einmal selbst auch zeigen würde.
Der erste dergestaltige Protagonist, der so zu trennen vermag, wird vom Menschen üblicherweise Gott genannt. Gott agiert in meiner Welt nicht anders als ein Schauspieler in der Theaterwelt. Das Verhältnis, das ich zu ihm pflege und er zu mir, dient Ihnen und mir als Schablone für das Verhältnis, das wir untereinander haben. Man verstehe mich nicht voreilig falsch: Ich sage weder, es gebe einen Gott, noch behaupte ich, er habe das Theater gestiftet. Genau umgekehrt will ich gesagt haben, dass zuerst die Situation der Unaufrichtigkeit war, eines grundsätzlichen Misstrauens, einer vorzeitigen Verteidigung, einer Vorwegnahme des Bösen, weil Selbst-Zerstörenden in einer Attitüde, der Attitüde der Beobachtung, der Belauschung, des Sehens, ohne gesehen zu werden, des Seins-ohne-Sichtbarsein. Denken wir uns ein Wesen, das so agiert, aber nicht ich selbst bin, dann trifft auf dieses der Terminus Gott zu. Die Beziehung, die wir mit einem solchen Wesen hätten, wurde im Athen des fünften vorchristlichen Jahrhunderts entdeckt und Theater genannt. Theater des Dionysos. Ich glaube nicht, dass es treffender ginge! Die Unaufrichtigkeit ist nur möglich durch die Interferenz von Theaterwelt und meiner eigenen Welt AM GLEICHEN EINEN ORT. Durch den Dithyrambus, Doppelgeborenheit.
Dieser Ort ist keineswegs ein besonders philosophischer. Er ist einfach hier. Zwischen den Marktständen, im Pissoir, vor dem Fernseher, in meinem Traum oder auf dem Schlachtfeld. Ich werde versuchen, den Mechanismus dieser Unaufrichtigkeit, welcher der Mechanismus des Theaters ist, anhand von Woody Allens INTERIORS zu erklären und dabei gleichzeitig zu zeigen, was eine Geschichte wirklich ist.
Wenn für Sie bis hierin das Meiste chinesisch blieb, so bezweifle ich, ob Sie schon jemals ein Theaterstück oder einen Film mit dem nötigen Bewusstsein gesehen haben. Möglicherweise steht Ihnen diese Erfahrung erst noch bevor.
Die Materie gewordene Welt des Voyeurs - das Theater - erhebt die Unaufrichtigkeit zur Institution: Ich lasse mich nicht entdecken und dadurch erkennen als das, was ich bin, weil ich bereits, immer schon, einem höheren Prinzip folge und im fiktiven Theater der Ideen immer schon der Grosse Zuschauer war - genau nach Platons Höhlenmetapher - und meine Grosse Idee schon immer Gott. Das Theater - ob nun aristotelisch-dramatisch oder episch verstanden - verliert diesen seinen Modus nur dann, wenn die eben skizzierte, kategorische Trennung von Schauspieler und Zuschauer - wie im experimentellen Kleintheater - sich auflöst. Dann und nur dann wird plötzlich der Nächste wieder zur Gefahr. Das Spiel von Festgenageltsein und Überstieg, von Faktizität und Transzendenz fängt wieder an. Ich wäre dann augenblicklich wieder für alles verantwortlich, für das, was ich erfahre ebenso, wie für das, was ich andere erfahren mache, das heisst auch gleich, dass ich dann für die Lage im und ums Theater zur Verantwortung gezogen werde. Diese Verantwortung wird glücklicherweise nicht eingefordert, da sich parallel dazu das Theater gleichsam verflüchtigt. Die Interferenz von Theaterwelt mit meiner eigenen Welt geht gerade an der Vermischung von Bühnenwelt und Zuschauerwelt zugrunde. Das wissen die Kleintheaterleute nicht, weil sie - wie alle Leute – keine Ahnung davon haben, dass durch die schärfste Trennung die grösste Einheit erzielt wird: Wie könnte ich die Wonne des Kusses erfahren, wenn sich die Lippen der Geliebten in die meinigen auflösen würden?
WOODY ALLENS INTERIORS, DIE PERFEKTE GESCHICHTE
(Februar 1979). Es fällt uns die Aufgabe zu, zugleich das Handlungsgerüst und die Typenanalyse des Films zu entwerfen. Ich setze hier übrigens voraus, dass Sie über die gängigen Kriterien der Dramaturgie und des Script Writings einigermassen im Bild sind, nicht weil ich auf solche Kenntnisse zurückkommen möchte, sondern um mit meinen Ausführungen jenen entscheidenden Kontrast zu geben, der Sie auf das hinweisen müsste, was ich letztendlich sagen will: Die Story ist nie das, was man in der Dramaturgie und in der Rezension dafür hält.
Die folgende Untersuchung ist existentialistisch, was nicht zufällig ist, aber auch nicht meinem persönlichen Geschmack entspricht. So wie eine Autopanne mit den Mitteln behoben wird, die einem Automechaniker zur Verfügung stehen und nicht etwa mit solchen, die ein Romanist oder Teilchenphysiker verwendet, so ist relativ rasch einzusehen, dass die existentiale Analyse hier, im Falle von Allens «Bergmann-Film» (ein, wie sich herausstellen wird, Kastratenklichee der sich als filmkritisch verstehenden, idealistischen Oberflächlichkeit unserer Zeit) die wohl adäquateste ist. Sollte sie nicht zum Ziele führen, mag man im Anschluss an sie Besseres zur Anwendung bringen und dabei im Auge behalten, was überhaupt zu erklären ist: die vollständige Logik der Geschichte. Wenn man bestreitet, dass es der Film- und Theaterkritik gerade um diese zu tun sein muss, so wird man auch sofort bestreiten müssen, dass es dem Automechaniker darum gehe, die vollständige Logik des defekten Maschinenteils - angesichts eben dieses Defekts - in Anwendung zu bringen.
Eine existentialistische Analyse trennt nicht zwischen den Charakteren und dem Handlungsablauf einer Geschichte. Wie man schon bei Aristoteles - geschweige denn bei auf ihn folgenden Kritikern und Theoretikern - nachlesen kann, lässt sich diese Trennung nicht rechtfertigen. Wenn, wie bei Aristoteles, der Charakter der Akteure aus ihren Akten folgt, oder wenn Didérot sagt: Il ne faut point donner d'esprit à ses personnages, mais savoir les placer dans des circonstances qui leur en donnent, so zeigt sich hier nur das alte Diktum Heraklits, dass nur in den uns umgebenden Dingen, nicht aber in uns Verstand sei, als eine simple Wahrheit, die den Theatermacher und -kritiker unmittelbar angeht. Auf der etwas fragwürdigen, oberflächlicheren Ebene, auf der man das Scriptwirting normalerweise lernt und lehrt (z.B. nach Herman) mag es so aussehen, als gebe es ein zu findendes Gleichgewicht zwischen Aktion und Charakter, so dass zu viel Aktion die Akteure zu Puppen mache, und dass zuviel Charakter die Aktion versiegen lasse und die intrinsische Geschwindigkeit der Geschichte verlangsame. Dieser oberflächliche Gesichtspunkt ist dann zulässig, wenn man unter einer Geschichte das versteht, was sich - wenn man den Film oder das Stück gesehen hat - nacherzählen lässt.
Die Typen, das ist der Film - und der Film, das sind die Typen! Davon werde ich hier ausgehen, und ich werde im Anschluss an die Analyse von Woody Allens Film Becketts Endspiel vornehmen, um Ihnen zu zeigen, dass die eigentliche Geschichte weder das ist, was man als Narration oder umgesetzte histoire, noch das, was man überhaupt als histoire bezeichnet hat sein kann, sondern ein die Sache selbst konstituierender Plot, den man sowohl statisch, als Bild, sehen kann, als auch dynamisch, als Szenario. Zunächst hingegen bitte ich Sie, eine - ich möchte sagen: deskriptiv-kausalistische, kurz: deskriptive - offizielle, veröffentlichte Filmbeschreibung und -würdigung zu lesen, die das von mir kritisierte und als unerheblich verworfene Kritikschema vertritt, das den State of the Art kennzeichnet:
«Eine zerbrochene Ehe: Die Welt, in der Arthur und seine drei Töchter während Jahren gelebt hatten, erscheint dem gealterten Mann in der Rückschau als eine Schöpfung von Eve (Geraldine Page), seiner Frau: Die von ihr geschaffene Welt sei voller Harmonie und Würde gewesen, erklärt er, 'wie ein Eispalast'. Nachdem seine Töchter erwachsen geworden sind, bricht Arthur eines Tages aus diesem Eispalast aus: Er verlässt Eve, die darauf einen Zusammenbruch erleidet und in eine Klinik eingewiesen werden muss. Nach ihrer Entlassung hält sie nur noch die Hoffnung am Leben, ihr Mann werde eines Tages wieder zurückkehren und ihre mütterliche Wärme benötigen. Arthur jedoch kehrt von seiner Italienreise mit der extrovertierten, oberflächlichen und aufdringlichen Pearl (Maureen Stapleton) zurück, die er nach erfolgter Scheidung heiraten will. Der Hauptteil des Films besteht in der geduldigen Beobachtung des Verhaltens der drei Töchter Flyn (Kristin Griffith), Joey (Mary Beth Hurt) und Renata (Diane Keaton) zu ihrer Mutter während dieser Ereignisse, wobei verschiedene Rückblenden auch in die Jugendzeit der drei Frauen zurückführen. Das grösste Verständnis bringt Joey der Mutter entgegen, obwohl diese früher immer Renata bevorzugt hatte. Wie sich Eve nach dem Zusammenbruch der heilen Welt im Meer das Leben nimmt, will Joey ihr nachfolgen, wird aber vom Mann der Schwester gerettet und ausgerechnet von der verabscheuten Stiefmutter durch künstliche Beatmung ins Leben zurückgeholt.»
Das Ganze sieht, so betrachtet, recht beliebig aus. Der Alte zieht aus, als seine Vaterpflichten erfüllt sind. Da seine Frau eine intellektuelle, kultivierte, introvertierte Dame ist, sucht er jetzt den Ausgleich bei Pearl. Die drei Töchter - wen wundert's? - verhalten sich jede anders als die andere der Mutter (und dem Vater) gegenüber. Natürlich erleidet die Mutter Eve ein bisschen mehr als nur eine Krise (wir sind im Film), und sie begeht Selbstmord. Warum nicht, das ist ihr gutes Recht? Könnte ja sein, dass, wenn man so ist wie diese Eve, man sich im Anschluss an das, was hier passiert, umbringen muss?
Kann das dem Publikum genügen? Der Kritiker ist der Meinung: ja. Wir sind der Meinung: nein. Würde es sich hier nicht um einen Woody Allen handeln, sondern beispielsweise um Ben Hur, Some Like It Hot oder eine Ganghofer-Verfilmung, wäre für mich auch klar: So geht das nicht. Da wird weder die Geschichte nacherzählt, noch geht es hier um so etwas wie Film. Es bleibt dunkel, ob hier Der Wolf und die Sieben Geisslein erzählt wird, oder das, was sich zwei Frauen, die vor dem Postschalter warten zuflüstern. Zunächst müsste man wissen, dass es sich hier um einen Film handelt. Man gibt oben den Kaffee ein, dann drückt man auf den roten Knopf, wartet, bis das einsetzende Rattern eine aggressivere Qualität annimmt, dann drückt man noch einmal auf den roten Knopf. Anschliessend Deckel heben. Mit dem Löffel gemahlenen Kaffee entnehmen. So etwa sähe eine analoge Kritik oder Funktionsbeschreibung für eine neue Kaffeemühle aus. Man merkt: Filme sollen nicht anders verkauft werden – und auch nicht anders begriffen werden – als Kaffeemühlen. Der Eine mag’s, der Andere nicht. Alles ist subjektiv, und relativ ist es sowieso. Protagoras lässt grüssen.
Die meisten Filmkritiker kennen zwar Protagoras nicht. Der scheint, obwohl einer der Stammväter der Relativismen, mit denen man auf billige Weise Geist zeigen kann (und darf), nicht interessanter zu sein als die Frage, was denn eine Geschichte sei. Ich kenne kein Metier, das so oberflächlich gehandhabt wird (von Professionellen) wie die diversen Formen der Kritik, dabei wäre doch mit ihr alles zu machen, würde man sich nur etwas mehr Mühe geben. Wenn ich etwas von der Art, wie es der oben abgedruckte Text präsentiert, jemandem über einen Film erzähle, dann habe ich das deutliche Gefühl, überhaupt nichts gesagt zu haben. Warum sagt man es dann? Steckt dahinter nicht eine ungeheuerliche Arroganz? Versteckt sich hinter der Maske der relativistischen Demut nicht der Hochmut an und für sich?