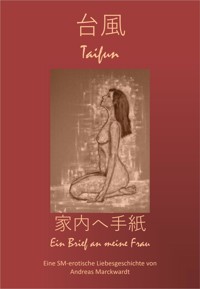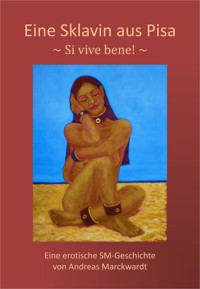2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Erotik
- Sprache: Deutsch
Sechs Jahre sind inzwischen vergangen, seit Andreas und Valentina sich kennengelernt haben. In Giannis abgelegenem Wochenendhaus, tief in den Apuanischen Alpen. Valentina hat ihren Beruf weitgehend aufgegeben und widmet sich neben dem Haushalt nur noch ihrer Glasbläserei. Eva steckt mitten in der Pubertät, und das Verhältnis zu Valentina ist entsprechend angespannt. Eigentlich hatte Andreas gehofft, bei einem Urlaub in den Cevennen würden sich die Dinge etwas beruhigen. Bis dort unerwartet sein Freund Gianni auftaucht - mit einer beunruhigenden Nachricht. Es geraten Dinge ins Rollen, die Andreas Schritt für Schritt begreifen lassen, was Valentina dunkles, streng gehütetes Geheimnis ist, und warum sie nie über die Zeit vor ihm reden wollte. Am Ende ist es Gianni, der sich als echter Freund erweist und den beiden den Weg ebnet zu einer gemeinsamen Zukunft. *** „Valentina, bei Fuß!“ befahl er leise, als die beiden endlich allein in ihrem Schlafzimmer waren. Sofort ließ sie das Nachthemd, das sie gerade überstreifen wollte, fallen, trat vor ihn und ließ sich auf die Knie sinken. „Wie wollt Ihr Eure Dienerin gebrauchen, Herr?“ fragte sie und schaute dabei zu ihm auf. Der Blick aus ihren fast schwarzen Augen, wenn sie so ergeben vor ihm kniete, raubte ihm auch nach all der Zeit, die sie nun zusammen waren, immer noch den Atem. Er war, als würde darin ein kaltes Feuer lodern, das ihn dennoch unweigerlich verzehrte, wäre er nur einmal unachtsam. Er bückte sich, ergriff ihre Hände und bedeutete ihr, sich zu erheben. „Ich will,“ begann er heiser und schluckte, „ich will, daß du deinen Schoß für mich öffnest.“ Er wunderte sich darüber, wie seltsam schwer es ihm manchmal immer noch fiel, ihr einen direkten Befehl zu geben. Manchmal beschlich ihn der Verdacht, das könnte so bleiben, würde sich nie ändern. „Zieh dich aus!“ befahl er ihr schließlich nach diesem kurzen Moment der Befangenheit. „Leg dich aufs Bett, ganz offen!“ Dann küßte er sie sanft auf die Schläfen. „Ja, Herr,“ entgegnete sie nur. Blitzschnell zog sie den Schlüpfer und die Söckchen aus und glitt auf das Bett. Dort spreizte sie weit ihre Schenkel, hob die Arme über den Kopf und sah ihm direkt in die Augen. Andreas riß sich die Kleider vom Leib. Ihr Gehorsam, der doch auch immer ein Gefühl von mühsam gebändigtem Trotz und Widerspruch ahnen ließ, vermochte es immer, ihn aufs heftigste zu erregen. Schwer atmend, wohl auch ein wenig vom Wein, kam er über sie und drang sofort in sie ein. ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Niemandsland Trilogie
Teil 3: „Niemandsland“
von
Andreas Marckwardt
Copyright (c) März 2013 by Andreas Marckwardt
E-Book
Niemandsland Trilogie:
Teil 1: „Taifun – Ein Brief an meine Frau“
Teil 2: „Eine Sklavin aus Pisa“
=> Teil 3: „Niemandsland“
Niemandsland ©2013 Andreas Marckwardt, All rights reserved
Weitergabe, Veröffentlichung, Abdruck, Vervielfältigung oder die elektronische Speicherung bzw. Verarbeitung in elektronischen Datenbanken (auch auszugsweise) bedürfen der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung des Autors.
Umschlagbild © 2013 Midori Hanako, All rights reserved
Weitergabe, Veröffentlichung, Abdruck, Vervielfältigung oder die elektronische Speicherung bzw. Verarbeitung in elektronischen Datenbanken (auch in abgeänderter Form oder Farbgebung) bedürfen der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung des Künstlers und seines Modells.
Rev03_2023_Sep_13 (letzte Überarbeitung)
Impressum:
Titel: © Copyright by
Andreas Marckwardtc/o Block ServicesStuttgarter Str. 10670736 [email protected] Rechte vorbehalten.Tag der Veröffentlichung: 24-Feb-2013
Bitte erlaubt mir an dieser Stelle einen Hinweis in eigener Sache.
Wer eBooks unabhängiger Autoren „kostenfrei“ herunterlädt schädigt nicht Amazon oder Thalia oder sonst einen großen Verleger, sondern er schädigt vor allem und unmittelbar den Autor. Er nimmt fremdes Eigentum zum eigenen Nutzen an sich und macht sich dadurch im besten Sinne des Wortes zum Dieb.
Wer eBooks unabhängiger Autoren auf so genannten „Piratenplattformen“ zum kostenfreien Download anbietet, schädigt ebenfalls nicht Amazon oder Thalia oder sonst einen großen Verleger, sondern vor allem und unmittelbar den Autor. Er ist ganz sicher kein Kämpfer für die Freiheit des Wortes, schon gar nicht für die Freiheit der Autoren, sondern schlicht und ergreifend ein Dieb und Hehler, der sein Geschäft mit gestohlenen Gütern betreibt und so die Urheber der Werke um die Früchte ihrer Arbeit betrügt. Weil er selbst nicht fähig ist, mit Kreativität und Anstrengung ein eigenes Werk zustande zu bringen.
Du gibst 9 Euro aus für „einen doppelten, entkoffeinierten Mokkachino ohne Zucker mit fettarmer, laktosefreier Milch,“ der binnen Sekunden aus einer Patrone gepreßt und dir liebevoll und stilecht in einem Pappbecher vor die Nase geknallt wird, auf den immerhin dein Name gekritzelt wurde? Aber die gleichen 9 Euro für ein Buch, dessen Autor sich mehr als ein Jahr Arbeit damit gemacht hat, sind dir zu viel? Hoffentlich nicht!
Denn, um ein altes Sprichwort abzuwandeln:„Charakter ist eine Zier, doch es geht auch ohne ihr.“
Allen anderen wünscht der Autor ein ungetrübtes Lesevergnügen an einem ehrlich verfaßten und genau so ehrlich erworbenen Buch! :-)
Andreas Marckwardt
Inhalt
Inhalt
Nachtgedanken
Bacchus und Orlando
Das Privileg, eine Frau zu sein
Der Gesang von Männern
Der Gesang der Nachtigall
Nach St.André de Vézines
Feen und Geister
Freunde und Gespenster
Fischer und Helden
Tagträume und ein Junge aus Straßburg
In der Gesellschaft von Wölfen
Pandoras Schatzkästlein
Die Bürde, eine Frau zu sein
Ein unerwartetes Impromptu
Ein unerwarteter Besuch von Freunden
Kochen ist Männersache
Ein altes Versprechen
Was des Bedauerns würdig ist
Ein Untoter stirbt
Silberne Hände
Frühstück mit Sonnenbrille
Mutter Erde entführt eine Tochter
Strafe muß sein!
Zwei Wochen in den Alpe Apuani
Die Heimat der Zugvögel
Das Geschenk
Ich danke
Weitere Bücher von Andreas Marckwardt
Sie kam in einen großen, wilden Wald,da kniete sie nieder und ihr erschien ein Engel, der führte sie zu einem kleinen Haus,daran war ein Schild mit den Worten:
»Hier wohnt ein jeder frei«
(Gebrüder Grimm)
Es war einmal, im Südwesten Deutschlands ...
Nachtgedanken
Im Osten trug der Himmel bereits dunkelblauen Samt. Nach Westen hin ging er in hellen Türkis über, bis schließlich ein dunkles Orange am Horizont verriet, daß die Sonne erst vor kurzem untergegangen war. Im Südosten zeigte sich hoch am Himmel ein erster, strahlend heller Stern. Jupiter, dachte Andreas und blinzelte in den Himmel bei dem vergeblichen Versuch, mit bloßem Auge das Scheibchen des Planeten aufzulösen. Meine Augen lassen nach, dachte er und nahm seufzend sein Weinglas. Es war leer. Er wollte gerade aufstehen, als Valentina aus dem Haus kam. In der einen Hand hielt sie einen Teller mit Oliven und Käse, in der anderen ein leeres Glas und einen Kanten Weißbrot, und unter einen Arm hatte sie eine Flasche Chianti geklemmt. Sie machte es sich in einem Stuhl bequem, ihm gegenüber an der anderen Seite des Tisches, richtete sich ein Glas Wein und begann, zu essen. Dabei balancierte sie den Teller auf ihren angezogenen Knien. Die Flasche hatte sie direkt neben ihr eigenes Glas gestellt und Andreas dabei keines Blickes gewürdigt.
„Danke,“ sagte Andreas mit ironischem Unterton und angelte über den Tisch hinweg nach der Weinflasche. Valentina warf mit einem eleganten Schwung ihres Kopfes das schwere, schwarze Haar nach hinten und tat so, als sei er Luft. „Aha!“ stellte Andreas leise fest, während er sich seinen Wein einschenkte, „sind wir also beleidigt!“ Er hob die Schultern und ließ sie gleich wieder sinken. „Auch gut. Schweigen wir eben miteinander. Zum Reden ist es eh noch zu warm.“ Die roten Klinker, mit denen die Terrasse ausgelegt war, hatten die Hitze des Tages in sich gespeichert und gaben sie nun langsam wieder ab. Es war vollkommen windstill, und Andreas hatte – einzige Möglichkeit der Kühlung – die Markise eingeholt. Er trank einen Schluck Chianti, legte den Kopf nach hinten und schloß die Augen. Er mochte diese Abendstimmung nach einem heißen Sommertag, liebte das Zirpen der Grillen, den schweren Duft von Gräsern und Blumen. Irgendwo bellte ein Hund. Ein paar Kinder spielten noch auf der Straße. Von Norden her drangen die unvermeidlichen Geräusche der Zivilisation als leises Rauschen bis zu seinem kleinen Reich am Rand der Kleinstadt vor. Der Rauch der vielen, meist zu ungeduldig betriebenen Grillfeuer hatte sich längst wieder verzogen. Und bald, wenn die Kinder von ihren Eltern nach Hause gerufen wurden, würde Ruhe einkehren. Nur noch gelegentlich unterbrochen von einsamen Mopeds, mit denen halbstarke Jungs hin und wieder durch das Viertel jagten, auf der Suche nach sich selbst, vielleicht auch nach einem flüchtigen Blick auf eines der Mädchen – mit etwas Glück sogar auf ein ganz bestimmtes der Mädchen – die hier im Viertel wohnten, und die kraft eines seltsamen Zufalls offenbar alle just in diesem Jahr in eben jenes Alter gekommen waren, in dem sie eine unwiderstehliche Anziehungskraft auszuüben schienen auf Moped fahrende Jungs.
Allerdings fühlten sich die Jungs in ihren eigenen Reihen doch immer noch deutlich sicherer. Andreas‘ Gedanken wanderten zurück in die Zeit, als er selbst ein Moped hatte. Bei den Mädchen wußte man einfach nie so recht, woran man war und was sie wollten. Obwohl – irgendwie interessant waren die Weiber ja schon. Und der geringschätzige Ausdruck, mit dem sie von den Jungs bedacht wurden, war zumindest insofern Ausdruck der Anerkennung, als er eine unbestimmte Furcht verriet vor dieser seltsamen Gattung, die man noch so wenig verstand, und zu der man sich doch so sehr hingezogen fühlte. Auch wenn die anderen Jungs rumspöttelten und kicherten. Vielleicht waren sie ja auch bloß neidisch. Die Jungs hingegen wurden von den Mädchen eher als Angehörige einer primitiven Rasse angesehen. Man konnte beim besten Willen nicht ausmachen, was sie dachten oder empfanden. Grob waren sie, lautstark, verschlossen und kindisch, manche waren sogar ungepflegt und rochen. Andreas schmunzelte leise bei dem Gedanken an Evchens gelegentliche Schilderungen seiner jungen Geschlechtsgenossen, und ein Gedicht Heinrichs von Kleist fiel ihm ein:
Träumt er zur Erde, wen,Sagt mir, wen meint er?Schwillt ihm die Träne, was,Götter, was weint er?Bebt er, ihr Schwestern, was,Redet, erschrickt ihn?Jauchzt er, o Himmel, wasIst’s, was beglückt ihn?
Das Evchen, seine eigene Tochter, die gerade vierzehn geworden war, und die niemals, unter keinen denkbaren Umständen zugeben würde, daß sie hinter diesen Fragen heimlich andere, bessere Antworten vermutete als Fußball, Mopeds und Kraftmeiereien. Jungs waren vorerst noch doof, unterbelichtet, grob und unflätig. Voll kraß hieß das in ihrer Sprache.
„Son‘incavolato nero!“ Die knapp vorgebrachte Bemerkung genügte, Andreas jäh aus seinen Gedanken zu reißen, und er atmete erst einmal tief durch, wie um sich zu orientieren.
„Aha,“ entgegnete er und hatte dabei erneut einen ironischen Tonfall in der Stimme, „Madame sind also stinksauer. Gut. Und darf ich auch wissen warum?“
Valentina stellt ihren Teller ab, warf ihn förmlich auf den Tisch, setzte sich aufrecht hin, dann verschränkte sie die Arme vor der Brust, senkte den Kopf und blickte zornig hinüber zu den unschuldigen Pappeln am Fluß, die sich schwarzgrün gegen den Horizont abzeichneten. Das Orange hinter ihnen war mittlerweile einem dunklen, tiefroten Glühen gewichen. Aber sie gab ihm keine Antwort.
Andreas erhob sich, nahm die Öllampe von der Wand und stellte sie auf den Tisch. Er betastete suchend seine Hosentaschen. Eine ebenso erfolglose wie unausrottbare Geste, seit er sich vor Jahren das Rauchen abgewöhnt hatte. Den Griff zum Tabak hatte er längst abgelegt, aber Streichhölzer suchte er immer noch da, wo er sie früher immer mit sich getragen hatte. Wortlos warf ihm Valentina ihr Feuerzeug auf den Tisch. „Danke, Liebes,“ sagte Andreas leise und zündete damit die Lampe an. Er füllte beide Gläser nach, zuerst sein eigenes, dann, nach kurzem Zögern, auch ihres, und nahm wieder Platz.
„Ich bin nicht dein Liebes!“ Valentina nahm einen kleinen Schluck Wein und stellte dann, anders als noch kurz zuvor ihren Teller, das Glas behutsam zurück. „Mußtest du unbedingt den – wie sagt man àrbitro?“ Andreas schüttelte unwissend den Kopf. „Sport, Fußball, schwarzer Mann mit Pfeife,“ umschrieb sie im Stakkato den Begriff, der ihr gerade fehlte. „Du meinst wohl den Schiedsrichter?“
„Si, den meine ich. Mußtest du unbedingt den Schiedsrichter machen?“ Und nach einem kurzen Moment des Überlegens fügte sie grollend hinzu: „Dazu hattest du kein Recht!“
Andreas schüttelte den Kopf. „Du, ich habe nicht Schiedsrichter gespielt.“
„Hast du wohl!“ fiel sie ihm ins Wort. „Du hast dich eingemischt! Und wie du das getan hast! Dabei ging dich das Ganze überhaupt nichts an!“ Valentina sprach leise, hob nicht die Stimme, aber die Verärgerung war ihr deutlich anzuhören.
Andreas schüttelte leise lachend den Kopf. „Ein Schiedsrichter entscheidet, wer im Recht ist, und bestraft den, der gefoult hat. Beides habe ich nicht getan.“
Valentina widersprach sofort. „Doch, genau das hast du! Sie hat mich beleidigt, hat mich eine Puttana genannt, und als ich sie dafür zurechtgewiesen habe…“
Doch nun hob Andreas bestimmt und keinen Widerspruch duldend die Hand. „Sie hat dich nicht eine Nutte genannt. Sie hat Tusse zu dir gesagt, das ist etwas anderes. Auch nicht schmeichelhaft und keineswegs akzeptabel, aber immer noch um Längen von der Nutte entfernt. Und du hast sie im übrigen auch nicht zurechtgewiesen, du hast ihr eine runtergehauen.“
Valentina warf ihm einen giftigen Blick zu. „Nutte, Puttana, Tusse, wo ist der Unterschied, èh? Sie behandelt mich wie ein Stück Dreck, wie eine Putzfrau, und du stellst dich vor sie und verteidigst sie auch noch. Bin ich das für dich? Ein Stück Dreck?“
Andreas schüttelte den Kopf. „Nein, das bist du natürlich nicht.“
„Gut. Warum verteidigst du sie dann, wenn sie mich behandelt, als wäre ich eine Putzfraunutte?“ Andreas rieb sich heftig den Nacken und zog die Luft durch die Zähne.
„Valentina, erstens tut sie das nicht. Und zweitens habe ich sie nicht verteidigt. Ich bin dazwischen gegangen, als euer Streit eskaliert ist. Ich dulde nicht…“ Er hob die Hand um einen neuerlichen Einwand ihrerseits abzuwehren. „Laß mich bitte ausreden. Ich dulde nicht, daß sie dich eine Tusse nennt oder in sonst einer Form beschimpft oder beleidigt, Okay? Ich dulde aber auch nicht, daß Streitigkeiten in meinem Haus mit Ohrfeigen ausgetragen werden.“
Valentina schaute grimmig vor sich hin. „Dein Haus,“ sagte sie abfällig. „Wäre ich ihre Mutter, hättest du nicht so reagiert. Du hast ihr selbst schon den Hintern verhauen, wenn sie sich daneben benommen hat.“
Andreas schüttelte den Kopf. Er mußte sich zusammennehmen; der Hinweis auf Evas Mutter lies einen Anflug von Zorn in ihm aufsteigen, den er mit einem heftigen Atemzug quittierte. „Das ist schon lange Jahre her,“ sagte er leise, „Und die zwei, drei Male, wo ich die Beherrschung verloren habe, habe ich mich bei ihr entschuldigt. Es war damals schon nicht recht. Mittlerweile ist sie vierzehn und hat ein Recht darauf, wie eine Erwachsene behandelt zu werden. Und Ohrfeigen sind völlig daneben.“
„Seltsame Logik,“ murrte Valentina. „Aber gut. Meinetwegen. Nur, dann soll sie sich aber auch selbst so benehmen, als wäre sie erwachsen!“
Andreas dachte eine Weile nach. „Okay, in dem Punkt gebe ich dir recht: Sie benimmt sich gerade etwas strano. Aber auch nicht verrückter als andere Mädchen in dem Alter. Mit vierzehn, darauf möchte ich wetten, warst du auch nicht viel besser. Waren wir alle nicht.“ Für einen kurzen Moment spielte er mit dem Gedanken, an das Verständnis zu appellieren, das sie aufbringen müßte, wäre sie tatsächlich Evas Mutter, verwarf den Gedanken aber gleich wieder. Es wäre völlig unangemessen. Valentina entgegnete nichts, und er wertete dies als Zustimmung.
Eva war nachmittags nach Hause gekommen, hatte ihre Schultasche im Flur auf den Boden geknallt, wo sie sie meistens einfach liegenließ, war dann grußlos an Valentina vorbei geradewegs ins Wohnzimmer geschlurft und hatte sich dort, so wie sie war, mit ihren unsäglichen, total verkommenen Segeltuchschuhen aufs Sofa gefläzt, um die neueste Bravo zu verschlingen. Als sie dann auch noch zum Telefon gegriffen hatte, um sich mit ihrer besten Freundin kurzzuschließen – ein Vorgang, der erfahrungsgemäß unter zwei Stunden Dauer keinen Abschluß finden würde, zumal sie besagte Freundin seit mindestens zehn Minuten nicht gesehen und folglich auch nicht gesprochen hatte – war Valentina der Kragen geplatzt. Was folgte, war zuerst die Aufzählung aller Verhaltensfehler der letzten fünf Minuten, jeweils gefolgt von mindestens einer patzigen Antwort. Daraus entwickelte sich dann eine dieser für Andreas nie so recht nachvollziehbaren Grundsatzdebatten. Fest entschlossen, sich seinen ersten Urlaubstag nicht vermiesen zu lassen, hatte er selbst nicht darauf reagiert, sondern hatte wortlos die Markise ausfahren lassen und war auf die Terrasse gegangen. Er hatte die selbst auferlegte Zurückhaltung in seinem Stuhl auf der Terrasse dann auch trotz des immer hitziger werdenden Streits durchgehalten. Bis eben zu dem Moment, als Eva lautstark verkündete, Valentina sei schließlich nicht ihre Mutter und habe ihr daher exakt gar nichts zu sagen. Überhaupt, was ihr einfalle, sich hier so aufzuspielen. Sie sei doch bloß irgend so eine Tusse, die hier wohne und…
Weiter war sie nicht gekommen. Ein kurzes, hartes Klatschen hatte den Disput abrupt unterbrochen und gleichsam eine Atempause entstehen lassen. Auf diese folgten ein lauter Aufschrei und eine Reihe weiterer Schimpfworte, diesmal gemischt: Die im hellen, heulenden Diskant vorgetragenen auf deutsch, die in dunklerem Alt, nicht minder erregt klingenden, auf italienisch. Da war es ihm dann doch zu bunt geworden, und entgegen seiner ursprünglichen Absicht war er dazwischen gegangen. Eva hatte sich eine kurze, aber unmißverständliche – und vor allem unüberhörbare – Abfuhr eingefangen, verbunden mit der ebenso unmißverständlichen Aufforderung, erstens sofort auf ihr Zimmer zu gehen, sich zweitens für den Rest des Tages besser nicht mehr blicken zu lassen, und drittens der ultimativen Order, ja nicht das Telefon zu blockieren – sie hatte einen überlebensnotwendigen Anschluß in ihrem Zimmer. Valentina hingegen war von ihm recht barsch darauf hingewiesen worden, daß sie sich mit ihren fünfunddreißig Jahren gefälligst benehmen solle wie eine Erwachsene und sich insbesondere nicht prügeln solle wie ein Gassenweib. Woraufhin beide Damen mit pathetischer Geste den Schauplatz der Auseinandersetzung verlassen hatten. Er war ein weiteres Mal zurückgeblieben mit dem unbestimmten Gefühl, schuldig zu sein. Obwohl er sich diesmal ziemlich sicher gewesen war, daß er nichts grundsätzlich Falsches getan hatte. Eine Ansicht allerdings, die er – nach seinen jüngeren Erfahrungen zu schließen – höchstwahrscheinlich mit keinem im Haus teilen würde außer mit sich selbst. So lange, bis der Zorn verraucht war oder der nächste Krach kam. Dazwischen gab es dann für ihn höchst verwirrende Momente, in denen das Evchen und Valentina sich prächtig zu verstehen schienen – und er sich fühlte wie die Katze, der zwar im Grunde das Haus gehört, die dort aber nicht wirklich etwas zu sagen hat.
Es war nicht das erste Mal, daß er ohne es zu wollen und ohne es verhindern zu können, zwischen die Fronten eines Krieges geraten war, den er nicht verstand. Und von dem ihm niemals klar wurde, weshalb und worum genau er eigentlich geführt wurde. Er konnte weder vorhersehen, wann er aufflammen würde, noch verstand er die Mittel der Kriegführung, die angewendeten Strategien und die unterschiedlichen Arten der Waffenführung in den manchmal offenen Schlachten, manchmal zermürbenden Grabenkämpfen. Das war doch Eva, sein kleines Evchen – sie mochte es schon lange nicht mehr, wenn er sie so anredete. Und so unbequem ihm diese Einsicht war: Gewisse Veränderungen waren selbst für ihn nicht zu übersehen. Sie war groß geworden. Über Nacht war sie groß geworden, fast so groß wie er selbst. Längst schon überragte sie Valentina. Sie war schlank, hochgewachsen, mit elfenartigen Gliedern, schmalen Gelenken und langen, feingliedrigen Händen. Und doch war da auch etwas anderes mit ihr geschehen. Sie hatte einen kleinen, zarten Busen entwickelt. Wenig üppig zwar, ähnlich dem ihrer Mutter, aber eben doch unübersehbar. Auch wenn sie diesen ersten Ansatz von Fraulichkeit vor allen anderen und – so zumindest sein Eindruck – insbesondere vor ihrem Vater tunlichst zu verbergen suchte. Meistens trug sie zu diesem Zweck eines ihrer unsäglichen, sackförmigen T-Shirts. Dazu Jeans und Segeltuchschuhe, die aussahen, als hätte sie ihre Klamotten aus der Altkleidersammlung geklaubt.
Doch es war noch keine Woche her, da lief sie ausnahmsweise und nur von der extremen Hitze dieses in vielerlei Hinsicht verrückten Sommers getrieben im Haus umher mit einem dieser gerade angesagten Bikinis, die als Höschen eine Art Hüft-Hot Pants hatten, welche knapper nicht mehr geschnitten sein dürften. Und dabei war ihm zum ersten Mal aufgefallen, daß sie eine Taille entwickelt hatte, daß es nicht mehr der eher konturlose Körper war, mit dem vorgestreckten Bauch des kleinen Mädchens, den er früher immer gekitzelt hatte, wobei sie dann gejauchzt und gekräht hatte vor Vergnügen. Sie hatte unbestreitbar eine feminine Figur bekommen. Noch nicht sehr feminin, aber doch schon unverkennbar weiblich. Und mit der Figur hatte sich zugleich auch ihr Gang verändert. Nicht mehr das unbeschwerte, kindliche Hüpfen, an das er sich so gern erinnerte, und mit dem sie ihm früher entgegengeeilt war, um ihm dann um den Hals zu fallen und sich auf seinen Arm nehmen zu lassen, wobei sie sich um seinen Nacken klammerte, als wolle sie ihn erdrücken. Nein, sie hatte sich gleichfalls über Nacht diese manchen Frauen eigene Art der Bewegung angeeignet, bei der die Füße den Boden kaum zu berühren schienen, und die langen, schlanken Beine, trotzdem sie schwungvoll ausgriffen, die Hüften sich sanft und kaum merklich wiegen ließen. So daß es den Anschein hatte, als glitte sie engelsgleich auf einer weichen, weiten Welle dahin. Ein Anblick, der ihn für die Dauer eines verstörenden Moments an ihre Mutter erinnerte; auch sie verstand es, zu gehen wie ein Engel über eine Nachtwiese. Was er jedoch sofort und energisch wegschob. Nein, das konnte nicht sein! Das war doch Quatsch, nichts als bloße Einbildung! Nicht sein Evchen! Dazu war es doch noch viel zu früh! Ihre Art, das lange, blonde Haar mit einer schwer zu beschreibenden Geste von Kopfbewegung über die Schultern zu werfen und ihn dann anzublicken, mit einem kurzen, ernsten Blick, so als wisse sie…
Der wissende Blick mancher Frauen. Dagegen war er schon immer machtlos gewesen.
Aber nein, das mußte alles bloß Einbildung sein. Er redete sich ein, selbst dahinter noch immer sein Evchen zu sehen. Hatte sie ihn schließlich nicht schon damals auf die gleiche Weise angesehen, als den beiden nur schmerzhaft, langsam, Schritt für Schritt klar wurde, daß sie fortan eine Familie zu zweit sein würden? Und da war sie doch auch nichts weiter als sein Kind, sein kleines Kind, sein Holzpferdchen. Sein Fünfzigpfennig-Mädchen, das jeden Morgen noch zu ihrem Papa ins Bett schlüpfte, kuscheln wollte und unbedingt von ihm wissen wollte, wie es im Himmel aussieht, und wo der denn ist. Und das nachts schlechte, böse Träume hatte und bei nächtlichem Gewitter überhaupt nicht anders einschlafen mochte als ihren Rücken dicht an Papa gepreßt und fest von seinem Arm gehalten. Dann fiel ihm ein, daß sie erst damit aufgehört hatte, als Valentina ins Haus gekommen war.
Doch er wußte insgeheim, auch wenn er dies niemals, unter keinen denkbaren Umständen zugegeben hätte, daß er sich belog. Er wußte in den heimlichen Kammern und Winkeln seiner Gedanken, daß er nicht viel besser war als ein Napoleon, der bei Waterloo inständig hoffte, die Sonne möge heute ausnahmsweise einfach etwas später oder am besten gleich überhaupt nicht aufgehen. Weil er in der dann beginnenden Schlacht unvermeidlich unterliegen und sich geschlagen geben mußte. Aber noch war es nicht sein Krieg. Noch nicht. Er betrachtete Valentina, die angestrengt die Stirn in Falten legte und nach wie vor dreinschaute, als seien die reglosen Pappeln schuld an allem Ungemach.
„Was weißt du schon!“ antwortete Valentina. die Antwort beunruhigte ihn etwas, ohne daß er sagen konnte, warum.
„Und außerdem bin ich kein Kind! Schon gar nicht deines, merk dir das!“
Er sah Valentina fragend an.
„Na von wegen dem ich solle mich erwachsen benehmen.“ Sie äffte ihn nach. „Was fällt dir eigentlich ein, so etwas zu sagen!“ schimpfte sie leise. „Noch dazu, wenn deine Tochter gerade daneben steht und mich beleidigt und so tut, als sei ich ihr Dienstmädchen! Putzfraunutte…“
Es dauerte eine Weile, bis Andreas leise antwortete: „Es war nicht erwachsen, ihr eine herunterzuhauen. Es mag in gewisser Weise verständlich gewesen sein, aber es war trotzdem nicht erwachsen.“
Sie schüttelte ärgerlich den Kopf. „Darum geht es nicht.“
„Worum geht es dann?“
„Es geht darum, daß du nicht das Recht hast, so etwas zu sagen. Vor anderen schon gar nicht. Ich brauche dich nicht, um mir zu sagen, was erwachsen ist. Du bist nicht mein Vater!“
Der Nachsatz kam so heftig, daß Andreas erschrak. „Nein,“ entgegnete er nach einem kurzen Moment vorsichtig, „du hast recht. Das bin ich nicht. So gesehen war es in der Tat unangemessen, das zu sagen.“
„Vollkommen richtig. Das war es! Unangemessen!“
Andreas nickte und trank, einem plötzlichen Impuls folgend, sein Weinglas in einem Zug leer bis zur Neige. Dann schenkte er sich erneut nach.
„Was hätte ich denn deiner Meinung nach tun sollen in dem Moment?“ fragte er leise.
„Wie hätte ich reagieren sollen? Wie hättest du reagiert, wenn ich deine vierzehnjährige Tochter geohrfeigt hätte wegen eines Streits, in dem es um etwas so Bedeutendes ging wie Straßenschuhe im Wohnzimmer und eine nicht weggeräumte Schultasche?“
„Ich habe keine Tochter!“
„Das ist nicht der Punkt, Valentina, bitte!“ entgegnete er streng.
„Ich weiß. Entschuldige! Aber es geht um wichtigeres als nur um die Schuhe. Es ist mehr. Es ist ganz einfach… Ach, ich weiß auch nicht.“ Mit unwirscher Geste strich sie eine Haarsträhne aus dem Gesicht, nahm dann ihr Weinglas, nippte ein wenig daran, stellte es zurück und verschränkte wieder die Arme vor der Brust. Eine Weile geschah gar nichts. Erst als Andreas ihr nachschenken wollte, regte sie sich wieder, um ihm mit knapper Geste zu bedeuten, daß sie keinen Wein mehr wolle.
„Was hättest Du also getan an meiner Stelle?“ wiederholte er seine Frage.
„Ich… ich weiß es nicht,“ antwortete sie schließlich leise.
„Aber daß ich auf irgendeine Weise eingreifen mußte, bevor die Sache endgültig entgleist, das gestehst du mir zu?“ Valentina antwortete nicht. Andreas rieb sich nachdenklich das Kinn.
„Nun, wenn wir also beide selbst nach mehreren Stunden noch keine Antwort darauf wissen, welches Verhalten von mir in der Situation angemessen gewesen wäre, könntest du mir dann bitte nachsehen, daß ich in den ein, zwei Sekunden, die ich in der Situation hatte, eben keine bessere Lösung gefunden habe, als euch beide zu rüffeln?“
Nach einer Weile fügte er hinzu: „Es tut mir leid, wenn ich dich dadurch verletzt habe. Entschuldige bitte. Ich wollte vermeiden, daß der Streit noch weiter aus dem Ruder läuft.“
„Nein,“ antwortete Valentina nach ein paar Minuten. „Das ist es nicht. Du mußt dich nicht entschuldigen. Du hast recht, die ganze Situation ist völlig außer Kontrolle geraten. Ich habe mich nur geärgert, daß… Ach, Mist…“ Sie nippte erneut an ihrem Weinglas.
„Ich glaube, ich ärgere mich vor allem darüber, daß mir die ganze Sache so dermaßen entglitten ist.“
„Ich glaube,“ sagte sie schließlich, „ich ärgere mich vor allem über mich selbst. Ich hätte sie nicht schlagen dürfen. Ochetta, son‘io!“
Andreas entgegnete nichts, sondern spähte in den Himmel. Es waren nun schon deutlich mehr Sterne zu sehen. Aber ohne seine Brille sahen sie für ihn nur aus wie schmutzige Lichtfleckchen. Es war ruhig geworden. Die spärliche Flamme des Öllämpchens tauchte die beiden in sanftes Licht. Er wendete seinen Blick wieder zu Valentina. Gut sechs Jahre war es jetzt her, daß er sie kennengelernt hatte. An einem unwahrscheinlichen Ort und unter recht seltsamen Umständen. Seither hatte sich vieles verändert. Einiges, weil sie es so beschlossen hatten. Anderes hatte sich mehr oder weniger einfach so ergeben. Den wenig geliebten Job bei einer Beraterfirma hatte sie irgendwann aufgegeben. Auch ihre Stelle an einem Institut der Uni in Pisa. Sie habe das sowieso schon lange machen wollen, es habe nichts mit ihm zu tun, hatte sie diesen Schritt begründet. Das Fach Volkswirtschaft habe sie in Wahrheit ja nie interessiert, das habe sie allein auf Wunsch ihres Vaters studiert. Und selbst dem schien die Karriere seiner Tochter dann doch eher unangenehm gewesen zu sein. Er habe ja doch nur gewollt, daß sie auf diese Weise einen passenden Mann finde, einen aus besseren Kreisen, un Pezzo Grosso.
„Und so ein großes Tier habe ich dann ja auch gefunden. Der hat meinem Vater gefallen. Er wäre der rechte Schwiegersohn nach seinem Gusto gewesen. Dieses verkommene Schwein!“ Es hatte gallig geklungen, als sie das ausrief, aber mehr wollte sie offenbar nicht erzählen, und er wollte nicht danach fragen. Es war überhaupt das einzige Mal gewesen, daß sie ihren Vater auch nur erwähnt hatte. Sie sprach nie über ihre Familie. Ein paarmal hatte er sie gefragt, aber sie war jedesmal ausgewichen oder hatte die Frage einfach überhört.
Nein, etwas Künstlerisches habe sie immer machen wollen, Etwas, wo sie wirklich kreativ sein könne. Nicht diesen pompösen Zahlenmist, den sie täglich durchzuseihen und aufzukochen habe, und mit dem sie auf immer neue Weise doch immer nur denselben Schwachsinn andiene. Je nach Auftraggeber mal aus Keynesianischer, dann wieder aus Angebots-theoretischer Sicht; wie es halt gerade opportun sei, damit – erstes Ziel vor allen anderen – die eigene Firma ungehindert von überflüssigen und vermeidbaren Unstimmigkeiten vom Auftraggeber eines Gutachtens das vereinbarte Berater-Salär einstreichen könne. Sie hasse die Verlogenheit der Politiker und Wirtschaftsbosse, mit denen sie zu tun habe und die an keinem Mikrophon vorbeikämen, ohne mit treuherzigem Dackelblick zu behaupten, alles für diejenigen und nur für diejenigen zu tun, die ihrer Verantwortung unterstünden. Und die dann ja doch alle handelten, als seien sie direkte Nachfahren des Fürsten von Machiavelli. In Wahrheit waren diese Leute doch stolz darauf, Schicksal zu spielen für die Machtlosen, das Fußvolk, die Plebs. Sie waren die Herren, und Valentina spüre als Frau überdeutlich, so hatte sie damals erklärt, was diese Männer am liebsten mit ihr tun würden, welche Rolle sie ihr am liebsten zuweisen würden. Ihr, einer Frau, die sie ja nur war. Mehr war sie für die eben nicht. Nur eine Frau halt.
Nein, sie wolle viel lieber schöne Dinge machen. All das, was man sie als Kind nicht habe lernen lassen. Weil es unter ihrer Würde gewesen sei. Handarbeit kam in ihrer Familie nicht in Frage. Derlei Dinge kaufe man, aber man mache sich nicht die Finger damit schmutzig, hatte es damals geheißen. Die Frage, wovon sie fortan leben wolle, wenn sie ihre Tätigkeiten einfach so beendete und damit ohne eigenes Einkommen war, blieb zwischen ihnen beiden unausgesprochen. Sie machte keine Anstalten, eine Antwort zu suchen, und Andreas fragte gar nicht erst. Es schliff sich statt dessen mehr oder minder ein. Sie lebte bei ihm, machte zwischen ihren Mal- und Kunsthandwerk-Kursen den größten Teil der Hausarbeit und war ansonsten in ihrer neuen Tätigkeit wirklich gut – soweit er das mit seinem sehr beschränkten Horizont auf Gebiet der bildenden Künste überhaupt beurteilen konnte. Er selbst konnte weder malen noch gestalten, hatte keinen Blick für Farbe oder Komposition und war über Strichmännchen nie hinausgekommen. Seine heimliche Leidenschaft war die Musik. Das war sie immer gewesen, auch wenn er dann doch einen anderen Beruf ergriffen hatte und mittlerweile viel zu selten dazu kam, seine geliebte Gitarre in die Hand zu nehmen. Auf dem Klavier übte er mittlerweile gar nicht mehr. Nicht zuletzt dadurch verdiente er ja auch genug für beide zusammen. Trotz unsinnig hoher Preise für Gas, Benzin, Krankenversicherung und auch sonst allgemein steigender Kosten ging es ihnen nicht schlecht. Sie kamen gut zurecht, wie man so sagt.
Und zwischen all den Unfertigkeiten und Halbheiten, all den ungeliebten, oftmals unausgesprochen eingegangenen Kompromissen und Zugeständnissen, zu denen sie sich von der Realität gezwungen sahen, liebten sie sich auf ihre Weise. Da gab es die geheimen Riten und Gewohnheiten, zu denen auch zählte, daß sie jeden Abend, bevor sie zu Bett ging, vor ihm niederkniete, seine Hände küßte und danach fragte, ob und auf welche Weise sie ihm noch dienen dürfe. Und er hatte gelernt, aus der Frage, aus der Art, wie sie gestellt wurde, aus dem Augenaufschlag, der Haltung des Kopfes, der Bewegungen und dem Druck ihrer kleinen Hände herauszulesen, was angebracht war und was nicht. Zumal sie an diesem Brauch auch dann festhielt, wenn beide sich vorher ernsthaft gestritten hatten – was hin und wieder vorkam, wie in jeder Partnerschaft. Und er bildete sich ein, je nach Situation und beider Lust und Laune hinreichend sicher entscheiden zu können, ob er nur ihre Dienste als Frau in Anspruch nehmen sollte, ob die Peitsche angebracht war – oder einfach nur ein Gutenacht-Kuß. Sei es, um ihren Kopf, ihren manchmal halsstarrigen Willen niederzuzwingen, sie zu demütigen und auf den Platz zu verweisen, der ihr nach geheimer Übereinkunft gebührte. Sei es – zumindest gelegentlich – um sie zu bestrafen. Eine Vokabel allerdings, mit der er gewisse Probleme hatte. Er glaubte zu wissen, wann sie die liebevolle, zärtliche Inbesitznahme brauchte, und wann hingegen er Demut einzufordern hatte, oder ihre Bereitschaft, sich erniedrigen zu lassen. Und verlor dabei auch seine eigenen Bedürfnisse nicht aus dem Auge. Ein Fehler, der ihm in jungen Jahren manchmal unterlaufen war. Aber selbst wenn er sie nur mit einem sanften, liebevollen Kuß auf Mund oder Stirn in die Nachtruhe entließ, war doch in diesen Momenten immer ein geheimes Einverständnis, eine Komplizenschaft zu spüren, die für einen heiligen Augenblick alle anderen Realitäten nebensächlich zu machen vermochte.
„Valentina, bist du unzufrieden?“
„Wie meinst du das?“ Sie sah ihn etwas unsicher an.
„Ich meine, du bist jetzt fünfunddreißig.“ Andreas zögerte kurz. Er nahm seine Brille vom Tisch und setzte sie auf.
„Kann es sein, daß du mit dem, was du aus deinem Leben gemacht hast, aus deinen Talenten, deinen Fähigkeiten… kann es sein, daß du manchmal daran zweifelst, die richtigen Entscheidungen getroffen zu haben? Kann es sein, daß du der Meinung bist, nicht das aus dir und deinem Leben gemacht zu haben, was du gekonnt hättest, wären manche Gelegenheiten, Bedingungen besser gewesen? Daß du Zeit vergeudet hast? Zeit, von der du glaubst, daß sie dir nun fehlt?“
Valentina wollte unmittelbar antworten, hielt dann aber inne um angestrengt nachzudenken.
„Ich meine das so,“ fuhr Andreas nach ein paar Minuten erklärend fort: „Jeder von uns hat seine Träume. Und wir alle haben Fähigkeiten. Manche dieser Fähigkeiten entdecken wir erst sehr spät in uns, manchmal vielleicht auch zu spät. Andere erkennen wir nie. Mit den Unfähigkeiten, den eigenen Fehlern und Schwächen ist es allerdings auch nicht anders. Und in der Mitte des Lebens kann es sein, daß man auf einmal das Gefühl hat, seine Träume verraten zu haben. Die Einsicht, daß man sein Leben nicht so genutzt und nicht das daraus gemacht hat, was hätte sein können. Natürlich wäre man dann unzufrieden, denke ich mir. Und ich frage dich: Bist du unzufrieden?“
„Ich… bestimmte Dinge… manche Entscheidungen waren falsch,“ begann Valentina nachdenklich, „waren aus heutiger Sicht ganz einfach falsch. Doch, ja, es stimmt: Ich ärgere mich zum Beispiel, daß ich den falschen Beruf gewählt habe, daß ich nicht das gemacht habe, was ich eigentlich machen wollte. Ich habe mich da in etwas hineinzwingen lassen, das… es hat mich viel Zeit und Energie gekostet.“
„Sehr viel Zeit,“ fügte sie nach einer Weile bitter hinzu, „für nichts und wieder nichts.“
Andreas nickte. „Und diese Zeit fehlt dir heute? Wäre das zum Beispiel die Erfahrung und Routine, die du heute mit deinen Glasarbeiten bräuchtest, um wirklich gutes Kunsthandwerk zu machen?“
Valentina betrachtete einen Moment lang versonnen auf den gepflasterten Boden vor ihren Füßen, atmete plötzlich tief ein, blickte auf und antwortete: „Doch, ja, so ungefähr empfinde ich es. Ich… ich…“ Sie verschloß sich selbst den Mund mit einer Hand und blickte nachdenklich, wehmütig, fast verzweifelt zu den nachtschwarzen Bäumen am Fluß.
„Es stimmt. Ich lebe hier bei dir, schreibe hin und wieder als Freelancerin für den Wirtschaftsteil der Zeitung, eigentlich ein – wie sagt man Giornaluccio – Käseblatt? Ich mache meine Kurse, habe die kleine Glaswerkstatt im Keller, verkaufe sogar hin und wieder eine Schale oder Lampe, Aschenbecher, irgendeinen Nippes, erledige den Haushalt für dich und Eva, und…“
Sie stockte, so als lauschte sie in ihr Inneres oder auch einfach nur in die Nacht. „Ich habe das Gefühl, mein Leben ist wie… wie Wasser, das ich nicht… weißt du, ich kann es nicht halten… Wie Wasser in der Hand, so ist mein Leben. Wie Wasser in der Hand.“
Es verstrich eine geraume Zeit, und erst als Andreas sein Glas erneut füllte, fragte er leise: „Du hättest alles erreichen können, Familie, Erfolg im Beruf, vielleicht sogar Reichtum. Aber weil du dich für nichts von alledem wirklich und richtig entschieden hast, hast du tatsächlich auch nichts erreicht. Und nun ist dein Leben annähernd zur Hälfte vorbei, und damit auch die Zeit, die wesentlichen Weichen zu stellen, deine Lebensentscheidungen zu treffen. Jetzt weißt du nicht, was werden soll. Ist es so ungefähr? Oder beschreibe ich es falsch?“
Sie sah ihn an. Lange und ernst. Dann sprang sie auf, eilte um den Tisch herum zu ihm, kniete sich zwischen seine Beine, legte ihren Kopf auf seine Brust und umfaßte ihn.
„Ich will bei dir sein. Die Entscheidung war doch richtig? Alles andere ist doch nicht wichtig? Nicht wirklich wichtig! Oder?“ Sie klammerte sich an ihn. Andreas spürte den unausgesprochenen Wunsch, hielt sie fest und wiegte sie langsam.
„Die Entscheidung war richtig, und ich bin gottfroh, daß du dich so entschieden hast. Das mußt du mir bitte glauben. Aber wenn das andere dich daran hindert, glücklich und unbeschwert zu sein, wenn es dich beschwert, dann ist es vielleicht doch sehr wichtig, dann hat es Gewicht.“
Valentina ließ sich auf ihre Fersen sinken und schaute zu ihm auf. „Deine Sprache, das Deutsche, ist schon seltsam, weißt du,“ sagte sie.
Er lächelte sie an und ergriff ihre Hände.
„Sieh, Valentina, ich bin Mittelmaß, und ich bin mir dessen bewußt.“ Sie wollte protestieren, aber er hinderte sie daran, indem er ihr einen Finger an die Lippen legte. „Doch: Mittelmaß. Auch ich hätte vielleicht vieles aus meinem Leben machen können, was ich nicht gemacht habe. Und wenn ich ehrlich bin, dann war es oft nur Bequemlichkeit, die mich daran gehindert hat. Manchmal wohl auch Feigheit, indem ich mir selbst irgendwie bewiesen habe, daß es ja doch keine Aussicht auf Erfolg haben könne, wenn ich dieses oder jenes tue. Tatsächlich war ich bloß nicht mutig genug, es zu versuchen. Und dann waren da natürlich auch die echten Mißerfolge, die Sachen, die ich wirklich in den Sand gesetzt habe. Aber daß ich heute nicht Bundeskanzler bin oder Vizepräsident eines Konzerns oder Chef von tausenden von Leuten, das hat in Wahrheit vor allem damit zu tun, daß ich es nicht wirklich gewollt habe. Ich war nicht ehrgeizig genug, zu bequem, zu wenig zielstrebig, zu sehr interessiert an zu vielen anderen Dingen, habe mich immer wieder allzu gerne ablenken lassen. Und vor allem…“ Er atmete tief durch. „Vor allem war ich wohl zu häufig mit mir selbst beschäftigt. Mit meinen Zweifeln, den Unsicherheiten, und nicht zuletzt meinen Ängsten. Der Unbefangenheit, die ich nicht habe. Die hatte ich nie!“ lachte er leise. „Andere haben sie und haben das entsprechende daraus gemacht. Viele sind auch nur auf die Nase gefallen. Aber einige waren erfolgreich. Auch wenn ich mir bei etlichen von denen sicher bin, daß ich besser bin als sie. Aber sie haben es getan und ich eben nicht. Das war der ganze Unterschied. Mehr war es eigentlich nicht.“
Valentina richtete sich auf und schlang die Arme um seinen Hals. „Bitte, du bist nicht Mittelmaß. Du bist fein, sensibel, du weißt so viel über Dinge, von denen andere gar nicht wissen, daß es sie gibt…“
Er unterbrach sie. „Bitte, Valentina, natürlich schmeichelt es mir, daß eine so schöne und kluge Frau wie du so für mich empfindet. Glaube mir, ich genieße deine Liebe. Im wahrsten Sinne des Wortes genieße ich sie. Und ich gebe zu, ich bin stolz auf die Rechte, die du mir gewährst. Aber das ist es nicht, worauf ich hinaus will.“
„Worauf dann?“ Sie schüttelte den Kopf.
Sanft machte er sie von sich los und nahm ihre Hände wieder in seine. Sie ließ sich wieder auf die Fersen sinken.
„Sieh mal, ich bin nicht unzufrieden mit dem, was ich erreicht habe. Ich kann einer Frau und einem Kind eine sichere Existenz bieten. Mehr als das: Sogar einen gewissen Luxus. Nicht den ganz großen Luxus, aber – immerhin.“
Valentina protestierte, und diesmal konnte er sie nicht rechtzeitig daran hindern: „Aber das ist doch alles nicht wichtig! Ich möchte auch dann mit dir zusammen sein, wenn…“
Andreas verschloß mit einem Finger ihre Lippen und schüttelte energisch den Kopf.
„Bitte, ich mag keine romantischen Verklärungen,“ sagte er ernst. „Und für einen Mann ist es durchaus wichtig, daß er all das kann. Für mich ist es das jedenfalls. Frag mal einen arbeitslosen Mann, was für ihn das Schlimmste ist an seiner Situation. Aber auch das ist es nicht, worauf ich hinaus will.“ Valentina legte den Kopf zur Seite und sah ihn fragend an.
„Was ich sagen will, ist dies: Ich habe meine Lebensentscheidungen selbst getroffen. Die wichtigen jedenfalls. Und zwar immer dann und so weit reichend, wie ich das für notwendig gehalten habe. Und ich fühle mich gut damit, wie ich mich entschieden habe. Ich finde mich selbst darin wieder. Natürlich hätte ich mehr aus meinem Leben machen können. Wenn ich mir all die Nieten ansehe, die heutzutage Entscheidungen treffen, dann bin ich mir dessen sogar sicher. Die Frage wäre allerdings: Mehr nach welchen Maßstäben. Aber mehr ist glaube ich auch der falsche Begriff. Sagen wir lieber, ich hätte etwas ganz anderes daraus machen können.“
„Aber ich habe mich entschieden, so zu leben, wie ich das tue. Ich wollte eine Familie, und ich habe eine. Auch wenn sie kleiner ist, als ich mir das erträumt hatte. Ich wollte früh heiraten und habe es getan. Das war mir wichtiger als irgendeine Karriere: Daß ich eine Frau neben mir habe, die ich liebe und die mich liebt. Ich habe einen bürgerlichen Beruf gewählt, der mich beileibe nicht wirklich befriedigt. Mein Job taugt ganz sicher nicht dazu, mich damit zu identifizieren oder daran meine Persönlichkeit zu festzumachen. Aber ich habe das auch nie erwartet. Die Sicherheit dieser Existenz war mir wichtiger als die Liebe zur Kunst. Ich wollte diese Sicherheit für mich und meine Familie. Meine Frau wurde krank, das war nicht geplant.“
„Aber auch das war und ist Teil meines Lebens: Daß ich all das durchgemacht habe. Und wie ich es getan habe. Es waren meine Entscheidungen. Einschließlich der Niederlagen. Aus mir ist kein berühmter Musiker geworden, wird auch nie einer werden. Vielleicht wäre ich ja auch nur einer der unzähligen Gebrauchsmusiker geworden, der mit irgendwelchen unbekannten Gruppen und Bands über die Ortschaften und durch Kneipen tingelt. Wer weiß das schon. Und vielleicht wäre aus dir eine weltbekannte Glasmeisterin geworden – oder doch nur eine ewige Assistentin und Hilfs-Glasbläserin, deren Leben sich jahrweise auf irgendeinem Hinterhof von Murano vor einem vorsintflutlichen Brennofen in Schweiß verflüchtigt. Beides wäre möglich. Aber vielleicht wärst du auch als Hilfs-Glasbläserin glücklich. Es ist alles nur vielleicht.“
Valentina hatte den Kopf sinken lassen und blickte auf ihre Knie. Sie sagte nichts.
„Valentina! Du liebe Valentina! Wir sind beide in einem Alter, wo man nicht mehr so viele Lebensentscheidungen treffen wird. Wir haben eigentlich, wenn wir ehrlich sind, nur noch zwei Möglichkeiten: Entweder wir stehen zu dem, was wir geworden sind, und treffen auf genau dieser Basis die Entscheidungen, die wir noch treffen dürfen. Aber dann auch wieder mit allen Konsequenzen.“
Valentina schaute auf. In ihren Augen sammelten sich Tränen.
„Oder?“ fragte sie leise.
Andreas atmete tief durch. „Oder wir versuchen verzweifelt, das zu korrigieren, was nicht mehr zu korrigieren ist. Wir versuchen, die Zeit zu leben, die wir nicht mehr leben können. Weil sie bereits vergangen ist. Und versuchen, mit Gewalt etwas nachzuholen, was die Natur uns ganz sicher nicht mehr erlauben wird – nicht in unserem Alter. Wir sind unzufrieden mit uns selbst, weil wir uns nicht als das begreifen, was wir sind, sondern immer nur als das, was wir tun oder getan haben oder nicht getan haben. Wir ersetzen unser Sein durch unser Tun und sind unser Leben lang damit beschäftigt, uns auf unser Leben vorzubereiten. Und enden irgendwann als lächerliche, keifende und vor allem gescheiterte Existenzen. Es gibt genug von der Sorte, die in Fitneß-Studios und teuren Sportwagen verzweifelt bis zur Lächerlichkeit versuchen, ihre Jugend festzuhalten und ihre Vergangenheit ungeschehen zu machen. Wir sind nicht mehr in dem Alter, in dem man sich aufs Leben vorbereitet. Wir leben schon längst.“
Sie sah ihn an, Tränen rannen über ihr Gesicht und ihr Kinn zitterte.
Er versuchte, sie anzulächeln. „Ich fürchte, viel mehr Alternativen haben wir nicht.“ Er ließ ihre Hände, nahm seine Brille ab, legte sie auf den Tisch und vergrub sein Gesicht in den Handflächen. Sie richtete sich auf, legte sein Gesicht frei und wollte ihn küssen, aber er konnte oder wollte diesmal ihren Kuß nicht erwidern.
„Sieh, Valentina, ich kann dich nur um eines bitten.“
„Was? Ich… was kann ich tun? Bitte…“
„Ich kann dich bitten, meine Mittelmäßigkeit mit mir zu teilen. So, wie sie nun mal ist. Oder aber…“ Andreas zögerte.
„Was aber?“ Sie sah ihn verzweifelt an.
Andreas schaute zum Himmel, als suche er dort eine Antwort. Aber ohne seine Brille und durch den Schleier einer verstohlenen Träne erschienen ihm selbst die Sterne nur noch als blasse, verwaschene Fleckchen auf dem Mantel der Nacht. Von dort konnte er keine Hilfe erwarten. Er schaute ihr so fest er es vermochte in die Augen.
„Oder aber, du entschließt dich dazu, deinen Traum von dem zu verfolgen, was du aus dir machen könntest. Aber dann mußt du auch dies mit aller Konsequenz tun. Denn du wirst nicht mehr die Zeit haben, abzuwarten. Und du wirst vielleicht auch nicht mehr all die Dinge erreichen und in Tat und Wirklichkeit umsetzen können, die dir als junger Frau vielleicht einmal offen gestanden haben. Du wirst dich für einige, wenige Sachen entscheiden müssen. Auch wenn dies bedeuten sollte, daß du mich… daß du uns… aufgeben mußt.“
Diesmal unterband er ihren Protest rechtzeitig genug, um sich nicht aus seinem Konzept bringen zu lassen.
„Nein, Valentina, es ist mein Ernst. Und bitte glaube mir, es fällt mir ganz und gar nicht leicht, das zu sagen. Aber du kannst nicht für die nächsten Jahre zwischen damals und heute hin und her taumeln, und mit dieser schwindeligen Unzufriedenheit mein Leben belasten. Doch,“ erwehrte er sich eines weiteren Protestversuchs, „doch, ich sage ganz bewußt belasten. Weil Du am Ende eines halbherzig beschrittenen Weges irgendwelche halbherzigen Entscheidungen treffen würdest. Und was würde dann aus uns? Diese Ungewißheit ertragen will ich nicht und kann ich nicht. Auch wenn ich dich so sehr liebe, daß es mir manchmal weh tut.“ Er unterbrach sich. Er war sich nicht sicher, ob sie das folgende nicht verletzen würde.
„Ich werde auch keine großartigen Lebensentscheidungen mehr treffen,“ fuhr er schließlich fort. „Und ich trage noch eine ganze Weile die Verantwortung für mein Kind. Evchen ist längst noch nicht soweit, ihr Leben alleine bestimmen zu können.“
Valentina war bei dieser Eröffnung vor ihm zusammengesunken und verbarg ihr Gesicht an seinem Oberschenkel. „Ich… Andreas…“ Sie schaute auf, und ihre schönen schwarzen Augen, die er so sehr liebte, schienen zu schwimmen in einem Meer von Tränen.
„Oh Andreas, bitte… bitte schick mich nicht… nicht weg! Bitte! Ich… ich… ich will doch bei dir bleiben,“ stammelte sie.
Er bückte sich sofort und hob sie zu sich auf. „Aber Valentina, Liebes, bitte, so war das doch nicht gemeint.“
Sie befreite sich sanft von ihm und schüttelte tapfer den Kopf.
„Doch, Andreas, ich weiß genau, was du meinst. Und du hast doch recht. Ich könnte mich manchmal selbst ohrfeigen, weil ich einfach nicht weiß, was ich will. Es frißt mich auf. Und ich weiß nicht, was ich dagegen tun kann. Es ist… du bist so… du bist so gut zu mir…“
Andreas entfuhr ein gequältes Stöhnen. Er wollte etwas einwenden, aber diesmal ließ ihn Valentina nicht zu Wort kommen.
„Doch! Das bist Du! Und ich… ich weiß einfach nicht, was ich tun soll… womit ich all das verdiene… es kann doch gar nicht wahr sein, alles… ich könnte verrückt werden, manchmal…“ Sie vergrub ihr Gesicht in Händen und schüttelte den Kopf. Andreas nahm mit sanfter Gewalt ihre Unterarme und zog ihre Hände zu sich. Er betrachtete sie, diese schmalen, kleinen Hände, die manchmal so seltsam fremd wirkten, gerade so, als gehörten sie ihr nicht wirklich. Und wie oft hatte er sie ihr schon genommen, sie ihr auf den Rücken oder an schweren Ketten angebunden, wenn er ihre Demut einforderte, ihren Gehorsam als Frau, die sein Eigentum war. Er ballte die zerbrechlich schönen Finger, ebenso zerbrechlich schön wie die gläsernen Kunstwerke, die sie damit anfertigte. Er ballte sie vorsichtig zu zwei kleinen Fäusten, küßte sie sanft und vergrub sie in seinen eigenen, die dagegen unglaublich groß und sehnig wirkten. Er hatte tausend Antworten, und doch keine.
„Andreas, bitte,“ sagte sie nach geraumer Zeit, „bitte, du weißt, ich werde dir immer gehorchen, wenn du das verlangst. Aber bitte… heute… bitte schlage mich heute abend nicht! Auch wenn du es willst oder ich es verdient habe, ja?“ Sie sah ihn flehend an.
„Du weißt, du hast jedes Recht dazu. Ich gehöre dir, will dir gehören. Mit allem. Bitte, nimm mich, wenn du möchtest. Und so, wie du willst. Ich werde dir dienen, ja? Aber bitte nicht schlagen… nicht erniedrigen… ich… heute abend könnte ich es nicht… ich könnte es nicht ertragen. Bitte…“ Andreas war gerührt und kämpfte nun selbst mit den Tränen. Er fühlte in dem Moment die heimliche Verachtung gegen sich selbst und seinen Leidenschaften. Er fühlte sie in diesem Moment viel stärker als sonst in jenen schwachen Momenten, in denen ihn die alten Selbstzweifel überfielen. Er wollte gerade antworten, da hörte er eine leise Stimme rufen.
„Valentina?“
„Das ist Eva,“ sagte Andreas erschrocken.
„Valentina?“ rief sie nach einer kurzen Pause erneut. Aber sie rief so leise, als hätte sie Angst, die Gerufene könnte es hören.
„Hörst du das?“ fragte Andreas leise.
„Was?“
„Ich glaube, Evchen hat gerade nach dir gerufen.“
„Eva hat gerufen? Nach mir?“ fragte Valentina ungläubig.
Und plötzlich stand Eva in der Terrassentür. Ihre langen blonden Haare umrahmten wirr das blasse Gesichtchen. Sie knetete mit beiden Händen in der fast knöchellangen Monster-Sack-Sonderangebots-Ausgabe von T-Shirt, die sie als Nachthemd trug. An den Füßen trug sie weiße Söckchen.
„Valentina, bitte,“ sagte sie leise, „kannst du bitte mal kommen?“
Valentina sah erstaunt zuerst zu Andreas, dann zu Eva. „Ja, Eva, was ist denn los?“
„Kannst du bitte mal kommen, Valentina?“ fragte das Evchen erneut und noch leiser, eindringlicher als zuvor. „Bitte, nur kurz,“ fügte sie kaum hörbar hinzu und schlug den Blick zu Boden. „Kommst du bitte mal?“
Valentina und Andreas warfen sich einen kurzen, fragenden Blick zu.
„Aber ja, natürlich komme ich.“ Valentina erhob sich, küßte Andreas flüchtig auf die Wange, „Ich komme gleich wieder, Herr,“ flüsterte sie ihm ins Ohr, dann ging sie hinüber zu Eva.
„Was ist denn, Liebes?“ fragte sie leise.
Eva sah kurz und unsicher zu ihrem Vater, dann zu Valentina.
„Kommst du bitte mal ganz kurz,“ wiederholte sie. Sie nahm Valentina bei der Hand machte Anstalten, sie wegzuziehen. Valentina folgte ihr. Andreas blieb zurück und hörte, wie beide die Treppe hinaufgingen. Wenig später hörte er oben Türen gehen, Schritte auf dem Flur, dann wieder Türen gehen, danach blieb es still.
Bacchus und Orlando
Andreas trank sein Weinglas zum zweiten Mal für diesen Abend in einem Zug leer, schenkte sich gleich nach und trank noch einen kräftigen Schluck hinterher. Er trank den Wein wie Wasser gegen einen quälenden Durst. Das Gespräch war ihm schwer gefallen. Und Evchen, so wie sie gerade da gestanden war, ist doch noch sein kleines Mädchen. Da genügt einem Vater ein einziger Blick, um das zu wissen. Er schenkte sich erneut nach und bemerkte dabei, wie der Alkohol in ihm zunehmend seine Wirkung tat. Ach ja, das Gespräch…
Valentinas Bitte hatte ihn etwas aus der Fassung gebracht. Es war richtig, er hatte irgendwann im Laufe des Abends durchaus Lust verspürt, sie zu züchtigen. Er hatte zuerst an den Rohrstock gedacht. Er wußte, sie empfand es als besonders erniedrigend, sich dieser Strafe auszuliefern zu müssen. Der Stock war anders als die Reitpeitsche oder die Klammern, die er sonst gerne an ihr gebrauchte. Nicht etwa schmerzhafter, nein, um den Grad der Schmerzen ging es ihnen beiden nicht. Aber der Rohrstock war einfach anders. Der Stock selbst hatte etwas Symbolhaftes, Demütigendes an sich. Vielleicht weil er genau für das Erziehungsrecht stand, das sie ihm gerade vorhin noch so vehement – und vollkommen zurecht – abgesprochen hatte: Die Peitsche degradierte sie zur Sklavin, zum Haustier, zu seinem „Frau-Tierchen,“ wie er es nannte; der Stock hingegen machte sie zum Kind. Und obwohl sie stolz genug war, sich diesbezügliche Äußerungen von ihm nicht bieten zu lassen, auch wenn sie in der Erregung eines Streits gesprochen waren, so unterwarf sie sich zu anderen Zeiten genau dieser Erziehungsgewalt ihres Geliebten, seinem Erziehungsrecht, seinem Züchtigungsrecht bei Regelverletzungen in Dingen des Alltags.
Sie sah es tatsächlich als sein Recht – und so ganz nebenbei wohl auch als seine Pflicht. Auch wenn sie das nie so darstellen würde, aber sie erwartete es von ihm.