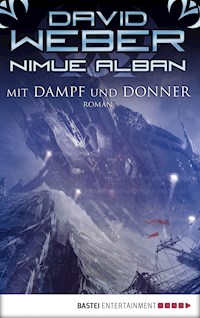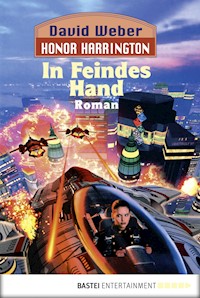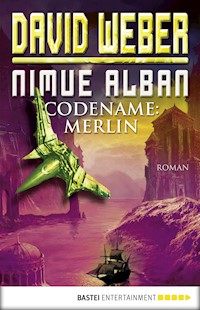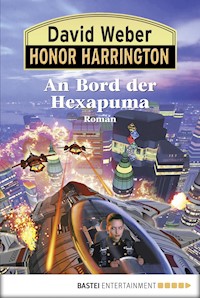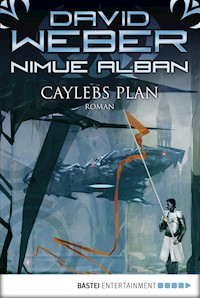
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Nimue-Reihe
- Sprache: Deutsch
Eine Welt ohne Technik. Eine außerirdische Spezies, die die Menschheit auslöschen will. Und eine Heldin im Körper eines Androiden. Im neuen Nimue-Alban-Roman läuft Weber zur Höchstform auf! Für alle Fans von Stoffen wie Honor Harrington und Starship Troopers.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 528
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über den Autor
Titel
Impressum
Widmung
Juni, im Jahr Gottes 893
.I.
.II.
.III.
.IV.
.V.
.VI.
.VII.
.VIII.
.IX.
.X.
.XI.
.XII.
.XIII.
.XIV.
.XV.
.XVI.
.XVII.
.XVIII.
Juli, im Jahr Gottes 893
.I.
.II.
.III.
.IV.
.V.
August, im Jahr Gottes 893
.I.
.II.
.III.
September, im Jahr Gottes 893
.I.
.II.
.III.
.IV.
Personenverzeichnis
Glossar
Eine Anmerkung zur Zeitmessung auf Safehold
Über den Autor
David Weber ist ein Phänomen: Ungeheuer produktiv (er hat zahlreiche Fantasy- und Science-Fiction-Romane geschrieben), erlangte er Popularität mit der HONOR-HARRINGTON-Reihe, die inzwischen nicht nur in den USA zu den bestverkauften SF-Serien zählt. David Weber wird gerne mit C. S. Forester verglichen, aber auch mit Autoren wie Heinlein und Asimov. Er lebt heute mit seiner Familie in South Carolina.
David Weber
NIMUE ALBAN:
CAYLEBSPLAN
Aus dem Amerikanischenvon Ulf Ritgen
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Deutsche Erstausgabe
Für die Originalausgabe:
© 2008 by David Weber
Titel der Originalausgabe: »By Heresies Distressed« (Teil 2)
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2011/2014 by Bastei Lübbe AG, Köln
This work was negotiated through Literary Agency Thomas Schlück
GmbH, 30827 Garbsen, on behalf of St. Martin’s Press, L. L. C.
Textredaktion: Beate Ritgen-Brandenburg
Lektorat: Ruggero Leò
Titelillustration: Arndt Drechsler
E-Book-Produktion: Urban SatzKonzept, Düsseldorf
ISBN 978-3-8387-0231-5
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Für Bobbie Rice und Alice Weber,zwei meiner Lieblingsdamen.Ihr beide leistet wirklich ziemlichgute Arbeit!
Juni, im Jahr Gottes 893
.I.
Elvarth, Grafschaft Storm Keep,Corisande-Bund
»Sind wir bald da?«, fragte Prinz Daivyn in klagendem Tonfall.
Phylyp Ahzgood fand, der kleine Prinz klinge im Vergleich zu seinem älteren Bruder einfach nur kläglich. Kronprinz Hektor hätte die Frage in deutlich weinerlicherem Ton gestellt – und damit keinerlei Zweifel daran gelassen, dass die Frage in Wirklichkeit eine Beschwerde war.
»Noch nicht ganz, Daivyn«, versuchte Prinzessin Irys ihn zu beruhigen. Sie beugte sich über ihn und mummelte ihn enger in seinen Mantel ein. »Schlaf doch einfach noch ein bisschen! Wenn du aufwachst, sind wir dann bestimmt da!«
Daivyn schaute seine Schwester an. Im Schein der kleinen Lampe, die vom Dach der Kutsche herabhing, konnte man deutlich erkennen, wie er ihr unter gerunzelter Stirn einen ängstlich fragenden Blick zuwarf. Doch dann nickte er, durch Irys’ Verhalten offenkundig ebenso beruhigt wie durch ihre Worte, und kuschelte sich wieder in den bequemem, gepolsterten Sitz. Für einen Jungen seines Alters reichte dieser Sitz ganz und gar als Bett aus, und so schloss Daivyn gehorsam wieder die Augen.
Mehrere Minuten lang beobachtete Irys ihn; ihre Augen flossen über vor Zärtlichkeit. Schließlich holte sie tief Luft, ließ sich gegen das Rückenpolster sinken und blickte zu Graf Coris hinüber.
»Das Ganze ist einfach unerträglich!«, brach es aus ihr heraus. Obwohl sie aufgewühlt war, bemühte sie sich leise zu sprechen. Auf gar keinen Fall wollte sie ihren Bruder wecken. Der Kleine jedoch schien schon wieder tief und fest zu schlafen – und das, obwohl die Kutsche teilweise heftig hin und her schaukelte und das Hufgetrappel der Kavallerie-Eskorte nicht zu überhören war.
»Ich verstehe Eurer Hoheit Erbitterung«, erwiderte der Graf ebenso leise. »Und ich kann Euch Eure Gefühle nicht verdenken. Mir geht es nicht viel anders als Euch. Auch ich habe das Gefühl, mein Heil in der Flucht zu suchen.«
»Nein, Phylyp, so dürfen Sie nicht denken!« Sie schüttelte den Kopf. »Sie sind schließlich nur hier, weil mein Vater es Ihnen befohlen hat!«
»Ich möchte Eurer Hoheit versichern, dass es mir ebenso eine Ehre wie eine Pflicht ist …«, setzte er an. Die Prinzessin schüttelte heftig den Kopf und unterbrach so seinen Redefluss.
»Können wir nicht einfach so tun, als hätten wir all diese üblichen, pflichtschuldig vorgebrachten Bemerkungen bereits hinter uns?«, fragte sie. Als sie seine verdutzte Miene sah, huschte ein Lächeln über ihr Gesicht. »Verzeihen Sie mir bitte, Phylyp! Ich wollte mit keiner Silbe andeuten, Sie könnten das, was Sie gerade sagen wollten, möglicherweise nicht ernst meinen. Nein, wirklich nicht! Dafür kenne ich Sie einfach schon viel zu lange. Aber ich bin es so leid, immer all das zu sagen, was man von mir erwartet! Ich bin es leid, immer weiter nur eine Rolle zu spielen!«
Kurz schwieg der Graf. »Ja, ich verstehe«, sagte er dann. »Trotzdem: Ihr seid eine Prinzessin von Corisande, und ich bin, auf Befehl Eures Herrn Vaters, Euer Vormund und zugleich der Erste Ratgeber Eures jüngeren Bruders, sollte es zum Äußersten kommen. Ich fürchte, das sind Rollen, denen wir uns nicht einfach entledigen können, Eure Hoheit.«
»Wenn man bedenkt, dass wir uns schon mein ganzes Leben lang kennen und Sie zumindest einmal persönlich anwesend waren, als meine Windeln gewechselt wurden – meinen Sie nicht, Sie könnten mich ›Irys‹ nennen und nicht ›Eure Hoheit‹, Phylyp? Zumindest, wenn wir beide allein sind?«
Ihm lag schon eine Entgegnung auf der Zunge, doch dann überlegte er es sich anders.
»Ich weiß nicht, ob das wirklich eine gute Idee ist«, sagte er schließlich. »Angesichts der Umstände ist es ganz besonders wichtig, dass Eure und auch Daivyns Würde so weit gewahrt bleiben wie eben möglich. Wenn ich Euch gegenüber zu viel Vertraulichkeit an den Tag legte, wird das Eure Autorität als Tochter des Prinzen von Corisande untergraben. Und aus deutlich selbstsüchtigeren Motiven heraus möchte ich noch Folgendes hinzufügen: Ich möchte nicht, dass jemand auf die Idee kommt, ich würde die Aufgabe, die Euer Herr Vater mir zugewiesen hat, zu meinem eigenen Vorteil nutzen.«
»Dessen bin ich mir durchaus bewusst, Phylyp. Deswegen habe ich ja auch gesagt: ›Zumindest, wenn wir beide allein sind.‹ Aber wir werden es in Delferahk schon schwer genug haben, ganz egal, was noch geschieht. Ich hätte gern wenigstens einen Menschen um mich, von dem ich weiß, dass ich ihm vertrauen kann, und der mich zumindest hin und wieder mit Vornamen anspricht. Und wenn mein Vormund das nicht kann, wer dann?«
»Also gut … Irys.« Sein Lächeln war bittersüß. »Übrigens habt Ihr Recht: Ich war tatsächlich schon dabei, als man Euch die Windeln wechselte.«
»Gut!«
Belustigt blitzten ihre Augen auf. Die Belustigung hielt allerdings nicht lange an. Graf Coris glaubte aber zu erkennen, dass der Blick der Prinzessin nun etwas weniger düster war als zuvor. Nur war es bei den gegebenen Lichtverhältnissen durchaus möglich, dass er sich irrte.
»Ich wünschte, Vater hätte sich anders entschieden«, kehrte Irys zum eigentlichen Thema zurück.
»Ihr meint, statt Euch zusammen mit Daivyn fortzuschicken?«
»Mich überhaupt fortzuschicken«, verbesserte sie ihn. Ihre Stimmung war vielleicht eine Nuance weniger düster als eben noch. Dennoch funkelte im Schein der Laterne eine Träne in ihren langen Wimpern; das Licht brach sich darin wie in einem Diamanten. »Ich weiß, dass er glaubt, keine andere Wahl gehabt zu haben – zumindest nicht, wenn er wollte, dass Daivyn von zu Hause fortgebracht werden muss. Aber, Phylyp, ich sollte jetzt an seiner Seite sein!«
»Glaubt bloß nicht, diese Entscheidung sei ihm leicht gefallen!«, entgegnete Coris sehr sanft. »Um ehrlich zu sein: Ich bin mir sicher, dass ihm diese Entscheidung schwerer gefallen ist als je eine andere.«
»Ich weiß. Ich weiß!« Heftig schüttelte sie den Kopf. »Und ich will auch wirklich nicht klingen wie eine bockige, verzogene Prinzessin.«
Der Graf wollte darauf schon etwas erwidern. Dann schüttelte er nur den Kopf. Ein leises Lächeln umspielte seine Lippen.
Mehrere Minuten lang saß Irys nur schweigend da und streichelte ihrem kleinen Bruder über die Stirn. Dann blickte sie wieder zu Coris auf.
»Offenkundig hat es wenig Sinn, sich über die bereits gefällte Entscheidung aufzuregen. Stattdessen sollte ich wohl lieber über die allgemeine Reiseplanung lamentieren«, sagte sie entschieden heiterer.
»Ja, die lässt wirklich ein wenig zu wünschen übrig, nicht wahr?«, bestätigte Coris mit einem schiefen Grinsen, als die Kutsche durch ein weiteres, besonders tiefes Schlagloch holperte. »Betrachtet es als eine weitere Unannehmlichkeit, die wir Cayleb und seinen Charisianern zu verdanken haben!«
»Ach, glauben Sie mir, es gibt eine ganze Menge ›Unannehmlichkeiten‹, die ich eines Tages mit Kaiser Cayleb werde … besprechen müssen.« Sie klang zwar belustigt, doch der Blick, der in ihren Augen lag, strafte ihren Tonfall Lügen.
»Admiral Tartarian schätzt die Lage aber wohl ganz richtig ein«, meinte Coris, und Irys nickte.
Derzeit war ihre Kutsche, obwohl sie eine beachtliche Geschwindigkeit vorlegte, noch mehrere Stunden von Elvarth entfernt. Elvarth schmückte sich zwar gern mit der Bezeichnung ›Stadt‹, war jedoch eher ein besseres Fischerdorf. Die Reise über Land von Manchyr aus war lang, ermüdend und anstrengend gewesen, insbesondere für Daivyn (der noch überhaupt nicht begriff, was hier eigentlich vor sich ging). Elvarth lag nämlich in der Grafschaft Storm Keep, am nördlichsten Ausläufer von Corisande. Doch die kleine Stadt hatte drei entscheidende Vorteile: Zunächst einmal war sie so klein und unbedeutend, dass nicht einmal Cayleb von Charis auf die Idee gekommen war, ihren Hafen zu blockieren. Zweitens war sie von Manchyr so weit entfernt, wie es im Fürstentum Corisande nur möglich war. Und drittens lag dort zufälligerweise eine kleine Galeone vor Anker, die dort Schutz vor der Imperial Charisian Navy gefunden hatte.
»Gewiss doch, ja, der Admiral schätzt die Lage richtig ein, das glaube ich auch«, erwiderte Irys ihrem Vormund. »Und ich bin froh, dass er es geschafft hat, Captain Harys zu gewinnen.«
Wieder nickte Coris. In mancherlei Hinsicht, dachte er, hat sich Zhoel Harys verschlechtert, als er das Kommando der Galeone Schwinge übernommen hat. Denn Harys hatte zuvor die Galeere Lanze kommandiert, war befördert worden und hatte dann das Kommando über eine von Tartarians ersten bewaffneten Galeonen übernommen, über die Entermesser. Im Gegensatz zur Entermesser führte die Schwinge nur eine Hand voll ›Falken‹ und ›Wölfe‹ mit sich, und sie war kaum halb so groß wie das andere Schiff. Natürlich bestand die Gefahr, die Imperial Charisian Navy werde die Entermesser schon bald in ein blutverschmiertes Wrack verwandeln. Dennoch stellte das Kommando über ein solches Schiff für dessen Captain beruflich gesehen einen gewaltigen Schritt nach vorn dar.
Trotzdem war Harys stolz darauf gewesen – jedenfalls hatte er diesen Anschein gemacht –, dass sein Prinz ihn dafür ausgewählt hatte, zwei der drei fürstlichen Kinder in Sicherheit zu bringen. Coris zweifelte keinen Moment daran, dass der Captain alles in seiner Macht Stehende unternehmen würde, um diesen Auftrag erfolgreich zum Abschluss zu bringen.
Erneut ging Coris Tartarians Plan zur Evakuierung der Prinzessin und des jüngeren Prinzen durch. Die Idee, nach Osten zu segeln und nicht etwa nach Westen, hielt Coris für sinnig. In den Gewässern rings um Corisande und Zebediah hatte die Charisian Navy ein gewaltiges Truppenaufgebot zusammengezogen. Aber die Schiffe waren im Gebiet zwischen dem Corisande-Bund und dem ursprünglichen Territorium von Charis massiert. Ein einzelnes kleines Schiff, das nach Osten aufbrach, nicht etwa nach Westen – also nicht in das für die Charisianer besonders interessante Gebiet –, hatte vermutlich eher eine Chance, nicht aufgebracht zu werden.
Natürlich barg auch der Ostkurs seine Risiken. Graf Coris dachte an die Trellheim-Piraten und die Schwärme charisianischer Freibeuter, die vor Dohlar kreuzten. Andererseits würde die Schwinge weder unter der Flagge von Corisande noch unter der von Dohlar fahren. Harys hatte sich mit einer ganzen Auswahl verschiedenster Landesflaggen eingedeckt, und er verfügte über hervorragend gefälschte Papiere aus Harchong. Dazu kam, dass man sich aus zweierlei Gründen gerade für die Schwinge entschieden hatte: Neben dem abgelegenen Ankerplatz war ein wichtiger Grund die Fracht, die sie geladen hatte, bevor die Bedrohung durch die Charisianer sie in einen Hafen getrieben hatte. Bislang ließen zumindest alle zur Verfügung stehenden Informationen vermuten, das neue Charisianische Kaiserreich lasse die kleine Handelsmarine von Harchong gänzlich unbehelligt. Wenn indes die Berichte über Harchongs Beteiligung am Bau der neuen ›Vierer-Gruppen‹-Flotte tatsächlich der Wahrheit entsprachen, würde dieser Frieden nicht mehr lange halten. Doch im Augenblick schien es tatsächlich noch so zu sein. Daher könnte es Harys und der Schwinge gelingen, ohne Schwierigkeiten die Shwei Bay zu erreichen. Von dort aus wäre es zweifellos deutlich ungefährlicher, über Land nach Delferahk zu reisen.
Vor allem ist es wichtig, dass wir unerkannt reisen, dachte Coris beinahe schon grimmig. Du bist einfach viel zu wichtig, Irys! Es ist viel besser, wenn du einfach nur eine Nichte bist, nur eine Lady Marglai, die zusammen mit mir nach Delferahk reist.
Auch diese Tarnung war Tartarians Idee gewesen. Die Charisianer würden sofort glauben, Hektor sei bereit, denjenigen seiner Ratgeber, dem er mit Abstand am meisten vertraute, mit einem Hilfeersuchen nach Dohlar und Delferahk zu schicken. Und wenn einer der Feinde von Corisande Coris’ Mission als die persönliche Bemühung besagten Beraters interpretierte, das Land zu verlassen, bevor es endgültig Schiffbruch erlitte, dann war das Coris nur recht. Dass die Schwägerin des Grafen darum gebeten habe, ihre Tochter und ihren Sohn nach Delferahk zu bringen, damit die beiden in Sicherheit wären, klang ebenfalls plausibel. Marglai und Kahlvyn Ahzgood waren ungefähr im selben Alter wie Irys und Daivyn. Gut, Marglai war einige Jahre älter als Irys, Kahlvyn etwas jünger als Daivyn, aber es kam einigermaßen gut hin. Zudem hatten die Ahzgoods in Delferahk Verwandte. Es war durchaus vorstellbar, sie würden Mitgliedern ihrer Familie, auch wenn man einander an sich nicht sonderlich nahe stand, in diesen unruhigen Zeiten einen sicheren Hafen bieten wollen.
Trotzdem gab es immer jede Menge, das schieflaufen konnte. Auf hoher See drohten einer Galeone auch unter normaleren Umständen reichlich Gefahren.
»Glauben Sie wirklich, dass alles klappen wird?«, fragte Irys den Grafen leise, beinahe als hätte sie seine Gedanken gelesen.
»Wünscht Ihr eine ehrliche Antwort?« Er blickte sie an. Dann zuckte er kaum merklich die Achseln. »Ich denke, es wird funktionieren. Ich will Euch nicht vormachen, es gebe nicht reichlich Dinge, die den Plan doch noch durchkreuzen könnten. Aber ich halte den Plan für den bestmöglichen in unserer Situation.«
»Gut, dann kann man wohl kaum mehr erwarten, oder?«, gab Irys nur zurück, schlang den Mantel enger um sich, lehnte sich in ihrem Sitz zurück und schloss die Augen.
Unglücklich legte Merlin Athrawes die Stirn in Falten. Er konnte nicht anders, als dem Grafen Coris Recht geben, so sehr er das bedauerte. Merlin hatte erst recht spät von Hektors Entschluss erfahren, seine Tochter und seinen jüngeren Sohn aus Corisande fort- und damit in Sicherheit zu bringen. Dennoch hatte Merlin schon vor beinahe einem ganzen Fünftag begriffen, was in Corisande vor sich ging. Bedauerlicherweise hatte Hektor dem Kutscher seiner Tochter und der Kavallerie-Eskorte unter anderem aufgetragen, so rasch wie möglich zu reisen. Auf diese Weise war Merlin nicht mehr genug Zeit geblieben, die Hand voll leichter Kreuzer, die das Meer zwischen Sword Point und East Island sicherten, noch rechtzeitig zu informieren. Irys und Daivyn würden vor ihnen Elvarth erreicht haben.
Kurz hatte Merlin in Erwägung gezogen, sie mit Hilfe seines Aufklärer-Schwebebootes persönlich abzufangen. Er verwarf den Gedanken aber rasch wieder. Natürlich wäre er mit dem Schwebeboot rechtzeitig eingetroffen; aber was hätte er dann unternehmen sollen? Er konnte ja kaum die Galeone zerstören, die am Kai der kleinen Stadt vor Anker lag, ohne Aufsehen zu erregen. Merlin war auch nicht bereit, das Schiff einfach mit Mann und Maus zu versenken, sobald es erst einmal das offene Meer angesteuert hätte. Schließlich befanden sich neben der Besatzung auch ein junges Mädchen und ihr kleiner Bruder an Bord. Leider sahen weder Merlin noch Cayleb eine Möglichkeit, ihr Wissen um die wertvolle Fracht der Galeone Schwinge mit beispielsweise den Freibeutern in dohlaranischen Gewässern zu teilen: Diese rechtzeitig zu benachrichtigen hätte wieder viel zu viel Aufsehen erregt und unschöne Fragen nach Caylebs Quellen nach sich gezogen.
Cayleb, den Merlin selbstredend sofort über Hektors Pläne informiert hatte, konnte, wie Merlin selbst, auch nur hoffen, dass einer der Patrouillen-Schoner durch Zufall auf die Schwinge stieße, sie aufbrächte und dann feststellte, welch unglaublich wertvollen Fang man gerade gemacht hatte. Aber Captain Zhoel Harys war ein fähiger Kommandeur. Daher war es wahrscheinlicher, dass Irys und Daivyn ungehindert König Zhames’ Hof erreichen würden.
Weder Merlin noch Cayleb behagte die Vorstellung, dass die beiden ihnen einfach entkommen sollten. Aber es war doch unwahrscheinlich, dass die erfolgreiche Flucht der beiden sich allzu sehr auf die Ereignisse in Corisande auswirken würde. Zumindest nicht kurzfristig. Langfristig wäre es sicher … lästig oder sogar deutlich schlimmer. Und deswegen hoffte Captain Athrawes auch inständig, dass einer ihrer Schoner eben doch Glück hätte und auf eine Galeone namens Schwinge stieße.
.II.
Herzogtum Manchyr,Corisande-Bund
Man hätte das Brandungsboot auch für einen dunkleren Fleck in der mondlosen Nacht halten können, als es sich aus Südosten näherte. Es war sorgfältig mattschwarz lackiert, und die Matrosen an den Rudern legten sich stetig, aber mit besonderer Umsicht in die Riemen. Man konnte jetzt wirklich nicht gebrauchen, dass Brandungsgischt ins Boot geriete und es überspült würde. Das Schießpulver der Passagiere würde dann nass – und noch einiges andere.
Sergeant Edvarhd Wystahn saß auf der vorderen Ruderbank. Das Gewehr hielt er zwischen den Knien aufgestellt. Er spähte zum schwarzen, nur undeutlich erkennbaren Strand hinüber. Abgesehen von den Schaumkronen der Wellen, die sich am Sandstrand brachen, der das Mondlicht gelblich reflektierte, konnte Wystahn keinerlei Details erkennen. Er glaubte, jenseits des Strandes einen Hügel aufragen zu sehen, der sich matt gegen den Sternenhimmel abhob. Vielleicht jedoch, wie sich der Sergeant selbst eingestand, bildete er sich das ja auch nur ein.
Ich habe viel zu lange diese verdammten Karten studiert, dachte er und grinste schief. Den ganzen letzten Fünftag lang habe ich sogar schon davon geträumt!
Eigentlich war das durchaus zu verschmerzen. Einer der Grundsätze der Aufklärer-Schützen lautete: Man darf sich ruhig im Vorfeld, beim Planen und Üben für einen Einsatz überarbeiten, anstatt Verluste hinzunehmen, die sich durch ein wenig Vorausdenken hätten vermeiden lassen.
»Ganz ruhig!«, zischte der Unteroffizier, der für dieses Brandungsboot verantwortlich war. »Riemen hoch! Styv, Zhak – ab über Bord!«
Sanft überwand das Boot auch noch die letzten Wellen und hielt dann dank des Ankers am Heck seine Position: Bug in Richtung Strand. Die beiden Matrosen ließen sich über das Dollbord in das hüfthohe Wasser gleiten. Die Brandung trug sie fast davon, als sie sich mit all ihrem Gewicht gegen das Boot stemmten, um es vorwärts zu schieben. Als das Wasser noch flacher wurde, fanden sie besser Halt. Dann bohrte sich der Bug des Bootes auch schon mit einem leisen Knirschen in den Sand. Der Laut übertönte kaum das Rauschen von Wellen und Wind, und der Unteroffizier nickte Wystahn zu.
»Hier müssen Sie aussteigen, Sergeant«, sagte er leise, und Wystahn bemerkte, wie in einem breiten Grinsen die Zähne seines Gegenübers aufblitzten. »Gute Jagd!«
Wystahn nickte ihm zu, dann wandte er sich an die Männer seines Trupps.
»Also gut, Jungs«, sagte er, »los geht’s!«
Er kletterte über die Bordwand und watete durch das Wasser, das seine Füße umspülte. Die Wellen, die mit letzter Kraft den Strand erreichten, reichten ihm bis zu den Knien. Seine Stiefel wirbelten Sand auf; die Rückströmung trug die feinen Körner wieder hinaus aufs offene Meer. Wystahn spürte, wie einzelne Wellenkämme an seinen Waden leckten. Der feste Boden gab bei jedem Schritt unter seinen schweren Stiefeln nach. Dann, endlich, war der Sergeant aus dem Wasser – sofern man das sagen konnte bei all dem Wasser in seine Stiefeln! Er ignorierte das und blickte sich am Strand um. Dann schaute er zu den Sternen hinauf, um sich zu orientieren.
»Sieht aus, als hätten die Lamettahengste uns ausnahmsweise mal an den richt’gen Ort geschickt«, meinte er, und mehrere seiner Leute glucksten leise. »Hier ist’s ja noch finst’rer als in ’nem Bärenarsch«, fuhr er fort, »aber ich denk, das da drüben, das ist unser Hügel.«
Er deutete in Richtung Hügel. Erneut blickte er zum Sternenhimmel auf, orientierte sich ein letztes Mal und nickte dann Ailas Mahntyn, dem erfahreneren seiner beiden Corporals, knapp zu.
»Legen Sie los, Ailas, und versuchen Sie, ausnahmsweise mal nicht über Ihre Plattfüße zu stolpern!«
Mahntyn schnaubte nur und brach in die Finsternis auf. Wystahn und der Rest der Aufklärer-Schützen ließen dem Corporal einen angemessenen Vorsprung. Dann folgten sie ihm den Strand hinauf und hinein in das hohe, widerspenstige Gras, dessen Rascheln und Flüstern in der stetigen Brise dem Gemurmel des Meeres zu antworten schien.
»Ich hoffe, diese tolle Idee, die ich da hatte, zahlt sich auch aus«, bemerkte Kaiser Cayleb. Er stand auf der Heckgalerie der Kaiserin von Chans und blickte zu jenen Sternen auf, die gerade eben noch Sergeant Wystahn begutachtet hatte. Von Caylebs Standpunkt aus waren keine Hügel am Strand zu erkennen. Doch er sah den Schein der Sterne, der sich in den Segeln mindestens eines halben Dutzends Galeonen fing. Langsam schüttelte der junge Kaiser den Kopf. »Ich glaube nicht, dass Bryahn allzu glücklich darüber sein wird, mitten in der Nacht in dieser Art und Weise an Land gehen zu müssen«, setzte er hinzu.
»Unfug«!, widersprach Merlin, der selbst hier über Cayleb wachte. »Warum sollte ein Admiral sich denn auch Sorgen darüber machen, mit zwölf Kriegsschiffen und sechzig Transporter-Galeonen, vollgestopft mit fünfzehn- oder zwanzigtausend Marines, geradewegs auf einen Strand zuzuhalten, den er nicht sehen kann?«
»Na, vielen Dank auch!« Cayleb wandte sich um, lehnte sich gegen die Reling der Galerie und blickte seinen inoffiziellen Ratgeber an. »Ihr wisst wirklich ganz genau, wie man Zuversicht verbreitet!«
»Man bemüht sich«, gab Merlin zurück und strich sich über den eingewachsten Bart. Cayleb lachte leise, und auch Merlin lächelte. Aber dieses Lächeln schwand rasch wieder, als er sich an eine andere Nacht zurückerinnerte, in der er auf einer Heckgalerie eines anderen Schiffes gestanden und sein letztes Gespräch mit König Haarahld geführt hatte.
Ach, jetzt hör aber auf!, schalt er sich selbst. Und such auch nicht ständig nach bösen Vorzeichen! Es ist ja nun nicht so, als würde Cayleb gleich zusammen mit den ersten Truppen an Land gehen!
»Wie läuft es denn?«, fragte Cayleb in nun deutlich ernsthafterem Tonfall, und Merlin zuckte mit den Schultern.
»So weit, so gut.« Vor dem geistigen Auge sah er die schematischen Darstellungen, die Owl ihm von den SNARCs übermittelte; die Plattformen überwachten den kleinen Trupp charisianischer Marines bei ihrem Marsch landeinwärts ständig. »Die meisten sind weniger als tausend Schritt vom gewünschten Ort aus an Land gegangen«, fuhr er dann fort. »Wir haben eine Einheit, die es geschafft hat, etwas mehr als eine Meile weiter südlich des gewünschten Punktes anzulanden, aber die dient ohnehin bloß der Täuschung. Im Augenblick sieht es so aus, als wäre der ganze Rest ziemlich genau im Zeitplan.«
»Gut.«
Cayleb wandte sich wieder ab und schaute einige Augenblicke lang nur schweigend in die Nacht hinaus. Dann holte er tief Luft und nahm sich zusammen.
»Gut«, wiederholte er. »Und jetzt wäre es, wie Domynyk mir vor Rock Point empfohlen hat, ein guter Zeitpunkt, ein wenig zu schlafen.«
»Das halte ich für eine ausgezeichnete Idee«, pflichtete Merlin ihm bei.
»Na, bis zum Morgengrauen kann ich ohnehin nicht allzu viel Sinnvolles tun«, meinte Cayleb. Er klang deutlich ruhiger, als ihm eigentlich zumute war, das wusste Merlin genau. Jetzt aber deutete er mit einem Finger auf seinen ›Leibgardisten‹. »Was Euch betrifft, Seijin Merlin, bin ich unter den gegebenen Umständen bereit, auf Eure Dienste zu verzichten, damit Ihr Eure ›Auszeit‹ bekommt. Aber das gilt nur heute Abend, nicht dass Ihr das missversteht!«
Merlin schnaubte belustigt und verneigte sich ironisch vor seinem Kaiser.
»Jawohl, Euer Kaiserliche Majestät. Was immer Ihr befehlt, Euer Kaiserliche Majestät«, erwiderte er in übertrieben salbungsvollen Ton.
Erleichtert seufzte Wystahn, als Ailas Mahntyn lautlos zwischen den hohen Gräsern hervortrat, die das Ziel, den Hügel, überwucherten. Der Sergeant hob die Hand und gebot dem Trupp, der ihm dichtauf folgte, Halt zu machen. Mahntyn deutete auf einen Punkt, der etwas weiter den Hügel empor lag.
»Die sind genau da, wo sie zu vermuten waren, Sarge«, flüsterte der Corporal, und es gelang ihm, mit seinen Worten das stetige Seufzen des Windes zu übertönen. »Vier Mann. Die haben einen Signalmast und ein paar Flaggen. Ein Signalfeuer scheint’s da auch zu geben. Zwo von denen schlafen. Einer sitzt auf einem großen Felsblock – der hat wohl Wache. Der Vierte macht gerade Tee oder so. Der eigentliche Wachposten steht ungefähr fünfzig Schritt weit in dieser Richtung da.« Mahntyn deutete hügelaufwärts ein wenig weiter nach rechts. »Lagerfeuer und Signalausrüstung sind da drüben.« Mahntyn zeigte nach links. »Zelte und die andere Ausrüstung liegen auf der landwärtigen Seite des Hügels.«
»Gute Arbeit«, erwiderte Wystahn leise.
Ailas Mahntyn hatte noch weniger eine ›anständige Ausbildung‹ genossen als Wystahn. Aber er war im Echsengebirge aufgewachsen, und sein Talent, sich lautlos zu bewegen – ganz zu schweigen davon, dass er selbst im Stockfinsteren noch etwas sehen konnte –, war schlichtweg phänomenal. Er hatte das geschulte Auge eines echten Waldbewohners, wenn es darum ging, ein Gelände einzuschätzen. Er besaß die Fähigkeit eines Jägers, sich in seine Beute hineinzuversetzen – und sein Verstand war messerscharf, auch ohne ›Ausbildung‹. Wann immer sie sich nicht gerade bei einem Einsatz befanden, versuchte Wystahn seinem Corporal das Lesen und Schreiben beizubringen. Denn diese Fertigkeiten waren nun einmal Voraussetzung dafür, Sergeant bei den Aufklärer-Schützen zu werden. Wystahn hielt viel von Mahntyn – auch wenn er sorgsam darauf achtete, dies seinem Corporal gegenüber niemals zu erwähnen. Wystahn hielt so viel von Mahntyn, dass es ihn nicht im Mindesten überraschen würde, wenn dieser Corporal es irgendwann sogar zum Offizier brächte. Voraussetzung war allerdings, er bekäme das mit dem Lesen und Schreiben leidlich hin. Doch was das anging, war Mahntyn bedauerlicherweise noch längst nicht so weit. Er bemühte sich redlich, mehr, als er das anderen gegenüber eingestanden hätte. Aber für ihn waren Buchstaben noch ungleich schwerer zu fassen als jede Zinkenechse.
Der Sergeant schob seine Gedanken zu Mahntyn beiseite und wandte sich um. Er bedeutete dem Rest seines Trupps, sich um ihn und den Corporal zu sammeln.
»Wiederholen Sie das noch einmal für die Jungs!«, wies er Mahntyn an und hörte selbst auch beim zweiten Mal ebenso aufmerksam zu wie beim ersten Mal. Als der Corporal seinen Bericht beendet hatte, machte sich Wystahn daran, seinen Männern die jeweiligen Aufgaben zuzuweisen.
»… und Sie übernehmen den Wachposten«, endete er zwei Minuten später und tippte Mahntyn gegen die Brust.
»Aye«, erwiderte der Corporal lakonisch und nickte den anderen drei Männern seiner Gruppe zu.
Sie alle waren ebenso wortkarg wie er, und sie bewegten sich fast ebenso leise. Hin und wieder vermochte Wystahn zu hören, wie eine Stiefelsohle über einen Stein schabte … aber vielleicht war auch das nur Einbildung. Um den Wachposten jedenfalls würde er sich keine Gedanken machen müssen. Mahntyn, der auf Wystahns Befehl hin den Mann auf dem Felsblock ausschalten würde, war der Beste für diese Aufgabe. Schließlich war er nicht nur leise und umsichtig, sondern hatte den Corisandianer auch schon ausgemacht und sich sicherlich gleich überlegt, wie er ihn am besten erreichen könnte. Der Mann, der gerade Tee kochte – oder was immer er auch trieb –, war im Schein des Lagerfeuers leicht zu entdecken. Falls der Bursche beim Kochen auch noch in die Flammen geschaut hatte, war er im Finsteren der Nacht gänzlich blind. Die beiden anderen schliefen in ihren Zelten. Keiner dieser drei Männer würde wohl bemerken, wenn sich jemand an sie anschlich. Der Wachposten hingegen saß im Dunkeln; seine Augen hatten sich an die Nachtschwärze längst gewöhnt. Angesichts der Aufgabe, die er zu erfüllen hatte, würde er zudem auch hellwach und aufmerksam sein. Natürlich waren Soldaten eben auch nur Menschen, und da bei den gegebenen Lichtverhältnissen nicht einmal die Erzengel selbst mehr als wenige hundert Schritt weit ins Landesinnere schauen könnten, war der Mann vermutlich nicht so wachsam, wie das eigentlich von ihm erwartet wurde. Darauf allerdings wollte sich Edvarhd Wystahn nicht verlassen. Und wenn der Corisandianer tatsächlich aufmerksam seine Pflichten erfüllte, dann würde es deutlich schwieriger werden, sich an ihn anzuschleichen als an seine Kameraden.
»Also gut«, sagte der Unteroffizier zu den Männern, die er nicht zusammen mit Mahntyn fortgeschickt hatte, »dann wollen wir die Burschen mal wecken gehen!«
Kaiser Cayleb trat auf das Achterdeck der Kaiserin von Chans und blickte zum Himmel hinauf. Langsam näherten sich von Osten feine Wolkenschleier. Doch es war unverkennbar, dass sie hoch oben am Himmel trieben und sehr dünn waren. Es war etwas gänzlich anderes als die dichten Sturmwolken, die ihnen allen während der letzten Monate nur allzu vertraut geworden waren. Die Sterne schimmerten über ihnen. Aber die feinen Wolkenfäden wirkten bereits hellgrau, als spähe die Sonne schon über den Rand der Welt hinweg. Die Nacht fühlte sich an, als nahe allmählich der Morgen. Respektvoll hielten Captain Gyrard und seine Offiziere Abstand, als ihr Kaiser mit großen Schritten an die Heckreling trat und achteraus blickte. HMS Dauntless folgte dem Flaggschiff dichtauf, und es war mittlerweile tatsächlich eindeutig leichter, sie auszumachen, als zuvor.
Captain Athrawes war in ein leises Gespräch mit Captain Gyrard vertieft gewesen, als der Kaiser an Deck gekommen war. Nun nickte der Seijin Gyrard kurz zu, überquerte das Deck und bezog hinter Cayleb Stellung. Dabei verschränkte er die Hände hinter dem Rücken, als warte er respektvoll ab.
Noch einige Augenblicke lang inspizierte der Kaiser den Himmel, die See und den Wind, dann wandte er sich seiner persönlichen Leibwache zu.
»Ja?«, fragte er leise.
»Ja«, stimmte Merlin zu, ebenso leise, und deutete eine Verneigung an.
Niemand, dessen Gehör nicht besser gewesen wäre als das Merlins, hätte diesen kurzen Wortwechsel mit anhören können. Schließlich gab es hier die unausweichliche Lautkulisse eines Segelschiffes unter voller Fahrt. Doch es sollte auch niemand zuhören. Obwohl der Kaiser keine Miene verzog, war ihm anzumerken, dass sich seine Stimmung aufhellte.
Für Merlin galt das nicht. Doch er hatte ja bereits gewusst, was Cayleb erst erfragen musste. Die Besatzungen der Boote, die Aufklärer-Schützen, hatte man sorgfältig darüber informiert, wohin sie sich wenden sollten, sobald sie erst an Land wären. General Chermyn und seine Offiziere waren alle an Orte geschickt worden, an denen Wachposten zu erwarten gewesen waren – an Orte nämlich, an denen Seine Majestät, Kaiser Cayleb, Wachen aufgestellt hätte, um seine Küste zu sichern, wäre er an Sir Koryn Gahrvais Stelle gewesen und hätte sich ganz besonders viel Sorgen gemacht.
Einige der Marines waren der Ansicht, der Kaiser übertreibe mit seinen Vorsichtsmaßnahmen. Andere hatten sich insgeheim gefragt, ob ihr Kaiser, so groß sein Geschick als Admiral auch sein mochte, wohl auch als Landratte erfahren genug sei, anhand einer Karte geeignete Aussichtspunkte zu erkennen. Doch jeder einzelne dieser Zweifler war klug genug gewesen, seine Meinung für sich zu behalten. Cayleb hatte seine Glaubwürdigkeit zu steigern gewusst, indem er zwei Tage an Bord eines der Schoner der Flotte verbracht hatte, ständig auf dem Fockmars. Diese heikle Position hatte den Skipper des Schoners beachtlich Sorgen gemacht. Dort oben hatte Cayleb persönlich die Küste mit einem Fernglas abgesucht. Natürlich hatte sich der Schoner zu diesem Zeitpunkt lediglich auf einer Routine-Patrouille befunden und daher nicht die persönliche Standarte mit der Krone gehisst, mit der offiziell verkündet wurde, der Kaiser befinde sich an Bord. Gewissenhaft hatte Cayleb einen ganzen Notizblock vollgeschrieben. Es brauchte ja niemand zu wissen, dass ihm diese Notizen in Wirklichkeit der Seijin diktiert hatte, der neben ihm auf dem Fockmars ausgeharrt hatte (vorgeblich, um dafür zu sorgen, dass der Kaiser nichts Törichtes anstellte – wie etwa über die eigenen Füße zu stolpern und als großer, hässlicher Fleck auf dem Deck des Schoners zu enden).
Und tatsächlich war Koryn Gahrvai besorgt genug gewesen, um Wachposten aufzustellen. Der Kommandeur der chisholmianischen Armee war sich des Risikos nur zu bewusst, das er eingegangen war, als er seine vordersten Truppen im Talbor-Pass postiert hatte. Er wusste außerdem ganz genau, was passieren konnte, wenn eine hinreichend große Truppe per Schiff hinter seine Reihe gebracht würde. Doch Gahrvai hatte nicht die Absicht, Cayleb dergleichen tun zu lassen. Aus diesem Grund hatte er eine ganze Reihe von Wachposten aufgestellt, alle stets in Blickweite zueinander: Entlang der Küste von Manchyr sicherten sie eine Strecke von beinahe fünfzig Meilen, ausgehend von den Dark Hill Mountains. Jeder dieser Wachposten war mit Signalflaggen ausgestattet, und an strategisch wichtigen Stellen hatte man Semaphorenmasten aufgerichtet. Gahrvai hatte die höchstmöglichen Erhebungen in der Landschaft ausgewählt. So sollten seine Wachposten sogar noch den Weißpferd-Kanal ideal einsehen und daher charisianische Galeonen sechs Stunden vor ihrer eigentlichen Anlandung sichten können.
Natürlich verließ man sich dabei aufs Tageslicht. Wären die Charisianer allerdings selbstbewusst genug, sich im Schutze der Dunkelheit der Küste zu nähern und den Landgang im Morgengrauen zu starten, würden Gahrvais Wachposten dieses halbe Dutzend an Stunden Vorsprung einbüßen. Doch selbst in einem solchen Fall würden die Wachen Gahrvai mit Hilfe der Semaphoren eine Warnung zukommen lassen, lange bevor charisianische Marines das südliche Ende des Talbor-Passes erreichten. Zudem hätten die Charisianer keinerlei Kavallerieunterstützung. Ohne die sechs Stunden Vorwarnzeit würde es für Gahrvai allerdings schwieriger, seine Infanterie aus dem Pass abzuziehen, bevor die Charisianer ihn einkesseln konnten. Gahrvai wiederum hatte Kavallerieunterstützung. Er hatte Graf Windshares Männer bereits in Stellung gebracht; sie sollten ihm den Rücken freihalten.
Alles in allem hatte Gahrvai also gute Gründe, sich zumindest einer Sache sicher zu sein: Die Charisianer befanden sich östlich von ihm. Und Gahrvai hatte die Absicht, dafür zu sorgen, dass es dabei auch bliebe. Sollte es dem Feind trotz aller Bemühungen gelingen, ihn am Talbor-Pass zu umgehen, wollte er sich so rasch wie möglich nach Manchyr zurückfallen lassen und sich die massiven Befestigungen rings um die Hauptstadt zunutze machen, für die sein Vater gesorgt hatte. Die Zeit arbeitete für Corisande, vor allem jetzt, wo Anvil Rock von den charisianischen Gewehren wusste und bereits damit begonnen hatte, sie nachbauen zu lassen. Es gab nur eines, was sich Corisande nicht leisten konnte, nämlich dass seine Feldarmee aufgerieben würde. Deshalb würde sich Gahrvai – auch angesichts einer Armee, die nur halb so groß war wie seine eigene – von einer schwer befestigten Stellung in eine andere zurückziehen. Die Zweifel an seinem Mut, die deswegen aufkommen mochten, die Kritik, die es hageln würde, scherten Gahrvai in einer solchen Lage wenig.
Bedauerlicherweise hatte Sir Koryn keine Vorstellung davon, in welchem Ausmaß Merlin Athrawes Aufklärung zu betreiben vermochte und über welch detaillierte Kenntnisse Kaiser Cayleb Ahrmahk daher verfügte. Merlin hatte sämtlichen Besprechungen des Stabes und aller Offiziere beigewohnt, hatte jeden der Kommandeure beobachtet, hatte ihre Stärken und Schwächen analysiert. Merlin und damit auch Cayleb wussten ganz genau, warum Gahrvai sich für die gewählte Kommandostruktur entschieden hatte. Seine Entscheidung war an sich gut; Cayleb hätte an seiner Stelle vermutlich nicht anders entschieden. Aber Cayleb war so gut informiert, dass er von einem möglicherweise fatalen Fehler in Gahrvais Kommandokette wusste. Aus diesem Grund hatte er Merlin gebeten, jeden einzelnen Beobachtungsposten der Corisandianer aufzuspüren. Merlin hatte deren Verbindungslinien skizziert und die Stellungen der Semaphoren ermittelt, die als Zentralknotenpunkte dieser Verbindungslinien fungierten. Anhand dieser Informationen hatte Cayleb die nächtlichen Anlandungen geplant, in deren Rahmen Sergeant Wystahn und seine Männer corisandianische Strände erreicht hatten.
Sorgsam hatte Cayleb darauf geachtet, auch einige ›mutmaßliche Beobachtungsposten‹ zu benennen. In Wahrheit wusste er genau, dass dort niemand postiert war. Und umgekehrt hatte er auch bewusst einige Wachposten ausgelassen, obwohl er von deren Existenz wusste – allerdings waren das Wachposten, die ihre Berichte stets über einen der Zentralverbindungsknoten weiterleiteten und nicht etwa unmittelbar an Gahrvais Hauptquartier. Es wäre gänzlich undenkbar gewesen, mit widernatürlicher Unfehlbarkeit wirklich jeden einzelnen Beobachtungsposten anzugreifen, und ebenso wenig konnte sich Cayleb leisten, nicht wenigstens hier und da einige seiner Truppen buchstäblich ins Leere laufen zu lassen. Er musste allerdings darauf hoffen, niemand würde bemerken, dass es sich bei den ›übersehenen‹ Posten ›zufälligerweise‹ genau um die handelte, die niemandem mit Hilfe von Signalen berichten konnten, was sie beobachtet hatten. Gegen Boten und Kuriere konnte Cayleb natürlich nichts unternehmen. Doch von jeder der noch verbliebenen Positionen aus würde es zumindest mehrere Stunden dauern, bis Meldeläufer Gahrvai unmittelbar Bericht erstatten könnten. Und das setzte schon voraus, dass der betreffende Kurier schlau genug war zu begreifen, was vor sich ging, und sofort zum Talbor-Pass lief, statt erst noch zu überprüfen, warum der benachbarte Wachposten nicht den Eingang der abgesetzten Meldungen bestätigte.
Gahrvai in den Rücken zu fallen und zuvor seine Warnkette auszuschalten, auf die er sich verließ, war natürlich nicht die ideale Lösung des Problems. Es war lediglich eine Lösung, die nicht einmal der weiseste und gerissenste Kommandeur des Gegners hätte vorausahnen können.
Gahrvai ist ein derart achtbarer Gegner, dass er wirklich etwas Besseres verdient, als derart ausgetrickst zu werden, dachte Cayleb. Ich komme mir vor, als würde ich mogeln. Aber wie Merlin so schön sagt: Wenn man nicht mogelt, strengt man sich nicht genug an.
Der Kaiser wandte den Blick nach Osten und suchte mit den Augen den Horizont ab. Nun war es unverkennbar, dass sich der Himmel tatsächlich aufhellte: Hinter der Dauntless waren weitere Galeonen auszumachen. Wenn die Sturmboote erst einmal die Strände erreicht haben, wird das Licht für meine Zwecke voll und ganz ausreichen, entschied er. Er überquerte mit großen Schritten das Achterdeck und ging auf Captain Gyrard zu. Das Klacken seiner Absätze auf den taufeuchten Holzplanken war der einzige Laut, der nicht dem Wind oder den Segeln geschuldet war, und der Kommandant des Flaggschiffes nahm respektvoll Haltung an, als Cayleb vor ihm stehen blieb.
»Also gut, Captain Gyrard«, sagte der Kaiser förmlich. »Setzen Sie das Signal!«
»Aye aye, Euer Majestät.« Zum militärischen Gruß legte Gyrard die Hand an die Schulter und nickte dann Lieutenant Lahsahl zu.
Einen kurzen Moment später rauschten an Bord der Kaiserin von Chans leuchtende Signal-Laternen bis zur Spitze des Besan empor.
»Ist das nicht ein herrlicher Anblick?«, murmelte Edvarhd Wystahn in sich hinein.
Er stand auf der Felsnase, auf der in der vergangenen Nacht der corisandianische Wachposten gekauert hatte, und musste sich eingestehen, dass der Bursche einen atemberaubenden Blick auf die funkelnden Wellen des Weißpferd-Kanals gehabt hatte. Doch vorerst gehörte Wystahn dieser Anblick ganz allein. Er vermutete, der Vorbesitzer dieses Aussichtspunktes wäre viel unglücklicher als er ob des Anblicks, der sich ihm auf den Weiten der See bot.
Die Transport-Galeonen lagen bereits vor Anker oder drehten gerade bei, um sich von ihren Beibooten zum Ufer ziehen zu lassen. Die Sturmboote mit ihren flachen Schiffsböden hatten die Männer bereits an Land gebracht, die an Bord eben dieser Fahrzeuge den weiten Weg von Dairos hierher zurückgelegt hatten. Na, die werden mal froh sein, endlich fest’n Boden unter’n Füßen zu ham, dachte Wystahn und gestattete sich ein Grinsen. Die Sturmboote hatten bereits mehrmals ihren Wert unter Beweis gestellt. Bei jedem stärkeren Seegang allerdings konnte man problemlos auf die Idee kommen, Shan-wei persönlich habe sie entworfen – und es stand so fest wie das Amen in der Kirche, dass bei jedem dieser Boote mindestens der eine oder andere an Bord genommene Marine seekrank wurde.
Und wenn der erste arme Teufel mit m Kotzen anfängt, mach’n die andren sofort alle mit. Ich wette, am Strand war jeder von denen grasgrün im Gesicht und hat sich die Seele aussem Leib gereihert.
Doch falls dem so war, so ließ keiner der Soldaten sich etwas davon anmerken, als die erste Welle der Infanteristen sich zu Kolonnen formierte und dann landeinwärts marschierte. Die Boote hatten zunächst die Dritte Brigade unter dem Kommando von Brigadier Clareyk und dazu Brigadier Haimyns Fünfte Brigade angelandet, gefolgt von der Ersten, die Brigadier Zhosh Makaivyr unterstand. Jetzt schwärmten diese sechstausend Mann aus, um landeinwärts die Landezone zu sichern. Unterdessen fuhren die Sturmboote wieder zu den wartenden Galeeren hinaus, um auch die anderen neuntausend Mann abzuholen, die sich bereits jetzt darauf vorbereiteten, ihren Kameraden zu folgen.
Wystahn selbst war der Ansicht, die Chancen, den ganzen Plan des Kaisers in die Tat umzusetzen, stünden schlechter als eins zu eins. Es war einfach viel zu wahrscheinlich, dass sie einen Wachposten übersehen hatten, zufälligerweise ein Kavallerist sie bemerkte oder ein Signalposten irgendwo im Inland sie entdeckte, bevor sie es geschafft hätten, ganz hinter die corisandianischen Truppen vorzurücken. Aber das war Edvarhd Wystahn durchaus recht so. Wenn es klappte, dann klappte es eben. Dann wäre der Krieg wahrscheinlich schon so gut wie vorbei. Und wenn es nicht klappen sollte, dann würde das die Corisandianer zumindest dazu zwingen, sich aus diesen vermaledeiten Stellungen im Pass zurückzuziehen, ohne dass Wystahn und seine Marines genötigt wären, diese beachtlichen Befestigungsanlagen frontal anzugreifen. Und das bedeutete, dass Ahnainah Wystahn aus der Grafschaft Lochair viel weniger damit würde rechnen müssen, zur Witwe zu werden.
»Was?!«
Koryn Gahrvai starrte seinen Adjutanten an. Schweigend erwiderte der Lieutenant den Blick, die Augen weit aufgerissen. Dann streckte er seinem Vorgesetzten ein Blatt Papier entgegen.
»Hier ist das Signal, Sir«, sagte er.
Es gelang Gahrvai – irgendwie –, dem jungen Burschen das Blatt nicht geradewegs aus der Hand zu reißen. Dann trat er näher an die offene Klappe des Kommandozeltes heran, um mehr Licht zu haben, und überflog die mit Bleistift geschriebenen, schnell hingeworfenen Zeilen. Dann las er sie noch einmal. Und ein drittes Mal.
Besser wurde es dadurch nicht.
Er hob den Kopf, starrte blicklos aus dem Zelt hinaus und beobachtete eine kleine Ewigkeit lang das alltägliche Treiben im Lager. Schließlich wandte er sich wieder den versammelten Offizieren zu, deren Besprechung so abrupt unterbrochen worden war.
»Irgendwie ist es Cayleb gelungen, hinter unsere Reihen zu gelangen«, sagte er mit rauer Stimme.
Die Köpfe der Männer ruckten hoch; niemand wollte glauben, was der Oberkommandierende soeben verkündet hatte. Die Offiziere, die den Kartentisch umstanden, schauten Gahrvai beinahe ebenso betäubt an, wie er selbst sich fühlte.
Doch Baron Barcors Gesichtsausdruck zeigte mehr als Unglauben. Seine Miene schien einen Herzschlag lang wie versteinert. Dann konnte Gahrvai beobachten, wie Barcor jegliches Blut aus dem Gesicht schwand und er so blass wurde wie Kalk. Das war alles andere als beruhigend. Schließlich war Barcor gerade erst angesichts seiner Verdienste bei Haryl’s Crossing zum Oberbefehlshaber der gesamten Nachhut der Armee von Corisande befördert worden. Gahrvai hatte diesen Posten mit Bedacht für Barcor gewählt: Oberbefehlshaber zu werden schien eine angemessene Belohnung zu sein. Faktisch aber war Barcor der Verwalter sämtlicher für die Front vorgesehener Reserveeinheiten geworden, mehr aber auch nicht. Gahrvai hatte niemals die Absicht gehabt, einen von Barcors Männern unter dem Kommando des Barons in die Schlacht ziehen zu lassen. Stattdessen hatte er ganz nach Bedarf einzelne Bataillone und Regimenter abziehen und diese ›vorübergehend‹ dem Kommando von Offizieren von echtem Format – wie etwa Graf Mancora – unterstellen wollen.
Mancora, der bei Haryl’s Crossing zwar leicht verwundet worden war, es aber trotzdem irgendwie geschafft hatte, zusammen mit einer bedauernswert kleinen Schar aus seinem Flügel die Reihen der Nachhut zu erreichen, wirkte ebenfalls erstaunt. Aber in seinen Augen fand sich keine Spur dessen, was Gahrvai mit den Worten ›betäubt wie ein Last-Drache‹ beschrieben hätte. Bedauerlicherweise war Mancora dafür abgestellt worden, das Kommando über die vordersten Einheiten im Talbor-Pass zu übernehmen.
Und das bedeutet, dass ich genau die falschen Leute an genau den falschen Orten stehen habe … schon wieder!, dachte Gahrvai verbittert. Mancora hätte seine Leute innerhalb einer Stunde in Marsch gesetzt. Langhorne allein weiß, wie lange Barcor brauchen wird, seinen fetten Arsch zu bewegen!
»Wie schlimm ist es, Sir?«, erkundigte sich Mancora mit leiser Stimme.
»Das kann ich noch nicht sagen«, gestand Gahrvai. »Aber laut diesem Bericht«, sagte er und wedelte mit der Depesche, »haben die es irgendwie geschafft, in dem Sektor an Land zu gehen, der dem Pass am nächsten ist, ohne dass uns auch nur ein einziger unserer Wachposten vorgewarnt hätte.«
»Aber das ist unmöglich!«, platzte Barcor heraus und setzte dann hastig noch ein »Sir« hinzu.
»Genau das dachte ich auch«, pflichtete ihm Gahrvai mit grimmiger Miene bei. »Bedauerlicherweise haben wir uns da beide getäuscht, Mein Lord. Die müssen unmittelbar bei Tagesanbruch angelandet sein. Wie die es geschafft haben, unsere Wachposten auszuschalten, bevor die auch nur eine einzige Nachricht absetzen konnten, übersteigt wirklich mein Vorstellungsvermögen! Aber laut diesem Bericht hier befinden sie sich weniger als zwanzig oder sogar nur fünfzehn Meilen vor dem Westende des Passes entfernt.«
Barcors verdutzter Gesichtsausdruck verwandelte sich in etwas, was Gahrvai entschieden zu sehr nach Panik aussah.
»Liegt uns bereits eine Abschätzung ihrer Truppenstärke vor, Sir?«
Diese Frage kam von Colonel Ahkyllys Pahlzar, dem Mann, der zuvor Charlz Doyals stellvertretender Kommandeur gewesen war. Nachdem Doyal in charisianische Gefangenschaft geraten war, hatte Pahlzar das Kommando über Gahrvais Artillerieeinheiten übernommen. Eigentlich hätte man ihn entsprechend befördern müssen. Dieses Versäumnis wollte Gahrvai so rasch wie möglich berichtigen, und im Augenblick stellte Pahlzars ruhige Stimme einen sehr willkommenen Kontrast zu Barcors Entsetzen dar.
»Nein, Colonel. Aber ich denke, wir dürfen davon ausgehen, dass er mit einer Übermacht anrückt. Wir haben bereits festgestellt, dass er nicht zu der Art Feldherr gehört, der eine schwache Einheit ohne jegliche Unterstützung ausschickt, bloß um sie dann aufreiben zu lassen.«
Sichtbar gequält verzog Barcor das Gesicht, als Gahrvai ihn mit diesen Worten daran erinnerte, was in Haryl’s Crossing geschehen war. Einige weitere der versammelten Offiziere wirkten ähnlich unglücklich. Andere jedoch – darunter auch Mancora und Pahlzar – nickten nur zustimmend.
»Also gut.« Gahrvai schüttelte sich kurz. Dann trat er forschen Schrittes an den Kartentisch heran und betrachtete noch einmal die darauf vermerkten Positionen. Er hätte alles dafür gegeben, mit einem magischen Fingerschnippen jetzt einfach seine Kommandostruktur umstellen zu können. Bedauerlicherweise war er nun einmal außerstande, Wunder zu wirken. So suchte er Barcors Blick und zwang sich, möglichst zuversichtlich zu wirken.
»Ich möchte, dass Sie so rasch wie möglich zu Ihrem Kommandostand zurückkehren, Sir Zher. Wir können es uns nicht leisten, uns von denen im Pass festnageln zu lassen. Hier wäre eine gute Position.« Er tippte auf einen Punkt der Karte etwa vier Meilen westlich des eigentlichen Passes. Dort führte eine der königlichen Landstraßen zwischen zwei Hügeln hindurch. Eine kleine Ortschaft mit dem (passenden, aber nicht sonderlich originellen) Namen ›Grüntal‹ lag genau zwischen ihnen und erstreckte sich entlang der Straße. »Wenn Sie diesen Punkt rasch genug erreichen, können sich Ihre Männer rings um die Stadt verschanzen und den Feind dazu zwingen, zu Ihnen zu kommen. Wenn sich die Gegenseite entschließt, Sie nicht anzugreifen, und stattdessen beispielsweise versucht, an Ihnen vorbeizukommen, dann verschafft uns das Zeit, Ihnen Verstärkung zu schicken und den letzten Rest Ihrer Männer aus dem Pass zu holen. Sowohl ein direkter Angriff wie der Versuch, Sie, Sir Zher, zu umgehen, verschafft uns Zeit, weitere Truppen vom Pass abzuziehen und bis zum nordöstlichen Ende Ihrer Stellungen vorrücken zu lassen – alles hängt davon ab, dass Sie Ihre Stellung halten!«
Barcor starrte ihn an, dann nickte er heftig, beinahe schon krampfartig. Kurz erwog Gahrvai, ihn abzulösen und jemand anderem das Kommando über die Nachhut zu übergeben, Mancora beispielsweise. Doch auch dafür blieb ihnen keine Zeit. Es würden kostbare Stunden verschwendet, bis allen die Umbesetzung mitgeteilt worden wäre. Währenddessen würden Caylebs Marines stetig vorrücken und schon an der Hintertür seiner Armee anklopfen, bevor der erste Soldat auch nur das Lager verlassen hätte.
Wahrscheinlich geschieht das ohnehin, wenn ich Barcor das Kommando behalten lasse. Aber das werde ich wohl riskieren müssen.
»In der Zwischenzeit«, fuhr Gahrvai mit fester Stimme fort, »werde ich Graf Windshare eindeutige Anweisungen übermitteln, den Feind nach Kräften zu behindern. Es klingt nicht so, als hätte Cayleb überhaupt irgendwelche Kavalleristen dabei. Mit ein wenig Glück wird Windshare den Gegner lange genug aufhalten, dass Sie Position beziehen können.«
»Jawohl, Sir.« Barcors Entgegnung klang sehr gepresst, und er räusperte sich lautstark. »Wenn Sie gestatten, Sir«, sagte er dann mit deutlich normalerer Stimme, »kehre ich dann jetzt zu meinen Männern zurück.«
»Selbstverständlich, Mein Lord.« Wieder versuchte Gahrvai nach Kräften, Zuversicht auszustrahlen, als er mit fester Hand Barcors Unterarm umfasste und innerlich Gott dafür dankte, dass der Baron unmöglich wissen konnte, was ihm gerade wirklich durch den Kopf ging. »Der Rest der Armee wird unmittelbar hinter Ihnen sein.«
»Ich danke Ihnen, Sir.«
Barcor ließ Gahrvais Unterarm los und marschierte auf den Zeltausgang zu. Dabei wirkte er beinahe wie ein festentschlossener Kommandeur, der genau wusste, was er tat. Gahrvai gestattete sich einen Hoffnungsschimmer: Vielleicht traf dieser Eindruck die Wahrheit doch mehr als sonst. Dann wandte er sich wieder den restlichen seiner Offiziere zu.
»Meine Lords«, ergriff er das Wort, »bitte überlegen Sie sich, was wir alles unternehmen müssen. Ich fasse unterdessen die Anweisungen für Graf Windshare ab. Graf Mancora?«
»Jawohl, Sir?«
»Es ist möglich, dass dies nur ein Ablenkungsmanöver ist, einzig und allein mit dem Ziel, uns in Panik zu versetzen, damit wir uns aus unseren derzeitigen Stellungen zurückziehen. Als Vorsichtsmaßnahme gegen diese durchaus gegebene Möglichkeit möchte ich, dass Sie und Ihre Männer genau dort bleiben, wo Sie sind. Gleichzeitig jedoch wünsche ich, dass Sie sich Pläne für einen raschen Rückzug zurechtlegen, für den Fall, dass Cayleb tatsächlich mit einer großen Streitmacht in unserem Rücken steht. Bitte sorgen Sie dafür, dass Sie und Colonel Pahlzar den Rückzug seiner Artillerie sorgfältig koordinieren!«
»Selbstverständlich, Sir.«
»Was den Rest von uns betrifft …« Gahrvai blickte die anderen Offiziere am Kartentisch der Reihe nach an. »Ich möchte, dass jede Einheit, die sich derzeit hinter Graf Mancora befindet, innerhalb der nächsten zwo Stunden bereit ist, nach Westen aufzubrechen.« Einige am Tisch gestatteten sich eine verständnislose Miene, und Gahrvai kniff die Lippen zu einem schmalen Lächeln zusammen. »Meine Herren, wir sitzen in diesem Pass wie die Hühner auf der Stange. Keiner von uns kann vorrücken, solange die Einheit unmittelbar westlich von ihm sich nicht bereits in Marsch gesetzt hat. Glauben Sie bloß nicht, das sei Cayleb nicht bewusst! Also: Ich habe zwo Stunden gesagt, und das meine ich auch! Haben wir uns verstanden?«
Ringsum wurde genickt, und Gahrvais Lächeln wurde ein wenig freundlicher.
»Ich empfehle, dass jeder von Ihnen einen Ihrer Adjutanten zurück zu Ihrem Kommandoposten schickt, um den Abmarsch vorzubereiten. Ich werde versuchen, dafür zu sorgen, dass Sie persönlich so rasch wie möglich zu Ihren Männern zurückkehren können. Wenn Sie mich dann jetzt entschuldigen würden!«
Forsch galoppierten Cayleb und seine Leibgarde an der Flanke der Marines-Marschreihen entlang. Begleitet wurden sie von einer einhundert Mann starken Kavallerie-Kompanie – eine der wenigen, über die Caylebs Marines verfügten. Natürlich würde eine Kompanie dieser Stärke niemals ausreichen, um einen ernsthaften Angriff abzuwehren. Doch die gesamte, kompakte Einheit war schnell und wendig. Abgesehen davon konnte man im Notfall immer noch zu der Marschkolonne zurückkehren, die Kavallerie und Kaiser absolut verlässlich zur Seite stand. Wenn eine vollständige Brigade Marines nicht den Versuch verhindern konnte, den Kaiser zu töten oder gefangen zu nehmen, dann war dieser ganze Einsatz ohnehin schon von vornherein zum Scheitern verurteilt.
So zumindest sah Cayleb die Lage, und daran orientierte er sich. Merlin hatte sein Bestes gegeben, den jugendlichen Kaiser umzustimmen. Cayleb aber war unerschütterlich geblieben. Widerstrebend hatte Merlin schließlich zugegeben, dass der Kaiser mit dieser Einschätzung nicht gänzlich Unrecht hatte, ob Merlin das nun passte oder nicht. Komme, was wolle: Cayleb war Merlins einzige Möglichkeit während dieses Einsatzes, Einfluss auf die charisianischen Truppen zu nehmen. Merlin konnte ja schlecht bei Brigadier Clareyk auftauchen und ihm sagen, wohin er seine Truppen marschieren lassen solle, um Bedrohungen abzuwehren, die seine eigenen Kundschafter noch nicht entdeckt hatten. Cayleb hingegen konnte befehlen, wonach auch immer ihm gerade der Sinn stand. Schon jetzt war sein Heer zu dem Schluss gekommen, der Kaiser sei an Land wie auf See gleichermaßen gut darin, taktische Situationen einzuschätzen. Es hatte also durchaus Sinn, Cayleb zur Speerspitze der Charisianer zu machen. Und weil dies derart klar auf der Hand lag, war Merlin gezwungen, es auch vor Cayleb einzugestehen.
Abgesehen davon war Cayleb nun einmal der Kaiser, und das war etwas, was hin und wieder zu betonen er sich nicht scheute – wann immer es ihm passte jedenfalls.
Gut, dass er wirklich so viel im Köpfchen hat, dachte Merlin. Er ritt eine halbe Pferdelänge seitlich versetzt hinter dem jungen Kaiser. Er mag ja ein Dickschädel sein. Aber wir wären in einem unglaublichen Schlamassel, wenn er den Kaiser heraushängen ließe, ohne dabei ein so heller Bursche zu sein! Was für ein Glück, dass er es gewohnt ist, ein Kommando innezuhaben. Das ist weiß Gott besser als Unentschlossenheit! Trotzdem hoffe ich, Sharleyan und ich können ihn davon abhalten, übermäßig selbstsicher zu werden. Jemand, der so viel Macht besitzt wie Cayleb, verfällt allzu leicht dem Irrtum, alles müsse immer nach seinem Willen laufen – und das mit zunehmendem Alter immer häufiger und heftiger.
Die Spitze der Kolonne kam in Sicht. Cayleb und seine Eskorte verlangsamten ihre Reittiere, als sie Brigadier Clareyks ebenfalls berittene Kommandogruppe erspähten. Über ihnen flatterte die schwalbenschwanzförmige Standarte, in die in Scharlach und Gold ein Kraken und eine große ›3‹ eingestickt war. Man hatte den Brigadier offensichtlich davon in Kenntnis gesetzt, dass sein Kaiser kommen würde, und nun kamen er und sein Stab ihm entgegen.
»Euer Majestät«, begrüßte ihn Clareyk und deutete, so gut das im Sattel ging, eine Verbeugung an.
»Brigadier«, gab Cayleb die Begrüßung zurück. »Ich hoffe, Sie haben nicht das Gefühl, ich wolle mich hier einmischen«, fuhr der Kaiser dann fort, »aber ich habe festgestellt, dass ich mich nicht im sicheren Schiff verschanzen mag, während ich meine Marines ausschicke, ohne mich in Schwierigkeiten zu bringen.«
Cayleb hatte die Stimme leicht angehoben. Merlin sah, dass mehrere der vorbeimarschierenden Marines sich ein Grinsen nicht verkneifen konnten. Die Bemerkung des Kaisers würde innerhalb einer Stunde bei der gesamten Brigade die Runde machen, davon war Merlin überzeugt. Bei Anbruch der Nacht wüsste dann gewiss dies gesamte Truppe westlich der Dark Hills davon.
»Gewiss, Euer Majestät«, pflichtete ihm Clareyk mit einem breiten Lächeln bei. Merlin war sich indes sicher, dass der Brigadier sich in Wahrheit wünschte, Cayleb sei jetzt einfach nur irgendwo anders, bloß nicht bei der Dritten Brigade. Doch dann schaute Clareyk mit einem sonderbaren Gesichtsausdruck zu Merlin hinüber, und der Mann, der einst Nimue Alban gewesen war, fragte sich, wie viel sich Clareyk wohl in Wirklichkeit schon über ihn zusammengereimt haben mochte.
»Haben Ihre Kundschafter schon etwas über Gahrvais Kavallerie in Erfahrung gebracht?«, fragte Cayleb und schlug einen ernsten Tonfall an. Clareyk verzog das Gesicht.
»Berittene Kundschafter habe ich nicht viel, Euer Majestät. Unter den gegebenen Umständen aber wollte ich nicht, dass sich Patrouillen zu Fuß allzu weit von den Flanken der Kolonne entfernen. Bislang sind sie nur einige wenige Male auf die Kavallerie der Gegenseite gestoßen. Aber das waren immer nur Ein- oder Zwo-Mann-Patrouillen.«
»Gahrvais Kundschafter stoßen auf unsere Kundschafter«, merkte Cayleb stirnrunzelnd an. »Ist es schon zu Gefechten gekommen?«
»Mir liegen einige Berichte vor.« Clareyk nickte. »Bislang ist es jedes Mal zu unseren Gunsten ausgegangen. Andererseits kann ich wohl auch nur über Gefechte Berichte erhalten, die auch wirklich zu unseren Gunsten ausgegangen sind«, setzte er mit einem frostigen Lächeln hinzu.
Nun war es an Cayleb zu nicken. Er kratzte sich nachdenklich über den kurzen, säuberlich gestutzten Bart, den er sich hatte wachsen lassen, seit sie Charis hinter sich gelassen hatten. Kurz blickte er nach Nordosten, ganz offenkundig in Gedanken, und schaute schließlich wieder Clareyk an.
»Ich gehe davon aus, dass wir es nur allzu bald mit Graf Windshare höchstpersönlich zu tun bekommen werden«, sagte er. »Eigentlich bin ich sogar überrascht, dass das noch nicht passiert ist. Ich weiß, dass wir diese Möglichkeit bei unseren Strategiesitzungen bereits angesprochen haben, Brigadier. Nur werde ich das Gefühl nicht los, er wird mit größerer Truppenstärke eintreffen, als wir erwartet haben.«
»Ich verstehe, Euer Majestät«, erwiderte Clareyk ruhig. Er gestattete sich einen kurzen Seitenblick auf Captain Athrawes, bevor sein Blick ernst und konzentriert wieder seinem Kaiser galt. »Habt Ihr irgendwelche Vorschläge, Euer Majestät?«
»Die habe ich tatsächlich«, gab Cayleb zurück. Nachdenklich kniff er die Augen ein wenig zusammen. »Meines Erachtens beweist die Tatsache, dass Windshare noch nicht eingetroffen ist, vor allem eines: Wir haben ihn überrascht. Es bedeutet aber auch«, er blickte Clareyk geradewegs in die Augen, »dass sich die feindliche Infanterie langsamer in Marsch gesetzt hat, als ihr Oberbefehlshaber das gehofft hat. Ich halte es sogar durchaus für möglich, dass Gahrvais Infanterie noch überhaupt nicht aufgebrochen ist.«
»Wenn die Berichte unserer Spione, Baron Barcor habe das Kommando über die Nachhut erhalten, tatsächlich zutreffen, halte ich das zumindest für eine bedenkenswerte Möglichkeit, Euer Majestät«, stimmte ihm Clareyk zu.
»Nehmen wir doch mal an, dem wäre so. Jemand wie Windshare sollte dann, meine ich, ganz besonders entschlossen sein, unseren Vormarsch, wenn er ihn schon nicht aufhalten kann, wenigstens deutlich zu verlangsamen – vor allem, wenn er mehr Männer bei sich hat als wir ursprünglich angenommen haben. Er wird daher nach einer Gelegenheit Ausschau halten, einen vernichtenden Angriff auf unsere vorderste Kolonne zu führen. Ihre Kolonne, Brigadier.«
»Jawohl, Euer Majestät.«
»Andererseits hätten wir dann auch die Gelegenheit, Windshare vernichtend zu schlagen. Wie schätzen Sie, Brigadier, Ihre Chancen ein, gegen … nun, sagen wir: dreitausend oder viertausend Kavalleristen anzukommen?«
Als Cayleb ihm diese Zahl entgegenschleuderte, kniff Clareyk die Augen zusammen. Er neigte den Kopf zur Seite. Offensichtlich dachte er über das Kräfteverhältnis nach. Schließlich drehte er sich in seinem Sattel herum und begutachtete das Terrain, durch das seine Truppen in diesem Augenblick vorrückten.
»Angenommen, natürlich, Euer Majestät Zahlen träfen zu«, sagte er dann, und wieder huschte sein Blick zu Merlin hinüber, »meine ich, wir sollten mit einer Kavallerie dieser Stärke ohne größere Schwierigkeiten zurechtkommen. Wegen des recht offenen Geländes von hier bis Grüntal werden wir vielleicht weiter ausschwärmen müssen, als mir das eigentlich lieb ist. Aber im Gegenzug wird die feindliche Kavallerie nicht in der Lage sein, sich uns soweit unbemerkt zu nähern, dass wir nicht noch als effektive Defensivmaßnahme ins Karree gehen könnten.«
»Das sehe ich zwar auch so«, gab Cayleb langsam zurück, »aber gehen Sie ins Karree und ist Windshare dann klug und vor allem geduldig genug, abzuwarten, hat er den Sieg errungen. Denn er braucht uns nur lange genug aufzuhalten, um Gahrvai die Infanterie aus dem Talbor-Pass abziehen zu lassen. Windshare muss sich nur damit zufrieden geben, Sie hier in Karree-Formation festzunageln – und Gahrvai hat alle Zeit der Welt dafür.«
»Und Ihr möchtet mich jetzt dazu bringen, ihn in Versuchung zu führen, nicht klug und geduldig genug zu sein, Euer Majestät?«
»Ganz genau!« Cayleb nickte. »Jeder Bericht, den ich bislang über Windshare erhalten habe, zeigt deutlich, dass er zu aggressivem Vorgehen neigt. Jemand hat sogar über ihn gesagt, er würde mit seinen Sporen denken. Das mag ihm gegenüber ungerecht sein. Denn er ist vielleicht nicht der klügste Mann auf Gottes Erden, aber gewiss auch nicht dumm. Dennoch rät ihm sein Instinkt vermutlich, schnell und hart zuzuschlagen. Er wird versucht sein, die erstbeste Gelegenheit zu einem solchen Schlag zu nutzen. Wir nämlich stellen für Gahrvais restliche Truppen eine große Bedrohung dar, und er wird vermutlich nicht allzu viel Vertrauen in Barcors Reaktionsgeschwindigkeit setzen. Ich möchte, dass Sie, Brigadier, Windshare davon überzeugen, ihm biete sich gerade eben diese Gelegenheit.«
»Das ist riskant, wenn Ihr mir gestattet, das zu sagen, Euer Majestät«, merkte Clareyk an.
»Das wohl. Die feindliche Kavallerie aufzureiben, Brigadier, könnte jedoch kriegsentscheidend sein.«
»Verstanden, Euer Majestät. Ich hoffe allerdings, Majestät verzeihen mir, wenn ich offen bin: Bei solch riskanten Unternehmen würde ich es vorziehen, Euch an einem anderen Ort zu wissen.«
»Das scheint mir irgendwie jeder sagen zu müssen«, erwiderte Cayleb. Sein Grinsen hatte etwas Verkniffenes. »Meistens kann ich mich selbst dazu überreden, auf diese Mahnungen zu hören. Aber dieses Mal nicht, Brigadier! Ich verlange von Ihnen und Ihren Männer, ein größeres Risiko einzugehen, ein höheres, als bisher besprochen. Ich könnte und dürfte das nicht, wenn ich mich selbst währenddessen irgendwo in den hinteren Reihen aufhielte.«
»Euer Majestät, meine gesamte Brigade ist deutlich weniger wichtig für Charis als Ihr«, gab Clareyk unverblümt zurück. »Bei aller Ehrerbietung Euch gegenüber, Majestät, aber das muss ich respektvollst ablehnen: Ich für meine Person kann und darf Euch, Majestät, keiner unnötigen Gefahr aussetzen!«
»Brigadier …«, setzte Cayleb scharf an. Doch dann biss er sich sichtlich auf die Zunge. Einen Moment lang mahlten seine Kiefer, dann holte er tief Luft.
»Sie haben wirklich die Absicht, unnachgiebig zu bleiben, was?«
»Ja, Euer Majestät, es tut mir Leid, aber so ist es.« Clareyk blickte seinem Monarchen geradewegs in die Augen. »Es ist Euer Vorrecht, mich jederzeit meines Postens zu entheben, solltet Ihr das wünschen. Aber das Kaiserreich kann Euch im Augenblick im wahrsten Sinne des Wortes nicht entbehren. Das wisst Ihr ebenso gut wie ich. Wenn Ihr wünscht, dass ich Graf Windshare eine Falle stelle, dann werde ich das selbstverständlich tun. Aber ich werde keinesfalls Euer Leben aufs Spiel setzen, schließlich könnte Windshare ja doch Glück haben.«
Cayleb funkelte Clareyk finster an. Der Brigadier jedoch verzog keine Miene. Dann zuckte der Blick des Soldaten ein drittes Mal zu Merlin hinüber.
»Also gut, Brigadier«, sagte der Kaiser nach langem, bedrohlichem Schweigen. »Sie haben gewonnen. Und Sie haben Unrecht, was mein Vorrecht angeht, Sie Ihres Postens zu entheben.« Er ließ seine Zähne aufblitzen. »Ich fürchte, ich käme damit nur so lange durch, bis die Kaiserin herausfände, was Sie angestellt haben, um sich meinen Unmut zuzuziehen.«
»Ich muss gestehen, dass mir dieser Gedanke auch schon gekommen ist, Euer Majestät.«