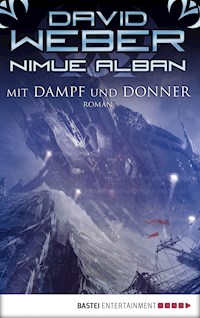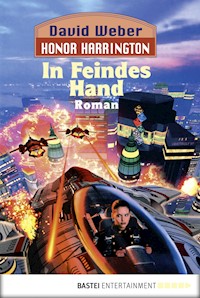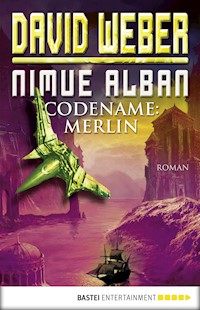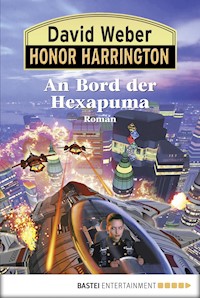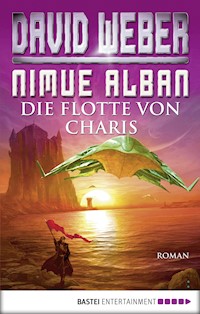
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Nimue-Reihe
- Sprache: Deutsch
Vor langer Zeit mussten die Menschen vor einer außerirdischen Spezies fliehen, um der Auslöschung zu entgehen. Sie begannen ein neues Leben auf einer fernen Welt. Doch sie sind von einem totalitären Regime unterjocht. Nimue Alban soll dies ändern. Vor vielen Jahren fand sie den Tod. Nun erwacht sie zu neuem Leben, im Körper eines Cyborgs ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 676
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
David Weber
DIE FLOTTEVON CHARIS
Aus dem Amerikanischen vonUlf Ritgen
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Deutsche Erstausgabe
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2008 by David Weber
Titel der Originalausgabe: »By Schism Rent Asunder« (Teil 2)
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2009/2014 by Bastei Lübbe AG, Köln
This work was negotiated through Literary Agency
Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen,
on behalf of St. Martin's Press, L. L. C.
Lektorat: Uwe Vöhl / Ruggero Leò
Titelillustration: Arndt Drechsler
Umschlaggestaltung: Druck & Grafik Siebel, Lindlar
E-Book-Produktion: Urban SatzKonzept, Düsseldorf
ISBN: 978-3-8387-0989-5
Sie finden uns im Internet unterwww.luebbe.de
Bitte beachten Sie auch: www.lesejury.de
Dieses Buch ist Sharon gewidmet.
Na ja, eigentlich sind sie das alle, und normalerweise schreibe ich auch keine öffentlichen Liebesbriefe, aber dieses Jahr mache ich eine Ausnahme. Ich danke Dir, dass Du mich geheiratet hast – noch einmal.
Ich liebe Dich.
August,im Jahr Gottes 892
.I.
Schoner Blade und Galeone Guardian, vor der Echsen-Insel, Hankey-Sund
»Also gut, Mister Nethaul! Bugkanone bereit!«
»Aye aye, Sir!«
Zur Bestätigung hob Hairym Nethaul auf seinem Posten auf dem Vorderdeck des Schoners Blade die Hand, während das schlanke Freibeuterschiff mit seinem glatten Deck immer weiter auf seine zukünftige Beute zuhielt. Captain Ekohls Raynair, Kapitän und Teileigner der Blade, stand am Steuerrad und kniff angespannt die braunen Augen zusammen, während er gleichzeitig den Wind und die Stellung seiner Segel im Auge behielt – und auch die dohlaranischen Galeonen, auf die er es abgesehen hatte.
»Lassen Sie sie einen Viertelstrich vom Wind abfallen«, grollte er, und der Rudergänger nickte.
»Aye, Cap’n«, erwiderte er und schob dabei das bereits gut zermahlene Päckchen Kaublatt in die andere Backentasche; leise lachte Raynair in sich hinein. Die Flottendisziplin an Bord der Blade ließ wirklich zu wünschen übrig, doch der Captain konnte sich dennoch darauf verlassen, dass alle erforderlichen Aufgaben erledigt wurden. Sein Schoner und er waren siebentausend Meilen von Charis entfernt – und das wäre nur die Strecke gewesen, die eine Wyvern hätte zurückgelegen müssen, um diesen Ort zu erreichen. In Wahrheit war das Schiff mehr als dreimal so weit gefahren. Es war eine wirklich lange Reise, doch das machte Raynair nichts aus. Die Fahrt hierher hatte fast drei Monate gedauert, obwohl die Blade und ihre drei Geleitschiffe wirklich schnell waren, doch auch das machte Raynair nichts aus.
Nein, was Ekohls Raynair etwas ausmachte, das war, dass er und seine Kollegen aus dem Konsortium von Anfang an recht gehabt hatten. Es schien überdeutlich, dass niemand in Dohlar auch nur im mindesten vermutet hatte, charisianische Freibeuter könnten derart fern ihrer Heimat tätig sein. Im Laufe des letzten Monats hatten die vier Schoner - Blade, Axe, Cutlass und Dirk – eine regelrechte Schneise in die völlig unvorbereitete Handelsmarine von Dohlar geschlagen, und bislang konnte man mit dem Erfolg dieser Expedition sehr, sehr zufrieden sein.
Wie überaus freundlich von König Rahnyld, so viel Zeit und Mühe darauf zu verwenden, uns reich zu machen, dachte Raynair, während sein Schiff die Wellen durchschnitt wie die Klinge, nach der man es benannt hatte. Natürlich hatte der König sich das nicht ganz so gedacht. Aber wenn man dumm genug ist, mit Kraken schwimmen zu gehen, dann kann man sich glücklich schätzen, wenn man dabei nur einen Arm oder ein Bein verliert.
Die Bemühungen Rahnylds IV., aus dem Nichts eine ausgewachsene Handelsmarine aufzubauen, waren zweifellos lobenswert – zumindest aus dohlaranischer Sicht. Raynair sah das anders. Sein Vater und einer seiner Onkel waren Kapitän und Erster Offizier (und ebenfalls Miteigner) eines charisianischen Handelsschiffes gewesen, das vor zwölf Jahren den Golf von Dohlar angesteuert hatte und dort, als es sich gerade der Silkiah-Bucht näherte, mit einer dohlaranischen Kriegsgaleere in Konflikt geraten war. Sie hatten noch nicht einmal einen dohlaranischen Hafen angelaufen – ihre Fracht war für einen Gewürzhändler aus dem Großherzogtum Silkiah bestimmt gewesen –, doch das hatte man nicht als bedeutungsvoll erachtet.
König Rahnyld hatte beschlossen, die Zufahrt zum Golf von Dohlar, zum Hankey-Sund und zur Silkiah-Bucht müsse untersagt werden. Angefangen hatte er damit, eine Maut für alle Schiffe zu erheben, deren Kurs sie östlich der Dohlar-Untiefe und der dort liegenden Inselgruppe vorbeiführte. Schließlich hatte er sein ›Protektorat‹ bis zur Wal-Insel ausgedehnt, die mehr als eintausend Meilen vor seiner eigenen Küste lag. Zu behaupten, in einem derartig gewaltigen Meeresgebiet Polizei spielen zu können, war nicht nur völlig beispiellos, es war schlichtweg lächerlich. Ebenso wie praktisch alle anderen Seemächte hielt sich Charis beispielsweise an die alte Regel, eine Nation könne Souveränität nur für die Gewässer beanspruchen, die sie auch effektiv kontrollieren konnte – und das auch tat. Das beschränkte sich auch nicht nur darauf, passierenden Handelsschiffen Geld abzunehmen. Zu dieser Kontrolle gehörte auch, gegen Piraten vorzugehen, Navigationsrisiken mit Bojen zu markieren, die Seekarten stets auf dem neuesten Stand zu halten und im Allgemeinen dafür zu sorgen, dass sich alle ›anständig benahmen‹. Und das wiederum bedeutete letztendlich, dass als Territorialgewässer nur das angesehen werden konnte, was noch in Schussreichweite der entlang der Küste aufgestellten Geschütze lag – im Allgemeinen ging man dabei von drei Meilen aus. Eigentlich waren schon diese drei Meilen sehr großzügig gerechnet, und das war auch jedem bewusst. Außerdem war es durchaus bemerkenswert, dass aus irgendeinem Grund sämtliche Schiffe des Harchong-Reiches von König Rahnyls ›Wegzoll‹ freigestellt waren.
Auch Ahbnair und Wyllym Raynair hatten keinerlei Grund gesehen, ihr sauer verdientes Gold in Rahnylds Taschen wandern zu lassen. Vor allem, da es doch offenkundig war, dass diese ganzen ›Wegzoll-Forderungen‹ einzig und alleine den Zweck hatten, sämtliche nicht-dohlaranischen Handelsschiffe von den Gewässern fernzuhalten, die Rahnyld IV. als ›sein Eigentum‹ ansah.
Niemand in ganz Charis wusste genau, was an jenem Nachmittag in den Gewässern zwischen dem Hankey-Sund und der Silkiah-Bucht vorgefallen war. Bekannt war nur, dass die Dohlaranischen Flotte auf die Galeone Raynair’s Pride das Feuer eröffnet, sie dann geentert und schließlich versenkt hatte. Weder Ekohls’ Vater noch sein Onkel hatten diesen Zwischenfall überlebt, und nur zwei Besatzungsmitglieder waren jemals wieder in ihre Heimat zurückgekehrt.
Es gab einen Grund, warum Ekohls Raynair deutlich weniger überrascht gewesen war als die meisten anderen, als Rahnyld sich so eifrig zu einem Bündnis mit Hektor von Corisande bereiterklärt hatte, obschon Dohlar und Corisande beinahe auf gegenüberliegenden Seiten dieser Welt lagen. Und um ganz ehrlich zu sein: Es war auch nicht nur die Aussicht auf einen ordentlichen Profit gewesen, der nun die Blade und ihre Geleitschiffe in die dohlaranischen Gewässer gelockt hatte.
Erneut blickte Raynair zu der massigen dohlaranischen Galeere hinüber. Er verstand sofort, warum sie in diesem Golf eingesetzt wurde. Ein einziger Blick auf das ›richtige blaue Meer‹, eben die hohe See, hätte die Mannschaft dieses schwerfälligen Seelenverkäufers mit den hochaufragenden Seitenwänden vermutlich zu Tode erschreckt. Glücklicherweise schien der Gouverneur der Provinz Shwei begriffen zu haben – was auch immer die Kirche, oder in diesem Falle eben auch Rahnyld von Dohlar, über Charis denken mochten –, dass sich charisianisches Geld ebenso gut ausgeben ließ wie das eines jeden anderen Reiches. Im Augenblick verdiente er sehr gut daran – und das recht unauffällig –, Raynair und seinen Partnern das Recht einzuräumen, ihre Prisen und die erbeutete Fracht in Yu-Shai in der Shwei-Bucht an Händler aus Harchong weiterzugeben. Niemand wusste, wie lange das noch so weitergehen würde, doch zumindest im Augenblick brauchte sich Raynair keine Gedanken darüber zu machen, wie er sämtliche aufgebrachten Prisen den ganzen Weg bis nach Charis zurückschaffen solle.
Diese Galeere hier scheint mir deutlich störrischer als die meisten, ging es Raynair durch den Kopf. Stur behielt deren Kapitän den Kurs bei, statt sich in das Unausweichliche zu fügen. Er hatte sämtliche Segel setzen lassen, die ihm zur Verfügung standen – was nicht sonderlich beeindruckend war für jemanden, der mit den Segelrissen charisianischer Galeonen vertraut war –, und so schleppte sie sich nun durch das Wasser, als glaube der Skipper der Galeere tatsächlich, er könne diesem schnittigen, flachen Schoner entkommen.
Na ja, bald wird er eines Besseren belehrt sein, dachte Raynair.
»Sorgt dafür, dass dieser verdammte Narr seinen Schädel hinter das Schanzkleid schafft!«, fauchte Captain Graygair Maigee.
Hastig duckte sich der betreffende Soldat, und der verärgerte Maigee stieß einen befriedigten Grunzlaut aus. Dann galt seine Aufmerksamkeit wieder ganz dem charisianischen Schiff, das sich immer weiter der Guardian näherte.
Ist schon komisch, dachte er. Als man mir das in der Gorath Bay erläutert hat, schien mir das Ganze eine deutlich bessere Idee zu sein. Jetzt frage ich mich doch, welcher Idiot sich das ausgedacht hat. Wenn es in der verdammten Flotte auch nur einen Einzigen gäbe, der von irgendetwas Ahnung hätte, dann wären wir gar nicht erst in diesen Schlamassel geraten!
»Meinen Sie, er wird sofort auf uns das Feuer eröffnen, oder wird er uns erst einen Schuss vor den Bug setzen, Sir?«, fragte Airah Synklyr, sein Erster Offizier.
»Woher zur Hölle soll ich das wissen?«, erwiderte Maigee missmutig. Aber er musste sich eingestehen, dass die Frage wirklich nicht unberechtigt war. »Wir werden’s wohl herausfinden müssen«, setzte er hinzu.
Und wenn ich mich nicht täusche, dann sogar ziemlich bald.
»Also gut, Mister Nethaul – geben Sie ihr einen Schuss vor den Bug!«
Die Bugkanone dröhnte, kaum dass Raynair seinen Befehl ausgesprochen hatte, und er schaute zu, wie weit jenseits der Galeone eine weiß schäumende Wassersäule emporstieg.
Die Blade und ihre Schwesternschiffe stammten aus der Shumair-Werft von Charis. Im Prinzip waren sie in der gleichen Art und Weise gebaut wie die Schiffe, die Sir Dustyn Olyvyr für die Royal Navy konstruiert hatte, doch man hatte an ihnen einige kleinere Veränderungen vorgenommen, um sie besser auf ihre Aufgabe als Freibeuter vorzubereiten. Ihre Gegenstücke von der Navy trugen jeweils vierzehn Dreißig-Pfund-Karronaden, während die Blade nur über zehn Karronaden verfügte, und dazu noch den langen Vierzehn-Pfünder, der auf seiner neuen ›Pivotlafette‹ tatsächlich schwenkbar war. Raynair hatte keine Ahnung, wer diese ›Pivotlafette‹ entwickelt hatte, und es war ihm auch ziemlich egal.
Im Prinzip handelte es sich um eine gewöhnliche Protze, die man auf eine Plattform aus zwei schweren Holzbalken aufgestellt hatte. Zu diesen Holzfendern gehörten noch vier weitere massive Blöcke, in regelmäßigen Abständen aufgestellt. Doch diese Lafette war nicht mit Rädern ausgestattet; stattdessen rutschte sie, wenn der Rückstoß des Schusses sie zurückschleuderte, in den Kerben entlang, die man eigens in diese Fender hineingefräst hatte. Die Fender selbst wiederum waren über einen Pivot-Stift im hintersten der Blöcke mit dem Deck verbunden. Dieser Stift ragte durch das Deck hindurch, und sein unteres Ende war durch einen massiven Holzblock von zwei Fuß Seitenlänge gesichert. Dort, wo der Stift das Deck durchstieß, wurde er durch einen massiven Sockel aus Gusseisen verstärkt, der halb in das darunterliegende Spantenwerk ragte; das obere Ende, das bis zu den Fendern reichte, war durch ein schweres Lager geschützt – schließlich musste es einen Großteil der Wucht des Rückstoßes abfangen, wann immer die Waffe abgefeuert wurde. Laufrollen unter dem vorderen Ende der Fender bewegten sich auf einer kreisförmig in das Deck eingelassenen Eisenschiene, und indem man das vordere Ende der Waffe an der Reeling entlangführte, während das hintere Ende auf diesem Pivotstift herumgeschwenkt wurde, konnte das Geschütz theoretisch einmal vollständig um die eigene Achse gedreht werden, auch wenn natürlich der Bugspriet und die Takelage gewisse Schusswinkel verhinderten. Den Gerüchten zufolge war Baron Seamount für diese Konstruktion verantwortlich, doch alles, was Raynair hier wirklich interessierte, das war, dass diese Lafette, die entlang der Mittschiffslinie aufgestellt war, somit auch zur Unterstützung beider Breitseiten eingesetzt werden konnte.
Es gab eine Obergrenze, welche Geschützgröße hier verwendet werden konnte, und der lange Vierzehn-Pfünder feuerte deutlich leichtere Geschosse ab als die Karronaden, doch dafür war dessen Reichweite größer, und es erforderte wirklich nicht das schwerste Geschütz, um einen halbwegs vernünftigen Kapitän davon zu überzeugen, dass es an der Zeit war zu kapitulieren.
»Wie zur Hölle haben die das gemacht?«, entfuhr es Synklyr.
»Meinen Sie vielleicht, ich wüsste das?«, fauchte Maigee zurück.
Natürlich hatte er gewusst, dass es eine rhetorische Frage gewesen war. Er war sich nicht einmal sicher, dass sich Synklyr bewusst war, diese Frage laut ausgesprochen zu haben. Doch nichts davon verbesserte die Laune des Captains darüber, dass er es hier mit einem weiteren Vertreter dieser anscheinend endlosen Reihe infernalischer Neuerungen aus Charis zu tun hatte.
Tatsächlich war dies wohl das erste Mal, dass Maigee diese neue charisianische Artillerie erlebte – was, so vermutete er, den Hauptgrund für seine Verärgerung und seine Anspannung darstellte. Praktisch jeder aus der Dohlaranischen Flotte, von Herzog Thorast persönlich an, mühte sich nach Kräften, die Effektivität jener neuen charisianischen Kanonen herunterzuspielen. Maigee vermutete, das sei völlig unausweichlich - ganz offensichtlich, dachte er sardonisch, ist es viel einfacher, sich einzureden, diese Kanonen der Charisianer würden überhaupt nicht funktionieren, als sich darüber (Gedanken zu machen, was man unternehmen könnte, falls sie eben doch funktionierten –, doch das half natürlich den armen Teufeln, die diesen Waffen zum ersten Mal gegenüberstanden, kein bisschen weiter.
Er hatte das dringende Bedürfnis, das Fernglas zu zücken und sich die Bewaffnung dieses Schoners sehr genau anzuschauen, doch Ferngläser waren selbst zu den besten Zeiten an Bord von Handelsschiffen rar gesät, und das galt natürlich erst recht für ein Schiff, das man bewusst so heruntergekommen erscheinen ließ wie die (Guardian.
»Bereit, Mister Synklyr«, sagte er stattdessen und schaute dann zu seinem Zweiten Offizier hinüber. »Es ist so weit, Mister Jynks«, erklärte er.
»Das ist sonderbar …«, murmelte Ekohls Raynair vor sich hin, als die Galeone schließlich das Unausweichliche akzeptierte und beidrehte. Er legte die Stirn in Falten und versuchte sich zu überlegen, was genau ihm hier innerlich keine Ruhe ließ, während die Blade es dem anderen Schiff gleichtat und Nethaul und ein Dutzend schwer bewaffneter Matrosen den ersten Kutter bestiegen, um ihre Prise zu entern. Da war noch irgendetwas …
Und dann fand Raynair heraus, was dieses ›irgendetwas‹ war.
»Jetzt!«, bellte Captain Maigee, und dann geschahen mehrere Dinge gleichzeitig.
Die wartenden Soldaten richteten sich auf; die Luntenschlossmusketen im Anschlag, erschienen sie hinter dem hohen Schanzkleid der Galeone, während andere, eigens dafür vorbereitete Abschnitte dieses Schanzkleides plötzlich herunterklappten und die Kanonen entblößten, die dahinter aufgestellt waren. Es waren nur ›Falken‹, deren Geschosse weniger als acht Pfund wogen – schließlich war die Guardian nur eine umgebaute Handels-Galeone. Als sie konstruiert wurde, hatte niemand an schwerere Geschütze auch nur gedacht, doch jede dieser ›leichten‹ Kanonen wog immer noch mehr als eine Tonne. Es wäre schlichtweg nicht möglich gewesen, größere, noch schwerere Geschütze an Bord zu bringen, und selbst wenn auch nur ein Zehntel aller Geschichten stimmten, die über die neuen Kanonen der Charisianer kursierten, würde ihre eigene Breitseite sehr viel langsamer abgefeuert werden können. Doch das Freibeuterschiff verfügte nur über fünf Kanonen auf jeder Breitseite, die Guardian hingegen über achtzehn.
Raynair hatte das Gefühl, ihm bliebe das Herz stehen, als dieses dohlaranische ›Handelsschiff‹ plötzlich die Zähne fletschte. Er öffnete den Mund, doch bevor er auch nur den ersten Befehl erteilen konnte, schien rings um ihn der ganze Tag zu explodieren.
An Bord dieses Schiffes befanden sich mindestens einhundert Musketiere. Jetzt tauchten sie aus ihren Verstecken auf und eröffneten das Feuer auf den Kutter der Blade. Über diese Entfernung hinweg konnten nicht einmal Luntenschlossmusketen ihr Ziel verfehlen, und die konzentrierte Salve verwandelte den Kutter in ein geborstenes Wrack, das allmählich versank – angefüllt mit blutüberströmten Leichen.
Dass Nethaul soeben den Tod gefunden hatte und mit ihm auch der gesamte Rest seiner Entermannschaft, begriff Raynair erst allmählich, als auch schon die dohlaranische Breitseite donnerte. Es waren nur dohlaranische Kanonen, doch dafür waren es wirklich viele, und ganz offensichtlich hatten diese Bordschützen verdammt viel Ahnung davon, aus welchem Ende der Kanone die Kugel kommen würde. Dennoch gelang es einigen von ihnen, ihr Ziel zu verfehlen, trotz der geradezu lächerlich geringen Entfernung. Doch die meisten leisteten deutlich bessere Arbeit, und zahllose Schreie waren vom Deck der Blade zu hören, als die Geschosse der Dohlaraner sich quer durch Raynairs Mannschaft pflügten.
Das alleine war schon schlimm genug, doch die gleiche Breitseite ließ auch den Fockmast der Blade in einer Lawine aus Spieren und Tuch herabstürzen. Der Fockmast war der eigentliche Hauptmast eines Zweimast-Schoners, und so war die Blade kaum noch seetauglich.
»Feuer!«, hörte Raynair jemand anderen rufen – mit seiner eigenen Stimme –, und vier der fünf Karronaden der Backbord-Breitseite des Schoners spien Flammen.
»Ja!«, schrie Maigee, als der Mast des charisianischen Schiffes brach. Das war deutlich besser, als er erhofft hatte, und er konnte schon jetzt mindestens ein Dutzend Männer sehen, die auf dem völlig zerschossenen Deck des Schoners lagen.
Doch dann verschwand das Freibeuterschiff hinter einer Rauchwolke, und Maigee taumelte, als die riesigen, ungleich schwereren Geschosse aus den Karronaden des Schoners sein eigenes Schiff trafen.
Man hatte die (Guardian als Handelsschiff geplant und gebaut. Ihre Spanten waren leichter, ihre Planken dünner, als jeder Schiffskonstrukteur einer Kriegsflotte das verlangt hätte. Zumindest in einer Hinsicht gereichte ihr das zum Vorteil. Da die Planken so viel dünner waren, ließen die gewaltigen Kanonenkugeln der Blade ungleich weniger und deutlich leichtere Splitter durch die Luft sausen, als das bei einem ›anständigen Kriegsschiff‹ der Fall gewesen wäre. Andererseits war der Rumpf dieses Schiffes mit Soldaten und Matrosen regelrecht überfüllt, und die leichtere Bauweise dieser Galeone bedeutete auch, dass sie ungleich weniger robust war als ein Kriegsschiff.
Immer schlimmer dröhnte Maigee das Kreischen und Schreien seiner Verwundeten in den Ohren. Eine seiner Kanonen wurde unmittelbar getroffen, und der wuchtige Holzklotz, der ihr als radlose Lafette diente, barst in tausend Stücke, während weitere schwere Geschosse der Charisianer blutige Schneisen in die Schiffsbesatzung rissen. Die Guardian war der Blade, was die Anzahl ihrer Geschütze betraf, in einem Verhältnis von mehr als drei zu eins überlegen, und die Dohlaraner hatten das Überraschungsmoment auf ihrer Seite. Doch die Kanonen der Blade feuerten ungleich schwerere Geschosse ab, und sie feuerten auch viel, viel schneller.
»Nachladen! Nachladen, verdammt noch mal!«, hörte er Synklyr irgendwo vor sich brüllen, auch wenn er ihn im dichten Pulverdampf nicht sehen konnte. Rau und verzerrt übertönte die Stimme des First Lieutenant die Schreie der Verwundeten. Immer wieder blitzte das Mündungsfeuer der Musketen auf, die Soldaten luden nach, so schnell sie konnten, doch der Schoner war viel zu weit entfernt, um gezielte Schüsse abgeben zu können.
»Macht sie fertig – macht diese Mistkerle fertig!«, brüllte Raynair, während der Bootsmann einen Trupp Matrosen mit Äxten und Beilen herbeieilen ließ, um die Trümmer des geborstenen Masts zu beseitigen.
Wie auf den meisten Freibeuterschiffen, befand sich auch an Bord der Blade eine deutlich größere Mannschaft, als das eigentlich erforderlich gewesen wäre – sei es, um das Schiff zu steuern, sei es, um zu kämpfen. Irgendwoher musste ja schließlich auch die Besatzung für die Prisen kommen. Doch diese todbringende Überraschung der Dohlaraner musste mindestens dreißig von Raynairs Männern das Leben gekostet oder sie zumindest schwer verwundet haben. Wenn man dann noch Nethaul und die Männer an Bord des versunkenen Kutters mitzählt, kommt man eher auf sechzig, als auf fünfzig, informierte eine innere Stimme ihn schonungslos. Das war mindestens ein Drittel seiner gesamten Besatzung.
Doch es gab einen Grund, warum er während der gesamten langen Überfahrt von Charis hierher stets unablässiges Geschützexerzieren gefordert hatte. Seine Geschützbedienungsmannschaften an der Backbordseite hatten schwere Verluste hinnehmen müssen, doch ihre Ersatzleute von Steuerbord kamen bereits herübergestürmt und nahmen die Plätze ihrer toten oder verletzten Kameraden ein. Hätte die Blade frei manövrieren können, hätte die gesamte Lage deutlich anders ausgesehen. Bedauerlicherweise bedeutete der geborstene Fockmast, dass selbst diese schwerfällige dohlaranische Galeone es nun im Hinblick auf Manövrierbarkeit mit ihr aufnehmen konnte.
Nein, jetzt gab es nur noch eines, was Ekohls Raynair tun konnte, und er fletschte die Zähne, als die zweite Breitseite der Blade dröhnte.
.II.
Königlicher Palast, Tellesberg,Königreich Charis
»Wird das Ihren Anforderungen genügen, Doktor?«
Rahzhyr Mahklyn wandte sich vom Fenster ab und blickte Pater Clyfyrd Laimhyn an, König Caylebs Privatsekretär und Beichtvater. Im Laufe der Jahre hatte Mahklyn es mit vielen Priestern zu tun gehabt, die nicht gerade … begeistert darüber gewesen waren, mit welchen Dingen sich die Königliche Hochschule befasste. Pater Clyfyrd hingegen schien erfreulicherweise keinerlei Vorbehalte zu kennen. Vielleicht war das auch nicht sonderlich erstaunlich, schließlich hatte Erzbischof Maikel persönlich ihn seiner Majestät dem König für ›heikle Aufgaben‹ empfohlen. Nun stand Laimhyn aufmerksam dort und wartete ab, bis Mahklyn über diese Frage nachgedacht hatte.
Nicht, dass es hier wirklich viel ›nachzudenken‹ gibt, ging es Mahklyn durch den Kopf, und blickte erneut aus dem Fenster des Turmes. Der Turm von König Cayleb – der Urgroßvater des derzeitigen Monarchen hatte ihn seinerzeit errichten lassen – befand sich auf der Seite des Palastes, die vom Hafen am weitesten abgelegen war. Damit bot sich Mahklyn ein Blick auf das südliche Drittel von Tellesberg und die umliegende Farmen und Wälder; am Horizont reckten sich die Berge dem Himmel entgegen. Der Ausblick war zweifellos besser als der von seinem alten Büro unmittelbar am Hafen, und der Turm selbst bot mindestens noch einmal halb so viel Platz wie zuvor. Mahklyn musste zwar sogar noch mehr Stufen emporsteigen, um sein neues Büro zu erreichen, doch wenn er sich die Mühe machte, noch ein Stockwerk mehr zu erklimmen, kam er zum Flachdach des Turmes, auf dem er Sonnenlicht und Wind genießen konnte. Dort oben warteten, unter einem Sonnendach, bereits mehrere bequeme, gepolsterte Korbstühle auf ihn, und Mahklyn konnte sich sehr wohl die sündhafte Freude vorstellen, sich in einem dieser Sessel niederzulassen, einen Notizblock auf dem Schoß, die Füße gemütlich auf einen Schemel gestützt, in Reichweite ein kaltes Getränk – gekühlt durch Eis, das man von eben jenen Bergen in der Ferne holte und in einem Kühlhaus tief unterhalb des Palast aufbewahrte. Und es gab Diener, die ihm bei Bedarf jederzeit nachschenkten.
Ich denke, das ist Teil des Problems, dachte er sardonisch. Eigentlich soll ›reine Gelehrsamkeit‹ doch wohl kaum so viel Spaß machen!
Eigentlich jedoch, und das wusste er genau, hatten seine immer noch nicht gänzlich verschwundenen Vorbehalte damit überhaupt nichts zu tun. Sie waren nur Überreste seiner sturen Treue dem Prinzip gegenüber, die Hochschule müsse offiziell (und so deutlich erkennbar wie möglich) von der Krone unabhängig sein. Was natürlich albern war, schließlich hatte der amtierende König unmissverständlich ausgedrückt, dass er genau diese Beziehung nachhaltig ändern würde. Und in jenem Fünftag, der seit der Zerstörung des ursprünglichen Hochschulgebäudes vergangen war, hatte Mahklyn sehr wohl begriffen, dass seine Majestät, König Cayleb, die richtige Entscheidung getroffen hatte. Bedauerlicherweise plagte ihn, wann immer er darüber nachdachte, immer noch ein schlechtes Gewissen.
Stell dich nicht so an und gib dem Mann eine Antwort, herrsche er sich selbst an.
»Ich denke, der Turm wird vollkommen ausreichend sein, Pater«, sagte er endlich und wandte sich wieder Caylebs Privatsekretär zu. »Ich wünschte, wir hätten etwas mehr Stauplatz, aber bedauerlicherweise werden wir uns darum ja vorerst keinerlei Sorgen machen müssen.«
Er lächelte, doch in diesem Lächeln lag unendliche Trauer, als er erneut darüber nachdachte, wie viele unschätzbar wertvolle Aufzeichnungen und Unterlagen der Zerstörung anheimgefallen waren. Und er war zu dem Schluss gekommen, dass Captain Athrawes von Anfang an recht gehabt hatte mit seiner Vermutung, wie und warum dieses Feuer ausgebrochen war … und auch, wer es gelegt hatte.
»Wenn Sie sich sicher sind, Doktor«, sagte Laimhyn, »dann wurde mir aufgetragen Ihnen zu sagen, Seine Majestät wünsche, dass Sie, Ihre Tochter und Ihr Schwiegersohn sowie Ihre Enkel in den alten Familienflügel des Palastes einziehen.«
Unwillkürlich öffnete Mahklyn schon den Mund, um zu protestieren, doch Laimhyn sprach schon weiter, bevor der alte Wissenschaftler etwas gegen die Größe, den Luxus und die Bequemlichkeit der ihm soeben vorgeschlagenen Unterkunft einwenden konnte.
»Seit fast zwanzig Jahren ist dieser Teil des Palastes so gut wie ungenutzt, Doktor. Tatsächlich werden wir sogar das Dach ein wenig reparieren müssen, bevor Seine Majestät es als wirklich bewohnbar erachten wird. Und wenngleich mir bewusst ist, dass Sie und Ihre Familie sich dort vielleicht ein wenig einsam und verloren fühlen könnten, kann ich Ihnen versichern, dass das nicht lange anhalten wird. Seine Majestät hat die Absicht, eines der königlichen Schlafgemächer für Sie zu einer Werkstatt umgestalten zu lassen, und es ist äußerst wahrscheinlich, dass auch noch zwei oder drei Ihrer geschätzten Kollegen einziehen werden. Wenn König Caylebs Turm eine angemessene Heimstatt für die Offizielle Hochschule darstellt, so ist die Tatsache, dass er auf der anderen Seite des Prinz-Edvarhd-Hofes dem alten Familienflügel genau gegenüberliegt, gewiss zweifellos bequemer für Sie alle.«
Wortlos schloss Mahklyn den Mund wieder. Laimhyn hatte diese letzten drei Worte zwar nur leicht betont, aber eben doch unverkennbar, und das ließ Mahklyn vermuten, genau diesen Umstand habe entweder der König persönlich angesprochen oder zumindest Captain Athrawes. Es klang auf jeden Fall ganz nach deren entsetzlicher Gerissenheit. Mahklyn wusste zwar nicht genau, wer diese anderen ›geschätzten Kollegen‹ sein könnten, doch er hatte bereits eine Vermutung, und mindestens zwei von ihnen waren mittlerweile ähnlich altersgebrechlich geworden wie er selbst. Und das machte es für Mahklyn natürlich deutlich schwieriger, sich diesem Argument der ›Bequemlichkeit‹ entgegenzustellen, als wenn er sich nur um seine eigenen Knie hätte kümmern müssen.
Abgesehen davon reißt Tairys mir den Kopf ab, wenn ich so ein Angebot ausschlage!
»Also gut, Pater Clyfyrd«, sagte er schließlich. »Bitte informiert Seine Majestät, dass er zu gütig und zu großzügig ist, ich aber diese Großzügigkeit gerne voller Dankbarkeit annehme.«
»Das wird Seine Majestät gewiss mit Freuden vernehmen«, murmelte Laimhyn, und es gelang ihm dabei fast, sich keinerlei Triumphgefühl anmerken zu lassen. Aber nur fast.
»Was nun …«, fuhr er mit deutlich forscherer Stimme fort, »… die Unterstützung seitens der Geistlichkeit betrifft, so hatte sich Seine Majestät gedacht …«
»Ach, jetzt hör schon auf zu nörgeln, Vater!«, sagte Tairys Kahnklyn und lächelte ihn liebevoll an, während sie eine Salatschüssel auf den Esstisch stellte. »Man könnte ja meinen, Seine Majestät habe dir eine Zelle im Kerker angeboten!«
»Es geht mir hier ums Prinzip«, widersprach Mahklyn beinahe schon streitlustig. »Wir sollen unabhängig sein und stets einen kritischen Verstand wahren, und uns nicht durch Versprechungen sündigen Luxus’ bestechen und untergraben lassen.«
»Also, ich persönlich bin ja für ›sündigen Luxus‹ immer zu haben«, warf Aizak Kahnklyn ein, während er nach der Holzzange griff und sich dann daranmachte, den Salat aufzutun.
Mahklyns Schwiegersohn war ein kräftiger, untersetzter junger Mann mittlerer Größe. Er trug einen dichten Bart, der fast unnatürlich schnell wuchs, seine Augenbrauen waren buschig und schienen seine kräftigen Schultern und muskulösen Oberarme nur noch zu betonen, und seine dunklen Augen lagen tief in ihren Höhlen. Wer ihn nicht kannte, hatte oft das Gefühl, er gehöre wohl eher als Hafenarbeiter in die Docks oder vielleicht auf irgendeine Farm, am besten hinter den Pflug. Doch in diesen tiefliegenden Augen glomm der Funke unablässiger Neugier, und er gehörte zu den intelligentesten und belesensten Männern, die Mahklyn kannte. Tairys und er waren die offiziellen Bibliothekare der Hochschule, und wenn es irgendjemanden gab, dem die Zerstörung aller Hochschulaufzeichnungen noch mehr zusetzte als Mahklyn selbst, dann waren das seine Tochter und sein Schwiegersohn.
»Ich auch. Ich auch! ›Sündigen Luxus‹ finde ich toll!«, erklärte Eydyth Kahnklyn, die jüngere Tochter von Tairys und Aizak, und hüpfte vor Aufregung auf ihrem Stuhl schon fast auf und ab. Ihr Zwillingsbruder verdrehte die Augen. Das tat er häufig, wenn Eydyths Enthusiasmus wieder einmal mit der Dreizehnjährigen durchging. Dennoch hörte Mahklyn auch von ihm keinerlei Protest, und so blickte er zu Aidryn hinüber, seiner ältesten Enkelin.
»Muss ich davon ausgehen, dass auch du deinen Eltern und deinen arg lautstarken Geschwistern in dieser Hinsicht beipflichtest?«, fragte er sie.
»Großpapa«, erwiderte die Zwanzigjährige und lächelte, »wenn du wirklich in einem zugigen, alten Mietshaus leben und arbeiten möchtest, bei dem du vier Treppen hochklettern musst, bloß um dein Büro zu erreichen, und durch dessen Fenster jeder, der es darauf anlegt, mühelos eine brennende Laterne schleudern kann, dann mach du nur. Der Rest von uns wird einfach irgendwie hier in diesem Palast zurechtkommen müssen.«
»Ich seid doch alles Hedonisten«, grollte Mahklyn.
»Wenn du das wirklich glaubst, dann solltest du wenigstens nicht dabei lächeln«, merkte Tairys an. Mit der Würde, die eines Patriarchen seines gesetzten Alters angemessen war, ignorierte Mahklyn diese Herausforderung. Vor allem, da er genau wusste, seiner Tochter ohnehin nicht beikommen zu können.
»Hat schon irgendjemand mit Onkel Tohmys darüber gesprochen?«, fragte Erayk jetzt. Mit seinen siebzehn Jahren war er das zweitälteste von Mahklyns Enkelkindern. Er kam deutlich mehr nach seiner Mutter als nach seinem Vater, war hochgewachsen und schlank – und er war eindeutig derjenige aus dieser Familie, der sich über alles am meisten Sorgen machte.
»Mein kleiner Bruder kann gut auf sich alleine aufpassen, Erayk, danke der Nachfrage«, gab seine Mutter zurück und lächelte. »Das macht er ja schließlich schon seit Jahren. Und ich bin mir sicher, wenn er wieder nach Hause kommt, dann wird er deutlich lieber hier ›vor Anker gehen‹ als in unserem alten Gästezimmer.«
Die meisten am Tisch lachten leise. Tohmys Mahklyn hatte nicht geheiratet – noch nicht, zumindest; schließlich ist er ja erst sechsunddreißig, rief sich Mahklyn ins Gedächtnis zurück –, vor allem, weil er behauptete, eine Gemahlin und eine Kapitänskajüte würden einfach nicht zusammenpassen. Als Kapitän einer von Ehdwyrd Howsmyns Galeonen war Tohmys jedoch häufiger fernab von Tellesberg als tatsächlich in seiner Heimatstadt, und Mahklyn vermutete, dass er in den verschiedensten Häfen von ganz Safehold die eine oder andere Liebste hatte. Im Gegensatz zu seiner Schwester hatte sich Tohmys nie für das Leben eines Gelehrten interessiert. Er war viel zu beschäftigt damit, deutlich … aufregendere Ziele anzustreben, und er hatte nicht das Geringste dagegen, auch die schönen Seiten des Lebens zu genießen.
»Ich fürchte, zumindest was das betrifft, hat deine Mutter recht«, erklärte Mahklyn seinem Enkel.
»Natürlich«, merkte Aizak fröhlich an. »Abgesehen von dieser merkwürdigen Vorliebe für Salzwasser, gehört er zu den vernünftigsten Menschen, die ich kenne. Meinst du wirklich, dein Onkel würde eine Unterkunft hier im Palast allen Ernstes verschmähen, Erayk?«
»Doch nicht Onkel Tohmys«, warf Eydyth ein und grinste breit.
»Ganz genau«, bestätigte Aizak, während er Mahklyn den Salatteller reichte. »Und damit sind wir noch gar nicht auf all die anderen Vorteile eingegangen«, setzte er noch hinzu, allerdings ein wenig leiser, während er seinem Schwiegervater über den Tisch hinweg in die Augen blickte.
Nein, das wirklich nicht, Aizak, pflichtete Mahklyn ihm innerlich bei. Die werden deutlich mehr Schwierigkeiten haben, hier mit Laternen um sich zu werfen, nicht wahr?
»Also gut«, sagte er. »Also gut! Dann höre ich eben auf, mich zu beklagen, mache mich an die Arbeit und werde diesen mir auferlegten sündigen Luxus in edlem Schweigen ertragen.«
»Euer Majestät!«
Mahklyn sprang aus seinem Sessel – oder kam dabei zumindest so weit, wie man das von einem Mann seines Alters und mit derart arthritischen Knien erwarten konnte –, doch König Cayleb bedeutete ihm mit einer Handbewegung, sich wieder in den Sessel fallen zu lassen.
»Ach, bleiben Sie doch sitzen, Rahzhyr!«, schalt ihn der jugendliche Monarch. »Wir kennen einander schon seit Jahren, Sie sind alt genug, um mein Vater zu sein, und das hier ist immerhin Ihr Revier, nicht das meine.«
Es ist doch, ging es Mahklyn durch den Kopf, sehr taktvoll – wenngleich nicht ganz korrekt –, dass Seine Majestät ›Vater‹ gesagt hat, und nicht ›Großvater‹.
»Euer Majestät sind sehr freundlich«, sagte er und ließ sich wieder in den luxuriös gepolsterten Sessel sinken, den Cayleb ihm bereitgestellt hatte.
»Meine Majestät sind nichts dergleichen«, gab Cayleb fast schon barsch zurück, während Merlin Athrawes ihm durch die Tür in Mahklyns Büro folgte; der Captain der Charisian Royal Guard hielt eine lederne Aktentasche in der Hand. »Meine Majestät sind berechnend, zynisch und eigennützig. Dafür zu sorgen, dass Ihnen und Ihren Kollegen alles erdenkliche bereitgestellt wird, was Sie benötigen, um anständig und effizient zu arbeiten – und ohne dass ich mir Sorgen machen müsste, Sie könnten zu viel Rauch einatmen –, liegt ganz und gar in meinem ureigensten Interesse.«
»Selbstverständlich, Euer Majestät.«
Mahklyn lächelte, und der König erwiderte das Lächeln. Doch dann wurde seine Miene deutlich ernsthafter, und Mahklyn hob neugierig die Augenbrauen, als Captain Athrawes hinter sich die Bürotür schloss.
»Tatsächlich liegt in dem, was ich gerade gesagt habe, eine ganze Menge Wahrheit, Doktor Mahklyn«, erklärte Cayleb nun. »Sogar mehr, als Sie vermutlich ahnen.«
»Wie bitte, Euer Majestät?«
»Lassen Sie es mich so ausdrücken …«, setzte Cayleb an und setzte sich in einen der anderen Sessel dieses großen, sonnendurchfluteten Büroraumes. »Ich darf doch wohl davon ausgehen, dass Ihnen einige unbedeutende … Eigenheiten an Seijin Merlin nicht entgangen sind, oder?«
Er hielt inne, neigte den Kopf zur Seite, und Mahklyns Augen verengten sich zu schmalen Schlitzen.
»Um ganz ehrlich zu sein, Euer Majestät«, erwiderte er dann langsam, »ist dem tatsächlich so.«
»Nun, das liegt daran, dass er wirklich ein recht bemerkenswerter Bursche ist«, sagte Cayleb, und sein Lächeln wirkte ein wenig angespannt. »Und der Grund für meinen unangekündigten Besuch an diesem Nachmittag ist, dass ich Ihnen gerne einiges über manche dieser Eigenheiten erzählen möchte, und auch, warum sie – und auch Sie – so wichtig sind für das, was im Augenblick geschieht, nicht nur hier in Charis, sondern auf ganz Safehold.
Bis vor kurzem war ich mir der Eigenheiten des Seijins nicht vollbewusst«, sprach er weiter. »Nicht bis zu jenem Tage, an dem Seijin Merlin und Erzbischof Maikel zu mir kamen und mich über einige Aspekte der Geschichte aufklärten, die den meisten Menschen nicht bekannt ist. Wissen Sie, Doktor, es sieht ganz so aus, als seinen vor mehreren Jahrhunderten …«
Etwas mehr als drei Stunden später lehnte sich Cayleb in seinem Sessel zurück und hob beide Hände, die Handflächen nach oben gedreht.
»Und das ist die Wahrheit, Doktor«, sagte er leise. »Ich weiß, dass das eine ganze Menge ist, die man erst einmal verarbeiten muss, und ich weiß, das das in völligem Gegensatz zu allem steht, was die Kirche uns je gelehrt hat, aber es ist dennoch die Wahrheit. Ich habe Erzbischof Maikel gefragt, und er hat mir versichert, er sei jederzeit bereit, alles zu bestätigen, was ich Ihnen gerade berichtet habe. Und die Bruderschaft wäre hocherfreut, Ihnen im Kloster Sankt Zherneau die Originaldokumente zugänglich zu machen, damit Sie sich selbst nach Gutdünken damit befassen können.«
»Das … wird nicht erforderlich sein, Euer Majestät«, erwiderte Mahklyn langsam. Immer noch waren seine Augen weit aufgerissen, und darin glomm kräftige, fast ungestüm lodernde Neugier, doch sein Blick war nicht auf den König gerichtet, sondern auf Merlin. »Ach, selbstverständlich werde ich dieses Angebot Seiner Eminenz annehmen – welcher Historiker würde sich das entgehen lassen?! Aber ich brauche diese Aufzeichnungen nicht zu sehen, um zu glauben, dass jedes einzelne Wort von dem, was Ihr mir berichtet habt, die Wahrheit ist – und das nicht nur, weil ich noch nie erlebt habe, dass Ihr gelogen hättet. Ich werde auch nicht vorgeben, bereits geahnt zu haben, was Ihr mir dort gerade erzählt habt, aber es erklärt so viele andere Dinge, über die ich mir im Laufe meines Lebens immer und immer wieder Fragen gestellt habe.«
»Wenn Sie mir verzeihen, das so auszudrücken, Doktor Mahklyn, aber Sie gehören zu den Menschen, die sich immer über irgendetwas Fragen stellen«, merkte Merlin an und zwinkerte verschmitzt.
»Man müht sich, Seijin Merlin.« Mahklyn schüttelte den Kopf. »Andererseits, wenn ich Euch anschaue und darüber nachdenke, auf welches Wissen und auf welche Fähigkeiten alleine schon Eure reine Existenz rückschließen lassen, dann ist es doch offenkundig, dass es mir nicht vergönnt sein wird, mir noch über alle Dinge Fragen zu stellen, über die ich mir Fragen stellen sollte, bevor meine eigene Zeit abgelaufen ist.«
»Und beunruhigt Sie dieses Wissen, nun, da Sie es haben, Doktor?«, fragte Cayleb leise.
»Ein Gelehrter sollte nie allzu beruhigt sein, Euer Majestät.«
»Das hatte ich nicht gemeint«, gab Cayleb trocken zurück.
»Das weiß ich, Euer Majestät.« Mahklyn blickte den König reumütig an. »Und doch war meine Antwort nicht gänzlich leichtfertig. Seijin Merlin und die ganze Historie, die Ihr für mich gerade zusammengefasst habt, sind genau das, wofür jeder Gelehrte lebt. Oder zumindest, wofür jeder von uns leben sollte. Ich bin mir sicher, ich werde Aspekte dieser Historie entdecken, die wahrlich beunruhigend sein werden, und sich zu bemühen, all das vor dem Hintergrund dessen zu begreifen, was uns die Kirche stets gelehrt hat, wird gewiss immer wieder zu Augenblicken echter Beängstigung führen. Doch wenn man das damit vergleicht, wie faszinierend das ist …«
Er zuckte mit den Schultern, und Caylebs Schultern schienen sich kaum merklich zu lockern, als habe ihn endlich eine bislang nicht wahrnehmbare Anspannung verlassen.
»Ich beginne auch allmählich zu verstehen, woher genau dieses bemerkenswerte Wissen von Seijin Merlin zu kommen scheint«, setzte Mahklyn den Gedanken fort.
»Ich glaube nicht, darüber jemals tatsächlich gelogen zu haben, Doktor.«
»Nein, das glaube ich auch nicht.« Mahklyn lachte leise. »Tatsächlich bin ich in Gedanken jede Erinnerung an die einleitenden Worte durchgegangen, die Ihr jedes Mal vorangestellt habt, bevor Ihr euch daran begabt, uns von einer neuen, nützlichen Technik oder Erfindung zu berichten. Ihr wart immer sehr vorsichtig, was die Art und Weise dieses Berichtens angeht, nicht wahr?«
»Ich habe mich gewiss bemüht«, erklärte Merlin nüchtern, »und das vor allem, weil ich immer gewusst habe, dass früher oder später ein Moment wie dieser kommen müsse. Es mag Dinge geben, die ich Ihnen oder den anderen nicht gewagt habe zu erzählen, aber ich habe von Anfang an beschlossen, keinerlei Information zurückzuhalten, die meine Glaubwürdigkeit in irgendeiner Art und Weise schmälern könnte, wenn ich letztendlich in der Lage wäre, die Wahrheit zu enthüllen.«
»Und falls Sie jetzt denken, er habe sich Euch gegenüber verhalten, als müsse er sich auf äußerst dünnem Eis bewegen, Doktor, dann hätten Sie miterleben sollen, wie er mit Pater Paityr gesprochen hat.«
»Ich glaube, das hätte ich wirklich gerne gesehen. »Mahklyn schüttelte den Kopf und lachte erneut leise in sich hinein. »Das muss sehr … unterhaltsam gewesen sein.«
»Ach, das können Sie sich gar nicht vorstellen, Doktor«, versicherte Merlin ihm.
»Wahrscheinlich nicht«, pflichtete Mahklyn ihm bei. Dann richtete er sich in seinem Sessel auf, beugte sich vor und legte die Hände auf den Tisch. »Andererseits, Euer Majestät, beginne ich allmählich zu verstehen, was Ihr gemeint habt, als Ihr vorhin hereingekommen seid. Sollte ich davon ausgehen, dass Seijin Merlin weitere grundlegende Kenntnisse mit der Hochschule teilen will – und mit Hilfe der Hochschule dann auch mit anderen?«
»Ja, dem ist tatsächlich so«, gab Cayleb ihm recht. »Und wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie über weitere mögliche Kandidaten für den ›Inneren Kreis‹ nachdenken würden. Offensichtlich kennen Sie Ihre Kollegen von der Hochschule deutlich besser als wir. Wer, denken Sie, wäre … flexibel genug, um die Wahrheit als solche zu akzeptieren?«
»Darüber werde ich nachdenken müssen, Euer Majestät«, gab Mahklyn vorsichtig zur Antwort, und Cayleb stieß ein Schnauben aus.
»Wenn Sie nicht darüber nachdenken müssten, dann hätte ich Sie einweisen lassen, Doktor! Und bitte vergessen Sie nicht: Die letztendliche Entscheidung obliegt weder Ihnen noch mir. Dennoch wäre es eindeutig hilfreich, weitere Angehörige der Hochschule zu haben, die mit uns zusammen an dieser Aufgabe arbeiten.«
»Das verstehe ich, Euer Majestät«, versicherte Mahklyn ihm.
»Gut. Und nun, Merlin … Ich glaube, Sie haben noch etwas für den guten Doktor?«
»Allerdings, Euer Majestät«, erwiderte Merlin und deutete eine Verneigung an. Dann griff er in die Aktentasche, die er in das Büro mitgebracht hatte, und zog ein Bündel Papierbögen hervor. »Ich habe das hier in eine Handschrift umgewandelt, Doktor«, sagte er. »Ich dachte, das würde vielleicht weniger Fragen aufwerfen, als wenn es als ordentlich gedrucktes, gebundenes Buch vorliegt – mit einem Erscheinungsdatum, das vor dem Tag der Schöpfung liegt. Nur für den Fall, dass irgendjemand anderes es zufälligerweise finden sollte. Hier.«
Er reichte es über den Tisch, und Mahklyn nahm es entgegen, beinahe schon übertrieben vorsichtig. Dann betrachtete er die ersten Seiten und zuckte überrascht zusammen.
»Das ist ja meine Handschrift!«, platzte es aus ihm heraus, und er blickte Merlin verdutzt an.
»Eigentlich ist es die von Owl«, erwiderte Merlin und lächelte. »Das ist ein ziemlich talentierter Urkundenfälscher, und ich habe ihm eine Probe Ihrer Handschrift zukommen lassen, bevor er das hier erstellt hat. Ich dachte, das wäre wohl am besten so.«
»Aber was ist das?«, fragte Mahklyn nach.
»Das, Doktor Mahklyn, wurde vor langer Zeit geschrieben, auf Terra, von einem Mann namens Sir Isaac Newton. Ich habe es geringfügig aktualisiert – das Original in englischer Sprache ist beinahe schon zweitausend Jahre alt –, aber ich denke, das könnte Sie interessieren.«
.III.
Königliches Patentamt, Tellesberg,Königreich Charis
»… und das ist Euer Büro, Pater.«
Pater Paityr Wylsynn folgte Pater Bryahn Ushyr in das große, quadratische Zimmer hinein und blickte sich um. Es war kleiner als sein altes Büro im Palast des Erzbischofs, doch Wylsynn hatte schon immer gedacht, dass dieser Raum damals ohnehin größer und prächtiger gewesen war, als das für ihn erforderlich gewesen wäre. Und auch dieser Raum war mehr als groß genug; durch die Fenster in zweien der Wände und das Oberlicht fiel reichlich Licht. Der Sessel hinter dem Schreibtisch wirkte sehr bequem.
»Ich darf davon ausgehen, dass es zufriedenstellend ist, Pater?«, fragte Pater Bryahn nach kurzem Schweigen.
»Hmm?« Kurz schüttelte Wylsynn den Kopf. »Ich meine … gewiss, Pater Bryahn«, erklärte er Erzbischof Maikels Privatsekretär. »Das ist mehr als zufriedenstellend.«
»Das freut mich. Wir haben auch ein halbes Dutzend ausgebildeter Schreiber, aus denen Ihr Eure persönlichen Adlaten auswählen könnt. Ich habe sie heute Morgen herüberschicken lassen. Sie warten bereits auf ein Einstellungsgespräch mit Euch. Bitte fühlt Euch ganz frei, auszuwählen, so viele auch immer Ihr wünscht – oder auch einfach alle.«
»Der Erzbischof ist sehr großzügig«, erwiderte Wylsynn, und Ushyr zuckte mit den Schultern.
»Seine Eminenz wünscht lediglich, dass Euch sämtliche Werkzeuge zur Verfügung stehen, derer Ihr bedürft, Pater.«
»Nun, er hat zweifellos dafür gesorgt, dass dem so sein wird.« Wylsynn durchquerte das Büro und betrachtete die Bücher, die hinter seinem Schreibtisch säuberlich aufgereiht in einem gewaltigen Bücherschrank standen – er reichte vom Boden bis zur Decke. Wylsynn überflog die Titel, die in die Buchrücken eingeprägt waren, nickte unwillkürlich immer wieder zustimmend mit dem Kopf. Hier konnte er wirklich auf sämtliche Nachschlagewerke zugreifen, die er nur benötigte.
»In diesem Falle, Pater, werde ich mich zurückziehen, damit Ihr Euch allmählich einleben könnt«, erklärte Ushyr. »Sollte Euch irgendetwas auffallen, was uns entgangen sein könnte, dann informiert uns darüber bitte umgehend.«
»Das mache ich«, versicherte Wylsynn ihm und begleitete den Pater noch bis zur Tür seines neuen Büros.
Ushyr verschwand, und mit langsamen Schritten kehrte Wylsynn zu seinem Schreibtisch zurück und nahm dahinter Platz. Erneut blickte er sich in seinem Büro um, doch eigentlich sah er es dabei überhaupt nicht. Ihn beschäftigte viel zu sehr die Frage, ob er wirklich wusste, was er hier tat, als dass er sich Gedanken über ›Möblierung‹ oder ›geräumige Büros‹ hätte machen können.
Derartige Zweifel waren für Paityr Wylsynn selten. Seit dem Tag, an dem er seinem Vater gesagt hatte, er sei bereit, seinen Posten in Charis anzutreten, hatte er immer das Gefühl gehabt, am ›richtigen‹ Ort zu sein. Nicht notwendigerweise an einem bequemen Ort, doch eben an dem Ort, an dem er gebraucht wurde, um zu erreichen, was immer Gott von ihm verlangte. Natürlich nur, bis Charis beschlossen hatte, sich nicht nur der ›Vierer-Gruppe‹ entgegenzustellen, sondern der gesamten Hierarchie von Mutter Kirche.
Der junge Priester schloss die Augen, suchte nach jenem stillen, ruhigen Ort im tiefsten Inneren seines eigenen Seins, an dem er sein Gottvertrauen bewahrte. Er fand ihn, und sofort erfasste ihn ein willkommenes Gefühl des Friedens. Seine Sorgen und Nöte verschwanden nicht etwa wie von Zauberhand, doch die Gewissheit, er sei in der Lage, sich mit jeder einzelnen davon zu befassen, wann immer sie auftauchte, erfüllte ihn dennoch.
Natürlich, dachte er, als er die Augen wieder öffnete, bedeutet ›sich damit befassen‹ nicht notwendigerweise das Gleiche, wie ›sich sicher sein, das Richtige zu tun‹, nicht wahr, Paityr?
In Wahrheit, so sinnierte er, machte er sich deutlich weniger Sorgen über seine Entscheidung, Maikel Staynairs Autorität als Erzbischof von Charis anzuerkennen – seine spirituelle Autorität ebenso wie seine weltliche –, als über diese Vorstellung eines ›Patentamtes‹.
Als man ihm diese Idee erklärt hatte, war er doch ein wenig erstaunt gewesen. Neue Ideen und Techniken registrieren lassen? Den Leuten, die sie ersonnen hatten, effektiv das Eigentum daran zuzugestehen und dann von anderen zu fordern, dafür zu zahlen, sie ebenfalls nutzen zu können? Absurd! Und schlimmer noch: Dieses ganze Konzept roch regelrecht danach, dass es hier darum ging, die Entwicklung von Innovationen und Neuerungen bewusst voranzutreiben – und das war etwas, womit sich kein Mitglied des Schueler-Ordens sollte anfreunden können. Dennoch musste er zugeben, dass es ihm nicht gelungen war, in der Heiligen Schrift oder den Kommentaren irgendetwas zu entdecken, das die Einrichtung eines solchen Amtes untersagt hätte. Das mochte natürlich gut daran liegen, dass bislang niemand auch nur auf die Idee gekommen wäre, ein solches Amt zu schaffen, doch es blieb dabei: Die Schriften untersagten es eindeutig nicht.
Und wenn diese Leute hier überleben wollen, dann werden sie innovative Lösungen für das Problem finden müssen, wie man sich verteidigt, wenn man im Verhältnis acht oder neun zu eins unterlegen ist.
Dieser grimmige Gedanke jagte Wylsynn einen mittlerweile bereits vertrauten Schauer über den Rücken. Zum Teil versuchte er sich weiszumachen, das sei nur der Versuch, sich das alles hier schönzureden, eine Möglichkeit, eine ungesunde und spirituell gefährliche Faszination an neuem Wissen zu rechtfertigen. Doch wann immer sich diese Versuchung regte, musste Wylsynn unwillkürlich an diesen entsetzlichen, völlig grundlosen Angriff denken, den Charis tatsächlich irgendwie hatte abwehren können.
Gewiss wollte oder erwartete Gott nicht, dass Seine Kinder hilflos dabeistanden, während ihre Familien ermordet und Häuser über ihren Köpfen in Brand gesteckt wurden! Unschuldige Menschen hatten alles Recht der Welt, nach geeigneten Mitteln Ausschau zu halten, sich gegen den Angriff eines anderen zur Wehr zu setzen, und was auch immer die Kirche offiziell verkünden mochte, Wylsynn wusste sehr wohl, dass dieser Angriff auf Charis völlig unberechtigt gewesen war. Nicht, dass es ihn sonderlich überraschte, wie in Zion und dem Tempel genau das Gegenteilige behauptet wurde. Es betrübte ihn, es widerte ihn an, das ja, aber es überraschte ihn nicht. Trotz seines eigenen tiefen, beständigen Gottvertrauens und Glaubens hatte sich Paityr Wylsynn niemals irgendwelchen Illusionen über die Verderbtheit und die Korruption der ›Vierer-Gruppe‹ und des ganzen Rates der Vikare hingegeben.
Nein, das ist nicht ganz richtig, herrschte er sich selbst an. Ein paar Illusionen hast du dir doch gegönnt, oder nicht? Zum Beispiel die Illusion, nicht einmal der Großinquisitor werde Anstrengungen unternehmen, ein ganzes Königreich einfach zu zerstören, bloß weil er sich darüber ärgerte.
Nachdem Clyntahn zu dieser Entscheidung gekommen war, hatte Wylsynn viel nachgedacht, gebetet und meditiert, und letztendlich war er zu dem Schluss gekommen, was hier in Charis geschehe, sei Gottes Wille. Wie unangenehm, wie … beunruhigend ihm Erzbischof Maikels Ansichten auch sein mochten, es bestand nicht der geringste Zweifel daran, der Erzbischof von Charis sei Gott deutlich näher als der Großinquisitor. Maikel Staynair mochte vielleicht irren, aber er war nicht böse … und genau das konnte Wylsynn über Zhaspahr Clyntahn und den Rest der ›Vierer-Gruppe‹ eben nicht mehr behaupten. Und um die Wahrheit zu sagen: Wylsynn war von Tag zu Tag mehr davon überzeugt, dass Staynair nicht einmal irrte. Was das mit sich brachte, und wie sehr das Wylsynns eigenes Verständnis der Schriften und deren inhärenten Lehren veränderte, war gewiss beängstigend, aber Gott hatte niemals versprochen, es werde einfach sein, Seinen Willen zu tun.
Und so saß Pater Paityr Wylsynn, Intendant von Charis, ordinierter Priester des Schueler-Ordens, nun hier in seinem Büro – in einem Gebäude, das ausdrücklich dafür gedacht war, Menschen dazu anzuhalten, sich neue Mittel und Wege zu überlegen, irgendetwas zu bewirken.
Er schüttelte den Kopf; dieser Gedanke brachte ihn dazu, die Lippen fast schon zu einem Lächeln zu verziehen. Dann stand er auf, ging zu einem seiner neuen Fenster hinüber und blickte in den Nachmittag hinaus.
Man hatte das Patentamt in einem Gebäude untergebracht, das zu Baron Ironhills Ministerium gehörte. Der Intendant der Zivilliste hatte in Charis mehr zu tun als in vielen anderen der Königreiche auf Safehold, und Ironhill hatte einen Großteil seiner Mitarbeiter zu Beginn dieses Jahres in ein deutlich größeres Gebäude umziehen lassen. Dieses Haus hier mochte ja für Ironhills Zwecke zu klein gewesen sein, doch es gab hier eine Vielzahl an Bürorräumen – von denen zugegebenermaßen einige nicht viel größer waren als ein mittelgroßer Schrank –, in denen das neue Patentamt (das ebenfalls Ironhills Ministerium unterstand, zumindest derzeit noch) die zahlreichen Schreiber unterbringen konnte, die es gewiss schon bald benötigen würde. Zudem war es von alten Fasteichen und Föhren umstanden, die willkommenen Schatten spendeten.
Und auf dem niedrigen Wall, der es von allen Seiten umgab, patrouillierten Tag und Nacht Angehörige der Marines – bewaffnet mit Gewehren.
Wylsynn schürzte die Lippen, als er bemerkte, wie die Nachmittagssonne auf den Bajonetts der Marines glitzerte, die vor dem Tor des Patentamtes Wache hielten. Ihre Anwesenheit – und natürlich das, was mit dem ursprünglichen Gebäude der Königlichen Hochschule geschehen war – mahnten ihn grimmig, nicht jeder stimme mit seiner eigenen Einschätzung der Ereignisse hier in Charis überein. Die Vorstellung, es sei erforderlich, ihn vor Menschen zu schützen, die sich für treue Söhne von Mutter Kirche hielten, war … verstörend. Doch das Gleiche galt auch für das Schicksal, das die Inquisition Erayk Dynnys hatte zukommen lassen.
Es gibt keine einfachen Antworten, dachte er. Die Heilige Schrift sagt, Gott stellt jene auf die Probe, die Er liebt, und das habe ich immer für die Wahrheit gehalten. Doch üblicherweise ist das, was Er von mir verlangt, recht einfach zu erkennen. Vielleicht nicht einfach zu bewirken, aber doch wenigstens einfach zu erkennen.
Er holte tief Luft. Es wurde Zeit, diese Zweifel beiseitezuschieben. Er war nicht hier, um Neuerungen voranzutreiben – es gab, weiß Gott, schon genug Charisianer, die genau das mit Feuereifer taten! –, sondern um sicherzustellen, dass nichts jener neu patentierten Prozesse oder Konzepte gegen die Achtungen der Jwo-jeng verstießen. Und das konnte er ohne jegliche Bedenken tun.
Und was machst du, wenn über deinen Schreibtisch schon genügend neue Prozesse und Konzepte gewandert sind, dass selbst für dich die Grenzen der Ächtungen zu verschwimmen beginnen, Paityr?, fragte er sich selbst. Wie sagst du ›Halt!‹, wenn du erst einmal Teil jener geworden bist, die dem Volk sagen, Veränderungen seien etwas (Gutes? Seine Eminenz hat recht, in der Lehrschrift Über Gehorsam und Glauben wurde tatsächlich darauf hingewiesen, dass es Zeiten gibt, in denen Veränderungen gut sein können, sogar notwendig. Aber wenn dies hier nun eine jener Zeiten ist, wann wird es enden … und wo wird es enden?
Das waren die Fragen, auf die er keine Antwort wusste … noch nicht. Doch es gab Zeiten, da musste jeder Mensch, erst recht ein Priester, einfach darauf vertrauen, dass Gott ihn an das richtige Ziel führte.
Paityr Wylsynn straffte die Schultern, ging zur Tür seines neuen Büros hinüber, trat dann auf den Korridor hinaus und schaute zum Gangdiener hinüber.
»Pater Bryahn hat mir gesagt, er habe mehrere Kandidaten zusammengerufen, die ich in einem Gespräch auf ihre Eignung als mögliche Amtsschreiber überprüfen möge«, sagte er mit ruhiger Stimme. »Wären Sie wohl so freundlich, den ersten in mein Büro zu führen?«
.IV.
Parlamentsgebäude,Königreich Charis
Es war das erste Mal, dass Merlin das Innere des Parlamentsgebäudes von Charis mit eigenen Augen sah. Na ja, vielleicht wäre ›mit eigenen Video-Rezeptoren‹ besser umschrieben, ging es ihm durch den Kopf. Man will ja schließlich bei der Wahrheit bleiben.
Die Putzwände waren übermannshoch mit den Tropenhölzern getäfelt, die es in den nördlicheren Wäldern von Charis überreichlich gab. Langsam und stetig drehten sich mehrere Ventilatoren, die man an den freiliegenden Deckenbalken befestigt hatte; sie milderten angenehm die Hitze. Die Jalousien an den riesigen Oberlichtern hatte man geöffnet, sodass das Licht der Morgensonne in den Raum fiel; diese Fenster trugen ebenfalls dazu bei, dass ein wenig kühlere Luft in den Versammlungssaal strömte. Auch durch die Fenster in den für charisianische Architektur typisch dicken, gut die Hitze abhaltenden Seitenwänden fiel Sonnenlicht. Obschon der Tag wieder heiß zu werden versprach und obwohl sich in diesem Raum zahlreiche Personen versammelt hatten, war es im Saal doch überraschend kühl was viel über die Fertigkeiten jener Männer aussagte, die ihn geplant und gebaut hatten.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!