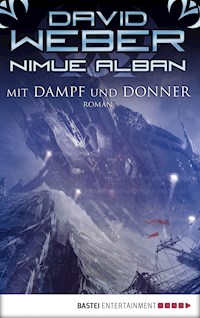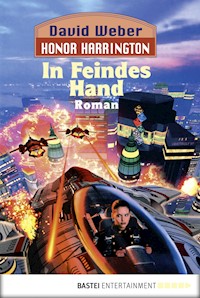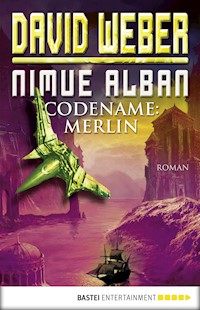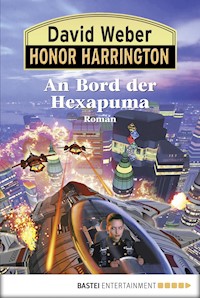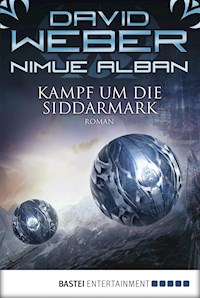
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Nimue-Reihe
- Sprache: Deutsch
Die Menschheit musste die Erde vor langer Zeit verlassen, um der Auslöschung durch eine überlegene außerirdische Spezies zu entgehen. Auf einem fernen Planeten begann sie ein neues Leben. Dort leidet sie unter einer Kirchendiktatur, die alles Wissen um die moderne Menschheitsgeschichte erbarmungslos unterdrückt. Doch nicht alle sind bereit, dies hinzunehmen. Unter ihnen die ehemalige Offizierin Nimue Alban, die den Kampf gegen die Diktatur aufnimmt ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 695
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über den Autor
Titel
Impressum
Widmung
März, im Jahr Gottes 896
.I.
.II.
.III.
.IV.
.V.
.VI.
.VII.
April, im Jahr Gottes 896
.I.
.II.
.III.
.IV.
.V.
.VI.
.VII.
.VIII.
.IX.
.X.
.XI.
.XII.
.XIII.
.XIV.
.XV.
.XVI.
.XVII.
.XVIII.
.XIX.
.XX.
.XXI.
.XXII.
Charaktere
Glossar
Die Erzengel
Hierarchie der Kirche des Verheißenen
Über den Autor
David Weber ist ein Phänomen: Ungeheuer produktiv (er hat zahlreiche Fantasy- und Science-Fiction-Romane geschrieben), erlangte er Popularität mit der HONOR-HARRINGTON-Reihe, die inzwischen nicht nur in den USA zu den bestverkauften SF-Serien zählt. David Weber wird gerne mit C. S. Forester verglichen, aber auch mit Autoren wie Heinlein und Asimov. Er lebt heute mit seiner Familie in South Carolina.
David Weber
NIMUE ALBAN:
KAMPFUM DIESIDDARMARK
Aus dem Amerikanischen vonDr. Ulf Ritgen
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Deutsche Erstausgabe
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2012 by David Weber
Titel der amerikanischen Originalausgabe:
»Midst Toil and Tribulation Teil 1«
Originalverlag: Baen Books, Wake Forest
This work was negotiated through Literary Agency
Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen,
on behalf of St. Martin’s Press, L.L.C.
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2014 by Bastei Lübbe AG, Köln
Titelillustration: Arndt Drechsler, Rohr
Textredaktion: Beke Ritgen
Lektorat: Ruggero Leò
Titelgestaltung: Guter Punkt, München
Datenkonvertierung E-Book: Urban SatzKonzept, Düsseldorf
ISBN 978-3-8387-4583-1
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Wie immer: für Sharon, einfach weil du du bist.
März, im Jahr Gottes 896
.I.
Grauwallberge,Provinz Gletscherherz,Republik Siddarmark
In dicht gewebten, eisigen Schleiern fiel Schnee. Der Wind, der die Flocken miteinander verwebte, war beißend scharf. Unablässig pfiff er über die dicke Schneedecke, die das Land bedeckte, und schien an den himmelhohen Berggipfeln zu rütteln. In der Eiseskälte warfen diese blaue Schatten auf weiße Schneedünen.
Für einen nichts ahnenden Besucher mochte die Schneedecke fest wirken und dazu einladen, sie zu betreten. Wahlys Mahkhom aber war in den Grauwallbergen geboren und aufgewachsen. Er wusste genau, wie gefährlich es hier war. Zornig und dennoch zu allem entschlossen, spähte er durch die Rauchgläser seiner Schneebrille. Ihm knurrte der Magen. Mahkhom war an winterliches Wetter gewöhnt, sogar hier oben in den Grauwallbergen. Trotzdem kroch die Eiseskälte durch den fellbesetzten Parka und die dicken Handschuhe, fraß sich in jeden Muskel und Knochen. Selbst bei besseren Wetterbedingungen reichte in diesen Bergen im Winter nur ein einziger unachtsamer Moment, und man war verloren. Aber die Bedingungen waren weit davon entfernt, ›besser‹ genannt werden zu können. Wie ein Dämon Shan-weis verschlang der Winter in Gletscherherz jede Wärme, alle Energie, und Nahrungsmittel waren schwerer zu finden denn je. Sonderlich ergiebig waren die hochgelegenen Weiden und felsigen Äcker der Provinz noch nie. Bislang allerdings hatte es in den Lagerhäusern immer noch genug gegeben, dass selbst Jäger wie Mahkhom den Winter überstehen konnten. Dieses Jahr war es anders. Sämtliche Lagerhäuser waren niedergebrannt worden: Was die eine kriegführende Partei übrig ließ, vernichtete zur Vergeltung die andere. Zudem waren die Felder in diesem Jahr mit so viel Schnee bedeckt wie seit Menschengedenken nicht mehr. Es war, als hätte der Allerhöchste selbst beschlossen, die Unschuldigen ebenso zu strafen wie die Schuldigen. Es gab Momente, in denen Mahkhom sich fragte, ob im nächsten Jahr überhaupt noch jemand lebte, um neue Feldfrüchte anzubauen. Diese Momente kamen sogar häufiger, als er sich selbst gegenüber einzugestehen wagte.
Seine Zähne klapperten wie die Kastagnetten einer Tänzerin aus dem Tiefland. Er zog seinen Schal ein Stück höher. Seine Mutter hatte ihm diesen Schal gestrickt – vor vielen, vielen Jahren. Nun schlang Mahkhom ihn ein wenig dichter um die Schneemaske, die fast sein ganzes Gesicht verdeckte. Der Hass in seinen Augen wurden noch unerbittlicher, kälter, viel kälter noch als der eisige Winter. Denn Mahkhom ging durch den Kopf, dass seine Mutter ihm nie wieder einen Schal stricken würde – und wer die Schuld daran trug.
Vorsichtig hob Mahkhom den Kopf, blickte sich prüfend um. Doch seine Gefährten waren mit den Bergen ebenso vertraut wie er selbst. Es war gut, dass sie sich unter den weißen Tüchern verborgen hielten, die die Männer für genau diese Zwecke mitgenommen hatten. In harter, rachsüchtiger Befriedigung fletschte Mahkhom die Zähne. Schon schlugen sie nicht mehr so heftig aufeinander. Auf Schneeschuhen hatten seine Gefährten und er den weiten Weg bis hierher zurückgelegt. Unfassbar anstrengend war der Marsch gewesen, vor allem weil die Verpflegung so knapp war. Sie wussten natürlich alle, dass es beinahe schon unverantwortlich war, ohne hinreichende Vorräte einen solchen Marsch anzutreten. Aber wie sollte ein Mann sich mit ausreichend Nahrungsmitteln versorgen, wenn er dabei in die Augen seines hungernden Kindes blickte? Diese Frage konnte Mahkhom nicht beantworten – noch nicht, zumindest. Und eigentlich wollte er es auch gar nicht tun müssen. Nein. Niemals.
Er kauerte sich wieder in das Loch, das er in den Schnee gegraben hatte, und türmte dann mit beiden Händen rings um sich kleine Wälle aus Schnee auf, um besser vor der Kälte geschützt zu sein. Dann spähte er zu dem Pfad hinüber, der sich wie eine riesenhafte Schlange durch die Berge zog. Eher wie der Kadaver einer Schlange, dachte Mahkhom. Anderthalb Tage lang hatten seine Gefährten und er schon geduldig gewartet. Jetzt lief ihnen die Zeit davon: Wenn das Zielobjekt, auf das sie warteten, nicht bald auftauchte, müssten sie ihre Mission abbrechen. Dieser Gedanke ließ es glutheiß vor Zorn in Mahkhoms Magen brodeln, die plötzliche Hitze dort ein drastischer Gegensatz zu der Eiseskälte der Berge. Mahkhom stellte sich seinem Zorn ganz bewusst. In diesem Winter hatte er zu oft erleben müssen, wie hassgeschürte Entschlossenheit und schierer Starrsinn allzu viele Männer geradewegs in den Tod geführt hatten. Aber Mahkhom selbst weigerte sich schlichtweg zu sterben. Es gab noch viel zu viele, die er mit in den Tod nehmen wollte.
Mahkhom hatte keine Ahnung, wie viel Grad gerade herrschten, obwohl es auf Safehold bemerkenswert präzise Thermometer gab – ein Geschenk der Erzengel, die Mahkhoms ganze Heimatwelt erschaffen hatten. Für Mahkhom spielte die genaue Temperatur allerdings keine Rolle. Er brauchte auch nicht zu wissen, dass er sich hier neuntausend Fuß über Normalnull befand, auf einem Planeten, dessen Achsenneigung elf Grad mehr betrug und dessen Durchschnittstemperatur sieben Grad geringer war als die eines Planeten namens Terra. Diesen Namen hatte Mahkhom ohnehin noch nie gehört. Er brauchte nur zu wissen, dass ein einziger unachtsamer Moment ausreichte, um …
Mahkhom erstarrte, als er aus dem Augenwinkel eine Bewegung bemerkte. Dann wieder: etwas bewegte sich im Halbdunkel des steilwandigen Passes, schwer zu erkennen. Mahkhom wagte kaum zu atmen. Augenblicklich beherrschte ihn statt brodelndem Zorn ruhige Wachsamkeit. Konzentriert und reglos war er, ungleich eisiger und unerbittlicher als die Berge, die ihn umgaben.
Was immer sich dort bewegte, es kam näher. Schließlich konnte der Jäger erkennen, dass es eine ganze Reihe weißgekleideter Männer waren. Mühselig schleppten sie sich auf Schneeschuhen voran. Es waren genau solche Schneeschuhe, die auch neben Mahkhoms Versteck im Schnee vergraben waren. Die Hälfte der Männer trugen so schwere Lasten, dass sie sich kaum noch aufrecht halten konnten. Begleitet wurde die Gruppe von nicht weniger als sechs Schlitten, vor die man Eisechsen gespannt hatte. Mahkhoms Augen blitzten befriedigt auf, als er die Schlitten sah: Das war der Beweis, dass die Informationen zutrafen, die man ihnen zugespielt hatte.
Er machte sich nicht die Mühe, nach seinen Kameraden Ausschau zu halten, die rings um ihn, im Schnee halb vergraben, in Deckung lagen. Die anderen Männer, die in den dichten, immergrünen Hainen etwa eine halbe Meile bergab bereitstanden, hätte Mahkhom ohnehin nicht sehen können. Doch er wusste, wo sie waren. Er wusste auch, dass sie bereit waren, so wachsam wie er selbst. Die Sorglosen, die Unbekümmerten und die Unbesonnenen waren längst tot. Wer jetzt noch lebte, hatte harte Lektionen lernen müssen, so geschickt er als Jäger und Fallensteller auch sein mochte. Und ebenso wie Mahkhom selbst mussten auch seine Gefährten noch entschieden zu viele andere Männer töten, um jetzt aus Torheit selbst zu sterben.
Kein Bergarbeiter und kein Fallensteller könnte sich jemals die kostspieligen Feuerwaffen aus dem Tiefland leisten. Hätten sie die Waffen selbst irgendwie finanzieren können, waren Schießpulver und Kugeln doch viel zu teuer. Ja, selbst für eine Armbrust mit Stahlsehne wurde ein unfassbar hoher Preis verlangt: mehr als zwei ganze Monatseinkommen eines Steigers. Andererseits konnte eine ordentlich gepflegte Armbrust mehreren Generationen gute Dienste leisten. Mahkhom hatte seine Waffe vom Vater ererbt, so wie dieser von seinem Vater. Die erforderliche Munition konnte man sich selbst herstellen. Nun rollte sich Mahkhom, verborgen unter seinem weißen Tuch, lautlos auf den Rücken und streifte die Überhandschuhe ab. Die Waffe an den Stiefeln stabilisiert betätigte er mit beiden Händen die Winde, um die Sehne zu spannen. Er ließ sich Zeit, denn in Eile war er wahrlich nicht. Die Karawane aus Trägern und Eisechsen würde noch beinahe eine Viertelstunde brauchen, um den Punkt zu erreichen, an dem man sie am leichtesten erwischen könnte. So unbequem es auch sein mochte, hier eng zusammengekauert die Waffe zu spannen: Es war immer noch deutlich besser, als sich aufzurichten. Man konnte viel zu leicht gesehen werden … und damit wäre der Feind vorgewarnt.
Endlich hatte Mahkhom die Sehne gespannt. Er vergewisserte sich, dass sie auch wirklich hinter der Sperrklaue eingerastet war, und löste die Winde wieder von der Waffe. Dann rollte er sich erneut auf den Rücken und legte einen massigen Bolzen mit quadratischem Kopf auf die Sehne. Konzentriert richtete Mahkhom die Armbrust aus, spähte durch das Lochvisier. Beobachtete. Wartete. Sein Herz wurde so kalt wie der eisige Wind hier oben, während die Gestalten näher und näher kamen.
Einen kurzen Moment lang, tief unter der Oberfläche seiner ihm bewussten Gedanken, beschäftigte ihn noch etwas anderes: Der Mann, der Mahkhom noch vor drei oder vier Monaten gewesen war, sah voller Entsetzen, was auf diesem hochgelegenen, eisigen Bergpfad schon bald geschehen würde. Jener andere Wahlys Mahkhom, der noch eine Familie gehabt hatte, wusste ganz genau, dass viele jener Männer dort vorn ebenfalls Familien hatten. Er wusste, dass jene Familien ebenso verzweifelt auf die Nahrungsmittel auf den Schlitten warteten, wie die Familien, die Mahkhom selbst zurückgelassen hatte: Sie kauerten sich dicht um die Feuerstellen in den armseligen, behelfsmäßigen Hütten, die ihnen Zuflucht boten, nachdem man allen Häusern ihres Dorfes den roten Hahn aufs Dach gesetzt hatte. Jener andere Wahlys Mahkhom kannte Hunger und Leid – und er wusste, dass der Tod schon bald die Frauen und Kinder der Männer dort vorn holen würde, wenn Mahkhoms heutiges Tagwerk erst einmal verrichtet wäre. Doch was auch immer jene leise Stimme in seinem Hinterkopf flüstern mochte: Der Wahlys Mahkhom, der hier und jetzt im Schnee kauerte, hörte nicht darauf. Dieser Mahkhom hatte etwas zu erledigen.
Nun war die Kolonne bis zu der einzeln stehenden Kiefer gekommen: ein perfekter Orientierungspunkt. Hinter der von Schnee und Eis steifen Maske verzog Mahkhom die Lippen zu einem Lächeln, das einer beutehungrigen Peitschenechse zur Ehre gereicht hätte. Noch einen Herzschlag lang wartete er ab. Dann betätigte er den Abzug, und die Armbrust schnellte einen glänzenden, todbringenden Silberspan durch die eisige Bergluft.
.II.
Königlicher Palast,Tellesberg,Altes Königreich Charis,Kaiserreich Charis
Schweigend saß Merlin Athrawes in seinem dunklen Gemach. Er hatte die Augen geschlossen und betrachtete nachdenklich Bilder, die nur er sehen konnte. Eigentlich hätte er jetzt ›schlafen‹ sollen, hätte sich die Auszeit nehmen müssen, die Kaiser Cayleb ihm befohlen hatte. Doch seit mehr als einem Fünftag beobachtete Merlin mit Hilfe von Owls SNARCs Wahlys Mahkhoms Freischärler. Merlin hatte die KI in ihrem weit entfernten Versteck angewiesen, ihn zu wecken, wenn es so weit wäre.
Düster schaute Merlin nun zu, wie Armbrüste ihre todbringenden Bolzen verschossen – einer völlig überraschten Versorgungskolonne entgegen.
Die hätten besser aufpassen sollen!, dachte er grimmig. Ist ja nicht so, als hätten nicht beide Seiten mittlerweile Erfahrung darin gesammelt, die Gegenseite hinterrücks abzuschlachten.
Aber die Männer in der Kolonne hatten nicht aufgepasst. Sie hatten sich einzig damit abgemüht, dringend benötigte Nahrungsmittel für ihre Familien zu beschaffen. Von stahlbesetzten Bolzen durchbohrt schrien sie auf. Dampfend rotes Blut sprenkelte den Schnee; hektisch wurden Befehle gebrüllt und nutzlose Warnungen ausgestoßen. Flucht von dem Bergpfad war nicht möglich. Vergeblich versuchten die Männer, Deckung zu finden, sich irgendwie zu verteidigen. Doch schon brandete eine weitere Salve heran, dieses Mal von der anderen Seite des schmalen Tals. Verzweifelt versuchten die Männer, ihre Schlitten zu wenden, in die Richtung zu flüchten, aus der sie gekommen waren. Doch dann trafen drei Bolzen gleichzeitig die hinterste Eisechse. Sofort brach das massige Tier zusammen; es röhrte und fauchte und leckte immer wieder seine Wunden. Der Pfad war viel zu schmal, um mit den Schlitten an der tödlich verwundeten Echse vorbeizukommen. Nicht einmal zu Fuß hätte man sich an dem Tier im wilden Todeskampf vorbeidrängen können. Noch während den Angegriffenen das klar wurde, stieß die zweite Spitze des Hinterhalts zu: Die Männer, die sich im hinteren, breiteren Teil des Tals im Immergrün verborgen hatten, stürzten ihnen entgegen, in den Händen Schwerter, Äxte und Spitzhacken. Gnadenlos schlugen sie auf die völlig überraschten Männer ein.
Lange dauerte es nicht – das einzig Gnädige an diesem Angriff. Mittlerweile machte keine der beiden Seiten mehr Gefangene – nicht mehr in Gletscherherz, nicht an der Grenze zu Hildermoss. Allein schon sich um die eigenen Verwundeten zu kümmern war unter den gegebenen Umständen fast unmöglich. Auf verwundete Feinde konnte niemand Zeit oder Vorräte verschwenden … wenn überhaupt jemand bereit gewesen wäre, deren Leben zu verschonen. Wenigstens hatte Mahkhoms Trupp noch nicht jegliches Augenmaß verloren – anders als manch andere Freischärler, die einander unablässig verfolgten. Die ganze Republik Siddarmark hatte sich in einen einzigen Albtraum verwandelt. Mahkhoms Männer verschonten zwar niemanden, brachten den Tod aber rasch – ohne zu foltern oder zu verstümmeln, wie es auf beiden Seiten mittlerweile zur Norm geworden war. Bitterer Hass zerriss die Republik.
Am Ende des kurzen Gefechts waren drei der Angreifer verwundet, nur einer von ihnen schwer. Mit rascher, gefühlloser Effizienz nahmen sie den Toten alles ab, was von Wert sein mochte. Die verwundete Eisechse wurde mit einem raschen Kehlenschnitt von ihren Schmerzen erlöst. Dann stemmte sich ein halbes Dutzend der Angreifer selbst in das Geschirr des schweren Schlittens. Andere schulterten die Rucksäcke der Gefallenen, deren nackte, blutüberströmte Leichen nun überall im Schnee verstreut lagen.
Dann war der Spuk vorbei, die Angreifer wieder verschwunden. Sie mühten sich den Bergpfad hinab, bis sie den Punkt erreicht hatten, um zu ihrem eigenen schwer bewachten Schlupfwinkel in den Bergen abzubiegen.
Die Leichen, die sie in der bitteren Kälte zurückgelassen hatten, gefroren bereits.
Während Merlin das Geschehen beobachtete, ekelte er sich vor sich selbst: Er war nachgerade entsetzt darüber, dass es ihm kaum noch etwas ausmachte, Leichen zu sehen. Aber als er an die Frauen und Kinder dachte, die nun niemals wieder ihre Väter, Söhne oder Brüder sehen würden, verspürte er zorniges, hilfloses Bedauern. Er wusste, dass sie alle früher oder später verhungerten oder in der eisigen Kälte der winterlichen Berge erfrören. Deshalb verspürte Merlin lodernden Zorn auf den Mann, der in Wahrheit für das verantwortlich war, was hier geschah – und nicht nur hier in diesem einen Tal, sondern überall in der ganzen Republik. Angefangen hatte es damit, dass Zhaspahr Clyntahn mit seiner Operation ›Schwert Schuelers‹ der Siddarmark praktisch direkt an die Gurgel gegangen war. In deren Verlauf hatte Merlin sein Gefühl dafür verloren, Leichen im Schnee zu bedauern – sofern es Leichen von Tempelgetreuen waren. Tempelgetreue fuhren nur die bittere Ernte ihrer eigenen Saat ein, wenn sie getötet im Schnee erstarrten.
Zügellosen Zorn verspürte Merlin auf die religiösen Fanatiker, die zugelassen hatten, dass Clyntahn sie zu seiner Waffe machte. Diese Fanatiker hatten Vorratslager abgefackelt und Dörfer in Brand gesteckt. Sie hatten Familien abgeschlachtet, bloß weil man vermutete, sie könnten reformistisches Gedankengut hegen. Doch dieser Zorn verdeckte nur einen anderen in Merlin: Zorn auf sich selbst. Ja, vielleicht bedauerten Cayleb und Sharleyan zutiefst, zu welchen Mitteln sie greifen mussten, um sich der Tyrannei der ›Vierer-Gruppe‹ entgegenzustellen. Aber nicht sie hatten diesen weltweiten Glaubenskrieg herbeigeführt. Nein, das hatte ein gewisser Merlin Athrawes getan – der nicht einmal ein Mensch war. Er war nur der CyberAvatar der Erinnerungen einer jungen Frau, die schon vor beinahe eintausend Jahren den Tod gefunden hatte. Für all diese Umwälzungen war jemand verantwortlich, in dessen Adern kein einziger Tropfen Blut floss und dem Hunger und Kälte nichts anzuhaben vermochten. Jemand, für den nichts von dem galt, was für diejenigen in den Bergen der Siddarmark galt, die in diesem entsetzlichen Winter bereits ihr Leben verloren hatten.
Und das Schlimmste von allem: Merlin hatte das Gesicht des Glaubenskriegs gekannt, dessen hässliche, entsetzliche Fratze. Dennoch hatte er hier und jetzt auf Safehold einen solchen Krieg angezettelt. Während Merlin die Leichen der Tempelgetreuen betrachtete, gestand er es sich ein: Er hatte gewusst, wohin ein Glaubenskrieg führte, führen musste: zu hasserfüllten, intoleranten Menschen, die im Namen Gottes Ausreden fänden, die brutalsten, barbarischsten Rohheiten zu begehen. Diese Menschen würden sich gegenseitig noch dafür auf die Schultern klopfen, wie heilig, gottesfürchtig und gerecht sie doch handelten! Merlin hatte gewusst, dass Männer wie Wahlys Mahkhom eines Tages von der Jagd in den Bergen zurückkehren und feststellen würden, dass Clyntahns Anhänger sein Dorf niedergebrannt und seine Familie ermordet hatten. Solche Männer würden in ihrem Hass auf den Feind ebenso brutal und ebenso gnadenlos werden, und ihre Rache würden sie ›Gerechtigkeit‹ nennen. Das vielleicht Entsetzlichste an all dem war, dass man Mahkhom diese Reaktion nicht einmal verübeln konnte. Was konnte man denn anderes von einem Mann erwarten, der feststellen musste, dass die Feinde seine Mutter regelrecht in Stücke gehackt hatten? Was sollte man anderes von einem Mann erwarten, der seine drei Kinder begraben musste – und das älteste davon war noch keine sechs Jahre alt gewesen? Was sollte man von einem Mann erwarten, der den geschändeten, verstümmelten Leichnam seiner Frau in den Armen gehalten hatte? Dessen Herz in Stücke zersprungen war, in dessen Seele eine Wunde schwärte, die niemals mehr verheilen würde? Es grenzte an ein Wunder, dass so ein Mann und seine Gefolgsleute dem Feind einfach nur den Tod gebracht hatten. Nur allzu viele andere Reformisten hätten es dabei nicht bewenden lassen. Sie hätten dem Feind genau das angetan, was dieser Feind ihnen und ihren Familien angetan hatte. Und wenn es dabei hin und wieder einen Unschuldigen erwischte, der inmitten all dieses Chaos, all der Grausamkeit und all der Verzweiflung einfach nur zu überleben versuchte, dann war das eben so.
Das ist ein Teufelskreis, dachte Merlin und riss den Blick von den nackten Leichen los. Grauenhafte Taten führen zu grauenhafter Vergeltung, und wer nicht an denjenigen Rache nehmen kann, die die eigene Familie abgeschlachtet haben, der rächt sich eben an jedem, der ihm in die Finger fällt. Schon ist weiterer Hass geboren, noch mehr Rachsucht, und so steigert sich das weiter und weiter.
Merlin Athrawes war ein PICA, ein Wesen aus Legierungen und MolyCircs, aus faseroptischen Verbindungen und elektronischen Schaltungen, nicht aus Fleisch und Blut. Er war nicht mehr der Biochemie menschlicher Lebewesen unterworfen, war kein Sklave seines Adrenalins. Er kannte keine der anderen physiologischen Manifestationen von Zorn, keine Kampf-oder-Flucht-Reaktion mehr, wie sie die Evolution dem Menschen einprogrammiert hatte. Dennoch beherrschte Merlin jetzt Hass und Frustration, weil er nicht in der Lage war, in den Tempel der weit entfernten Stadt Zion vorzudringen.
Wenn ich doch nur sehen könnte, was dort vor sich geht!, dachte er verzweifelt. Wenn ich doch nur wüsste, was sie da tun, was sie denken … was sie planen! Niemand von uns hat das rechtzeitig vorhergesehen, um Stohnar warnen zu können. Zumindest haben wir alle nichts bemerkt, was ihm nicht auch selbst schon aufgefallen sein muss. Aber wir hätten es kommen sehen müssen! Wir hätten wissen müssen, wie Clyntahn denkt. Wir haben ja weiß Gott genug Belege dafür gesehen, wie weit zu gehen er bereit ist!
Merlin und seine Verbündeten vermochten so viele Dinge zu beobachten. Sie hatten sogar mehr Informationen, als sie je nutzen könnten. Sie durften ja nicht riskieren, dass sich jemand fragte, woher ihr Wissen stammte. Daher war es in vielerlei Hinsicht besonders frustrierend, ausgerechnet Zion selbst, das Herzstück der Kirche, nicht im Auge behalten zu können. Das zu überwachen wäre auf der Welt Safehold eigentlich am dringendsten.
Nur ging es Merlin Athrawes nicht um Visionen von Zion. Es ging ihm darum, Zhaspahr Clyntahn und seine Spießgesellen sozusagen greifbar zu haben, und sei es nur für einen einzigen kurzen Moment. Genau das wünschte sich Merlin mit solcher Kraft, dass es schon an Besessenheit grenzte. In letzter Zeit dachte er häufig an Commodore Pei, vor allem seit der grausame Winter im Westen der Siddarmark schlimmer und schlimmer wurde. Als Safeholds Geschichte begann, hatte der Commodore Eric Langhornes Hauptquartier betreten, in der Brusttasche einen kleinen Nuklearsprengsatz. Merlin Athrawes hätte mühelos eine Multimegatonnen-Bombe in Zion zünden und damit nicht nur die gesamte ›Vierer-Gruppe‹, sondern auch den ganzen Tempel in einer einzigen alles vernichtenden Explosionen auslöschen können. Der Blutzoll wäre entsetzlich, ja. Aber könnte das wirklich schlimmer sein als das, was die Siddarmark durchlitt, wo die Zahl der Opfer von Tag zu Tag weiter stieg? Niemand vermochte einzuschätzen, wie viele Tote es mittlerweile schon zu beklagen gab. Wäre bei einem Anschlag auf den Tempel der Blutzoll höher als der, den dieser Krieg bereits im Königreich Charis und bei seinen Verbündeten gefordert hatte? Höher als die Zahl der Toten, die dieser Krieg in den kommenden Monaten und Jahren noch fordern würde?
Wäre ein Opfertod nicht der Weg für Merlin, sich von seiner Schuld reinzuwaschen? Sollte er nicht besser abtreten wie der mächtige Samson aus der Bibel, der im Augenblick seines eigenen Todes all seine Feinde vernichtete?
Ach, Schluss jetzt!, herrschte Merlin sich innerlich an. Es war doch nur eine Frage der Zeit, bis dieser Wahnsinnige Clyntahn Charis die Inquisition auf den Hals gehetzt hätte, selbst wenn ich nicht aufgekreuzt wäre. Einmal Blut geleckt hätte er auch nicht so bald wieder aufgehört, dort zu wüten. Nein, natürlich nicht! Vielleicht bin ich mitverantwortlich dafür, wann und wo das Blutvergießen begonnen hat. Aber ich trage keinerlei Schuld am wahren Grund für alle diese Gräueltaten. Ohne mein Eingreifen hätte Clyntahn mittlerweile längst gewonnen.
Das stimmte zweifellos. Es gab Zeiten, zu denen sich Merlin dessen auch bewusst war. Zeiten, in denen er nicht in einem abgedunkelten Raum saß und sich Blutbäder anschaute; Zeiten, in denen er nicht den Hass schmeckte, der hinter all diesen Gräueltaten stand. Merlin wusste, dass die Kirche fallen musste, wenn die Menschheit das unausweichliche zweite Zusammentreffen mit den völkermordenden Gbaba überstehen sollte. Doch die Wahrheit … in solchen Augenblicken war die Wahrheit kalt und bitter, durch Schuldgefühle vergiftet wie durch Arsenik.
Das reicht jetzt!, sagte eine Stimme in Merlins elektronischem Hinterkopf – eine Stimme, die bemerkenswert nach Sharleyan Ahrmahk klang. Ihr habt Euch angesehen, was Owl Euch zeigen sollte. Aber jetzt sitzt nicht einfach hier und kasteit Euch für Dinge, die Ihr ohnehin nicht ändern könnt. Außerdem wird Cayleb schon bald auf Owl zugreifen und dann herausfinden, dass Ihr länger aufgeblieben seid, als Ihr versprochen habt – schon wieder!
Erheiterung durchstach selbst Merlins heißen Zorn. Seine Mundwinkel zuckten, als er sich vorstellte, wie Cayleb Ahrmahk darauf regieren würde, dass Merlin sich schon wieder nicht an die Regeln gehalten hatte. Natürlich bildeten sich Cayleb oder Sharleyan keinen Moment lang ein, Merlin Athrawes ließe sich durch eines Kaisers Zorn beeindrucken. Aber Cayleb hatte diese Regel ja nicht deswegen aufgestellt. Er würde aus ganz anderem Grund einen ausgewachsenen Wutanfall bekommen. Cayleb würde Merlin auf jede nur erdenkliche Weise beleidigen, weil er wusste, dass Merlin genau das brauchte. Er wusste, wie sehr dieser PICA-›Seijin‹, dieser legendäre, mythische Krieger, es nötig hatte, behandelt zu werden wie ein echter Mensch.
Aber vielleicht – wer konnte das schon sagen? – war Merlin ja doch ein echter Mensch … auf einer anderen Ebene, die über fleischliche Hüllen, Herzschlag und Blut hinausging. Vielleicht jedoch war es bedeutungslos, wie viel Schuld Merlin auf seine Seele lud. Denn vielleicht lag Maikel Staynair falsch. Vielleicht war Nimue Alban in Wahrheit ebenso tot wie die ganze Terra-Föderation. Vielleicht war Merlin Athrawes in Wahrheit nichts anderes als ein seelenloses elektronisches Echo. Vielleicht besaß er gar keine Seele, die er hätte verlieren können.
In manchen Augenblicken hoffte Merlin inständigst, dem wäre nicht so. Zu anderen Zeiten – wenn er an Blut und an Schmerzen dachte, an ausgemergelte, verhungernde Kinder, die zitternd im Schnee der Berge kauerten – hoffte er ebenso inständig das Gegenteil.
Meine Güte, wie theatralisch!, dachte er und verdrehte die Augen. Cayleb hat recht damit, mir diese Auszeiten aufzunötigen, mehr als mir bewusst war! Vielleicht sollte ich morgen früh kurz im kaiserlichen Kinderzimmer vorbeischauen und meine Patentochter in den Arm nehmen. Vielleicht fällt mir dann wieder ein, worum es hierbei eigentlich geht!
Merlins Lächeln war jetzt auch eines, das den Namen verdiente. Die Gedanken an Schuld und Blutvergießen traten hinter die Erinnerung an das lachende kleine Mädchen zurück, das fröhlich auf Merlins Armen zappelte. Die Kleine war wie ein Versprechen Gottes, zu gegebener Zeit werde die Zukunft tatsächlich den entsetzlichen Preis wert sein, den alle dafür zahlen mussten.
Stimmt, dachte Merlin und bereitete schon die Befehlssequenz vor, die ihn in den Standby-Modus versetzen würde. Und beim Anblick dieses kleinen Mädchens, das ich so sehr liebe, fällt mir auch nicht schwer, mir das zu sagen.
.III.
Der Tempel,Stadt Zion,die Tempel-Lande
»Ich hoffe, Sie sind immer noch der Ansicht, das Ganze sei es wert gewesen, Zhaspahr«, meinte Vikar Rhobair Duchairn grimmig. Über den Konferenztisch hinweg traf sein vorwurfsvoller Blick den Großinquisitor.
Zhaspahr Clyntahn erwiderte den Blick. Nichts in dem von Hängebacken beherrschten Gesicht verriet, was in ihm vorging. Nichts, nicht einmal seine Wut war zu spüren, die zu zügeln ihm schwerfiel. Mannhaft unterdrückte er den Impuls, sein Gegenüber anzuknurren. Anders als der Schatzmeister hatte Clyntahn die Berichte aus der Siddarmark nicht nur gelesen, sondern wusste darüber hinaus, dass darin das Ausmaß an Tod und Zerstörung drastisch heruntergespielt wurde.
»Mir ist nicht begreiflich, wieso Sie alle mir dafür die Schuld in die Schuhe schieben«, sagte Clyntahn schließlich tonlos. »Schließlich habe nicht ich Zeitpunkt und Ort gewählt. Dafür dürfen Sie dem Dreckskerl Stohnar danken!«
Duchairn öffnete schon den Mund. Im letzten Moment schluckte er mit viel Selbstbeherrschung hinunter, was ihm bereits auf der Zunge gelegen hatte. Aber Verachtung und Zorn, die unverkennbar in seinem Blick lagen, vermochte er nicht zu verschleiern.
»Verzeihen Sie, wenn ich ein wenig begriffsstutzig bin«, sagte er schließlich. »Aber die Berichte, den von Erzbischof Wyllym eingeschlossen, lesen sich, als wäre es die Inquisition, die den … Widerstand ins Land und zum Reichsverweser trägt. Und«, nun wanderte Duchairns Blick zu Allayn Maigwair hinüber, dem Captain General des Tempels, »zufällig scheinen dem Widerstand Ratgeber der Tempelgarde zugewachsen zu sein, die nicht unbeteiligt an dem ›spontanen‹ Aufstand gewesen sind. Unter diesen Umständen werden Sie doch gewiss verstehen, dass ich mich des Eindrucks nicht erwehren kann, Sie wären mehr in diese Angelegenheit verwickelt als jeder andere in diesem Raum.«
»Natürlich.« Verächtlich schürzte Clyntahn die Lippen. »Ich bin der Großinquisitor von Mutter Kirche, Rhobair! Als solcher bin ich den Erzengeln und dem Allmächtigen gegenüber verantwortlich für die Sicherheit der Kirche. Ich wollte diese Situation in der Siddarmark wahrlich nicht herbeiführen. Zhasyn und Sie haben deutlich genug Ihre … Argumente dafür vorgebracht, die Wirtschaft der verräterischen Mistkerle unbeschadet zu lassen. Aber das hat mich nicht von der Verantwortung entbunden – meiner eigenen und der meiner Inquisitoren –, Stohnar und seine Busenfreunde im Auge zu behalten. Die Frage war: Geht es um die ein oder andere Mark, die in unsere Schatzkammer fließt, oder darum, dass die gesamte Republik Shan-wei und den charisianischen Ketzern in die Hände fällt? Hätte ich da die Wahl gehabt, mich anders zu entscheiden? Nein, ich war gezwungen, diese und keine andere Entscheidung zu treffen!«
»Gezwungen?« Zahmsyn Trynair, der Kanzler der Kirche, war offenkundig alles andere als begeistert davon, Duchairns Partei ergreifen zu müssen. Dennoch blickte er Clyntahn mit hochgezogenen Augenbrauen an. »Verzeihen Sie, Zhaspahr, auch wenn das nicht Ihre Absicht gewesen sein sollte: Dass Ihr Schwert Schuelers ausartet und gewalttätige Konfrontationen herbeiführt, daran bestand doch wohl nur wenig Zweifel!«
»Das habe ich Ihnen wieder und wieder erklärt«, versetzte Clyntahn mit gefährlicher, zur Schau gestellter Geduld. »Ich habe dafür sorgen müssen, für den Fall der Fälle eine Waffe zur Hand zu haben. Sollte ich etwa warten, die Klinge zu schärfen, bis Stohnar zugeschlagen hat? Schließlich waren gewisse Vorbereitungen erforderlich. Die wahren Söhne von Mutter Kirche mussten organisiert und einsatzbereit sein, wenn sie am dringendsten gebraucht werden. Gewiss, es ist durchaus möglich, dass einige meiner Inquisitoren übers Ziel hinausgeschossen sind. Ich will auch gar nicht so tun, als wäre ich nicht ebenfalls bestürzt darüber, mit welchem … Enthusiasmus die Kinder von Mutter Kirche zu ihrer Verteidigung geeilt sind. Aber in Wahrheit ist es gut, dass Wyllym und ich diese Vorbereitungen schon im Vorfeld getroffen hatten. Genau das beweisen doch die Berichte, die Ihnen hier vorliegen.«
Mit seinem dicken Zeigefinger deutete er auf die Aktenordner, die auf dem Konferenztisch lagen. Duchairn hatte sich durchringen können, die Unterlagen vollständig durchzuarbeiten … Seither fragte er sich, wie es wohl Mutter Kirche erginge, wenn des Schatzmeisters Berichte über die Finanzlage genauso wenig Ähnlichkeit mit den Tatsachen hätten. Natürlich enthielten die Siddarmark-Berichte auch Fakten, an deren Wahrheitsgehalt Duchairn nicht im Mindesten zweifelte. Doch die beste Möglichkeit, eine Lüge zu verkaufen, war, sie mit sorgfältig ausgewählten Wahrheiten zu maskieren. Darin war Wyllym Rayno, der Erzbischof von Chiang-wu, ein wahrer Meister.
Na, hoffentlich sagt er wenigstens Zhaspahr gegenüber die Wahrheit!, dachte Duchairn verbittert. Oder, ach, würde unser werter Kollege die Wahrheit überhaupt erkennen, wenn heutzutage jemand den Mut aufbrächte, sie ihm zu sagen?
»Sie sind doch selbst mit den Zahlen vertraut, Zhasyn«, fuhr Clyntahn in scharfem Ton fort. »Die Dreckskerle in Siddar-Stadt haben dreimal mehr Gewehre gekauft als uns gemeldet. Na, und jetzt raten Sie mal, gegen wen Stohnar die wohl einsetzen könnte! Genau: gegen die, die der hochverehrte Reichsverweser rundweg angelogen hat, was seine Waffenbestände betrifft! Also gegen uns, gegen Mutter Kirche, gegen wen denn sonst? Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber mir will absolut kein anderer Grund für diese Lüge einfallen.«
Finster starrte der Großinquisitor seinen Kollegen an. Trynairs Blick zuckte daraufhin nervös zum Schatzmeister hinüber. Duchairn konnte beinahe sehen, wie sich das bisschen Rückgrat schlagartig verflüssigte, das Trynair noch besaß. Aber viel dagegen unternehmen konnte er nicht. Denn Rayno dürfte sicher die Zahl von Stohnars Waffen hoffnungslos übertrieben haben. Aber ebenso sicher hatte er nicht erfunden, dass der Reichsverweser geheime Waffenlager unterhielt.
Bei den Aussichten würde ich weiß Gott auch Waffen in Hülle und Fülle zusammentragen: Zhaspahr Clyntahn, der nicht vielleicht, sondern mit Sicherheit irgendwann meine ganze Republik in Schutt und Asche legt.
»Und, bitte, werfen Sie doch nur einen Blick darauf: Überall in der Republik hegen und pflegen Stohnar, Maidyn und Parkair die reformistischen Ketzer – von ganzen Stadtvierteln voller Charisianer ganz zu schweigen! In Anbetracht dessen war es doch offensichtlich, was die im Schilde führten. Mit ausreichend Waffen im Rücken, um die eigene Sicherheit zu garantieren, hätten die drei Charis offen aufgefordert, mit ihnen eine Allianz einzugehen. Stellen Sie sich doch nur die Belohnung vor, die sie von Cayleb und Sharleyan dafür hätten einfordern können. Sie hätten ihnen immerhin eine Festlandsbasis für ihre Ketzerei verschafft. Nebenbei hätten die drei auch gleich die gesamte Armee der Siddarmark an Charis verkauft. Bei Langhorne, Zahmsyn, schon im Sommer würden charisianische Armeen durch die Randstaaten geradewegs in die Tempel-Lande einmarschieren! Das wissen Sie doch selbst.«
Der Zorn des Großinquisitors richtete sich gegen Trynair. Doch niemand im Raum bezweifelte, dass Clyntahns Angriff Duchairn galt. Der Kanzler sackte sichtlich in sich zusammen. Alle Kollegen wussten es: Die Vorstellung von siddarmarkianischen Armeen, die geradewegs die Randstaaten durchquerten, verfolgte Trynair schon seit Jahren – wie unwahrscheinlich Derartiges bislang auch gewesen sein mochte. Jetzt dürfte es der Vorstellungswelt des Kanzlers nach noch schlimmer kommen, als eh von ihm befürchtet: Diese Armeen könnten nun auch noch mit charisianischen Waffen ausgestattet sein, und ihre Treue gälte Monarchen, deren erklärtes Ziel die Vernichtung der ›Vierer-Gruppe‹ war. Albtraumhafter war für Trynair gewiss nur, sich der Inquisition stellen zu müssen – so wie es Clyntahns anderen Feinden ergangen war.
»Pater Zohannes und Pater Saimyn haben Berichte zuverlässiger Quellen vorgelegt. Danach hat die Armee ursprünglich unmittelbar nach dem ersten Schnee ein Manöver abhalten sollen, bei dem die Grenzen zu den Randstaaten abgeriegelt würden«, fuhr Clyntahn fort. »Ein Manöver!« Er verzog die Lippen zu einem höhnischen Grinsen. »Und dabei wären sämtliche Gewehre, die Stohnar uns verschwiegen hat, zur Grenze geschafft worden – dorthin, von wo der Weg von Siddar-Stadt nach Zion am kürzesten ist! Es ist doch ganz offensichtlich, dass es für das ›Schwert Schuelers‹ höchste Zeit war – ob uns das nun recht ist oder nicht!«
Duchairn biss so fest die Zähne zusammen, dass ihm die Kiefer schmerzten. Aber das war besser, als sich die Zunge zu verbrennen. Selbstverständlich hatten Zohannes Pahtkovair und Saimyn Airnhart verkündet, Stohnar habe die Absicht, die Grenzen abzuriegeln. Gehorsam, wie die beiden waren, würden sie ihm immer genau das berichten, was ihr Herr und Meister gerade hören wollte.
»Niemand bedauert mehr als ich, dass so viele Kinder Gottes ihr Leben verloren haben«, fuhr Clyntahn scheinheilig fort. »Aber das ist nicht die Schuld von Mutter Kirche. Das ist die Schuld ihrer Feinde. Uns blieb gar keine andere Wahl. Wir mussten handeln! Hätten wir nur einen oder zwei Fünftage lang abgewartet, hätte es weiß Langhorne noch viel schlimmer kommen können. Wenn Sie jetzt von mir erwarten, Tränen zu vergießen, bloß weil ein paar Ketzer, Gotteslästerer und Verräter genau bekommen haben, was ihnen zustand, dann können Sie lange warten, Zhasyn!« Mit einer fleischigen Hand schlug Clyntahn auf die Tischplatte. »Das alles haben die sich ganz allein zuzuschreiben. Und so schlimm es für sie in dieser Welt auch gewesen sein mag: Es ist nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was sie in ihrem nächsten Leben erwartet!«
Zornig blickte er sich im Ratszimmer um. Clyntahns Nasenflügel bebten, seine Augen funkelten. Erneut bewunderte Duchairn den Großinquisitor dafür, jederzeit genau das für die absolute, uneingeschränkte Wahrheit zu halten, was ihm besonders ins Kalkül passte. Aber ihm musste doch bewusst sein, dass er hier und jetzt nach allen Regeln der Kunst log … oder etwa nicht? Wie konnte jemand die Wahrheit derart gründlich manipulieren und pervertieren, ohne zu wissen – irgendwo tief in seinem Herzen –, wie die Wahrheit tatsächlich aussah? Oder verließ sich Clyntahn einfach nur darauf, dass ihm seine Untergebenen immer genau jene ›Wahrheit‹ berichteten, die er jeweils gerade benötigte?
Wieder einmal wurde dem Schatzmeister übel – eine jetzt schon vertraute Reaktion –, als er an die anderen Berichte dachte. Diese hatte Clyntahn bislang noch nicht ›anpassen‹ können. Darin ging es um die Gräueltaten, Vergewaltigungen und Morde – nicht nur in den Stadtvierteln ausgewanderter Charisianer, sondern überall in der ganzen Republik. Die Kirchen, die man in Brand gesteckt hatte, während sich ihre Priester noch darin aufhielten – hin und wieder sogar ganze Gemeinden! Und warum? Weil man ihnen vorwarf, reformistisches Gedankengut zu hegen. Duchairn dachte an die Lagerhäuser, die man abgefackelt hatte, an die Vorräte, die gezielt vergiftet worden waren – mitten in einem bitterkalten Winter! Er dachte daran, dass Kanalschleusen manipuliert worden waren – obwohl das Buch Langhorne das ausdrücklich untersagte! –, bloß um zu verhindern, dass die Ernte aus dem Westen der Republik die Städte im Osten erreichte. Natürlich konnte Clyntahn das alles als ›bedauerliche Unmäßigkeit‹ darstellen. Er konnte behaupten, es geschehe unbeabsichtigt, sei aber angesichts des gänzlich berechtigten und verständlichen Zorns aller treuen Söhne von Mutter Kirche unvermeidbar. Aber dergleichen war entschieden zu häufig vorgekommen, in allen Teilen der Republik. Es war auch immer viel zu effizient geschehen. All diese ›Unmäßigkeiten‹ mussten von genau den gleichen Leuten angeleitet worden sein, die zu diesen Ausschreitungen überhaupt erst aufgerufen hatten.
Und was meint Zhaspahr, wie es jetzt weitergeht?, fragte sich der Schatzmeister zähneknirschend. Siddarmarkianische Truppen an den Grenzen der Randstaaten? Ein charisianischer Stützpunkt auf dem Festland? Waffen und Gold aus Charis, die Stohnar geradewegs in die Hände fallen, nachdem er nun zum Todfeind von Mutter Kirche geworden ist? Zhaspahr hat doch erst dafür gesorgt, dass ganz genau das alles jetzt geschieht! Es sei denn, wir könnten die Republik vollständig zerschmettern, bevor Charis ihr zu Hilfe eilen kann. Zhaspahr sah sich also gezwungen, so zu handeln – geschenkt! Aber wenn er wirklich derartige Barbarei entfesseln und so viel Blut vergießen musste –, hätte er das dann nicht wenigstens effizient gestalten können?
Dann waren da die katastrophalen finanziellen Auswirkungen auch für Mutter Kirche selbst. Die blieben natürlich nicht aus, nachdem nun eines der letzten drei Festlandreiche, die überhaupt noch ihren Zehnten entrichten konnten, zerstört worden war. Glaubte Clyntahn vielleicht, die Schatzkammer könnte all das dringend benötigte Geld einfach herbeizaubern? Jetzt, wo die Inquisition systematisch jede Einnahmequellen zerschmettert hatte?
Aber das kann ich ihn ja wohl schlecht fragen, oder? Nicht, nachdem Zahmsyn in sich zusammenfällt wie ein angestochener Luftballon! Und Allayn nickt immer nur zustimmend. Wahrscheinlich ist diese Zustimmung sogar ernst gemeint! Und selbst wenn ich das Problem tatsächlich ausspräche, würde das doch überhaupt keinen Unterschied machen … der Schaden ist ja bereits angerichtet! Ich kann einfach nur darauf hoffen, dass wir Mittel und Wege finden, wenigstens die schlimmsten Konsequenzen zu vermeiden. Und vielleicht, nur vielleicht, läuft es ja doch so, wie Clyntahn sich das vorgestellt hat, und dann …
Duchairn verbiss sich diesen Gedanken, wagte kaum, ihn sich selbst gegenüber einzugestehen. Dann aber zwang er sich, der gallenbitteren Wahrheit ins Auge zu blicken: Wie sich diese katastrophalen Entwicklungen auch langfristig auswirkten, kurzfristig untermauerten sie Clyntahns Macht. Das zeigten die Berichte allzu deutlich, die aus Desnairia, den Randstaaten, den Tempel-Landen und vor allem aus dem Kaiserreich Harchong eintrafen. Die Vorstellung, die Siddarmark könne völlig zusammenbrechen, war für jeden Herrscher auf dem Festland schon erschreckend genug. Aber die Möglichkeit, die Siddarmark könne zum Einfallstor einer charisianischen Invasion werden, war noch viel, viel schlimmer. Mittlerweile scherten sich besagte Herrscher nicht mehr darum, ob Stohnar sie tatsächlich hatte verraten wollen, so wie Clyntahn das steif und fest behauptete. Jetzt interessierte sie nur noch, dass Stohnar überhaupt keine andere Wahl mehr hatte, als sie zu verraten, wenn sein eigenes Volk überleben wollte. Jeder einzelne Festlandsherrscher witterte zudem eine Gelegenheit, sich den einen oder anderen schmackhaften Brocken aus dem geschundenen Kadaver der Republik selbst einzuverleiben. Die ganze Hysterie in der Siddarmark, die Clyntahns Gräueltaten ausgelöst hatten, würde das Schisma nur noch tiefer in das Herz von Mutter Kirche treiben – genau wie Clyntahn das wollte. Er wollte, dass sich die Lage immer weiter zuspitzte; er wollte Furcht und Hass schüren. Denn genau das würde ihm die Macht verleihen, seine Feinde ein für allemal zu vernichten … und dabei Mutter Kirche nach seinem eigenen Gutdünken umzuformen. Er wollte aus der Kirche genau das machen, was er für richtig hielt.
»Ich muss Zhaspahr recht geben«, ergriff nun Maigwair zum ersten Mal das Wort. Duchairn warf ihm einen eisigen, verächtlichen Blick zu. Dem Captain-General schoss das Blut ins Gesicht. »Es steht mir nicht zu, die Berichte der Inquisition anzuzweifeln«, fuhr er fort, als wolle er sich verteidigen. »Dennoch möchte ich selbst noch einmal Folgendes betonen: Unsere Gardisten in der Republik bestätigen, dass sich in Siddar-Stadt deutlich mehr Musketen befinden – höchstwahrscheinlich sogar solche mit gezogenem Lauf –, als dort eigentlich sein dürften. Ganz offensichtlich hat jemand tatsächlich dort Waffen gehortet. Es ist gewiss ein Glücksfall«, kurz zuckte Maigwairs Blick zum Großinquisitor hinüber, »dass wir genug Zeit hatten, weitere Rekruten für die Garde anzuwerben. Mittlerweile hat sie Sollstärke erreicht. Und wenn der Schnee erst einmal geschmolzen ist, werden wir sie ebenfalls mit neuen Musketen ausstatten können. Wenigstens die Hälfte der neuen Waffen wird ebenfalls einen gezogenen Lauf aufweisen. Soweit ich weiß«, dieses Mal schaute er Clyntahn geradewegs an, »haben Ihre Agenten zumindest einige der Informationen erlangen können, die wir so dringend benötigen.«
»Ja, die Inquisition hat Informationen über die Bewaffnung der Ketzer erhalten«, bestätigte Clyntahn. »Derzeit befassen wir uns noch mit der Frage, welche Teile dieses Wissens wir uns gefahrlos zu eigen machen können, ohne gegen die Ächtungen zu verstoßen. Die Gotteslästerer haben die neuen Waffen nur unter dämonischem Einfluss ersinnen können, daran besteht keinerlei Zweifel. Aber ich denke, wir haben eine Möglichkeit gefunden, zahlreiche dieser Waffen nachzubauen, ohne uns selbst mit dämonischen Mächten einzulassen.«
Wütend musste sich Duchairn eingestehen, dass Clyntahn dabei angemessen würdevoll dreinblickte. Er stellte sich ganz als besorgter Großinquisitor dar, der sich ernstlich mühte, Mittel und Wege zu finden, Mutter Kirche vor jedweder Besudelung zu bewahren. Dabei dachte er in Wahrheit bereits darüber nach, wie er alles rechtfertigen könnte, was unbedingt einer Rechtfertigung bedurfte.
»Wir haben herausgefunden, wie die Ketzer ihre Kanonenkugeln zur Explosion bringen«, fuhr er fort. »Ich habe bereits zwei vertrauenswürdige Eisenhüttenmeister damit beauftragt. Es reicht auf jeden Fall nicht aus, die Kugeln einfach nur hohl zu gießen. Selbst das ist nicht einfach, ohne dabei auf Methoden zurückzugreifen, die uns durch die Ächtungen verwehrt sind. Auch die Zündung dieser sogenannten Granaten ist knifflig. Glücklicherweise ist es einem der treuesten Söhne von Mutter Kirche gelungen, an diese Information zu gelangen. Ich sollte vielleicht hinzufügen, dass er dafür sein Leben gegeben hat. Wie dem auch sei, innerhalb der nächsten ein bis zwei Monate sollten wir in der Lage sein, geeignete Zündschnüre zu fertigen. Im Frühjahr haben Sie, werter Kollege, dann auch eine Feldartillerie mit Explosivgranaten.«
Gütig lächelte der Großinquisitor, als Maigwairs Augen vor Begeisterung aufleuchteten. Duchairn hingegen kniff voller Verzweiflung die Augen zusammen. Verständlicherweise hatte Maigwair kurz vor einem Nervenzusammenbruch gestanden, als sich herausstellte, dass die Charisianer über explodierende Kanonenkugeln verfügten. Dass Maigwair schon bald seine zahlenmäßig weit überlegenen Truppen damit ausstatten könnte, musste ihm wie eine Begnadigung kurz vor der Hinrichtung erscheinen. Den Tod von ein paar Hunderttausend, vielleicht gar ein paar Millionen unschuldiger Siddarmarkianer würde der Captain General billigend in Kauf nehmen. Schließlich erhielte er so Gelegenheit, das rüstungstechnische Ungleichgewicht zwischen Mutter Kirche und ihren Feinden auszugleichen.
Vor allem, wenn ihn die Möglichkeit eines militärischen Sieges vermutlich vor den Fängen der Inquisition bewahrt, dachte Duchairn erbost.
Er atmete tief durch und richtete sich in seinem Sessel auf. Sein Blick galt seinem Widersacher Clyntahn. In den Augen seines Gegenübers erkannte er ein kaltes, zufriedenes Glitzern.
»Ich kann Ihrer beider Einschätzung unserer Lage nicht widersprechen – wie auch immer diese entstanden sein mag«, sagte Duchairn und hielt sich wieder einmal zurück. »Ich finde es zutiefst bedauerlich, dass sich die Lage so rasch und unkontrollierbar verschlimmert hat. Aber noch mehr Sorgen bereiten mir die Berichte über Hungersnöte in den Reihen der treuen Kinder von Mutter Kirche. Ich halte es für unerlässlich, umgehend Nahrungsmittel in die Regionen zu schaffen, die sich in deren Hand befinden. Mir ist durchaus bewusst, dass uns nicht unbegrenzt Transportmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Wir werden also sorgfältig abwägen müssen, welche rein militärischen und welche humanitären Transporte vorrangig sind. Dafür bleibt uns Zeit bis zur Schneeschmelze. Aber Mutter Kirche muss deutlich zeigen, wie sehr sie sich um all jene sorgt, die ihr nach wie vor treu ergeben sind. Das wird man von uns als ihren Vikaren erwarten.«
Die beiden Männer durchbohrten einander mit Blicken. Duchairns Bemerkung würde nun unwiderruflich zwischen ihnen stehen. Er wusste ganz genau, was Clyntahn durch den Kopf ging: Dem Großinquisitor war klar, dass der Schatzmeister von diesem Punkt niemals abrücken würde. In Clyntahns Blick sah Duchairn die ihm vertraute Verachtung über die vermeintliche Schwäche des Schatzmeisters. Geringschätzung darüber, dass sich Duchairns Zustimmung so billig erkaufen ließ. Oder besser: sich die Vorspiegelung von Duchairns Zustimmung erkaufen ließ. Denn auf nichts anderes liefe es letztendlich hinaus. Es war das Beste, was sich der Schatzmeister hier in diesem Ratssaal, an diesem Konferenztisch, erhoffen konnte. Und auch das war Clyntahn wie ihm bewusst.
Mehrere Sekunden lang herrschte Schweigen. Schließlich nickte Clyntahn.
»Selbstverständlich erwarten sie das von uns, Rhobair.« Er lächelte dünn. »Und Sie sind genau der Richtige, das für uns zu organisieren.«
»Ich danke Ihnen, Zhaspahr«, erwiderte Duchairn, als Trynair und Maigwair Zustimmung murmelten. »Ich werde mich bemühen, sämtliche rein militärischen Transporte so weit wie möglich unbeeinträchtigt zu lassen.«
Er erwiderte Clyntahns Lächeln. Dabei krampfte es ihm das Herz zusammen – aber neben Hass noch aus einem anderen Grund. Duchairn lehnte sich in seinem Sessel zurück. Er lauschte, wie Clyntahn und Maigwair über Einzelheiten der in Aussicht gestellten neuen Waffen sprachen. Während der Schatzmeister an die Zukunft dachte, wirkte sein Blick, als bestünden seine Augen aus purem Eis. Eigentlich war es bemerkenswert: Zhaspahr Clyntahn kannte sich mit Intrigen aus, mit Verschwörungen, Arglist und Verrat. Er wusste, welche Macht sich mit der Verbreitung von Angst und Schrecken erringen ließ. Er kannte das süße Gefühl, seine Feinde zu zermalmen. Doch trotz all seiner so erworbenen Macht, trotz seines Ehrgeizes und seiner Skrupellosigkeit war er gänzlich außerstande zu begreifen, welch enorme Macht Sanftmut zu entfalten wusste.
Noch ist es nicht so weit, Zhaspahr, dachte Duchairn, noch nicht. Aber eines Tages wirst du das vielleicht auf die harte Tour herausfinden. Und wenn Gott gnädig ist, dann wird er mir vielleicht gestatten, noch lange genug zu leben, das mitansehen zu dürfen.
.IV.
Dom zu Gorath,Gorath,Königreich Dohlar
»Und darum preisen wir, mit allen Engeln und Erzengeln und mit all den himmlischen Heerscharen, deinen Namen. Wir loben Dich und sagen heilig, heilig, heilig, o Herr der Heerscharen, Schöpfer der Welt. Himmel und Erde sind voll Deiner Gnade. Ehre Sei Dir, o Herr, unserem Schöpfer. Amen.«
Lywys Gardynyr, Graf Thirsk, schlug das Zeichen von Langhornes Szepter. Dann erhob er sich von dem Kniestuhl und ließ sich auf die dick gepolsterte Bank sinken. Er musste sich sehr zusammennehmen, nicht das Gesicht zu verziehen, so sündhaft weich war dieser Sitz.
Gardynyr war auf dem Gut seiner Familie aufgewachsen, weit entfernt von der Hauptstadt des Königreichs Dohlar und deren Dom. Daher zog er die schlichten Holzbänke seiner Kindheit und Jugend dem juwelengeschmückten Luxus des Doms zu Gorath vor. Natürlich hatte er auch in jeder anderen Hinsicht ein deutlich schlichteres Leben geführt als die weitaus meisten wohlhabenden, einflussreichen Bürger von Gorath. Im Laufe der Jahre hatte Graf Thirsk feststellen müssen, dass seine Abneigung gegen jeglichen Prunk, sobald es die Religion betraf, immer weiter zunahm. Auch hier und jetzt verspürte er diese Abneigung. Trotzdem konnte er nicht umhin, die beeindruckende Architektur des Doms zu bewundern, die prächtigen Statuen und die herrlichen Glasmalereien. Zugegeben, es war ein wunderbarer Anblick: die funkelnden Liturgiegefäße, die goldgeäderten makellosen Steinplatten des Fußbodens. Dort, in den Stein, für den Dohlar so berühmt war, waren die Sigilla der Erzengel eingelassen. Wie es die Pflicht eines jeden Kindes von Mutter Kirche war, hatte auch Gardynyr vor langer Zeit den Tempel im weit entfernten Zion besucht. Darum wusste er, dass der beeindruckende Dom zu Gorath kaum mehr war als ein blasser Abglanz der wahren Heimstatt Gottes auf Seiner eigenen Welt. Doch so sehr der Dom auch vor dem Tempel verblassen mochte: die beiden Türme des Doms, jeweils mit einem Szepter geziert, ragten hoch hinauf in den Himmel, dem Ruhme Gottes und der Erzengel entgegen. Die Schönheit dieses Gotteshauses ließ Graf Thirsk fast vergessen, dass um Herz und Seele von Mutter Kirche ein blutiger Krieg entbrannt war.
Aber eben nur fast.
Gardynyr sah, wie Bischof-Vollstrecker Wylsynn Lainyr die Arme sinken ließ und sich vom Altar abwandte. Nun blickte sich der Bischof-Vollstrecker im nur spärlich besuchten Dom um. Er bestieg die Kanzel und trat hinter die mit Gold und Edelsteinen geschmückte Heilige Schrift. Doch statt den prächtig illuminierten Folianten aufzuschlagen, legte er nur die gefalteten Hände darauf.
Mit steinerner Miene blickte Thirsk den Bischof-Vollstrecker an. Er mochte Lainyr nicht. Auch Ahrain Mahrlow, Lainyrs Vorgänger, hatte Gardynyr nicht sonderlich leiden können. Aber dass Mahrlow einem Herzanfall erlegen war, hatte Graf Thirsk doch sehr bedauert, jedenfalls im Nachhinein. Denn mittlerweile war Gardynyr immer weniger einverstanden mit der von Lainyr vorgegebenen Politik. Vor allem die Art, wie der Bischof-Vollstrecker die charisianischen Gefangenen behandelt wissen wollte, die sich für die Kapitulation entschieden hatten, ging dem Admiral gegen den Strich. Er hatte Details darüber gehört, was jenen Gefangenen widerfahren war, nachdem man ihn gezwungen hatte, sie an die Inquisition auszuliefern. Bittere Selbstverachtung war die Folge gewesen. Natürlich war ihm keine andere Wahl geblieben. Es war seine Pflicht gewesen, und das gleich in dreifacher Hinsicht: Als Adeliger im Königreich Dohlar war es seine Pflicht, den Befehlen seines Königs Folge zu leisten. Als Befehlshaber der Königlichen Flotte von Dohlar musste er Befehle seiner rechtmäßigen Vorgesetzten befolgen. Als Sohn von Mutter Kirche schuldete er ihr in jeglicher Hinsicht Gehorsam. Darüber hinaus hatte Gardynyr seine Pflicht als Vater und Großvater zu erfüllen. Er durfte nichts unternehmen, was Ahbsahlahn Kharmych, den schueleritischen Intendanten der Erzdiözese Gorath, dazu bringen könnte zu handeln. Jederzeit könnte er die Familie eines gewissen Admirals der gleichen Inquisition überantworten, die schon sämtliche Kriegsgefangenen abgeschlachtet hatte.
Das alles wusste Gardynyr. Besser fühlte er sich damit nicht. Seinem Empfinden nach hatte er seine unsterbliche Seele beschmutzt, als er seine Gefangenen ausgeliefert hatte. Nichts hier im vor Gold und Edelsteinen glitzernden Dom vermochte daran etwas zu ändern.
Unauffällig blickte Gardynyr nach rechts. Dort saß Bischof Staiphan Maik, der Sonderintendant der Flotte, zwischen Herzog Fern, dem Ersten Ratgeber König Rahnylds IV., und Herzog Thorast, Thirsks unmittelbarem Vorgesetzten. Maiks Miene war ebenso ausdruckslos wie Thirsks. Wieder musste er an den Rat des Weihbischofs denken an dem Tag, an dem der endgültige Befehl eingetroffen war, die Gefangenen an die Inquisition auszuliefern. Einen solchen Rat hatte er von einem Schueleriten nicht erwartet. Aber es war ein wirklich guter Rat gewesen.
Sogar besser, als ich damals begriffen habe, dachte der Graf grimmig. Seitdem erst weiß ich, wie genau man meine Mädchen und ihre Familien im Auge behält. Natürlich nur zu deren Schutz vor all den irren charisianischen Attentätern! Schließlich war ich bislang der Einzige, der es geschafft hat, der Charisian Navy eine Niederlage beizubringen … so bescheiden sie auch ausgefallen sein mag. Soso!
Er biss die Zähne so fest zusammen, dass ihm die Kiefermuskeln schmerzten, und zwang sich dazu, sich wieder zu entspannen. Ärger, Zorn kochte in ihm hoch: Einerseits hatte er herausfinden müssen, dass Inquisition und Königliche Garde beschlossen hatten, seine Familie zu ›beschützen‹ – mit anderen Worten: sie zu nützlichen Geiseln zu machen, um sich seinen Gehorsam zu sichern. Andererseits wusste er selbst nicht, ob er weiterhin gehorsam geblieben wäre, würde seine Familie nicht als Geiseln gehalten.
Eigentlich sollte alles eindeutig sein: schwarz oder weiß, Gehorsam oder Ungehorsam, Ehre und Schande, Gottesfurcht oder Dienst an Shan-wei. Ich sollte genau wissen, was meine Pflicht ist, ohne Konsequenzen fürchten zu müssen, wenn ich das tue, was ich für das Richtige halte. In jedem anderen Krieg wäre das auch so. Da ist eine Seite, die ihre Gefangenen zu Tode foltert. Und dann ist da die andere Seite, die sie anständig und ehrenvoll behandelt, sie nicht misshandelt, nicht hungern lässt, ihnen nicht die Behandlung durch Heiler verweigert. Sollte sich da nicht leicht erkennen lassen, wo Ehre und Gerechtigkeit zu finden sind – ja, und auch Gott und die Erzengel? Aber hier geht es um Mutter Kirche, die Hüterin der Seelen aller Menschen. In unserer sterblichen Welt spricht sie mit der Autorität Langhornes selbst! Wie könnte ich wagen, mein eigenes sterbliches, fehlbares Urteilsvermögen über das von Mutter Kirche zu stellen? Wie kann irgendjemand das wagen?
Dieser Frage hatten sich in den letzten fünf Jahren nur allzu viele Menschen stellen müssen. Viele hatten sich entschlossen, Mutter Kirche entgegenzutreten. Das erfüllte Lywys Gardynyr mit Entsetzen und Ehrfurcht gleichermaßen. Beide Empfindungen verstärkten sich noch dadurch, dass er sich selbst bei dem Wunsch ertappte, ebenso mutig zu sein.
Nein, sagte er sich selbst rau, nicht Mutter Kirche will ich entgegentreten. Ich will diesem kranken, mordlüsternen Dreckskerl Clyntahn und dem Rest seiner ›Vierer-Gruppe‹ entgegenstreten! Doch wie viel von meinem Zorn, von meinem Hass ist in Wahrheit nichts anderes als die Schlinge Shan-weis? Ausgelegt für mich und so viele andere, um uns dazu zu verführen, ihr zu Diensten zu sein? Wie sehr hat Shan-wei unser Urteilsvermögen und unseren Gerechtigkeitssinn schon getrübt? Die Heilige Schrift nennt sie nicht umsonst die Verführerin der Unschuld und die Verderberin der Rechtschaffenheit. Und …
»Brüder im Herrn«, unterbrach die Stimme des Bischof-Vollstreckers die Gedanken des Grafen. Alle im Dom Versammelten richteten den Blick auf den Geistlichen, und mit grimmiger Miene schüttelte Wyllys Lainyr den Kopf. »Erzbischof Trumahn hat mir über die Semaphoren eine Nachricht aus Zion geschickt. Er weist mich an, euch furchtbare Kunde zu bringen. Aus diesem Grund habe ich euch alle gebeten, an diesem Nachmittag zu mir in den Dom zu kommen. Zum einen, weil dies der beste Ort ist, euch diese Kunde zu bringen, und zum anderen, damit wir uns im Gebet versammeln können. Wir sollten die Erzengel anflehen, zwei unschuldige Opfer von Shan-weis Boshaftigkeit und vor den Machenschaften sündiger Männer zu beschützen, die sich ihr ganz und gar verschrieben haben.«
Gardynyrs Kiefermuskeln verspannten sich erneut. Also hatte er recht, was den Grund für diese unerwartete Versammlung der höchsten Adeligen des Königreichs – oder zumindest der Hauptstadt – betraf … und dazu der ranghöchsten Offiziere von Dohlars Armee und Flotte.
»Angesichts eurer Pflichten und eurer verschiedenen Mittel und Wege, an Informationen zu gelangen, werdet ihr mittlerweile gewiss schon ungeheuerliche Dinge aus Delferahk gehört haben«, fuhr Lainyr mit rauer Stimme fort. »Zwar mag
wenig Wahrheit in dem liegen, was uns bislang zu Ohren gekommen ist, aber bedauerlicherweise entbehren all diese Gerüchte mitnichten einer Grundlage. Charisianische Agenten haben Prinzessin Irys und Prinz Daivyn entführt.«
Ein Raunen ging durch den Dom. Angesichts einiger geflüsterter Bemerkungen musste sich Gardynyr immens zusammenreißen, nicht laut aufzulachen. War es wirklich möglich, dass diese Leute noch nichts von den ›Gerüchten‹ mitbekommen hatten, von denen Lainyr hier sprach? Wenn sie wirklich derart schlecht informiert waren, dann hatte das Königreich noch ungleich mehr Probleme, als Gardynyr bislang gedacht hatte.
»Natürlich werden die von Shan-wei Besessenen eine ganz andere Geschichte erzählen«, fuhr Lainyr fort. »Schon jetzt hat Shan-weis Behauptung, der Prinz und die Prinzessin seien mitnichten entführt, sondern vielmehr befreit worden, ihre giftigen Wurzeln im allzu fruchtbaren Mutterboden von Delferahk geschlagen. Zu gegebener Zeit wird gewiss das auch die offizielle Lüge sein, die das sogenannte Kaiserreich Charis und sein für alle Zeiten verdammtes Kaiserpaar verbreiten lassen. Doch die Wahrheit sieht ganz anders aus. Graf Coris, dessen Aufgabe es war, den Prinzen zu beschützen und über dessen Schwester zu wachen, hat die beiden vielmehr an eben jene Charisianer verkauft, die den Vater der beiden Kinder in Corisande haben ermorden lassen. Ja, es sind sogar Beweise dafür aufgetaucht, dass es Coris selbst war, der den Attentätern des exkommunizierten Gotteslästerers Cayleb überhaupt erst die Möglichkeit verschafft hat, unbemerkt nach Manchyr zu gelangen. Die Inquisition und König Zhames’ Ermittler haben noch nicht herausgefunden, wie er von Delferahk aus mit Cayleb und Sharleyan von Charis in Kontakt gestanden hat. Aber es ist ganz offensichtlich, dass dem so gewesen sein muss. Als Daivyn Daykyn zusammen mit seiner Schwester in Delferahk Zuflucht fand, hat König Zhames Graf Coris gestattet, eigene Gardisten anzuheuern, deren ausdrückliche Aufgabe es sein sollte, den rechtmäßigen Regenten des eroberten, blutenden Fürstentums Corisande zu beschützen. Und eben jene ›Gardisten‹ waren dem Grafen nun bei der Entführung der beiden Kinder behilflich.
Damit niemand auch nur einen Augenblick daran zweifelt, dass es sich um eine Entführung handelt, möge Folgendes reichen: Der charisianische Agent, der diesen verbrecherischen Akt vollführt hat, was Merlin Athrawes persönlich – der angebliche Seijin, der Cayleb Ahrmahk als persönlicher Waffenträger dient. Mit Hilfe der verderbten Künste Shan-weis ist es diesem Mann gelungen, eine ganze Kompanie der Königlichen Garde von Delferahk abzuschlachten. Deren einziges Ziel war es, Daivyn und Irys zu beschützen. Wir sprechen hier von Gardisten, die auf direkte Anweisung Bischof Mytchails, des Intendanten von Delferahk, die schutzlosen Waisen bewachen sollten.
Pater Gaisbyrt – ein Gehilfe Bischof Mytchails, der das uneingeschränkte Vertrauen des Bischofs genießt –, und ein weiteres Mitglied seines Ordens hatte man ausgeschickt, sich der Sicherheit des Prinzen zu vergewissern. Beide wurden kaltblütig ermordet.
Zwei Gardisten, die dieses Massaker überlebt haben, berichten übereinstimmend, Prinzessin Irys habe um Hilfe gerufen. Sie hat darum gebettelt, ihren Bruder vor eben jenen Mördern zu beschützen, die schon ihrem Vater das Leben genommen haben. Doch Shan-wei persönlich hat wieder unsere Welt betreten, und sie ist schlimmer als je zuvor nach ihrem tiefen Fall. Wir wissen nicht, mit welch verderbten Waffen sie ihren Diener Athrawes ausgestattet hat. Aber wir wissen, dass sterbliche Menschen diesen Waffen nichts entgegenzusetzen hatten. Bevor Athrawes seine schändliche Tat vollendete, hat er die eine Hälfte des Schlosses von Talkyra niedergebrannt und die andere in die Luft gesprengt. Er hat die besten Pferde aus König Zhames’ Stallungen gestohlen, und dann haben der Verräter Coris und er Prinzessin Irys aufs Pferd gefesselt. Ja, sie haben es wahrlich gewagt, eine hilflose, junge Maid zu fesseln, die sich verzweifelt gewehrt hat. Danach hat Athrawes selbst, Caylebs persönlicher Waffenträger, Prinz Daivyn zu sich in den Sattel genommen, so sehr der Junge auch um Hilfe geschrien hat. Gemeinsam sind sie von den lodernden Ruinen der Festung, in der Hektors Kinder geschützt gewesen waren, geradewegs in die Nacht hinausgeritten.«
Langsam schaute sich Lainyr um, blickte mit düsteren, kalten Augen die Bankreihen entlang. Thirsk fragte sich, wie viel vom Bericht des Bischof-Vollstreckers der Wahrheit entsprach – falls überhaupt ein Körnchen Wahrheit darin war. Der Admiral fragte sich auch, ob der Gottesmann selbst ein einziges Wort davon glaubte. Falls nicht, hatte er auf jeden Fall seinen Beruf verfehlt: Ihm hätte eine glänzende Karriere als Bühnenschauspieler offengestanden.
»Sie sind gen Osten geritten«, fuhr der Prälat mit kalter, tonloser Stimme fort. »Sie ritten nach Osten, bis zum Herzogtum Yarth, bis sie den Sarm erreichten. Dort trafen sie mit mehreren Hundert charisianischen Marineinfanteristen zusammen. Diese waren mit einer ganzen Flottille kleinerer Boote den Sarm hinaufgekommen, während Graf Charlz’ Truppen abgelenkt wurden: In der gänzlich schutzlosen Stadt Sarmouth war es zu Vergewaltigungen und Plünderungen gekommen, ehe sie mutwillig dem Erdboden gleichgemacht wurde. Einem einzelnen Zug delferahkanischer Dragoner ist es gelungen, die Entführer abzufangen. Doch diese wackeren Männer gerieten in einen Hinterhalt: Hunderte von Charisianern hatten sich in den Wäldern verborgen gehalten und den Dragoner-Zug fast bis auf den letzten Mann abgeschlachtet. Einer Hand voll Männern ist jedoch die Flucht gelungen … und diese Männer wurden Zeugen einer weiteren kaltblütigen Schandtat: der Ermordung eines weiteren geweihten Priesters Gottes! Dabei hatte dieser Priester nichts anderes im Sinn, als eine junge Maid und ihren hilflosen Bruder aus den Händen derjenigen zu retten, die die Mörder ihres Vaters sind!
Dann gelangten Athrawes und die anderen Charisianer den Sarm entlang bis nach Sarmouth. Von dort aus gingen sie dann an Bord eines charisianischen Kriegsschiffs, das sie zweifellos zu Cayleb und Sharleyan nach Tellesberg bringt.«
Erneut schüttelte der Bischof-Vollstrecker den Kopf. Kummervoll legte er die Hand an das Szepter vor seiner Brust.
»Es bricht mir fast das Herz, mir auch nur einen Moment lang vorzustellen, wie es den beiden unschuldigen Opfern ergehen mag, wenn sie in die Hände der Charisianer fallen«, fuhr er dann leise fort. »Ein Junge, der kaum zehn Jahre alt ist? Ein Mädchen, das noch keine zwanzig Jahre zählt? Allein, ohne jeden Schutz, in den Händen der gleichen blutbesudelten Ketzer, die auch schon den Vater und den älteren Bruder ermordet haben! Der rechtmäßige Fürst von Corisande, gefangengesetzt in einem gottlosen Kaiserreich, das sein Fürstentum erobert und geplündert hat? Gefangen in dem Kaiserreich, das schon weiß Langhorne wie viele unschuldige Kinder Gottes den gefühllosen Klauen ihrer gotteslästerlichen ›Kirche‹ überantwortet hat? Wer weiß, welchen Druck man dort auf den rechtmäßigen Prinzen von Corisande ausüben wird! Welche Bedrohungen wird Prinz Daivyn dort über sich ergehen lassen müssen, welche Entbehrungen – welche Folter? Zu welchen Schandtaten werden Cayleb und Sharleyan greifen, um ihr hilfloses Opfer gefügig zu machen? Gibt es denn überhaupt etwas, vor dem Cayleb und Sharleyan zurückschrecken?« Wieder schüttelte Lainyr den Kopf. »Eines sage ich euch, meine Söhne – es ist nur eine Frage der Zeit, bis diese hilflosen Kinder gezwungen sein werden, all die Lügen zu wiederholen, die ihre Häscher ihnen in den Mund legen.