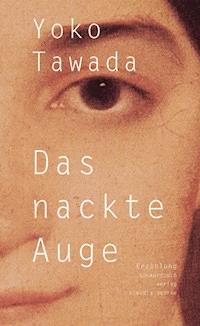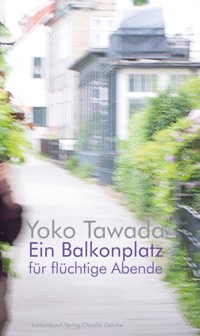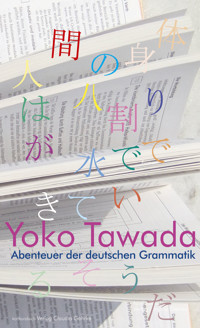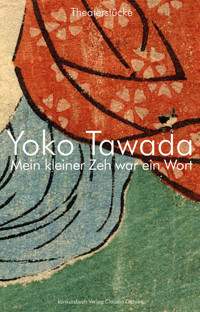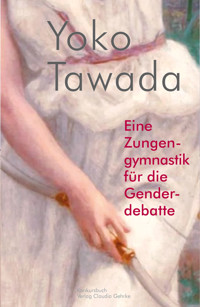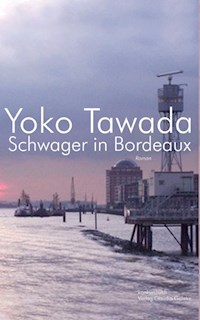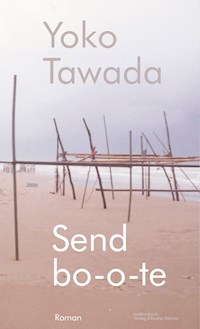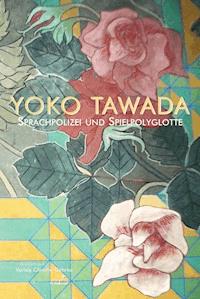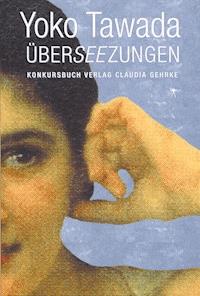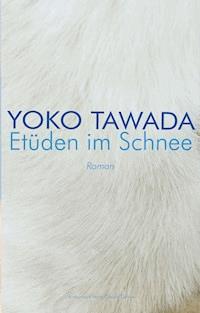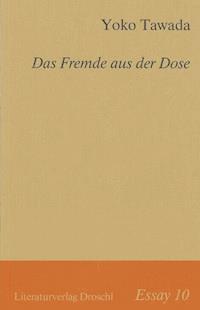9,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: konkursbuch
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein poetischer Bericht von Yoko Tawada über die Metamorphosen im Leben von 22 Frauen, die sich mitunter begegnen, Verwandlungen des Körpers nicht als Verlust erzählt, an Schönheit oder Jugend, sondern als sinnliches, traumhaftes Ereignis ... Das Buch handelt von einer vielschichtigen Erotik, die nichts mit “Beziehungen” zu tun hat. Metamorphosen des Körpers als rauschhaftes Erlebnis. Sie bewegen sich zwischen dem gegenwärtigen Alltag in Großstädten, zwischen „Finanzamt, anschließend Tesa kaufen“ und schamanistischen Märchen. Der Text handelt weniger von den bekannten und immer wieder erzählten Bereichen Liebe, Familie, Karriere etc, sondern von Empfindungen und Ereignissen in namenlosen Lebensbereichen … „Opium umweht die Leserin in den traumhaften Sequenzen... Sucht und Sehnsucht sind der Antrieb der Ich-Erzählerin für die Verwandlungen.“ (EMMA) „Yoko Tawadas Frauen leben heute, sind aber Luft- und Gedankenwesen, sie gebären sich und einander ständig neu in einem unendlichen Schaffensprozess, im Rausch, aber mit glasklarem Verstand, ohne jeden metaphysischen Hintergrund. Sie tanzen auf den versteinerten Verhältnissen und bringen die Welt und sich selbst in einen veränderten Aggregatszustand. Selten hat sich Weiblichkeit so fröhlich, so heiter vorgestellt.“ (NDR) „...eine glasklare Trunkenheit... In Tawadas Universum segmentieren sich Menschen in Glieder, Stimmen und Blicke und beginnen Tieren zu ähneln, während gleichzeitig die Dinge menschliche Eigenschaften annehmen... eine von der Last der Selbstkontrolle erlöste Heiterkeit.“ (Neue Zürcher Zeitung)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 245
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Yoko Tawada
Opium für Ovid
Kopfkissenbuch für 22 Frauen (Roman)
Konkursbuch Verlag Claudia Gehrke
Zum Buch
Ein poetischer Bericht von Yoko Tawada über die Metamorphosen im Leben von 22 Frauen, die sich mitunter begegnen, Verwandlungen des Körpers nicht als Verlust erzählt, an Schönheit oder Jugend, sondern als sinnliches, traumhaftes Ereignis ... Das Buch handelt von einer vielschichtigen Erotik, die nichts mit “Beziehungen” zu tun hat. Metamorphosen des Körpers als rauschhaftes Erlebnis. Sie bewegen sich zwischen dem gegenwärtigen Alltag in Großstädten, zwischen „Finanzamt, anschließend Tesa kaufen“ und schamanistischen Märchen. Der Text handelt weniger von den bekannten und immer wieder erzählten Bereichen Liebe, Familie, Karriere etc, sondern von Empfindungen und Ereignissen in namenlosen Lebensbereichen … „Opium umweht die Leserin in den traumhaften Sequenzen... Sucht und Sehnsucht sind der Antrieb der Ich-Erzählerin für die Verwandlungen.“ (EMMA)
„Yoko Tawadas Frauen leben heute, sind aber Luft- und Gedankenwesen, sie gebären sich und einander ständig neu in einem unendlichen Schaffensprozess, im Rausch, aber mit glasklarem Verstand, ohne jeden metaphysischen Hintergrund. Sie tanzen auf den versteinerten Verhältnissen und bringen die Welt und sich selbst in einen veränderten Aggregatszustand. Selten hat sich Weiblichkeit so fröhlich, so heiter vorgestellt.“ (NDR)
„...eine glasklare Trunkenheit... In Tawadas Universum segmentieren sich Menschen in Glieder, Stimmen und Blicke und beginnen Tieren zu ähneln, während gleichzeitig die Dinge menschliche Eigenschaften annehmen... eine von der Last der Selbstkontrolle erlöste Heiterkeit.“ (Neue Zürcher Zeitung)
Inhaltsverzeichnis
Titelseite
Zum Buch
1 Leda
2 Galanthis
3 Daphne
4 Latona
5 Scylla
6 Salmacis
7 Coronis
8 Clymene
9 Io
10 Thetis
11 Limnaea
---
12 Niobe
13 Iphis
14 Semele
15 Ceres
16 Pomona
17 Echo
18 Thisbe
19 Iuno
20 Ariadne
21 Ocyroë
22 Diana
Zur Autorin
Impressum
1 Leda
Leda steigt in die Badewanne. Die Tür des Badezimmers war geschlossen. Wegen der Lähmung beider Arme konnte sie sich nicht waschen, aber sie lehnte jede fremde Hilfe ab. Sie wolle ihren nackten Körper niemandem mehr zeigen. Sie sagte, ihr Körper sei nicht mehr sehenswürdig. Viel später fällt mir eine Frage ein: Ein altes Haus wird mehr begehrt als ein neues Haus. Ein dreihundertjähriger Baum wird öfter bewundert als ein dreijähriger Baum. Je älter desto schöner empfindet man eine Teekanne, ein Buch und ein Haus. Warum soll das bei den Menschen anders sein?
Vielleicht saß sie im Wasser mit ausgebreiteten Flügeln, die kraftlos an den Rändern der Badewanne lagen. Mit dem Schnabel reinigte sie die wasserdichten, cremeweißen Federn. Die Tür des Badezimmers war von innen abgeschlossen.
Das neue, umstrittene Gesetz sei gestern verabschiedet worden: die Krankenkasse müsse nicht mehr die Kosten für medizinische Behandlungen des Unterleibs übernehmen. Ein Spezialist für soziale Wandlungen sagte im Radio, in Zukunft würden öfter Transplantationen vorkommen, bei denen Unterleibsorgane auf den Oberleib übertragen würden.
Meine Fingernägel sind dreckig. Auf dem Kalender steht unter dem heutigen Datum: „Finanzamt, anschließend Tesafilm kaufen.“ Es ist federleicht, pünktlich aus dem Haus zu gehen. Man kommt dennoch immer später an als geplant. Von der Eingangshalle aus kann man schon viele krumme Rücken sehen. Sie steigen fristüberzogen und abgetragen in den Paternoster. Die Beamten dort verachten die Hüften älterer Frauen, so hatte Leda einmal zu mir gesagt. Als sie noch nicht gelähmt war, musste auch sie ab und zu den Paternoster dieses Gebäudes betreten.
Leda hat eine seltsame Sammlung von Schallplatten einer nicht mehr existierenden Firma mit dem Namen „Planeten“. In den sechziger Jahren produzierte diese Firma Platten, auf denen die Nadel des Plattenspielers von innen nach außen kreist.
Die Lähmung der Arme hindert Leda nicht daran, den veralteten Plattenspieler in Betrieb zu setzen. Sie zieht mit beiden Knien eine Platte aus dem Regal, holt die schwarz glänzende Scheibe mit trocknen Lippen aus der Hülle und legt sie dann vorsichtig auf die Anlage. Dabei bleibt ein Stück Lippenhaut am Plastik kleben. Sie blutet. Leda transportiert die Nadel mit der Zungenspitze. Sie spielt ihre Lähmung makellos vor.
Als Leda zwanzig war, schwamm sie durch die Menschenmenge – zurechtgeputzt und kühl konzentriert. Sie fühlte sich verpflichtet, nicht mehr mädchenhaft, nicht mehr ländlich und nicht mehr schüchtern oder erkältet auszusehen. Erst dreißig Jahre später konnte sie aus ihrem Körper etwas entfalten, das besonders war. Man hat das Gefühl, an jeder Stelle ihres Körpers eine Öffnung finden zu können, durch die man einen anderen Raum betreten kann.
Ein knöcherner Stuhl steht vor Ledas Augen, sie hält seine Lehne fest. Im Moment sitzt niemand auf diesem Stuhl. Vor einer Stunde saß eine Krankenschwester dort, vor einem Tag eine Katze, vor drei Jahren ein Musiker. In Ledas Augen sitzen sie alle gleichzeitig da. Der Stuhl steht mitten in einem Zimmer, das bürgerlich anonym eingerichtet ist. Die Konturen des Möbels werden nach und nach schwächer. Der Raum ist von zahllosen Schatten erfüllt, Schatten von Blättern. Steht man in einem Busch oder in einem Schreibzimmer? Das Holzmuster des Fußbodens verwandelt sich in das Kräuseln von Wellen.
Auf dem Boden des Badezimmers liegt eine Feder. Länger als eine menschliche Hand, weiß mit grauem Schimmer, frisch abgebrochen von einem unbekannten Körper. Wer taucht die Feder in die Tinte ein und schreibt mit ihr einen Dialog?
„Wann haben Sie ihre Mutter zuletzt nackt gesehen?“
„Als Kind.“
„Sie kennen Ihre eigene Mutter nur eingewickelt in ein anonymes Stück Stoff aus dem Kaufhaus? So unpersönlich?“
„Warum soll man ihren alten Körper sehen? Es ist für mich wichtiger, intensive Gespräche mit ihr zu führen.“
„Sie meinen, man kann die Nacktheit des Körpers durch ein Gespräch ersetzen?“
Um eine schlaflose Nacht zu verkürzen, geht sie sonntags um fünf Uhr aus der Wohnung und wandert über den Fischmarkt. Sie verachtet Nahrungsmittel. Pflanzen und Tiere seien schön, solange sie nicht auf einem Teller liegen. Als Gemüse und Fleisch seien sie nur noch geschmacklos. Wegen der unsichtbaren Stacheln isst sie kein Obst. Sie isst kein Getreide, weil es im Magen gärt und Giftgas erzeugt. Salat nimmt ihr die Körperwärme weg, Suppe verdünnt ihre Kraft, Zucker macht sie nervös, Essig sticht ihr Gefühl feindlich und Milch ekelt sie.
Leda hat oft Ohrenschmerzen. Jedes elektrische Gerät brummt heimlich, auch wenn man es nicht sofort hört. Die kleine Glühbirne in der Küche zittert die ganze Zeit und erzeugt dabei das Flügelrauschen eines Käfers. Die Uhr an der Wand und die Armbanduhr in der Handtasche ticken versetzt, wie stolpernd. Der Kühlschrank klagt Tag und Nacht. Je geringer sein Inhalt, umso lauter sein innerer Monolog. Manchmal sagt Leda, dass sie sofort alle Stecker im Haus aus den Steckdosen ziehen möchte. Sie geht die Wand entlang, beugt sich über die Kommode, schaut hinter dem Bett nach und zieht und zieht und zieht. Es gibt aber viel mehr Steckdosen, als man denkt. Es gibt Steckdosen unter der Blumenvase, hinter dem Ölgemälde, auf der Handfläche, auf dem Kopf. Auch Ledas Bauchnabel sieht aus wie eine Steckdose. Sie möchte den Stecker aus ihrem Körper ziehen.
Gelegentlich sucht Leda sich einen Künstler aus, von dem sie schwärmen kann. Nach einiger Zeit redet sie nicht mehr von ihm und an seine Stelle tritt ein anderer. Die Künstler empfinden keine Schmerzen, wenn sie von Ledas Leidenschaft verlassen werden. Die meisten sind nämlich schon seit über hundert Jahren tot. Im Moment spricht sie viel von einem rumänischen Pianisten. Als er geboren wurde, hatte er an der linken Hand sechs Finger. Wie es damals üblich war, ließ seine Mutter den sechsten Finger abschneiden. Man sieht auf seiner blassen, behaarten Haut heute noch einen roten münzenähnlichen Fleck. Seltsamerweise passiert es oft, dass sein sechster Finger mitten in einem Konzert zu ihm zurückkehrt. Besonders an solchen Stellen, an denen die Noten dichter gewachsen sind, erscheint der Finger wie ein Blitzlicht und schlägt die Tasten.
„Ich verstehe nicht.“
„Was verstehst du nicht?“
„Alle Menschen sind gleich begabt, einige haben aber wahrscheinlich größere Löcher auf dem Schädel, so dass die Geister leichter hineinfliegen können.“
Ein frecher Rhythmus nimmt Leda bei den Schultern und schüttelt sie. Schon ist sie eins mit ihm. Die Bäume schütteln den Wind, die Kranken schütteln den Hustenanfall und der Tanz tanzt Leda. Sie braucht keine Tanzfläche. Die Wimpern ihrer zugedrückten Augen zeichnen den Entwurf eines Raumes, in dem sie gerade tanzt. Aus ihren geöffneten Lippen spritzen würzige Melodien, die entgleisen und außerhalb der Tonleiter weitertanzen. In der Luft hinterlässt der Lippenstift schwankende Linien aus Rosa. Die Lippen sind nicht so beleidigt geschwollen wie die eines Mädchens, eher sparsam gereift. Waren Ledas Lippen schon immer so dünn? Dünn, aber feucht und unermüdlich. Sie sind ungezähmte Tiere, die schon seit vielen Jahren bei ihr sind.
„Ich könnte jede Melodie nachspielen, wenn ich sie einmal gehört habe“, sagt Leda. Wenn ich meine Finger bewegen könnte. Dieser Nebensatz wird nicht ausgesprochen. Das Ich, das eine Melodie hört, das Ich, das sie nachspielt, das Ich, das von einem Musikerleben träumt, das Ich, das von diesem Traum erzählt. Das Ich vermehrt sich täglich, in jedem Satz mindestens eine neue Geburt. Die Kinder kriechen wie Seidenraupen aus Wunden heraus. Es wäre besser, wenn die Mutter die Neugeborenen in ein Stück Plastik einwickeln und weiterverschenken würde. Aber sie will alle behalten, bis sie reif werden und verfaulen.
Leda berührt die Klaviertasten nur innerhalb ihres Kopfes und erzählt niemandem davon. Am liebsten schlägt sie gleichzeitig viele weiße Tasten, die nebeneinanderliegen. Jeder Ton greift seinen Nachbarn an. Die Töne ätzen, stechen, brennen und erzeugen Hitze. Leda hört gerne zu, wie die Töne miteinander streiten und in der Luft explodieren. Splitter der Töne schweben noch lange im Raum, bleiben aber bis zum Schluss unhörbar für die anderen.
„Ich verstehe nicht.“
„Was verstehst du nicht?“
„Das kann doch nicht sein, dass die Töne – wenn sie einmal in die Welt gesetzt worden sind – eines Tages verschwinden. Wo sind sie aber, wenn sie nicht mehr bei uns sind?“
Ein krummes Leben, du stürzt in tausend Trümmer. Kehre doch zurück in dein Haus, blumig tapeziert und übermalt. Es wird dich trösten. Du atmest zu krass, so wird dein Atem dich bald verlassen. Bleib stehen, schau und komm zurück zu uns in die Stube.
So mütterlich es sich anhört, in Wirklichkeit besteht das Lied aus einer gewaltsamen Botschaft. Auch die Zeitung singt dasselbe Lied. Leda bereut es, aufgestanden zu sein. Stirb, hoffentlich geschieht es dir bald. Nicht ich, sondern das Leben ist nicht lebenswert, antwortet Leda. Die Marmelade schmeckt fischig, aus der Zeitung springt ein Bericht über das Anwachsen der Kriminalität. Die Armut soll der Grund für das Verbrechen sein, obwohl es doch so viele kriminelle Bankiers und Politiker gibt. Eine heitere Schadenfreude wird zwischen den Zeilen hörbar. Stirb, wiederholt die Stimme aus der Zeitung. Oder kommt die Stimme aus dem amputierten Blumenstiel? Wer hat die Stimme im Zimmer installiert? Leda hatte Blumen in ihrem Schlafzimmer schon lange verboten. Du darfst mir nicht helfen, sagt Leda zu der Blume.
Adjektive sind entscheidend, nicht die Substantive. Wenn Leda eine dünne Freundin hat, ist ihre Dünnheit wichtig, und nicht, dass sie ihre Freundin ist. Leda kennt einige Frauen, die ausgebildet oder fettweich oder beurlaubt oder kalkig sind. Sie sind weder Künstlerinnen noch Mütter noch Steuerzahler.
Sie versuchen, Leda nichts Falsches zu sagen. Ihre Zungen verkrampfen sich, um Fehler zu vermeiden. Sie sprechen umständlich und fallen immer wieder genau auf die Sätze, die sie vermeiden wollten: “Schneide deine Haare ab, ihre Spitzen sind ärmlich dünn“, sagt eine zu Leda. “Wenn eine normale berufstätige Mutter wüsste, wie lange du im Bett liegst, ohne was zu tun“, sagt eine andere. “Durch eine Lähmung kommst du am schnellsten zu Geld“, sagt eine dritte.
„Setzen Sie sich bitte in die hinterste Reihe“, sagt der Beamte zu Leda. Leda schleppt sich nach hinten. Es gibt mindestens dreißig Reihen in dem Raum, ein Haufen Frauen, eine Masse parfümierter Körper. Der Beamte redet nur mit den Frauen aus der ersten Reihe. Jede wird irgendwann einmal drankommen, aber es wird sehr lange dauern. Denn für jede Frau muss eine präzise Summe ausgerechnet werden, damit eine absolute Gleichberechtigung entsteht. Es ist etwas komisch, dass alle Frauen im Raum daran glauben, der Staat sei ihr Vater und müsse deshalb ihr Leben finanziell retten. Die meisten Frauen haben einen leiblichen Vater, der sie aber nicht versteht. Er ist der böse Vater, während der Staat der gute Vater werden soll.
Die Luft im Wartesaal ist stickig. Leda bemerkt, dass der Kaktus auf der Fensterbank aus menschlichem Fleisch besteht. Leda schleicht aus dem Raum und geht nach Hause. Es war doch gut, dass sie nicht vorne saß. Sonst hätte sie nicht fliehen können. Alle Frauen kamen zwar freiwillig dorthin, aber das Verlassen des Raumes aus eigenem Willen war offiziell nicht erlaubt. Leda muss einen Zug nehmen, für den sie doppelt soviel bezahlt wie sonst, denn die Zeit steht außerhalb des normalen Tarifs. Wenn sie noch länger dort geblieben wäre, hätte sie vielleicht sogar einen Zuschuss bekommen. So bezahlt sie ihr sinnloses Unternehmen auch noch aus der eigenen Tasche. Am nächsten Tag und auch an den folgenden Tagen sperrt sie sich in ihrem Zimmer ein. Unbekannte Kakteen stehen draußen am Fenster und lecken die Glasscheibe mit pickeligen Zungen. Leda läuft ins Schlafzimmer. Ein winziges, grünes Licht flimmert in der Ecke. Leda drückt den Knopf. Der Anrufbeantworter ist voll beladen mit feuchtem Stöhnen der Vegetationen.
Leda dreht sich mit der Schallplatte zusammen. Die Drehung zeichnet einen immer größeren Kreis, die Kreiselfrau sieht Sterne vor den Augen, pulverartige Wunder rezeptfrei. Sie wird bis zum äußersten Kreis geschleudert, mit sich steigernder Geschwindigkeit. Die Ränder der Dinge glitzern wie belebt. Es ist nicht mehr auszuhalten. Jeder Riss im Kopf bedeutet einen Klang. Wenn der Faden abreißt, fliegt sie raus. Alle Wörter sind ausgeschält und blinken nackt auf der Oberfläche. Sie können nicht mehr klingen, sie reiben nur noch aneinander. Zu dem Nullpunkt zurückkehren. Leda springt immer höher, die Rückkehr wird immer mühsamer. Die Nadel auf einer Schallplatte sollte sich doch besser von außen nach innen bewegen und ins Loch der Mitte fallen, wie eine Besessene in die Arme ihres kleinen Bruders. Der kleine Bruder ist der Priester der Zahl Null. Er soll Leda empfangen und dorthin zurückbringen, wo sie allein nicht herkommt, zu einer Anti-Heimat. Sie hat aber keinen Bruder. Leda öffnet ein Stück zusammengefaltetes Papier und schluckt weißes Pulver. Langsam, aber gewaltig kommt sie zurück. Wohin? Der Kreiseltanz ist vorbei. Das weiße Pulver des weisen Bruders. Ihr Körper wird wie ein Leinensack umgedreht, vielleicht kann sie wieder einschlafen.
---
2 Galanthis
Einen Halbkreis zeichnend flog ich in die Luft, wie ein Spielball, und prallte auf die Straße. Zuerst erreichte meine rechte Hand den Betonboden, dann der schwere Sack mit den Eingeweiden. Das Handgelenk zerbrach unter seinem Gewicht und auf einmal stand der Schmerz wie ein Totempfahl neben mir. Vor meiner Nase flimmerte es. Etwas zog die beiden Augen viel zu sehr in die Mitte, so konnte der Blick kein Bild binden. Und ein Strudel des Lichtes. Er kam von dem hinteren Rad meines Fahrrades auf mich zu, es drehte sich ohne jeden Tritt und strahlte. Das Motorgeräusch entfernte sich und die bedrückende Sonntagsstille der Provinz kehrte zurück. Vogelgezwitscher tropfte herab, anscheinend gibt es Löcher im Himmel.
Ich lag unbewegt, wollte nicht wissen, ob Fäden meines Körpers zerrissen waren oder nicht. Zwischen Knochen und Fleisch die Ahnung eines Brennens. Ich ahnte die Angst vor kommenden Schmerzen, als wären sie nicht bereits da. Aber dann geschah etwas Seltsames: Ich bemerkte ein leichtes Brodeln im Fleisch, es war eine Lust, die auf nichts zielte, es verstärkte sich, bis ich zu lächeln begann, und auf einmal floss eine Strömung zwischen das Genick und die Ellbogen, dann in den Unterbauch, in die Schenkel, in die Zehen, und verbreitete sich im ganzen Körper. Dann fiel ich in einen Schlaf wie man einen Hang hinunterrollt. Ich hatte nie zuvor ein vergleichbares Gefühl erlebt und mir fiel nur das ganz unpassende Wort Glück ein.
Als ich wieder zu mir kam, wurde das Brummen eines Motors hörbar. Eine Frau stieg aus dem Auto und fragte mich, ob ich lebte, und drückte meinen Kopf gegen ihren Schoß. Es roch zuerst nach Schweiß, dann nach Feigen. Sie presste ihre kräftigen Oberschenkel von beiden Seiten gegen meine Ohren. In meinem Kopf wurde es eng. Unsichtbare Flüssigkeit sickerte aus meinem Mund, aus der Nase, aus den Augen, schließlich auch aus mir unbekannten Öffnungen.
Irgendwann muss die Frau mich ins Krankenhaus in Rissen gebracht haben. Abends war ich schon fertig mit allen Untersuchungen und den ersten Behandlungen. Wie ein Geschenk drückte ich den mit Gips geschienten Arm gegen meine Brust und gab der Frau, Galanthis, meine Telefonnummer.
Eine Woche später lag ich wieder verletzt und verlassen auf einer Landstraße in Schleswig-Holstein. Und einen Monat danach noch einmal. Kurze Zeit später wieder. Die Zeit wiederholte sich und ich konnte kein Schlusswort finden. Denn im entscheidenden Moment tauchte immer das Wort Glück auf und brach den Lauf meiner Gedanken. Es gibt kein stumpfsinnigeres Wort als Glück, es schlägt jeden Keim tot, es zertritt meine Heiterkeit.
Leda steht vor dem Schaufenster einer Apotheke und studiert die neuen Frühjahrsprodukte. Aus dem Ladenschild blickt ein metallener Schwan auf sie. Seit einigen Jahren gibt es einige spiritusartige Mittel mit eleganten Markenzeichen und Verpackungen. Die feinere Gesellschaft zieht die herben, durchsichtigen Medikamente den süßlichen, trüben vor. Flüssigkeiten sind aus der Mode, die Kapselform ist angesagt. Die Produkte sollten nicht zu preisgünstig sein, sonst besteht die Gefahr von Nebenwirkungen. Die Kapseln mit schlechteren Qualitäten bewirken Montagsschmerzen. Leda bekommt zwar auch von der teuersten Kapselauslese Schmerzen, aber es tut ihr dennoch gut, verächtlich über billigere Produkte zu sprechen.
Der Monat Mai als Krankheit, die abgelegte Hülle des Wintergemütes schwillt in der Wärme an, die Atemwege verengen sich, der Blütenstaub rächt die gefällten Bäume des letzten Jahres und alte Mücken verirren sich mit unentschlossenen Fluglinien in die Ohren, es säuselt und kratzt in allen Öffnungen.
Ledas Blick geht durch die Glasscheibe in den Laden, in dem eine Frau steht und Leda anstarrt.
Galanthis, eine stockmagere Holzfrau, hochgewachsen und mit buschigen grauen Haaren, fragt die Apothekerin nach Aspirin. Wenn Galanthis den Mund öffnet, bricht unkontrolliert eine tiefe, kratzende Stimme heraus. Überrascht und gehetzt von der eigenen Stimme versucht sie, das jetzige Tempo zu überholen. Ein Wettlauf ohne Erfolgsgefahr. Die Stirn zieht sich zusammen, weil die hastigen Wörter sie stechen. Galanthis hört ihre eigene Stimme immer weniger, spricht immer lauter.
Leda, eine illegale Apothekerin, legt ihrer Patientin Galanthis Leinsamen auf die Zunge. Die Samen werden feucht und bewegen sich wie winzige Käfer. Galanthis kippt schnell ein Glas Wasser nach und hustet.
„Sie meinen also, wir sind die Einsamen?“, fragt die Kranke und lächelt der Apothekerin zu, als wäre sie ihre Komplizin.
Die fachkundige Kräutersammlerin Leda antwortet streng: „Nein, das sind die Leinsamen, nicht die Einsamen.“
Sie lachen nicht, sondern sitzen mit ernstem Ausdruck da wie fünfjährige Mädchen beim Puppenspiel.
In meiner Puppenstube arbeitet die Puppe Leda als Apothekerin. Sie steht hinter dem Verkaufstresen, umgeben von hölzernen Schubladen, vor einer schief stehenden Waage. Sie ist Apothekerin geworden, weil sie Schubladen liebt. In einem Gemüseladen könnte sie die Auberginen nicht in eine Schublade legen. Nur in einer Apotheke dürfen Kugeln und Pulver im Dunkel hinter den Geheimzeichen schlafen. Leda ist süchtig danach, die Schubladen auf- und zuzuziehen. Früher konnte man ähnliche Schubladen und Geheimfächer noch in den Behörden, Schulen und Krankenhäusern finden. Aber die gläserne Reform hat alle dunklen Schubladen abgeschafft. Die Vorderseite eines Möbelstückes – sei es ein Schreibtisch, oder ein Aktenschrank – muss immer aus durchsichtigem Glas gemacht sein. Die Beamten können kein Machtgefühl mehr empfinden, indem sie das Fach öffnen und einen Blick hineinwerfen. Jetzt ist Apotheker der einzige Beruf, der diese Privilegien behält.
Wenn ich ein leichtes Brennen im Hals oder einen Druck im Bauch verspüre, steht Leda schon mit Schachteln voller Heilmittel vor mir.
„Du sollst sie nehmen.“
Ihr heimlicher Wunsch, in den Körper einer anderen Frau einzudringen, hat sich in Tabletten, Tropfen und Pulver verwandelt. Eine Suche nach erotischer Lähmung und gegenseitiger Abhängigkeit.
„Nein danke. Ich habe schon meine eigene …“
Ich spreche den Satz nicht zu Ende und verrate Leda nicht, was ich schon habe. Meine Ablehnung beleidigt sie, aber ich kann die Pulver nicht annehmen und kann ihr den Grund dafür nicht verraten. In Ledas Augen tauchen kalt geputzte Porzellanscherben auf.
Eine kleine Entdeckung änderte meinen Alltag. In meinem Körper wird nämlich etwas hergestellt, für das ich keinen Namen kenne. Diese Substanz heilt Wunden. Im Extremfall kann sie mich sogar in einen Rauschzustand versetzen.
Galanthis’ Knochenbau ist stabil, in ihrer Mitte ruht ein labiler Bereich: Einfach zusammengeworfene Eingeweide. Sie hat mehrere winzige Lebern, zu große Lungen, ein Herz zuviel, dafür fehlt der Blinddarm.
„Ich brauche einen Schein für das Arbeitsamt.“
Galanthis kann vor Aufregung weder die Stimme des Arztes noch ihre eigene Stimme hören, deshalb spricht sie laut.
„Ein äußerst schwaches Wesen“, sagte der Vertreter des beurlaubten Augenarztes, „eine verstopfte Nase, brüchige Zähne, verbrannte Haare, geschwollene Waden.“
Er verschluckte das Wort „unheilbar“, denn ein Arzt darf das Wort nicht benutzen.
„Ich möchte nur eine Bestätigung für meine Sehkraft haben, die Behörde verlangt das von allen Arbeitslosen“, erwiderte Galanthis.
In ihrem Alter nützt das auch nicht mehr, denkt der Arzt.
Es gibt Tage, an denen Galanthis sich hellwach fühlt. Sie studiert dann einen Laden nach dem anderen, kniet und streckt sich den ganzen Tag vor den Regalen, schleppt Prospekte herum und geht abends noch eine Stunde spazieren.
Es gibt Tage, da möchte man nicht einer geraden Straße folgen. So fährt Galanthis nach Ottensen, wo sie nichts zu erledigen hat, schlendert müßig herum, biegt ohne Grund ab und verirrt sich in eine krumme Gasse. Galanthis stößt auf eine Haustür mit dem Schild „Kasse rechts“. An der Kasse sitzt ein Automat, er streckt Galanthis eine Eintrittskarte hin. Der Flur ist düster und muffig. An seinem Ende wird Galanthis von einer menschenleeren Fabrikhalle empfangen. In der Mitte der Halle befindet sich ein Schwimmbecken. Galanthis taucht ihren Zeigefinger ins Wasser und befeuchtet sich die Stirn. Eine Erwartung steigt in ihr auf, jemand will ihr etwas versprechen. Sie schöpft mit der Hand Wasser und begießt sich selbst. Die nassen Haare kleben an Stirn und Wangen. Sie trinkt einen Schluck. Dann zieht sie sich aus. Die Hose legt sie auf den nassen Boden, Bluse und Unterwäsche folgen.
„Glauben Sie an Gott?“, fragt plötzlich eine Stimme hinter ihr. Galanthis greift schnell nach der Bluse und bedeckt damit das Schamhaar. Als sie sich umdreht, ist kein Mensch zu sehen.
Da Galanthis viel spazieren geht, halten ihre Schuhe nicht lange. Mit alten Schuhen ist oft ein Gefühl der Intimität verbunden. Auf dem Bett liegend, betrachtet Galanthis ihre Schuhe, die in der Ecke des Zimmers stehen. Wo ihre Schuhe stehen, ist sie zu Hause. Sie hat plattgedrückte, flache Schuhe, graue Turnschuhe und auch lange, geschmeidige Stiefel, die bis über die Knie reichen. Die leerstehenden Stiefel zeigen genau die Haltung des Menschen, der sie getragen hat. Das linke Bein ist leicht nach außen gebogen, eine Zehenspitze des rechten Fußes schaut frech weg, während eine andere kompromissbereit zu ihrem Kollegen hinschaut.
Galanthis schwitzt, wenn sie steht, weil sie zu viel Kraft verbraucht, um nicht hinzufallen. Das Laufen fällt ihr hingegen sehr leicht. Sie kann drei Stunden lang pausenlos in schnellen Schritten gehen.
Wie viele unterschiedliche Schweißgerüche kann ein Mensch auseinanderriechen? Wie gut kann ein Mensch riechen? Nicht so gut wie ein Hund, aber auch nicht so schlecht wie manche Stadtbewohner behaupten. Die verliebte Zuckerfeuchtigkeit unter den Armen, die müden Füße in den Schuhen, das neutrale Sportwasser, das Angstbad, die Panikdusche und rhythmische Feuchtigkeit im Rauschzustand. Es gibt auch mathematischen Schweiß. Er wird produziert, wenn man schwierige mathematische Aufgaben lösen will. Galanthis war in manchen Fächern sehr gut, besonders in der Mathematik. Sie errötete aber und kniff ihr Gesicht zusammen, wenn sie im Unterricht aufstehen und etwas sagen musste. Während ihr Mund wie mechanisch die richtigen Antworten sprach, bildeten sich Schweißtropfen über den Augen. Sie versuchte, die Stirn mit der Hand zu trocknen, aber ihre Handflächen waren noch feuchter.
Galanthis trug als Mädchen eine breite Hose und eine Jacke mit großen Blasebalgtaschen. In der Toilette holte sie ein frisches Unterhemd aus der Tasche und wechselte es gegen das alte, nasse aus. Der Schweiß zeichnete Landschaften auf den Stoff.
Als ich aufwachte, stand neben dem Bett eine Krankenschwester. Was, wenn sie der letzte Mensch wäre, den ich in diesem Leben sehe? Ich starrte auf ihre Lippen, die einen schnellen Rhythmus anschlugen.
„Verstehen Sie mich? Haben Sie Schmerzen?“, fragte sie mich.
„Nein. Es geht mir gut. Aber es gibt etwas, was ich nicht verstehen kann. Es tut mit leid, dass ich mich nicht besser ausdrücken kann, aber … Kann es sein, dass ich eine Art Drogenfabrik bin? Wenn mir etwas Schlimmes zustößt, wird sofort ein Mittel in meinem Körper hergestellt, so dass es mir danach gar nicht schlecht geht. Im Gegenteil. Ich bin danach high. Sind das Drogen? Wenn Sie wissen, wie diese Substanz heißt, sagen Sie es mir bitte. Kann ich diese Substanz vielleicht bewusst produzieren?“
Die Krankenschwester kehrte mir den weißen, gebügelten Rücken zu. Anscheinend wollte sie nicht darüber sprechen.
Galanthis besuchte mich oft im Krankenhaus, außerdem schrieb sie mir einige Postkarten. Die Flächen dieser Postkarten waren merkwürdig voll beschrieben. Für Galanthis war es scheinbar wichtig, ein Gleichgewicht zu halten. Wenn sie in der rechten Ecke eine Notiz gemacht hat, muss sie auch etwas auf die linke Hälfte schreiben, sonst kippt das Blatt um.
Ihre Beziehung zu Flächen machte ihr schon in der Schulzeit das Leben schwer. Das Wichtigste für sie war immer, eine Seite ihres Schulheftes auf die richtige Weise zu füllen. Buchstaben, Tabellen, Zahlen und Zeichnungen mussten auf jeder Seite gleichmäßig verteilt werden. Nie vergaß sie beim Rechnen Teile der einzelnen Zahlen, so dass die Gesamtsumme immer stimmte, und bei Fremdsprachen vergaß sie nie einen Buchstaben. Manche Wörter aber konnte sie sich nicht merken, weil sie nicht ausgeglichen aussahen. Die Grammatik der eigenen Sprache pflegte sie so sorgfältig wie ihr eigenes Blumenbeet. Aber wenn Lehrer ihr Fragen stellten, wurde ihr immer heiß und schwindelig. Die verschwitzten Handflächen schwiegen. Wenn der Schweiß sprechen könnte.
Galanthis ist an einen Operationstisch gefesselt. Eine Krankenschwester in hellblauer Uniform versucht, mit einer dicken Nadel ein Stück Leder an Galanthis’ Hand festzunähen. Das Leder stammt aus einem alten Stiefel. Galanthis fragt: „Jetzt wollen Sie aus meiner Hand einen Fuß machen?“
Aber ihre Stimme zerbricht in der Luft und bildet keinen verständlichen Satz. Auf dem Namensschild der Krankenschwester sieht Galanthis den Namen Iuno.
„Sie haben früher Drogen genommen“, sagte die Krankenschwester. Ja, das stimmt. Muss ich aber dreißig Jahre später dafür bestraft werden?
„Es ist keine Bestrafung. Es ist eine Rettung. Ohne Operation würden Ihnen die Hände verfaulen und abfallen.“
---
3 Daphne
Dass ich mich von dem Wort „Glück“ verabschieden und mich für das Wort „Opium“ entscheiden konnte, verdanke ich Karl Marx. Eines Tages blätterte ich in seinen Schriften, ohne sie wirklich zu lesen. Es war schon dunkel draußen und die listig leuchtenden Buchseiten zogen immer wieder neue Mücken an. Eine der Mücken verschwand zwischen den Buchstaben. In dem Moment flog mir ein Satz ins Auge: „Religion ist Opium für das Volk.“ Warum war ich nicht schon früher darauf gekommen, auch diese Substanz als Materie zu verstehen? Marx schreibt: Eisen, Weizen, Kaffee, Getreide, Baumwolle, Edelmetalle, Gold. Er schreibt: Opium.
Der Leib eines Heiligen liegt auf einem Podest, Frauen stürzen auf ihn zu, sie brechen ein Stück Fleisch von ihm ab und stecken es sich schnell in den Mund. Kurz darauf sind die Augen der Frauen von feuchten Oblaten bedeckt, mutige Atemzüge keuchen, durch längliche Fenster mit Glasmalerei stechen Lichtpfeile in den Raum hinein. Die Frauen beginnen zu tanzen, sie drehen sich mit erhobenen Händen. Hunderte von Händen flattern in der Luft, Schmetterlinge aus Haut und Knochen, sie wollen etwas greifen. Einige bilden Fäuste, weil sich geöffnete Handflächen schlecht verteidigen können. Man muss sie schließen. Eine Faust denkt wie „Faust“, eine andere schlägt zu. Ein Warenbesitzer soll wie ein Philosoph denken, flüstert mir eine Stimme zu. Ich bemerke, dass einige der Frauen in Wirklichkeit Männer sind. Etwas Weißes, Leichtes wird von Hand zu Hand weitergegeben. Es wandert immer schneller, es wird hin und her geworfen, wie ein Spielball. Habe ich auch eine Hand? Es gibt viele Hände, aber ich kann nicht sagen, welche mir gehört. Ein Ball, weich und lauwarm, frisch gebacken, noch duftend, außen braun, innen weiß. Hände saugen Fett aus dem Ball, er trocknet aus, beginnt zu bröckeln und bricht schließlich auseinander. Weißes Pulver fällt auf meine nackten Füße. Es brennt eiskalt. Weiß wie Schnee, fein wie Sand. Drogen? Eine Stimme liest mir einen Satz von Marx vor: „Brot zum Beispiel in dem Übergang aus der Hand des Bäckers in die Hand des Konsumenten ändert nicht sein Dasein als Brot.“ Ich wundere mich über den Satz und denke, das Brot verändert sich doch in jeder Hand.
Daphne stellt zwei Kaffeetassen auf den Frühstückstisch, der Stoff ihres Morgenmantels riecht frisch, die Marmeladendose trägt die Aufschrift “Kirsch“. Es ist sechs Uhr, das Bett ist schon gemacht, der Deckel des Mülleimers im Innenhof kracht, weggeräumt sind die Spuren der Nacht. Der Naturforscher verlässt das Haus und eilt in das Institut, an dem er seit Jahren die Wirkungen der Abgase auf Bäume untersucht. Er sucht inzwischen, obwohl das nie seine Absicht gewesen ist, nach einer positiven Wirkung der Abgase.
Kaum ist er aus dem Haus, geht Daphne in ihr Schreibzimmer, um zu arbeiten. Sie schreibt an einem Buch über die Figur der Zollbeamten in der Literatur, sie schreibt an dem Schreibtisch, an dem sie studierte, promovierte und jedes Jahr ihre Steuererklärungen schrieb. Wie viele Steuererklärungen werde ich noch in diesem Leben schreiben? Noch über fünfzehn?