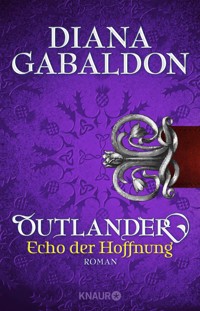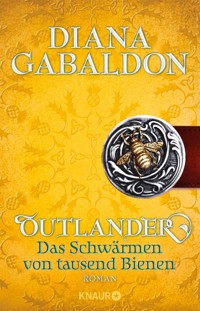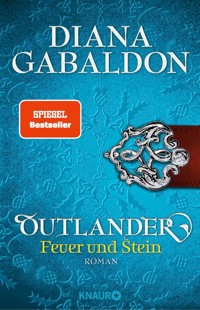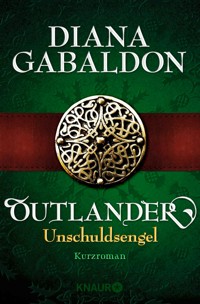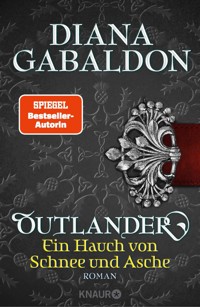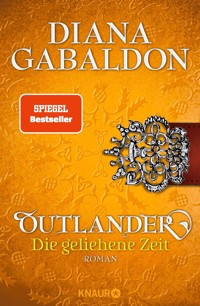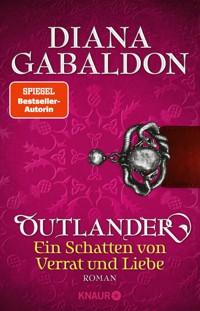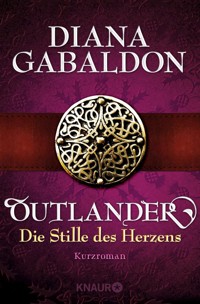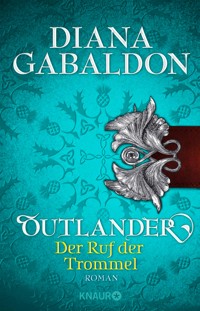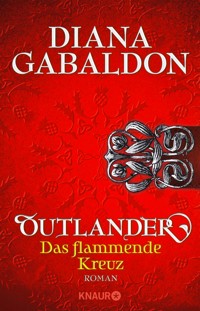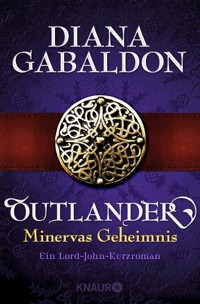
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das Paris des achtzehnten Jahrhunderts birgt mancherlei Geheimnisse … Minerva hat den Auftrag, sie zu lüften. Ein neuer Kurzroman aus der »Outlander«-Saga von Bestseller-Autorin Diana Gabaldon. Paris 1744. Minnie Rennie hilft ihrem Vater bei seiner Arbeit, die darin besteht, die Geheimnisse anderer Menschen zu ergründen - gegen Bezahlung natürlich. Eines Tages bittet ein Kunde sie darum, nach London zu reisen, um eine Intrige aufzudecken. Die verstorbene Ehefrau des dort ansässigen Herzogs soll eine Affäre mit einem anderen Mann gehabt haben, und nun liegt es an Minnie, Beweise dafür zu finden. Bald stößt sie auf einige brisante Briefe der Toten. Doch als sie Graf Harold Meldon kennenlernt, ist ihre Aufmerksamkeit nicht mehr nur auf die Intrige gerichtet … Der Kurzroman »Minervas Geheimnis« ist Teil von Diana Gabaldons opulenter »Outlander«-Saga. Er spielt nach dem zweiten Band »Die Geliehene Zeit«; Sie können ihn aber auch unabhängig davon lesen. »Minervas Geheimnis« sowie sechs weitere Kurzromane der Bestseller-Autorin Diana Gabaldon finden Sie auch in dem Sammelband »Outlander – Im Bann der Steine«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 265
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Diana Gabaldon
Outlander – Minervas Geheimnis
Ein Lord-John-Kurzroman
Aus dem Englischen von Barbara Schnell
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Paris 1744. Minnie Rennie hilft ihrem Vater bei seiner Arbeit, die darin besteht, die Geheimnisse anderer Menschen zu ergründen – gegen Bezahlung natürlich. Eines Tages bittet ein Kunde sie darum, nach London zu reisen, um eine Intrige aufzudecken. Die verstorbene Ehefrau des dort ansässigen Herzogs soll eine Affäre mit einem anderen Mann gehabt haben, und nun liegt es an Minnie, Beweise dafür zu finden. Bald stößt sie auf einige brisante Briefe der Toten. Doch als sie Graf Harold Meldon kennenlernt, ist ihre Aufmerksamkeit nicht mehr nur auf die Intrige gerichtet …
Der Kurzroman »Minervas Geheimnis« ist Teil von Diana Gabaldons opulenter Outlander-Saga. Er spielt nach dem zweiten Band »Die Geliehene Zeit«; Sie können ihn aber auch unabhängig davon lesen.
Inhaltsübersicht
Minervas Geheimnis
1. Kapitel
Überleben
2. Kapitel
Kalter Honig und Sardinen
3. Kapitel
Irische Landstreicher
4. Kapitel
Regimentsangelegenheiten
5. Kapitel
Strategie und Taktik
6. Kapitel
Unerwartete Begegnungen
7. Kapitel
Verkündigung
8. Kapitel
Das Horenbuch
9. Kapitel
Weit nach Mitternacht
10. Kapitel
Es wird ernst
11. Kapitel
Gartenfest
12. Kapitel
Sinnt auf Rache
13. Kapitel
Die Briefe
14. Kapitel
Berüchtigte Kleingeister
15. Kapitel
Einbruch und andere Zerstreuungen
16. Kapitel
Sic transit
17. Kapitel
Mit Glanz und Gloria
18. Kapitel
In den Wind hinaus
Danksagung
Dieses Buch widme ich Karen Henry, Rita Meistrell, Vicki Pack, Sandy Parker und Mandy Tidwell (die ich mit allem Respekt und der größten Dankbarkeit auch meine persönliche Erbsenzählertruppe nenne) für ihre unschätzbare Hilfe beim Aufspüren von Irrtümern, Anschlussfehlern und Kleinkram aller Art.
(Für etwaige verbleibende Fehler ist allein die Autorin verantwortlich, die nicht nur hin und wieder fröhlich die Chronologie ignoriert, sondern sich bisweilen auch ganz bewusst auf Abwege begibt.)
Minervas Geheimnis
1
Überleben
MINNIE RENNIE HATTE GEHEIMNISSE. Manche waren zu verkaufen, und manche gehörten definitiv nur ihr. Sie fasste sich an die Brust ihres Kleides und warf einen Blick auf die Gittertür an der Rückseite des Geschäfts. Nach wie vor geschlossen, die blauen Vorhänge dahinter fest zugezogen.
Auch ihr Vater hatte Geheimnisse; für die Außenwelt handelte Andrew Rennie (wie er sich in Paris nannte) mit seltenen Büchern, privat jedoch war er ein Sammler von Briefen, deren Verfasser davon ausgegangen waren, dass niemand außer dem Adressaten sie je zu lesen bekommen würde. Außerdem verfügte er über einen Vorrat an flüchtigeren Informationen, die er seinen Besuchern mittels einer Kombination aus Tee, Wein, kleinen Geldsummen und seinem beträchtlichen persönlichen Charme entlockte. Minnie vertrug einiges an Wein, hatte kein Geld nötig und war für den Charme ihres Vaters nicht empfänglich. Allerdings hegte sie den für eine Tochter angemessenen Respekt gegenüber seiner Beobachtungsgabe.
Das Stimmengemurmel aus dem Hinterzimmer hatte nicht den Rhythmus des Aufbruchs, es wurden keine Stühle gerückt … Sie huschte durch das mit Büchern vollgestopfte Geschäft zu den Regalen mit den Traktaten und Sermonen hinüber.
Sie zog ein rotes Kalbslederbändchen mit marmorierten Vorsatzblättern und dem Titel Gesammelte Predigten des Reverend George V. Sykes hervor, zog sich den Brief aus dem Ausschnitt, steckte ihn zwischen die Seiten und schob das Buch wieder zurück. Gerade rechtzeitig: Im Hinterzimmer kam Bewegung auf; Tassen wurden abgestellt, Stimmen wurden ein wenig lauter.
Mit klopfendem Herzen warf sie einen erneuten Blick auf Reverend Sykes und sah zu ihrem Entsetzen, dass sie den Staub auf dem Regal berührt hatte – eine Spur führte deutlich auf den ochsenblutroten Lederrücken zu. Sie huschte zur Ladentheke zurück, griff nach dem Staubwedel, der darunter aufbewahrt wurde, und innerhalb weniger Augenblicke war der ganze Bereich abgestaubt.
Sie holte mehrmals tief Luft; sie durfte nicht errötet oder erregt aussehen. Ihr Vater war ein guter Beobachter – eine Eigenschaft, die ihm (wie er oft sagte, wenn er sie in seiner Kunst unterwies) mehr als nur einmal das Leben gerettet hatte.
Aber es war alles gut; der Ton der Stimmen hatte sich erneut verändert – es war noch ein neues Thema aufgekommen.
Äußerlich gefasst, schlenderte sie an den Regalen entlang und hielt inne, um einen Blick auf die unsortierten Bücherstapel zu werfen, die auf einem großen Tisch an der Westwand standen. Kräftiger Tabakduft stieg von den Büchern auf, dazu der übliche Geruch nach Leder, Buckram, Leim, Papier und Druckerschwärze. Diese Sendung hatte eindeutig einem Mann gehört, der sich beim Lesen gern eine Pfeife gönnte. Doch sie schenkte der neuen Ware kaum Beachtung; ihre Gedanken verharrten noch bei dem Brief.
Der Fuhrmann, der diese neue Ansammlung von Büchern geliefert hatte – die Bibliothek eines verstorbenen Geschichtsprofessors aus Exeter –, hatte ihr kopfnickend zugezwinkert, und sie hatte sich mit einem Marktkorb aus dem Haus gestohlen und sich vor einem Obstgeschäft um die Ecke mit dem Mann getroffen. Ein Livre tournois für den Fuhrmann und fünf Sous für ein Körbchen Erdbeeren, dann hatte sie den Brief im Schutz der Gasse lesen können, ehe sie zurück zur Buchhandlung bummelte, die Früchte als Erklärung für ihre Abwesenheit in der Hand.
Keine Anrede, keine Unterschrift, wie sie es erbeten hatte – nur die Information:
Habe sie gefunden, stand da schlicht. Mrs Simpson, Chapel House, Parson’s Green, Peterborough Road, London.
Mrs Simpson.
Es war die Arbeit von Monaten gewesen, Monaten sorgfältiger Planung, unter den Kurieren, die ihr Vater einsetzte, Männer auszuwählen, die vielleicht nicht abgeneigt sein würden, sich etwas nebenbei zu verdienen und noch etwas mehr dafür, dass sie Stillschweigen über ihre Nachforschungen bewahrten.
Sie wusste nicht, was ihr Vater tun würde, falls er herausfand, dass sie nach ihrer Mutter gesucht hatte. Doch er hatte sich die letzten siebzehn Jahre geweigert, auch nur ein Wort über die Frau zu sagen; man durfte davon ausgehen, dass er nicht erfreut sein würde.
Mrs Simpson. Sie sagte es lautlos, erspürte die Silben in ihrem Mund. Mrs Simpson … Hatte ihre Mutter also wieder geheiratet? Hatte sie noch andere Kinder?
Minnie schluckte. Der Gedanke, dass sie Halbbrüder oder -schwestern haben könnte, war erschreckend, faszinierend … und verblüffend schmerzhaft zugleich. Dass womöglich jemand anders all diese Jahre ihre – ihre! – Mutter für sich gehabt hatte …
»Jetzt reicht es aber«, sagte sie, wenn auch kaum hörbar. Sie hatte keine Ahnung von Mrs Simpsons Lebensumständen, und es war unsinnig, ihre Gefühle an etwas zu verschwenden, was womöglich gar nicht existierte. Sie kniff die Augen fest zu, um ihre Gedanken in eine andere Richtung zu lenken, öffnete sie wieder, und plötzlich sah sie es.
Das Tier, das auf einer in Schweinsleder gebundenen Ausgabe des dritten Bandes der Geschichte des Papsttums (Antwerpen) hockte, war so lang wie ihr Daumen und für eine Kakerlake bemerkenswert reglos. Minnies Blick war jetzt schon fast eine Minute lang unbewusst darauf gerichtet, und das Insekt hatte nicht einmal mit dem Fühler gezuckt. Vielleicht war es tot? Sie zog einen abgenutzten Federkiel aus der Sammlung in dem Porzellangefäß und berührte es vorsichtig mit dem spitzen Ende.
Das Tier zischte wie ein Teekessel, und sie stieß einen kleinen Aufschrei aus, ließ den Federkiel fallen und sprang zurück. Die aufgestörte Kakerlake drehte sich schmollend langsam im Kreis, dann ließ sie sich wieder auf dem vergoldeten großen »P« nieder und zog ihre dornigen Beinchen ein, um anscheinend ihr Nickerchen fortzusetzen.
»Oh, das tust du nicht«, sagte sie zu dem Tier und wandte sich den Regalen zu, um etwas zu suchen, das schwer genug war, um es zu zerquetschen, ohne dass man jedoch den Fleck auf dem Umschlag sehen würde. Sie hatte die Hand schon auf einer Vulgata-Bibel mit einem dunkelbraunen Umschlag aus grobnarbigem Leder liegen, als sich die Geheimtür neben den Regalen öffnete und ihren Vater preisgab.
»Oh, du hast Bekanntschaft mit Frederick geschlossen?«, sagte er. Er trat vor und nahm ihr die Bibel aus der Hand. »Keine Sorge, meine Liebe; er ist ganz zahm.«
»Zahm? Wer macht sich denn die Mühe, eine Kakerlake zu dressieren?«
»Die Bewohner von Madagaskar, wurde mir mitgeteilt. Obwohl das Talent erblich ist; unser Frederick entstammt einem alten, edlen Geschlecht zischender Kakerlaken, doch sein Ursprungsland hat er nie betreten. Er ist in Bristol zur Welt gekommen – oder wohl besser geschlüpft.«
Frederick hatte sein Schläfchen unterbrochen, um die Nase neugierig am Daumen ihres Vaters zu reiben, den ihm dieser entgegenstreckte, wie man einem fremden Hund die Fingerknöchel hinhält. Die Kakerlake, die den Geruch anscheinend annehmbar fand, wanderte über den Daumen auf den Handrücken ihres Vaters. Minnie zuckte zusammen und konnte nicht verhindern, dass ihr eine Gänsehaut über die Arme lief.
Mr Rennie bewegte sich vorsichtig auf die großen Regale an der Ostwand zu, die Hand an seine Brust gehoben. Diese Regale enthielten die Bücher, die sich zwar verkaufen ließen, aber weniger wert waren: ein buntes Allerlei von Culpepers Kräuterkunde bis hin zu zerfledderten Shakespeare-Dramen und – mit Abstand am beliebtesten – einer großen Sammlung reißerischer Galgenbekenntnisse diverser Straßenräuber, Mörder, Urkundenfälscher und Gattenmörder. Zwischen den Büchern und Pamphleten war eine Kuriositätensammlung verstreut, von einer Spielzeugkanone aus Bronze und einer Handvoll scharfkantiger Steine, mit denen man angeblich in grauer Vorzeit Felle gegerbt hatte, bis hin zu einem chinesischen Fächer, der erotische Szenen zeigte, wenn man ihn aufklappte. Ihr Vater hob einen aus Weiden geflochtenen Grillenkäfig aus dem Schutt und beförderte Frederick zielsicher hinein.
»Gerade rechtzeitig, alter Freund«, sagte er zu der Kakerlake, die jetzt auf den Hinterbeinen stand und durch das Weidengeflecht hinausblickte. »Da kommt auch schon dein neuer Herr.«
Minerva blickte an ihrem Vater vorbei, und ihr Herz tat einen kleinen Satz; sie erkannte die hochgewachsene, breitschultrige Silhouette, die sich unter dem Türsturz automatisch duckte, um sich nicht den Kopf zu stoßen.
»Lord Broch Tuarach!« Ihr Vater trat freudig lächelnd vor und neigte dem Kunden den Kopf zu.
»Einfach Mr Fraser«, sagte dieser wie immer und streckte die Hand aus. »Euer Diener, Sir.«
Er hatte den Geruch der Straße mit hereingebracht: klebriges Platanenharz, Staub, Dung und Abfall und der allgegenwärtige Pariser Pisseduft, versetzt mit einem Hauch Parfum von den Orangenverkäufern vor dem Theater ein Stück weiter die Straße entlang. Auch seinen eigenen, dunklen Geruch nach Schweiß, Wein und Eichenfässern trug er mit sich; er kam oft aus seinem Lagerhaus. Sie atmete anerkennend ein, dann wieder aus, als er sich lächelnd von ihrem Vater zu ihr umwandte.
»Mademoiselle Rennie«, sagte er mit einem kräftigen schottischen Akzent, der das »R« herrlich rollte. Er schien ein wenig überrascht, als sie ihm die Hand hinhielt, doch er beugte sich pflichtschuldigst darüber und hauchte ihr höflich auf die Fingerknöchel. Wenn ich verheiratet wäre, würde er sie küssen, dachte sie, und ihre Finger drückten unbewusst fester zu. Er blinzelte, als er das spürte, doch er richtete sich auf und verbeugte sich vor ihr, elegant wie ein Höfling.
Ihr Vater räusperte sich leise und versuchte, ihren Blick auf sich zu ziehen, doch sie beachtete ihn nicht, sondern griff nach dem Staubwedel und steuerte dienstbeflissen auf die Regale hinter der Ladentheke zu – welche ausgewählte Erotika aus einem Dutzend Ländern enthielten. Sie wusste genau, was sein Blick gesagt hätte.
»Frederick?«, hörte sie Mr Fraser mit etwas verwunderter Stimme sagen. »Hört er auch auf diesen Namen?«
»Ich … äh … muss zugeben, dass ich ihn noch nie bei Fuß gerufen haben«, erwiderte ihr Vater ein wenig verblüfft. »Aber er ist ganz zahm; er kommt auf Eure Hand.« Offenbar hatte ihr Vater den Grillenkäfig geöffnet, um Fredericks Talente zu demonstrieren, denn sie hörte jemanden leise auf der Stelle treten.
»Nein, spart Euch die Mühe«, sagte Mr Fraser – sein Taufname war James; sie hatte ihn auf einer Verkaufsquittung für ein goldgeprägtes Kalbslederbändchen der Persischen Briefe gelesen – und lachte. »Das Tierchen ist nicht für mich. Ein Herr aus meiner Bekanntschaft sucht ein exotisches Geschenk für seine Mätresse – sie hat ein Faible für Tiere, sagt er.«
Ihr geschultes Ohr nahm das kleine Zögern mühelos wahr, ehe er »Herr aus meiner Bekanntschaft« sagte. Ihrem Vater erging es genauso, denn er lud James Fraser ein, mit ihm Kaffee zu trinken, und im nächsten Moment waren sie beide hinter der Gittertür verschwunden, hinter der sich der persönliche Schlupfwinkel ihres Vaters verbarg, und sie blickte blinzelnd auf Fredericks Stummelfühler, die fragend aus dem Grillenkäfig hervorwinkten, den ihr Vater vor ihr auf dem Regal abgestellt hatte.
»Pack Mr Fraser etwas Proviant zum Mitnehmen ein«, rief ihr Vater ihr durch die Wand zu. »Für Frederick, meine ich.«
»Was frisst er denn?«, rief sie.
»Obst!«, kam es gedämpft zurück, und dann schloss sich eine Tür hinter dem Gitterwerk.
Noch einmal fing sie Mr Frasers Blick auf, als er eine halbe Stunde später ging und ihr zulächelte, während er das Päckchen mit Frederick und seinem Erdbeerfrühstück an sich nahm. Dann duckte er sich wieder unter dem Türsturz hindurch; die Nachmittagssonne glänzte in seinem leuchtenden Haar, und er war fort. Sie stand da und starrte die leere Tür an.
Ihr Vater war ebenfalls aus dem Hinterzimmer gekommen und betrachtete sie nicht ohne Mitgefühl.
»Mr Fraser? Er wird dich niemals heiraten, meine Liebe – er hat eine Frau, noch dazu eine ganz außergewöhnliche Frau. Außerdem ist er zwar der beste der jakobitischen Agenten, doch sein Horizont ist zu begrenzt für dich. Ihm geht es nur um die Stuarts, und die schottischen Jakobiten werden es nie zu etwas bringen. Komm, ich habe etwas mit dir zu besprechen.« Ohne zu warten, wandte er sich ab und steuerte auf die Gitterwand zu.
Eine Frau. Außergewöhnlich also, ja? Das Wort »Frau« versetzte ihr zwar unleugbar einen Hieb in die Magengrube, doch Minnies nächster Gedanke war, dass sie James Fraser ja nicht unbedingt heiraten musste. Und was das »außergewöhnlich« betraf, nun, gewöhnlich war sie selbst wohl auch nicht. Sie wickelte sich eine weizenblonde Haarsträhne um den Finger und steckte sie hinter ihr Ohr.
Dann folgte sie ihrem Vater und fand ihn an dem kleinen Satinholztisch. Die Kaffeetassen waren beiseitegeschoben, und er schenkte Wein aus; er reichte ihr ein Glas und bedeutete ihr mit einem Kopfnicken, sich zu setzen.
»Denk gar nicht daran, Kleine.« Ihr Vater betrachtete sie durchaus wohlgesinnt über sein Glas hinweg. »Wenn du verheiratet bist, kannst du tun, was dir gefällt. Aber du musst dir deine Jungfräulichkeit bewahren, bis wir dich untergebracht haben. Die Engländer sind berüchtigte Kleingeister, was das betrifft, und ich hätte gern einen Engländer für dich.« Sie schnalzte geringschätzig mit den Lippen und trank ein Schlückchen Wein.
»Wie kommst du denn darauf, dass ich nicht schon …?«
Er zog eine Augenbraue hoch und tippte sich an die Nase.
»Ma chère, ich könnte einen Mann auf eine Meile an dir riechen. Und selbst wenn ich nicht hier bin … bin ich hier.« Er zog die andere Augenbraue hoch und sah sie an. Sie rümpfte die Nase, leerte ihr Glas und schenkte sich nach.
Stimmte das? Sie lehnte sich zurück und betrachtete ihn mit sorgsam ausdrucksloser Miene. Sicher, er hatte überall Informanten; wenn sie ihm den ganzen Tag dabei zugehört hatte, wie er hinter der Gittertür seinem Geschäft nachging, träumte sie die ganze Nacht von Spinnen, die in ihren Netzen zugange waren. Spinnend, kletternd, auf der Jagd entlang der glatten Seidenpfade, die versteckt durch die klebrige Masse liefen. Und manchmal hingen sie einfach da, rund wie Murmeln in der Luft, reglos. Mit tausend Augen, die alles beobachteten.
Doch die Spinnen hatten ihre eigenen Interessen, und sie selbst zählte normalerweise nicht dazu. Unvermittelt lächelte sie ihren Vater herzhaft an, und es erfüllte sie mit Genugtuung, Nervosität in seinen Augen aufflackern zu sehen. Sie senkte die Wimpern und vergrub das Lächeln in ihrem Wein.
Er hüstelte.
»Nun«, sagte er und setzte sich aufrecht hin. »Wie würde dir ein Besuch in London gefallen, mein Schatz?«
London …
Sie neigte den Kopf hin und her und überlegte.
»Das Essen ist furchtbar, aber das Bier ist nicht schlecht. Es regnet nur ohne Unterlass.«
»Du könntest ein neues Kleid bekommen.«
Das war interessant – also nicht nur ein Ausflug, um Bücher zu kaufen –, doch sie stellte sich gleichgültig.
»Nur eins?«
»Das hängt ein wenig von deinem Erfolg ab. Möglicherweise wirst du … etwas Besonderes brauchen.«
Bei diesen Worten kribbelte es hinter ihren Ohren.
»Warum gibst du dich mit diesem Unsinn ab?«, wollte sie wissen und stellte ihr Glas hin, dass es knallte. »Du weißt, dass du mich nicht mehr ködern kannst. Sag mir einfach, was du vorhast, dann sprechen wir darüber. Wie rationale Wesen.«
Das brachte ihn zum Lachen, wenn auch nicht ohne Sympathie.
»Du weißt doch, dass Frauen nicht rational sind, oder?«
»Ja. Männer ebenso wenig.«
»Nun, da hast du recht«, räumte er ein und tupfte sich mit einer Serviette einen Tropfen Wein vom Kinn. »Aber sie folgen Mustern. Und bei Frauen sind die Muster …« Er hielt inne und blinzelte über den Goldrand seiner Brille hinweg, während er nach dem Wort suchte.
»Komplexer?«, schlug sie vor, doch er schüttelte den Kopf.
»Nein, nein – oberflächlich betrachtet, erscheinen sie chaotisch, doch eigentlich sind die Muster bei Frauen von brutaler Einfachheit.«
»Wenn du damit den Einfluss des Mondes meinst, möchte ich darauf hinweisen, dass alle Mondsüchtigen, die mir bis jetzt begegnet sind, Männer waren.«
Seine Augenbrauen hoben sich. Sie wurden allmählich dichter, grauer und buschiger; ganz plötzlich sah sie, dass er älter wurde, und ihr Herz setzte einen kleinen Schlag aus.
Er fragte nicht, wie vielen Mondsüchtigen sie schon begegnet war – im Buchgeschäft kamen solche Menschen jede Woche vor –, sondern schüttelte den Kopf.
»Nein, nein, dabei geht es ja nur um Kalenderführung. Ich meine die Muster, die Frauen dazu bringen zu tun, was sie tun. Am Ende geht es dabei immer ums Überleben.«
»Der Tag, an dem ich jemanden heirate, nur um zu überleben …« Sie sparte sich die Mühe, den Satz zu beenden, schnippte aber verächtlich mit den Fingern und erhob sich, um den dampfenden Kessel von der Spirituslampe zu nehmen und die Teekanne neu zu füllen. Zwei Gläser Wein waren für sie die absolute Grenze – vor allem, wenn sie es mit ihrem Vater zu tun hatte –, und heute wollte sie ihren Verstand erst recht beisammenhaben.
»Nun, deine Ansprüche sind höher als die der meisten anderen Frauen.« Ihr Vater nahm die Teetasse entgegen, die sie ihm brachte, und lächelte sie darüber hinweg an. »Und – so schmeichle ich mir – du hast mehr Ressourcen, um ihnen gerecht zu werden. Doch das ändert nichts an der Tatsache, dass du eine Frau bist. Was bedeutet, dass du Kinder empfangen kannst. Und das, meine Liebe, ist der Punkt, an dem das Muster einer Frau wirklich brutal wird.«
»Tatsächlich«, sagte sie, jedoch nicht in einem Ton, der ihn einlud, das Thema zu vertiefen. Sie wollte lieber etwas über London hören. Doch sie würde aufpassen müssen.
»Wonach suchen wir denn?«, fragte sie und schenkte sich ebenfalls Tee ein, um ihren Blick auf die bernsteinfarbene Flüssigkeit heften zu können. »In London, meine ich.«
»Nicht wir«, verbesserte ihr Vater. »Diesmal nicht. Ich habe geschäftlich in Schweden zu tun – wo wir gerade von Jakobiten sprechen. Du …«
»Es gibt schwedische Jakobiten?«
Ihr Vater seufzte und rieb sich mit den Zeigefingern die Schläfen.
»Meine Liebe, du hast gar keine Vorstellung. Sie sprießen wie Unkraut – und wie das Gras im Felde schneidet man sie am Abend und lässt sie welken. Aber gerade, wenn man denkt, dass sie endgültig tot sind, passiert etwas, und plötzlich … aber das betrifft dich nicht. Du sollst einem gewissen Herrn ein Päckchen überbringen und von den Kontaktpersonen auf einer Liste, die ich dir geben werde, Informationen einholen. Du brauchst ihnen keine Fragen zu stellen, nimm einfach nur mit, was auch immer sie herausrücken. Und natürlich …«
»Sag ihnen nichts«, beendete sie. Sie ließ einen Zuckerklumpen in ihren Tee fallen. »Natürlich nicht, Vater; für was für eine Dilettantin hältst du mich?«
Das brachte ihn so sehr zum Lachen, dass seine Augen in den Falten fast verschwanden.
»Eine große anscheinend. Samuel Johnson hat mir erzählt, das Wort kommt von delectare. Freude an etwas haben.«
»Nun, Mr Johnson muss es ja wissen.« Er hörte auf zu lachen, sah aber immer noch belustigt aus. »Korrespondierst du noch mit ihm? Er ist zwar Engländer, aber ganz und gar nicht das, was ich für dich im Sinn habe, meine Kleine. Nicht ganz bei Verstand und völlig mittellos. Außerdem verheiratet«, fügte er fast nebenbei hinzu. »Lebt vom Geld seiner Frau.«
Das überraschte sie, und zwar alles andere als angenehm. Doch ihr Vater war ganz direkt; sein Ton war nicht anders, als wenn er sie in einem wichtigen Aspekt der Arbeit unterwies. Wenn es um die Arbeit ging, gab es zwischen ihnen keine Spitzfindigkeiten, und sie lehnte sich ein wenig zurück und bedeutete ihm mit einem Kopfnicken, dass sie bereit war zuzuhören.
»Also«, sagte ihr Vater und erhob seinen tintenfleckigen Finger, »viele Menschen würden dir wohl sagen, dass Frauen nichts anderes im Kopf haben als Kleider oder was Lady Weroderwas gestern im Salon zu Sir Bumsfidel gesagt hat. Und das mag zwar eine naheliegende Beobachtung sein, aber es ist nur eine Beobachtung. Wenn man so etwas sieht, fragt man sich, was dahintersteckt. Oder vielleicht darunter«, fügte er scharfsinnig hinzu. »Schieb mir den Wein herüber, Liebling. Für heute habe ich genug gearbeitet.«
»Das kann man wohl sagen«, gab sie knapp zurück und stellte die Madeirakaraffe vor ihn hin. Er war den ganzen Morgen unterwegs gewesen – vorgeblich, um Buchverkäufer und Raritätensammler zu besuchen, in Wirklichkeit jedoch, um zu reden … zu reden und zuzuhören. Und bei der Arbeit trank er niemals Alkohol.
Er füllte sein Glas nach und machte Anstalten, auch das ihre vollzuschenken, doch sie schüttelte den Kopf und griff nach der Teekanne. Sie hatte recht gehabt; sie brauchte ihr Urteilsvermögen.
»Da hast du noch ein Frauenmuster«, sagte sie sardonisch. »Frauen können nicht dieselben Mengen trinken wie Männer – aber sie laufen auch viel weniger Gefahr, betrunken zu werden.«
»Du bist eindeutig noch nie nach Sonnenuntergang in der Gropecunt Lane in London gewesen, meine Liebe«, sagte ihr Vater unerschütterlich. »Nicht, dass ich es dir empfehlen würde. Frauen trinken aus den gleichen Gründen wie Männer: um ihre Lebensumstände zu ignorieren oder sich dem Vergessen anheimzugeben. In der passenden Situation wird sich jedes Geschlecht ertränken. Doch Frauen liegt mehr daran zu überleben als Männern. Doch genug geredet – stutze mir eine frische Feder zurecht, meine Liebe, und lass mich dir sagen, mit wem du es in London zu tun bekommst.«
Er griff in eines der kleinen Schubfächer an der Wand und brachte ein kleines Notizbuch zum Vorschein.
»Hast du je vom Herzog von Pardloe gehört?«
Précis: Harold Grey, Herzog von Pardloe
Familiärer Hintergrund: Gerard Grey, Graf von Melton, erhielt den Titel Herzog von Pardloe (mit beträchtlichem Grundbesitz) als Belohnung dafür, dass er ein Regiment aufstellte (46. Infanterie, welche mit Auszeichnung während der Jakobitenrebellionen von 1715 und 1719 diente und in Preston und Sheriffmuir kämpfte). Allerdings geriet die Königstreue des Herzogs unter der Regentschaft von George II. dem Anschein nach ins Wanken, und Gerard Grey wurde der Teilnahme an der Verschwörung von Cornbury verdächtigt. Er entging zwar der Verhaftung, doch eine spätere Verschwörung führte zur Erteilung eines Haftbefehls wegen Hochverrats gegen ihn. Als er dies erfuhr, erschoss sich Pardloe im Konservatorium seines Landhauses, ehe die Verhaftung durchgeführt werden konnte.
Nach dem Tod seines Vaters erbte Pardloes ältester Sohn Harold Grey im Alter von einundzwanzig den Titel. Der Titel stand ihm zwar offiziell zu, doch für Grey war es der Titel eines Verräters, und er weigerte sich, ihn zu tragen. Stattdessen zog er es vor, sich mit dem älteren Familientitel ansprechen zu lassen, Graf von Melton. Hochzeit mit Esmé Dufresne (einer jüngeren Tochter des Marquis de Robillard) kurz vor dem Selbstmord seines Vaters.
Der gegenwärtige Herzog hat jegliche Andeutungen möglicher Verbindungen mit den Jakobiten (notwendigerweise) öffentlich von sich gewiesen, doch das bedeutet nicht, dass sie ihm nicht dennoch weiter anhaften oder dass seine Äußerungen seine wahren Ansichten widerspiegeln. In manchen Kreisen herrscht beträchtliches Interesse an seinen politischen Sympathien und Verbindungen, und etwaige Briefe, Informationen über Begegnungen mit verdächtigen Personen (Liste beiliegend) oder vertrauliche Konversationen, die auf jakobitische Sympathien hindeuten würden, wären von Wert.
Précis: Sir Robert Abdy, Baronet
Trat die Titelfolge im Alter von drei Jahren an und lebte zwar persönlich (bedauerlicherweise) ein tugendsames Leben, ließ sich aber tief in die jakobitische Politik hineinziehen und war letztes Jahr so unklug, eine Petition an Louis von Frankreich zu unterzeichnen, um diesen zu einer französischen Invasion Britanniens zwecks Unterstützung einer Wiedereinsetzung der Stuarts zu drängen. Überflüssig zu sagen, dass dies in Britannien nicht allgemein bekannt ist und dass es keine gute Idee wäre, es Sir Robert gegenüber direkt zu erwähnen. Du solltest auch nicht auf ihn zugehen, obwohl er gesellschaftlich aktiv ist und du ihm möglicherweise begegnen wirst. Falls ja, interessieren wir uns besonders für seinen gegenwärtigen Umgang – erst einmal nur Namen. Abstand wahren.
Précis: Henry Scudamore, Herzog von Beaufort
Der viertreichste Mann in England und ebenfalls Unterzeichner der französischen Petition. Häufig in der Gesellschaft zu sehen, wo er kein Geheimnis aus seinen politischen Sympathien macht.
Sein Privatleben ist viel weniger tugendsam als Sir Roberts, fürchte ich. Nachdem er durch einen Parlamentserlass den Zunamen seiner Frau angenommen hat, hat er sie letztes Jahr wegen Ehebruchs verklagt (wahr: Sie hatte eine außereheliche Affäre mit William Talbot, dem Erben des Grafen Talbot, und sie war nicht um Diskretion bemüht). Die Dame – ihr Name ist Frances – hat prompt die Gegenklage eingereicht mit der Begründung, der Herzog sei impotent. Der Herzog, seinerseits nicht schüchtern, hat vor mehreren vom Gericht einbestellten Gutachtern demonstriert, dass er zu einer Erektion durchaus imstande war; er hat seine Scheidung gewonnen und genießt nun vermutlich seine Freiheit.
Abstand wahren. Vorerst nur Partner und Namen.
Précis: Mr Robert Willimot
Bürgermeister von London bis 1741. Gegenwärtige Verbindungen zu …
2
Kalter Honig und Sardinen
DAS ZIMMER ROCH NACH welken Blumen. Es regnete stark; dennoch packte Hal den Fensterrahmen und ruckte daran. Dennoch blieb das Fenster geschlossen; das Holz war von der Feuchtigkeit aufgequollen. Er versuchte es noch zweimal, dann blieb er schwer atmend stehen.
Das Bimmeln der kleinen Uhr auf dem Kaminsims brachte ihm zu Bewusstsein, dass er seit einer Viertelstunde mit halb offenem Mund vor dem Fenster stand und sich nicht entscheiden konnte, ob er einen Bediensteten rufen sollte, um das verdammte Ding zu öffnen, oder ob er es einfach mit der Faust einschlagen sollte.
Er wandte sich ab, und da ihm kalt war, steuerte er instinktiv auf das Feuer zu. Seit er sich dazu gezwungen hatte, das Bett zu verlassen, fühlte er sich, als wate er durch kalten Honig, und jetzt ließ er seine müden Knochen in den Sessel seines Vaters fallen.
Der Sessel seines Vaters. Verflucht. Er schloss die Augen und versuchte, den Willen aufzubringen, sich zu erheben und zu gehen. Das Leder war kalt und steif unter seinen Fingern, unter seinen Beinen, hart an seinem Rücken. Keinen Meter weiter konnte er das Feuer im Kamin spüren, doch die Wärme drang nicht bis zu ihm.
»Ich bringe Euch Euren Kaffee, Mylord.« Nasonbys Stimme durchschnitt den kalten Honig zusammen mit dem Kaffeeduft. Hal öffnete die Augen. Der Bedienstete hatte das Tablett bereits auf dem kleinen Intarsientisch abgestellt und war dabei, die Löffel zurechtzulegen, den Deckel vom Zuckerschälchen abzunehmen und die Zange perfekt zu arrangieren, mit sanfter Hand die Serviette zu entfernen, die um den Krug mit der warmen Milch gefaltet war – die Sahne befand sich in einem identischen Krug am anderen Ende, wo sie kalt blieb. Die Symmetrie und Nasonbys ruhige, gekonnte Bewegungen wirkten beruhigend.
»Danke«, brachte er heraus und wies Nasonby mit einer kleinen Geste an, sich um die Details zu kümmern. Nasonby leistete der Geste Folge, und die Tasse wurde ihm in die reglosen, wartenden Hände gedrückt. Er trank einen Schluck – perfekt, sehr heiß, aber doch nicht so, dass er sich den Mund verbrannte, süß und milchig – und nickte. Nasonby verschwand.
Eine kleine Weile konnte er einfach nur Kaffee trinken. Er brauchte nicht zu denken. Nach der Hälfte der Tasse zog er es in Betracht, aufzustehen und sich auf einen anderen Sessel zu setzen, doch inzwischen hatte sich das Leder gewärmt und an seinen Körper geschmiegt. Fast konnte er sich die Berührung seines Vaters auf seiner Schulter einbilden, das kurze Zudrücken, mit dem der Herzog seine Zuneigung zu seinen Söhnen gezeigt hatte. Verdammt. Es schnürte ihm plötzlich die Kehle zu, und er stellte die Tasse hin.
Wie mochte es John gehen?, fragte er sich. Gewiss war er in Aberdeen hinreichend sicher. Dennoch, er sollte seinem Bruder schreiben. Ihr Vetter Kenneth und ihre Cousine Eloise waren derart engstirnige, strenge Presbyterianer, dass nicht einmal ein Kartenspiel für sie infrage kam und sie am Sabbat keine andere Tätigkeit zuließen als das Lesen der Bibel.
Ein einziges Mal hatten er und Esmé sie besucht. Eloise hatte Esmé höflich gebeten, ihnen nach dem faden Abendessen aus Hammelbraten und Rübenpüree vorzulesen. Ohne den Text des Tages zu beachten, der mit einem handgearbeiteten Spitzenbändchen gekennzeichnet war, hatte Em munter in dem Buch geblättert und sich für die Geschichte von Jephthah entschieden, welcher geschworen hatte, wenn ihm der Herr den Sieg über die Ammoniter gewähren würde, diesem das Erste zu opfern, was ihn bei seiner Heimkehr begrüßte.
»Tatsächlich«, sagte Esmé mit einem Hauch von französischer Attitüde. Sie hob stirnrunzelnd den Blick. »Was, wenn es sein Hund gewesen wäre? Was meinst du, Mercy«, sagte sie an Hals zwölfjährige Nichte Mercy gewandt. »Wenn dein Papa eines Tages nach Hause käme und verkünden würde, dass er den kleinen Jasper umbringen würde«, beim Klang seines Namens blickte der Spaniel von seiner Matte auf, »nur weil er es Gott versprochen hätte, was würdest du tun?«
Mercy bekam vor Schreck große Augen, und ihre Unterlippe zitterte, als sie den Hund ansah.
»Aber … aber … das würde er nicht tun«, sagte sie. Doch dann sah sie ihren Vater an, Zweifel in den Augen. »Oder, Papa?«
»Aber wenn du es Gott versprochen hättest?«, wandte Esmé helfend ein und blickte ihn mit ihren großen blauen Augen an. Hal hatte zwar seine Freude an Kenneths Gesichtsausdruck, doch Eloise wurde allmählich rot, also hüstelte er – und sagte dann mit dem ausgeprägten, berauschenden Gefühl, als steuerte er eine Kutsche über eine Klippe: »Aber Jephthah ist nicht seinem Hund begegnet, oder? Was ist wirklich geschehen? Ruf es mir ins Gedächtnis – es ist eine Weile her, dass ich das Alte Testament gelesen habe.« Tatsächlich hatte er es noch nie gelesen, doch Esmé las gern darin und erzählte ihm die Geschichten – mit ihren eigenen unnachahmlichen Kommentaren.
Esmé hatte es sorgsam vermieden, ihn anzusehen, und stattdessen mit vorsichtigen Fingern die Seite gewendet und sich geräuspert.
»Da nun Jephthah kam gen Mizpa zu seinem Hause, siehe, da geht seine Tochter heraus ihm entgegen mit Pauken und Reigen; und sie war sein einziges Kind, und er hatte sonst keinen Sohn noch Tochter.
Und da er sie sah, zerriss er seine Kleider und sprach: Ach, meine Tochter, wie beugst du mich und betrübst mich! Denn ich habe meinen Mund aufgetan gegen den Herrn und kann’s nicht widerrufen.
Sie aber sprach: Mein Vater, hast du deinen Mund aufgetan gegen den Herrn, so tue mir, wie es aus deinem Mund gegangen ist, nachdem der Herr dich gerächt hat an deinen Feinden, den Kindern Ammons.
Und sie sprach zu ihrem Vater: Du wollest mir das tun, dass du mir lassest zwei Monate, dass ich von hinnen hinabgehe auf die Berge und meine Jungfrauschaft beweine mit meinen Gespielen.
Er sprach: Gehe hin!, und ließ sie zwei Monate gehen. Da ging sie hin mit ihren Gespielen und beweinte ihre Jungfrauschaft auf den Bergen.
Und nach zwei Monaten kam sie wieder zu ihrem Vater. Und er tat ihr, wie er gelobt hatte; und sie war nie eines Mannes schuldig geworden. Und es ward eine Gewohnheit in Israel, dass die Töchter Israels jährlich hingehen zu klagen vier Tage um die Tochter Jephthahs, des Gileaditers.«
Dann hatte sie gelacht und das Buch geschlossen.
»Ich glaube nicht, dass ich meine Jungfrauschaft lang beweint hätte. Ich wäre ohne sie nach Hause gekommen …« Jetzt hatte sie ihm in die Augen gesehen, und ihr Funke hatte sein Inneres in Flammen gesetzt. »Dann hätten wir ja gesehen, ob mein lieber Papa mich noch als geeignetes Opfer betrachtet hätte.«