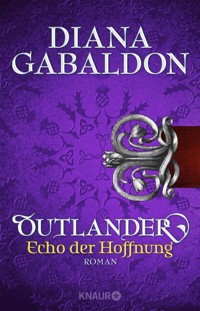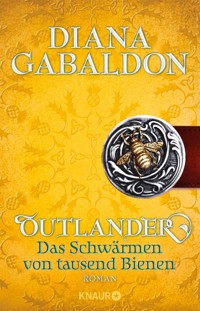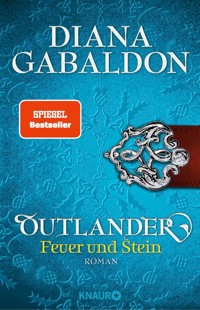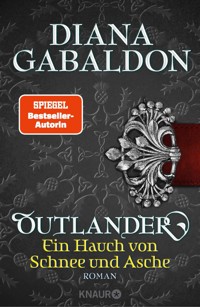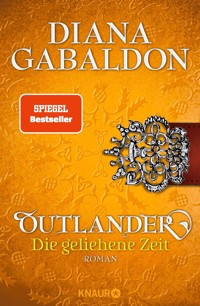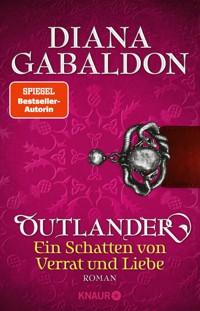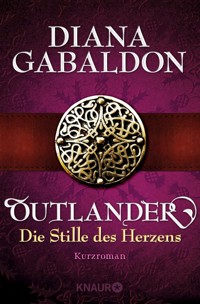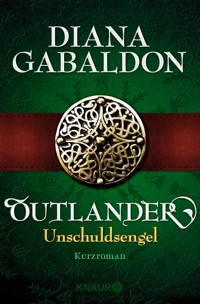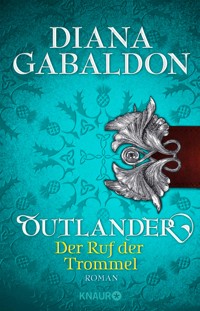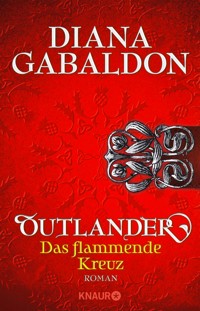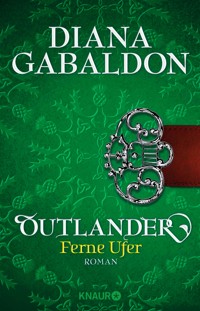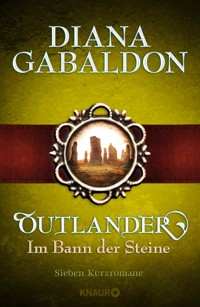
16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Outlander-Saga
- Sprache: Deutsch
Deutschlandpremiere: Die sieben wichtigsten Kurzromane aus der Outlander-Reihe von Diana Gabaldon erstmals in einem Band. "Outlander – Im Bann der Steine" enthält folgende Kurzromane der Bestseller-Autorin: - Lord John und der Usus der Armee - Die Stille des Herzens - Lord John und der Herr der Zombies - Wie ein Blatt im Wind - Unschuldsengel - Minervas Geheimnis - Die Kanonen von El Morro Der New-York-Times-Bestseller erscheint endlich auf Deutsch und bringt die Figuren aus Diana Gabaldons Outlander-Reihe zurück: In sieben Abenteuern – zwei davon bislang unveröffentlicht – stürzen Sie mit dem Weltkriegs-Flieger Jerry MacKenzie durch die Steine, erfahren, wie die Spionin Minnie Rennie im Herzog von Pardloe ihren Meister findet, begleiten den jungen Jamie Fraser nach Frankreich und reisen mit Lord John Grey von Kanada über Jamaica bis ins belagerte Havanna. Jeder der sieben Kurzromane spielt zu einer anderen Zeit und an einem anderen Ort, und doch sind sie alle mit jener epischen Saga verbunden, die 1946 in Schottland beginnt, als Claire Randall in den magischen Steinkreis tritt und im Jahre 1743 erwacht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1116
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Diana Gabaldon
Outlander – Im Bann der Steine
Sieben Kurzromane
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Treten Sie in den magischen Steinkreis …
In sieben Abenteuern stürzen Sie mit dem Weltkriegsflieger Jerry MacKenzie durch die Steine, erfahren, wie die Spionin Minnie Rennie im Herzog von Pardloe ihren Meister findet, begleiten den jungen Jamie Fraser nach Frankreich und reisen mit Lord John Grey von Kanada über Jamaica bis ins belagerte Havanna.
Jeder der sieben Kurzromane spielt zu einer anderen Zeit und an einem anderen Ort, und doch sind sie alle mit jener epischen Saga verbunden, die 1946 in Schottland beginnt, als Claire Randall in den Bann der Steine gezogen wird und im Jahre 1743 erwacht.
Fünf Klassiker und zwei brandneue Kurzromane aus der Welt von Outlander!
Inhaltsübersicht
Einleitung – Die Chronologie der Outlander-Bücher
Lord John und der Usus der Armee
Die Stille des Herzens
Lord John und der Herr der Zombies
Wie ein Blatt im Wind
Unschuldsengel
Minervas Geheimnis
1. Kapitel
Üverleben
2. Kapitel
Kalter Honig und Sardinen
3. Kapitel
Irische Landstreicher
4. Kapitel
Regimentsangelegenheiten
5. Kapitel
Strategie und Taktik
6. Kapitel
Unerwartete Begegnungen
7. Kapitel
Verkündigung
8. Kapitel
Das Horenbuch
9. Kapitel
Weit nach Mitternacht
10. Kapitel
Es wird ernst
11. Kapitel
Gartenfest
12. Kapitel
Sinnt auf Rache
13. Kapitel
Die Briefe
14. Kapitel
Berüchtigte Kleingeister
15. Kapitel
Einbruch und andere Zerstreuungen
16. Kapitel
Sic transit
17. Kapitel
Mit Glanz und Gloria
18. Kapitel
In den Wind hinaus
Die Kanonen von El Morro
Danksagung
Dieses Buch widme ich Karen Henry, Rita Meistrell, Vicki Pack, Sandy Parker und Mandy Tidwell (die ich mit allem Respekt und der größten Dankbarkeit auch meine persönliche Erbsenzählertruppe nenne) für ihre unschätzbare Hilfe beim Aufspüren von Irrtümern, Anschlussfehlern und Kleinkram aller Art.
(Für etwaige verbleibende Fehler ist allein die Autorin verantwortlich, die nicht nur hin und wieder fröhlich die Chronologie ignoriert, sondern sich bisweilen auch ganz bewusst auf Abwege begibt.)
Einleitung Die Chronologie der Outlander-Bücher
FALLS SIE DIESES BUCH in der irrigen Annahme erworben haben, dass es der neunte Outlander-Roman ist – das ist es nicht. Ich bitte um Entschuldigung.
Aber wenn es nicht der neunte Roman ist, was ist es dann? Nun, es ist eine Sammlung von sieben … äh … Werken unterschiedlichen Inhalts und unterschiedlicher Länge, die aber alle mit dem Outlander-Universum zu tun haben.
Fünf der Kurzromane in diesem Buch sind bereits in anderer Form auf Deutsch erschienen; zwei sind brandneu und bis dato unveröffentlicht: »Minervas Geheimnis« und »Die Kanonen von El Morro«.
Da diese Kurzromane an unterschiedlichen Stellen zur Geschichte der Romane gehören, finden Sie hier eine vollständige Chronologie der Outlander-Reihe(n), um Ihnen das Wer, Was und Wann zu erklären.
Die Outlander-Bücher umfassen drei Arten von Erzählungen:
Die enormen Wälzer, die in kein erkennbares (oder jedes bekannte) Genre passen.
Die kürzeren, nicht ganz so unbeschreiblichen Romane, die mehr oder weniger historische Krimis sind (auch wenn es darin außerdem um Schlachten, Aale und nicht ganz konventionelle Sexpraktiken geht).
Und: Die Beulen, kurze (oder kürzere) Texte, die irgendwo in die Handlung der Romane gehören, ähnlich wie ein sich windendes Beutetier, das von einer Schlange verschluckt wurde. Diese befassen sich häufig – aber nicht ausschließlich – mit Nebenfiguren, sind Vorgeschichte oder Fortsetzung und/oder füllen eine Lücke in der ursprünglichen Handlung.
Also. Die meisten der kürzeren Romane haben ihren Platz in einer großen Lücke, die in der Mitte von Ferne Ufer geblieben ist, in der Zeit von 1756 bis 1761. Auch einige der Beulen gehören in diesen Zeitraum, andere nicht.Um den Lesern die Orientierung zu erleichtern, folgt an dieser Stelle eine detaillierte Chronologie der einzelnen Elemente im Rahmen der Handlung. Allerdings möchte ich anmerken, dass die kürzeren Romane und die Kurzgeschichten alle so angelegt sind, dass man sie für sich lesen kann, ohne ihren Zusammenhang untereinander oder im Gefüge der enormen Wälzer zu berücksichtigen – falls Sie in der Stimmung für eine leichte literarische Zwischenmahlzeit sind statt des Neun-Gänge-Menüs mit passendem Wein und Dessert-Buffet.
UNSCHULDSENGEL (Kurzroman aus Im Bann der Steine) – Diese Jahre nach dem ersten Roman veröffentlichte Kurzgeschichte entführt die Leser nach Frankreich, wohin sich Jamie mit neunzehn vor den Nachstellungen Jonathan Randalls geflüchtet hat und wo er gemeinsam mit seinem besten Freund Ian als Söldner dient. (1740)
FEUER UND STEIN (Roman) – Wenn Sie die Serie noch gar nicht kennen, schlage ich vor, mit diesem Buch anzufangen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob es etwas für Sie ist, schlagen Sie das Buch irgendwo auf, und lesen Sie drei Seiten; wenn Sie es wieder weglegen können, bekommen Sie von mir einen Dollar. (1946/1743)
FEUER UND STEIN (Graphic Novel) – Einen etwas anderen Blickwinkel auf die Ereignisse zu Beginn der Saga eröffnet die Graphic Novel, die die Geschichte in Han Nguyens wunderschönen Illustrationen aus Jamies und Murtaghs Sicht erzählt. (1743)
DIE GELIEHENE ZEIT (Roman) – Es fängt nicht da an, wo Sie glauben, dass es anfangen wird. Und es endet auch nicht so, wie Sie glauben. Lesen Sie einfach; alles wird gut. (1968/1744–1746)
MINERVAS GEHEIMNIS (Kurzroman aus Im Bann der Steine) – Diese Geschichte spielt 1744/45 in Paris, London und Amsterdam und erzählt die Geschichte von Lord Johns älterem Bruder Hal (Graf Harold Melton, Herzog von Pardloe) und seiner (späteren) Frau Minnie, die zum Zeitpunkt der Handlung siebzehn ist, mit Bücher-Raritäten handelt und sich mit Urkundenfälschung, Erpressung und Einbrüchen etwas dazuverdient. Jamie Fraser kommt ebenfalls darin vor.
FERNE UFER (Roman) – Dieses Buch bekam von Entertainment Weekly einen Preis für den besten Anfang verliehen (damit Sie jetzt nicht Ihr Buch suchen müssen; der Satz lautet: »Er war tot. Allerdings pochte es schmerzhaft in seiner Nase, was ihm unter den Umständen seltsam erschien.«) Wenn Sie die Serie der Reihe nach lesen, sollten Sie dieses Buch lesen, ehe Sie die kürzeren Erzählungen angehen.(1968/1746–1767)
DIE FLAMMEN DER HÖLLE (Kurzgeschichte aus Die Hand des Teufels) – Um die Verwirrung noch etwas zu vergrößern, haben wir es bei Die Hand des Teufels mit einem Buch zu tun, das drei Kurzgeschichten enthält. Die erste – Die Flammen der Hölle – spielt 1757 in London und handelt von einem rothaarigen Mann, der sich mit einer dringenden Bitte um Hilfe an Lord John wendet und kurz darauf vor seinen Augen stirbt.
DAS MEER DER LÜGEN (Roman) – Historischer Krimi, der 1758 in London spielt, von Blut und anderen, noch unappetitlicheren Substanzen trieft und in dem Lord John (in rascher Folge) Bekanntschaft mit einem Kammerdiener, einem Verräter, einem Apotheker mit einem sicheren Heilmittel für die Syphilis, einem anmaßenden Deutschen und einem skrupellosen reichen Kaufmann schließt.
DER MAGISCHE PAKT (Kurzgeschichte aus Die Hand des Teufels) – Geschichte Nummer zwei, in der wir Lord John 1757 in Deutschland begegnen, wo ihn beunruhigende Träume von Jamie Fraser heimsuchen, wo ihm beunruhigende Begegnungen mit sächsischen Prinzessinnen und Nachtmahren widerfahren und ein verstörendes Zusammentreffen mit einem hünenhaften blonden Grafen aus Hannover.
DIE SÜNDE DER BRÜDER (Roman) – Der zweite Roman um Lord John (in dem allerdings auch Jamie Fraser vorkommt) handelt 1758, befasst sich mit einem zwanzig Jahre alten Familienskandal und konfrontiert Lord John mit explodierenden Kanonen und noch explosiveren Emotionen.
DER GEISTERSOLDAT (Kurzgeschichte aus Die Hand des Teufels) – Geschichte Nummer drei spielt 1758 in London, wo Lord John vor Gericht Rede und Antwort über die erwähnte explodierte Kanone stehen muss und begreift, dass es auf der Welt Dinge gibt, die gefährlicher sind als Schießpulver.
LORD JOHN UND DER USUS DER ARMEE (Kurzroman aus Im Bann der Steine) – Eine Kurzgeschichte, in der Seine Lordschaft 1759 in London einem Zitteraal zu nahe kommt und sich in der Schlacht um Quebec wiederfindet. Er hat einfach ein Händchen für solche Dinge.
DIE FACKELN DER FREIHEIT (Roman) – Dieses Buch spielt 1760 im Lake District, in London und in Irland. Eine Art Hybrid-Roman, der zu gleichen Teilen von Jamie Fraser und Lord John handelt. Aus ihren unterschiedlichen Perspektiven erzählen sie eine Geschichte über Politik und Korruption, Mord und Opiumträume, Pferde und uneheliche Söhne.
LORD JOHN UND DER HERR DER ZOMBIES (Kurzroman aus Im Bann der Steine) – 1761 erteilt man Lord John auf Jamaica das Kommando über ein Bataillon, um einen Sklavenaufstand zu beenden. Er entwickelt bisher ungeahnte Sympathien für Schlangen, Küchenschaben und Zombies.
DIE KANONEN VON EL MORRO (Kurzroman aus Im Bann der Steine) – Spielt 1762 auf Jamaica und in Havanna. Lord John, der im Begriff ist, seinen Posten als Militärgouverneur Jamaicas aufzugeben, erfährt, dass sich seine Mutter in Havanna auf Kuba befindet. Was nicht schlimm wäre, wäre nicht die britische Marine auf dem Weg, die Stadt zu belagern. Mithilfe seines Leibdieners Tom Byrd, eines ehemaligen Zombies namens Rodrigo und seiner mörderisch veranlagten Ehefrau Azeel sticht Lord John in See, um die ehemalige Herzogin von Pardloe zu retten, ehe die Kriegsschiffe eintreffen.
DER RUF DER TROMMEL (Roman) – Dieses Buch beginnt 1767 in der Neuen Welt, wo Jamie und Claire in den Bergen von North Carolina Fuß fassen … und ihre Tochter Brianna reichlich Unerwartetes erlebt, als ein unheilvoller Zeitungsausschnitt sie dazu bringt, sich auf die Suche nach ihren Eltern zu machen. (1969–1971/1767–1770)
DAS FLAMMENDE KREUZ (Roman) – Dieses Buch spielt vor dem historischen Hintergrund des Regulatorenkriegs in North Carolina, der eine Art Generalprobe für die bevorstehende Revolution war – und in welchem Jamie Fraser zum Rebellen wider Willen wird, seine Frau Claire zur Kräuterheilerin avanciert und sich ihr Enkel Jeremiah mit Kirschlikör betrinkt. Auf Briannas Ehemann wartet ein deutlich schlimmeres Schicksal, aber das verrate ich hier nicht. Dieses Buch hat mehrere Preise für den »Besten Schluss-Satz« gewonnen, aber den verrate ich hier auch nicht. (1770–1772)
EIN HAUCH VON SCHNEE UND ASCHE (Roman) – Gewinner der »Corine 2006« für den besten Roman sowie eines »Quill Awards« (dieses Buch hat Romane von George R.R. Martin und Stephen King aus dem Rennen geschlagen, was ich sehr amüsant fand). Jedes der Bücher hat eine innere »Form«, die ich beim Schreiben vor mir sehe. Dies hier sieht aus wie die Hokusai-Zeichnung mit dem Titel »Die große Welle von Kanagawa«. Nicht ein Tsunami – sondern zwei. (1979/1773–1776)
ECHO DER HOFFNUNG (Roman) – Dieses Buch spielt in Amerika, London, Kanada und Schottland. Die Illustration auf dem Titel dieses Buches spiegelt seine innere Form wider: Es ist ein Krähenfuß, ein althergebrachter militärischer Ausrüstungsgegenstand, der schon in der Antike gegen angreifende Elefanten benutzt wurde und heute noch von der Highwaypolizei eingesetzt wird, um Fluchtfahrzeuge aufzuhalten. Ein solcher Krähenfuß hat vier spitze Enden, genau wie dieses Buch: Jamie und Claire, Roger und Brianna (und Familie), Lord John und William und schließlich Ian junior. Sein Knotenpunkt ist die Amerikanische Revolution. (1980/1777–1778)
DIE STILLE DES HERZENS (Kurzroman aus Im Bann der Steine) – Diese Geschichte spielt 1778 zum Großteil in Paris und handelt von Michael Murray (Ians älterem Bruder), Joan MacKimmie (Marsalis jüngerer Schwester), dem Comte St. Germain (also doch nicht tot), Mutter Hildegarde und einigen anderen alten Bekannten.
EIN SCHATTEN VON VERRAT UND LIEBE (Roman) – Band acht der Highland-Saga setzt die Handlung an den brisanten Punkten fort, an denen Echo der Hoffnung im Sommer 1778 und im Herbst 1980 endete.
WIE EIN BLATT IM WIND (Kurzroman aus Im Bann der Steine) – Diese Geschichte spielt (zum Großteil) 1941–1943 und handelt davon, was tatsächlich aus Roger MacKenzies Eltern geworden ist.
Also, vergessen Sie nicht …
Sie können die kürzeren Romane und Erzählungen in jeder beliebigen Reihenfolge lesen. Ich würde Ihnen aber empfehlen, die enormen Wälzer der Reihe nach zu lesen.
Lord John und der Usus der Armee
ZU DEN FREUDEN des Verfassens historischer Romane gehört es, dass die besten Teile nicht erfunden sind. Diese Geschichte war das Resultat der Tatsache, dass ich Wendy Moores hervorragende Biografie des Arztes Dr. John Hunter gelesen habe und gleichzeitig ein Faksimilebüchlein über die Dienstvorschriften der britischen Armee während der Amerikanischen Revolution.
Eigentlich habe ich in beiden Büchern nichts Bestimmtes gesucht, sondern habe sie nur als allgemeine Quellen zur Zeitgeschichte gelesen – natürlich immer mit einem offenen Auge für faszinierende Dinge wie die Zitteraalpartys in London, die – genau wie Dr. Hunter selbst – historisch verbrieft sind.
Was die Dienstvorschriften betrifft, so muss man als Schriftsteller der Versuchung widerstehen, den Leuten Dinge zu erzählen, nur weil man sie weiß. Doch auch dieses Buch enthielt Kleinigkeiten wie die Information, dass das Wort »Bombe« im achtzehnten Jahrhundert durchaus gebräuchlich war und was damit gemeint war: nicht nur eine Explosionswaffe, sondern ebenso ein in geteertes Tuch gewickeltes Schrapnellpaket, das aus einer Kanone abgeschossen wurde (obwohl wir darauf achten müssen, das Wort Schrapnell zu vermeiden, da es seinen Namen von Lt. Henry Shrapnel von der Königlichen Artillerie hat, der die ursprüngliche »Bombe« zum »Schrapnellgeschoss« weiterentwickelte, einer Bombe voller Splitter, die außerdem Schwarzpulver enthielt und nach dem Abfeuern in der Luft explodierte. Dummerweise hat er das 1784 getan, was schade ist, weil Schrapnell ein toller Begriff ist, wenn man über den Krieg schreibt).
Unter vielen anderen Details fiel mir eine kurze Beschreibung des Prozederes bei einem Kriegsgericht ins Auge:
»Es ist der Usus der Armee, dass der Vorsitz eines Kriegsgerichts aus einem ranghohen Offizier und einer Anzahl weiterer Offiziere besteht, die dieser für geeignet befindet, das Gericht zu bilden, im Allgemeinen vier an der Zahl, möglicherweise mehr, jedoch nicht weniger als drei. Die angeklagte Person soll das Recht haben, Zeugen zu ihrer Unterstützung aufzurufen, und das Gericht soll diese befragen sowie jede andere Person, die es wünscht, und so soll es die Umstände klären und, falls es zu einer Verurteilung kommt, auch die Strafe.«
Das war alles. Keine Richtlinien für den Umgang mit Beweismitteln, keine Maßstäbe für eine Verurteilung, keine Vorgaben über das Strafmaß, keine Anforderungen an die Vorsitzenden eines solchen Gerichts, nur »der Usus der Armee«. Dieser Ausdruck ist offensichtlich bei mir hängen geblieben.
Wenn man es recht bedachte, war wahrscheinlich der Zitteraal daran schuld. Darüber hinaus konnte John Grey das Ganze auch der ehrenwerten Ms Caroline Woodford in die Schuhe schieben – was er eine Zeit lang tat. Und dem Arzt. Und natürlich diesem verflixten Dichter. Dennoch … nein, der Aal war daran schuld.
Die Gesellschaft hatte in Lucinda Joffreys Haus stattgefunden. Sir Richard war abwesend; ein Diplomat seines Standes konnte einer solchen Frivolität niemals seinen Segen geben. Zitteraalgesellschaften waren in London der letzte Schrei, doch da die Tiere sehr selten waren, waren es solche privaten Zusammenkünfte ebenso. Die meisten dieser Ereignisse fanden in öffentlichen Theatern statt. Hier rief man die wenigen Glücklichen, die auserwählt wurden, dem Aal näher zu begegnen, auf die Bühne, wo sich dann das Publikum daran ergötzte, wie sie einen Schlag bekamen und dann wie getroffene Kegel umhertorkelten.
»Der Rekord liegt bei zweiundvierzig auf einmal!«, hatte ihm Caroline erzählt, und ihre großen Augen hatten geglänzt, als sie von dem Tier in dem Wasserbassin aufblickte.
»Tatsächlich?« Es war eins der merkwürdigsten Geschöpfe, die er je gesehen hatte, auch wenn es eigentlich eher unauffällig aussah. Es war an die neunzig Zentimeter lang, und es hatte einen schwerfälligen, kantigen Körper mit einem stumpfen Kopf, der aussah wie von unkundiger Hand aus Ton geformt, und winzige Augen wie stumpfe Glasperlen. Mit den geschmeidigen, um sich peitschenden Aalen auf dem Fischmarkt hatte es nur wenig gemeinsam – und es erweckte gewiss nicht den Anschein, als könnte es zweiundvierzig Menschen nacheinander auf einen Schlag fällen.
Das Tier hatte nichts Anheimelndes an sich, außer einer kleinen, schmalen Schleierflosse, die ihm über den gesamten Unterkörper lief und sich in Wellen bewegte wie ein Gazevorhang im Wind. Diese Beobachtung teilte Lord John sofort Ms Caroline mit und wurde daraufhin beschuldigt, ein poetisches Wesen zu besitzen.
»Poetisch?«, sagte eine belustigte Stimme hinter ihm. »Kennen die Talente unseres tapferen Majors denn gar keine Grenzen?«
Innerlich grimassierend und äußerlich lächelnd, wandte John sich um und verneigte sich vor Edwin Nicholls.
»Es würde mir niemals einfallen, mich auf Euer Terrain zu wagen, Mr Nicholls«, sagte er höflich. Nicholls schrieb grauenvolle Verse, die sich zumeist mit der Liebe befassten, und er genoss die Bewunderung junger Frauen einer gewissen Geisteshaltung. Ms Caroline zählte nicht zu ihnen; sie hatte sogar eine äußerst gewitzte Parodie seines Stils verfasst, obwohl Grey nicht glaubte, dass Nicholls davon gehört hatte. Zumindest hoffte er es nicht.
»Ach, nein?« Nicholls zog eine honigfarbene Augenbraue hoch und warf Ms Woodford einen kurzen, aber bedeutsamen Blick zu. Sein Ton war scherzhaft, doch sein Blick war es nicht, und Grey fragte sich, wie viel Mr Nicholls wohl schon getrunken haben mochte. Nicholls hatte rote Wangen und glitzernde Augen, doch das konnte genauso gut eine Folge der Wärme im Zimmer sein, die beträchtlich war, und des aufregenden Anlasses.
»Denkt Ihr darüber nach, eine Ode an unseren Freund zu verfassen?«, fragte Grey, ohne Nicholls’ Seitenhieb zu beachten, und zeigte auf das große Wasserbecken mit dem Aal.
Nicholls lachte zu laut – nein, er war wirklich nicht mehr nüchtern – und winkte ab.
»Nein, nein, Major. Wie könnte ich es in Betracht ziehen, meine Energie an eine solch grässliche, bedeutungslose Kreatur zu verschwenden, wo ich doch solch entzückenden Engel zu meiner Inspiration habe.« Er grinste anzüglich – Grey wollte den Mann ja nicht beleidigen, aber es war unleugbar ein anzügliches Grinsen – in Ms Woodfords Richtung, woraufhin diese – mit zusammengekniffenen Lippen – lächelte und ihn tadelnd mit dem Fächer antippte.
Wo war Carolines Onkel?, fragte sich Grey. Simon Woodford teilte das Interesse seiner Nichte an der Naturkunde und hatte sie doch gewiss begleitet … Oh, da! Simon Woodford war in ein Gespräch mit Mr Hunter, dem berühmten Arzt, vertieft – was hatte Lucinda nur bewogen, ihn einzuladen? Dann fiel sein Blick auf Lucinda, die Mr Hunter über ihren Fächer hinweg scharf ansah, und er begriff, dass sie ihn gar nicht eingeladen hatte.
John Hunter war ein berühmter Arzt – und ein berüchtigter Anatom. Dem Gerücht nach schreckte er vor nichts zurück, wenn es darum ging, sich einen besonders begehrenswerten Kadaver zu schnappen – ob menschlich oder nicht. Er verkehrte zwar durchaus in der besseren Gesellschaft, jedoch nicht in den Kreisen der Joffreys.
Lucinda Joffrey hatte Augen, die Bände sprechen konnten. Sie waren das einzig Schöne an ihr, mandelförmig, bernsteinfarben und imstande, bemerkenswert einschüchternde Botschaften durch ein überfülltes Zimmer zu senden.
Hierher!, sagten sie. Grey lächelte und hob ihr das Glas zum Salut entgegen, machte aber keine Anstalten zu gehorchen. Die Augen verengten sich und glitzerten gefährlich, dann nahmen sie abrupt den Arzt ins Visier, der jetzt auf das Wasserbecken zuhielt. Sein Gesicht leuchtete vor Neugier und Sammelleidenschaft.
Die Augen hefteten sich wieder auf Grey.
Seht zu, dass Ihr ihn loswerdet!, sagten sie.
Grey blickte zu Ms Woodford hinüber. Mr Nicholls hatte ihre Hand in die seine genommen und schien irgendetwas zu deklamieren; sie sah so aus, als hätte sie die Hand gern zurück. Grey richtete den Blick erneut auf Lucinda und zuckte mit den Achseln. Er wies mit einer kleinen Geste auf Mr Nicholls’ ocker-samtenen Rücken und drückte ihr so sein Bedauern darüber aus, dass seine Verantwortung seinen Mitmenschen gegenüber ihn daran hinderte, ihren Befehl auszuführen.
»Nicht nur das Gesicht eines Engels«, sagte Nicholls gerade und drückte Carolines Finger so fest, dass sie aufquietschte, »sondern auch die Haut.« Er streichelte ihre Hand, und sein anzüglicher Blick überflog sie noch unverhohlener. »Wie mag ein Engel wohl am Morgen duften, frage ich mich.«
Grey betrachtete ihn nachdenklich von oben bis unten. Noch eine derartige Bemerkung, und er würde möglicherweise gezwungen sein, Mr Nicholls ins Freie zu bitten. Nicholls war hochgewachsen und kräftig, wog einen Viertelzentner mehr als er, und man sagte ihm nach, dass er Streit suchte. Am besten versuche ich zuerst, ihm die Nase zu brechen, dachte Grey, und schubse ihn dann mit dem Kopf voran in eine Hecke. Er wird nicht wieder ins Haus kommen, wenn ich seine Erscheinung verwüste.
»Was schaut Ihr denn so?«, erkundigte sich Nicholls unfreundlich, als er sah, dass Greys Blick auf ihm ruhte.
Lauter Applaus ersparte Grey die Antwort – der Besitzer des Aals rief die Gesellschaft zur Ordnung. Ms Woodford nutzte die Gelegenheit, ihre Hand fortzureißen, und ihre Wangen brannten vor Verlegenheit. Grey trat augenblicklich an ihre Seite und schob ihr die Hand unter den Ellbogen, während er Nicholls mit eisigem Blick fixierte.
»Kommt mit mir, Ms Woodford«, sagte er. »Suchen wir uns einen Platz, von dem wir alles gut beobachten können.«
»Beobachten?«, sagte eine Stimme neben ihm. »Ihr habt doch wohl nicht vor, nur zuzusehen, oder, Sir? Interessiert Euch denn gar nicht, wie es ist, das Phänomen am eigenen Leib auszuprobieren?«
Es war Hunter persönlich. Das buschige Haar ohne große Sorgfalt zusammengebunden, jedoch mit einem anständigen zwetschgenroten Anzug bekleidet, grinste er zu Grey auf; der Arzt war zwar breitschultrig und muskulös, aber nicht sehr groß – keine eins sechzig gegenüber Greys eins siebzig. Offenbar war ihm Greys wortloser Dialog mit Lucinda nicht entgangen.
»Oh, ich denke …«, setzte Grey an, doch Hunter hatte ihn schon am Arm und zog ihn durch die Menge, die sich um das Bassin drängte. Caroline folgte ihm hastig, nachdem ihr alarmierter Blick auf Nicholls’ finsteres Gesicht gefallen war.
»Ich bin sehr neugierig darauf zu erfahren, wie Ihr es empfunden habt«, plauderte Hunter. »Manche Leute berichten von bemerkenswerter Euphorie, momentaner Orientierungslosigkeit … von Kurzatmigkeit oder Schwindel – manchmal auch einem Stechen in der Brust. Ihr habt doch kein schwaches Herz, hoffe ich, Major? Oder Ihr, Ms Woodford?«
»Ich?« Caroline zog ein überraschtes Gesicht.
Hunter verneigte sich vor ihr.
»An Eurer Reaktion wäre ich besonders interessiert, Ma’am«, sagte er respektvoll. »Nur wenige Frauen besitzen den Mut, ein solches Abenteuer zu unternehmen.«
»Sie möchte aber nicht«, warf Grey eilig ein.
»Nun, vielleicht ja doch«, sagte sie und sah ihn mit einem kleinen Stirnrunzeln an, bevor sie den Blick auf das Wasserbecken und die lange graue Silhouette darin richtete. Sie erschauerte sacht – doch Grey, der die Dame schon lange kannte, erkannte darin einen Schauder der Vorfreude, nicht des Ekels.
Mr Hunter sah es ebenfalls. Sein Grinsen wurde breiter, und er verneigte sich erneut und hielt Ms Woodford den Arm hin.
»Gestattet mir, Euch einen Platz zu sichern, Ma’am.«
Grey und Nicholls setzten sich gemeinsam in Bewegung, um ihn daran zu hindern, stießen zusammen und funkelten einander an, während Mr Hunter Caroline zum Bassin führte und sie dem Besitzer des Aals vorstellte, einer finster aussehenden kleinen Kreatur namens Horace Suddfield.
Grey schob Nicholls beiseite und stürzte sich in die Menge, um sich rücksichtslos nach vorn durchzuschubsen.
Hunter erblickte ihn und strahlte.
»Habt Ihr noch Metallreste in der Brust, Major?«
»Habe ich – was?«
»Metall«, wiederholte Hunter. »Arthur Longstreet hat mir die Operation beschrieben, in deren Verlauf er siebenunddreißig Metallsplitter aus Eurer Brust entfernt hat – äußerst eindrucksvoll. Doch wenn irgendetwas davon zurückgeblieben ist, muss ich Euch davon abraten, das mit dem Aal zu probieren. Metall leitet Elektrizität, und die Möglichkeit von Brandverletzungen …«
Auch Nicholls hatte sich durch das Gedränge gekämpft, und bei diesen Worten stieß er ein unangenehmes Lachen aus.
»Eine gute Ausrede, Major«, sagte er mit unüberhörbarem Spott.
Er ist wirklich ziemlich betrunken, dachte Grey. Dennoch …
»Nein, es sind keine Splitter mehr da«, antwortete er abrupt.
»Exzellent«, sagte Suddfield höflich. »Wie ich höre, seid Ihr Soldat, Sir? Und ein kühner noch dazu – wer könnte besser an erster Stelle stehen?«
Und bevor Grey widersprechen konnte, fand er sich direkt am Rand des Bassins wieder. Caroline Woodfords eine Hand umklammerte die seine, die andere wurde von Nicholls festgehalten, der böse vor sich hin starrte.
»Sind wir alle so weit, meine Damen und Herren?«, rief Suddfield. »Wie viele, Dobbs?«
»Fünfundvierzig!«, erklang der Ruf seines Assistenten im Nebenzimmer, durch das sich die Schlange der Teilnehmer wand, Hand in Hand und zuckend vor Aufregung, während der Rest der Gesellschaft mit großen Augen auf Abstand blieb.
»Haben sich alle angefasst?«, rief Suddfield. »Fasst Eure Freunde fest an, bitte, ganz fest!« Er wandte sich an Grey, und sein kleines Gesicht leuchtete. »Nun denn, Sir! Packt ihn fest an, bitte – genau dort, kurz vor der Schwanzflosse!«
Wider besseres Wissen und ohne Rücksicht auf die Folgen für seine Spitzenmanschette biss Grey die Zähne zusammen und tauchte die Hand ins Wasser.
Als er das glitschige Tier packte, rechnete er im ersten Moment mit dem Schlag, den man bekam, wenn man ein Leidener Glas berührte und es Funken sprühen ließ. Doch dann wurde er heftig rückwärts geschleudert, jeder Muskel seines Körpers verkrampfte sich, und er fand sich auf dem Fußboden wieder, wo er keuchend zappelte wie ein gestrandeter Fisch, während er sich vergeblich zu erinnern versuchte, wie man atmete.
Mr Hunter, der Arzt, hockte neben ihm und beobachtete ihn neugierig und mit leuchtenden Augen.
»Wie fühlt Ihr Euch?«, erkundigte er sich. »Irgendwelche Schwindelgefühle?«
Grey schüttelte den Kopf, während sich sein Mund öffnete und schloss wie bei einem Goldfisch, und er hieb sich mühsam auf die Brust.
Mr Hunter, der dies als Aufforderung betrachtete, beugte sich augenblicklich nieder, knöpfte Grey die Weste auf und legte ihm ein Ohr an das Hemd. Was auch immer er hörte – oder eben nicht –, schien ihn zu alarmieren, denn er richtete sich mit einem Ruck auf, ballte beide Hände zu einer einzigen Faust und ließ sie mit solcher Wucht auf Greys Brust niedersausen, dass dieser es bis in seine Wirbelsäule spürte.
Der Hieb hatte die heilsame Wirkung, ihm die Luft aus der Lunge zu pressen; sie füllte sich automatisch wieder, und plötzlich fiel ihm wieder ein, wie man atmet. Sein Herz schien sich ebenfalls wieder daran zu erinnern, wozu es da war, und begann erneut zu schlagen. Er setzte sich auf, wehrte einen zweiten Hieb Hunters ab und ließ den Blick blinzelnd über die Verwüstung ringsum schweifen.
Der Fußboden lag voller Menschen. Manche wanden sich noch, manche lagen mit ausgestreckten Gliedern reglos da, manche hatten sich bereits erholt und ließen sich von ihren Freunden aufhelfen. Überall erschollen Ausrufe der Erregung, und Suddfield stand stolzerfüllt neben seinem Aal und ließ sich beglückwünschen. Nur der Aal machte einen gereizten Eindruck; er schwamm mit wütenden Bewegungen seines schweren Körpers im Kreis.
Greys Blick fiel auf Edwin Nicholls, der sich auf Händen und Knien langsam erhob. Er streckte die Hand aus, um Caroline Woodfords Arme zu ergreifen und ihr beim Aufstehen zu helfen. Sie erhob sich jedoch so ungeschickt, dass sie das Gleichgewicht verlor und mit dem Gesicht gegen Mr Nicholls prallte. Dieser verlor ebenfalls das Gleichgewicht und landete im Sitzen, Ms Caroline obenauf. Ob vor Schreck, aus Aufregung, weil er betrunken oder einfach nur ein grober Klotz war, ergriff er seine Chance – und Caroline – und drückte ihr einen herzhaften Kuss auf die erstaunten Lippen.
Was dann geschah, war ein wenig verworren. Er hatte den vagen Eindruck, Nicholls die Nase gebrochen zu haben – und die aufgeplatzten und geschwollenen Knöchel seiner rechten Hand sprachen für diese Vermutung. Doch es herrschte großer Lärm, und er hatte das bestürzende Gefühl, sich nicht mehr so recht innerhalb der Grenzen seines eigenen Körpers zu befinden. Unablässig schienen Teile seiner selbst davonzudriften und der Hülle seiner Person zu entfliehen.
Das, was sich noch an Ort und Stelle befand, war spürbar beeinträchtigt. Sein Gehör – das immer noch unter den Nachwirkungen der Kanonenexplosion vor einigen Monaten litt – hatte unter dem Einfluss des Elektroschocks völlig den Dienst eingestellt. Das heißt, er konnte zwar noch hören, doch was er hörte, ergab keinen Sinn. Einzelne Wörter drangen durch einen summenden, klirrenden Nebel zu ihm, aber er konnte sie nicht sinnvoll mit den Mündern in Verbindung bringen, die sich rings um ihn bewegten. Und er war sich dazu alles andere als sicher, ob seine eigene Stimme das sagte, was er sagen wollte.
Er war von Stimmen umringt, von Gesichtern – ein Meer fiebriger Klänge und Bewegungen. Menschen berührten ihn, zerrten an ihm, stießen ihn. Er ruderte mit dem Arm, eigentlich eher, um herauszufinden, wo sich dieser befand, als um jemanden zu schlagen, doch er spürte einen Aufprall. Noch mehr Lärm. Hier und dort ein Gesicht, das er erkannte: Lucinda, schockiert und aufgebracht; Caroline, bestürzt, das rote Haar zerzaust und offen, der Puder dahin.
Im Großen und Ganzen lief es darauf hinaus, dass er sich nicht sicher war, ob er Nicholls herausgefordert hatte oder umgekehrt. Es musste doch wohl Nicholls gewesen sein? Er erinnerte sich lebhaft daran, wie sich Nicholls das schleimdurchtränkte Taschentuch an die Nase hielt und ihn mit zusammengekniffenen Augen mörderisch anfunkelte. Seltsamerweise hatte er sich dann im Freien wiedergefunden, in Hemdsärmeln in dem kleinen Park vor dem Haus der Joffreys, eine Pistole in der Hand. Er hätte doch niemals aus freien Stücken mit einer fremden Pistole gekämpft, oder?
Vielleicht hatte Nicholls ihn beleidigt, und er hatte Nicholls herausgefordert, ohne sich dessen bewusst zu sein?
Es hatte vorhin geregnet, jetzt war es frisch; der Wind peitschte ihm das Hemd um den Körper. Sein Geruchssinn war bemerkenswert scharf; er schien das Einzige zu sein, das richtig funktionierte. Er roch Rauch aus den Schornsteinen, das feuchte Grün der Pflanzen und seinen eigenen Schweiß, seltsam metallisch. Und etwas schwach Fauliges – etwas, das nach Schlamm und Schleim roch. Unwillkürlich rieb er sich die Hand, die den Aal berührt hatte, an der Hose.
Jemand sagte etwas zu ihm. Mühsam richtete er seine Aufmerksamkeit auf Dr. Hunter, der an seiner Seite stand und ihn nach wie vor unverwandt mit dieser Miene durchdringenden Interesses ansah. Nun, natürlich. Sie würden einen Arzt brauchen, dachte er dumpf. Man muss bei einem Duell einen Arzt dabeihaben.
»Ja«, sagte er, als er sah, dass Hunter fragend die Augenbrauen hochgezogen hatte. Dann packte er Hunter mit der freien Hand am Rock, denn verspätet ergriff ihn die Furcht, er könnte dem Arzt gerade seine Leiche versprochen haben, sollte er umkommen.
»Ihr … rührt … mich … nicht an«, brachte er stockend heraus. »Keine … Messer. Leichenfledderer«, fügte er der Vollständigkeit halber hinzu, als ihm das Wort endlich einfiel.
Hunter nickte. Er schien sich nicht beleidigt zu fühlen.
Der Himmel war bedeckt; das einzige Licht kam von den Fackeln am Hauseingang. Nicholls war ein verschwommener, weißlicher Fleck, der sich ihm näherte.
Plötzlich packte jemand Grey, drehte ihn mit Gewalt um, und er fand sich Rücken an Rücken mit Nicholls wieder, dem Herzen des kräftigeren Mannes verblüffend nah.
Mist, dachte er plötzlich. Was für ein Schütze er wohl ist?
Jemand sagte etwas, und er ging los – zumindest hatte er das Gefühl –, bis ihn ein ausgestreckter Arm stoppte. Er drehte sich um, weil jemand heftig gestikulierend hinter ihn zeigte.
Oh, zum Teufel, dachte er erschöpft, als er sah, wie sich Nicholls’ Arm senkte. Es ist mir egal.
Er blinzelte, als er das Mündungsfeuer sah – der Knall ging im erschrockenen Aufkeuchen der Menge unter –, dann stand er einen Moment lang da und fragte sich, ob er wohl getroffen worden war. Es schien jedoch alles beim Alten zu sein, und neben ihm drängte ihn jemand zu feuern.
Vermaledeiter Poet, dachte er. Ich verschenke den Schuss, und dann reicht es. Ich möchte nach Hause. Er hob den Arm und zielte senkrecht in die Luft, doch sein Arm verlor eine Sekunde die Verbindung zu seinem Gehirn, und sein Handgelenk erschlaffte. Er korrigierte sich mit einem Ruck, und seine Hand spannte sich am Abzug. Ihm blieb kaum Zeit, den Lauf zur Seite zu reißen, als er auch schon feuerte.
Zu seiner Überraschung stolperte Nicholls ein wenig, dann setzte er sich ins Gras. Er stützte sich auf eine Hand, warf den Kopf zurück und umklammerte mit der anderen theatralisch seine Schulter.
Inzwischen regnete es in Strömen. Grey kniff die Augen zu, um seine Wimpern vom Wasser zu befreien, und schüttelte den Kopf. Die Luft schmeckte scharf wie zerschnittenes Metall, und einen Moment lang hatte er den Eindruck, dass sie … violett roch.
»Das kann nicht richtig sein«, sagte er laut und stellte fest, dass er anscheinend das Sprachvermögen wiedererlangt hatte. Er drehte sich zur Seite, um mit Hunter zu sprechen, doch natürlich war der Arzt zu Nicholls hinübergelaufen und blickte ihm in den Hemdkragen. Grey sah Blut auf dem Stoff, doch Nicholls weigerte sich, sich hinzulegen, und gestikulierte wild mit der freien Hand. Ihm lief Blut aus der Nase; vielleicht kam es daher.
»Kommt mit, Sir«, sagte eine leise Stimme an seiner Seite. »Es wirft sonst ein schlechtes Licht auf Lady Joffrey.«
»Was?« Überrascht erblickte er Richard Tarleton, der in Deutschland sein Fähnrich gewesen war und jetzt die Uniform eines Lancierleutnants trug. »Oh. Ja, das stimmt.« Duelle waren in London verboten; ein Skandal, wenn die Polizei Lucindas Gäste vor ihrem Haus festnehmen würde – ihr Mann, Sir Richard, würde alles andere als erbaut sein.
Das Publikum war bereits verschwunden, als hätte es sich im Regen aufgelöst. Die Fackeln an der Tür waren gelöscht worden. Gerade halfen Hunter und noch jemand Nicholls auf, und er schwankte durch den zunehmenden Regen davon. Grey erschauerte. Der Himmel wusste, wo sein Rock oder sein Umhang waren.
»Ja, gehen wir«, sagte er.
GREY ÖFFNETE DIE AUGEN. »Habt Ihr etwas gesagt, Tom?«
Tom Byrd, sein Kammerdiener, hatte einen Huster ausgestoßen wie ein Schornsteinfeger, und zwar vielleicht dreißig Zentimeter neben Greys Ohr. Als er sah, dass er sich die Aufmerksamkeit seines Brotherrn gesichert hatte, hielt er ihm mit beiden Händen die Nachtschüssel hin.
»Seine Durchlaucht ist unten, Mylord. Mit Ihrer Durchlaucht.«
Grey blinzelte das Fenster in Toms Rücken an, dessen geöffnete Vorhänge ein trübes Quadrat verregneten Lichtes freigaben.
»Ihre Durchlaucht? Was, die Herzogin?« Was konnte nur geschehen sein? Es konnte kaum später als neun Uhr sein. Seine Schwägerin unternahm niemals einen Besuch am Vormittag, und er hatte auch noch nie erlebt, dass sie seinen Bruder tagsüber begleitete.
»Nein, Mylord. Die Kleine.«
»Die Kleine – oh. Meine Patentochter?« Er setzte sich hin. Er fühlte sich gut, wenn auch merkwürdig, und er nahm Tom die Schüssel ab.
»Ja, Mylord. Seine Durchlaucht sagt, er möchte mit Euch über ›die Ereignisse des gestrigen Abends‹ sprechen.« Tom hatte das Zimmer durchquert und richtete den Blick strafend auf die Überreste von Greys Hemd und Hose, die mit Gras, Schlamm, Blut und Pulver befleckt waren und die Grey achtlos über die Stuhllehne geworfen hatte. Er wandte sich tadelnd zu Grey um, der daraufhin die Augen schloss und sich zu erinnern versuchte, was genau die Ereignisse des gestrigen Abends gewesen waren.
Er fühlte sich irgendwie seltsam. Nicht betrunken, er war nicht betrunken gewesen; er hatte keine Kopfschmerzen, kein Bauchgrimmen …
»Gestern Abend«, wiederholte er unsicher. Der gestrige Abend war verwirrend gewesen, doch er konnte sich daran erinnern. Die Gesellschaft mit dem Aal, Lucinda Joffrey, Caroline … warum in aller Welt sollte das Hal interessieren … was, das Duell? Warum sollte sich sein Bruder wegen einer solch albernen Angelegenheit sorgen – und selbst wenn es so war, warum tauchte er dann in aller Herrgottsfrühe mit seiner sechs Monate alten Tochter bei Grey auf?
Es war eher die Tageszeit als die Anwesenheit des Kindes, die ungewöhnlich war; sein Bruder ging oft mit seiner Tochter aus, mit der fadenscheinigen Ausrede, das Kind brauche Luft. Seine Frau beschuldigte ihn, mit dem Baby angeben zu wollen – die Kleine war bildhübsch –, doch Grey vermutete, dass der Grund sehr viel einfacher war. Sein todesmutiger, autokratischer, diktatorischer Bruder, Oberst eines eigenen Regimentes, der Schrecken seiner eigenen Männer wie auch seiner Feinde – hatte sich in seine Tochter über beide Ohren verliebt. Das Regiment würde in einem Monat neu stationiert werden. Hal konnte es schlicht nicht ertragen, sie derzeit aus den Augen zu lassen.
So traf er den Herzog von Pardloe auf einem Sessel im Salon an, auf dem Arm Lady Dorothea Jacqueline Benedicta Grey, die an einem Zwieback kaute, den ihr Vater ihr hinhielt. Auf dem Tisch neben dem Herzog lagen ihr feuchtes Seidenhäubchen, ihr winziger Kaninchenfellschlafsack und mehrere Briefe, von denen einige bereits geöffnet waren.
Hal blickte zu ihm auf.
»Ich habe dir Frühstück bestellt. Sag deinem Onkel John Guten Tag, Dottie.« Sanft drehte er das Baby um. Es wandte den Blick zwar nicht von seinem Zwieback ab, stieß aber ein leises Zwitschern aus.
»Hallo, Schätzchen.« John beugte sich vor und küsste die Kleine auf den Kopf, der mit feinem blondem Haarflaum bedeckt und etwas feucht war. »Machst du mit Papa einen schönen Ausflug im strömenden Regen?«
»Wir haben dir etwas mitgebracht.« Hal griff nach dem geöffneten Brief und reichte ihn seinem Bruder mit hochgezogener Augenbraue.
Grey zog seinerseits die Augenbraue hoch und begann zu lesen.
»Was!« Er blickte mit offenem Mund von dem Blatt auf.
»Ja, das habe ich auch gesagt«, pflichtete ihm Hal gutmütig bei, »als er vor Tagesanbruch bei mir abgegeben wurde.« Er griff nach dem versiegelten Brief und balancierte dabei vorsichtig das Baby. »Hier, das ist deiner. Er kam kurz nach Tagesanbruch.«
Grey ließ den ersten Brief fallen, als stünde er in Flammen, ergriff den zweiten und riss ihn auf.
»Oh John«, stand dort ohne Umschweife, »verzeiht mir, ich konnte ihn nicht aufhalten, es tut mir so leid, ich habe ihm gesagt, er soll es nicht tun, aber er hat nicht auf mich gehört. Ich würde ja davonlaufen, aber ich weiß nicht, wohin. Bitte, bitte, tut etwas!« Er war nicht unterzeichnet, doch das war auch nicht nötig. Er hatte Caroline Woodfords Handschrift trotz des hektischen Gekritzels erkannt. Das Papier war fleckig und gewellt – von Tränen?
Er schüttelte heftig den Kopf, um seine Gedanken zu ordnen, dann griff er noch einmal nach dem ersten Brief. Der Inhalt war immer noch derselbe wie beim ersten Lesen – von Lord Alfred Enderby an Seine Durchlaucht: Er forderte den Herzog von Pardloe in aller Form auf, ihm für die Ehrverletzung seiner Schwester, Ms Caroline Woodford, mittels seines Bruders Lord John Grey Genugtuung zu leisten.
Grey blickte mehrfach von einem Dokument zum anderen, dann sah er seinen Bruder an.
»Anscheinend hattest du einen ereignisreichen Abend«, sagte Hal und bückte sich mit einem leisen Stöhnen, um den Zwieback aufzuheben, der Dottie auf den Teppich gefallen war. »Nein, Schätzchen, den isst du besser nicht mehr.«
Dottie war eindeutig anderer Meinung und ließ sich erst ablenken, als Onkel John sie in den Arm nahm und ihr ins Ohr pustete.
»Ereignisreich«, wiederholte er. »Ja, das war er. Aber das Einzige, was ich mit Caroline Woodford gemacht habe, war ihre Hand zu halten, während ich einen Schlag von einem Zitteraal bekam, das schwöre ich. Gligligli-pppppssscchhhhh«, fügte er an Dottie gewandt hinzu, und sie kreischte und kicherte als Antwort. Als er aufblickte, starrte Hal ihn an.
»Lucinda Joffreys Abendgesellschaft«, betonte er. »Ihr wart doch gewiss eingeladen, Minnie und du?«
Hal grunzte. »Oh. Ja, das waren wir, aber ich war bereits anderweitig verpflichtet. Minnie hat gar nichts von dem Aal gesagt. Aber was höre ich da von einem Duell, das du der jungen Dame wegen ausgefochten hast?«
»Was? Es war doch nicht …« Er hielt inne und dachte krampfhaft nach. »Nun, wenn ich es recht bedenke, vielleicht ja doch. Nicholls – du weißt schon, das Ferkel, das die Ode an Minnies Füße geschrieben hat? –, er hat Ms Woodford geküsst, und sie wollte das nicht, also habe ich ihn geschlagen. Wer hat dir denn von dem Duell erzählt?«
»Richard Tarleton. Er war gestern Abend noch spät bei White’s im Kartenzimmer und erzählte, er hätte dich gerade nach Hause gebracht.«
»Nun, dann weißt du wahrscheinlich genauso viel darüber wie ich. Oh, du willst deinen Papa wiederhaben, wie?« Er reichte Dottie an seinen Bruder zurück und wischte über einen feuchten Speichelfleck auf seinem Rock.
»Ich nehme an, das ist es, worauf Enderby hinauswill.« Hal wies kopfnickend auf den Brief. »Dass du das arme Mädchen öffentlich bloßgestellt hast und ihre Tugend kompromittiert hast, indem du ihretwegen ein skandalöses Duell ausgefochten hast. Da hat er ja auch gar nicht so unrecht.«
Dottie kaute jetzt auf dem Fingerknöchel ihres Vaters herum und knurrte leise. Hal durchsuchte seine Tasche und brachte einen silbernen Beißring zum Vorschein, den er ihr anstelle seines Fingers anbot. Dabei warf er Grey einen Seitenblick zu.
»Du willst doch Caroline Woodford nicht heiraten, oder? Darauf läuft Enderbys Forderung nämlich hinaus.«
»Gott, nein.« Caroline war eine gute Freundin – intelligent, hübsch, mit einem Hang zu verrückten Eskapaden, aber heiraten? Ihn?
Hal nickte.
»Nettes Mädchen, aber du würdest innerhalb eines Monats entweder hinter Gittern oder im Irrenhaus landen.«
»Oder tot sein«, sagte Grey und betastete vorsichtig den Verband, den ihm Tom hartnäckig um die Fingerknöchel gewunden hatte. »Wie geht es Nicholls heute Morgen, weißt du das?«
»Ah.« Hal lehnte sich ein wenig zurück und holte tief Luft. »Nun … er ist tatsächlich tot. Ich habe einen sehr bösen Brief von seinem Vater erhalten, der dich des Mordes bezichtigt. Der ist beim Frühstück gekommen; habe nicht daran gedacht, ihn mitzubringen. War es deine Absicht, ihn zu töten?«
Grey setzte sich abrupt hin, denn das Blut war ihm vollständig aus dem Kopf gewichen.
»Nein«, flüsterte er. Seine Lippen fühlten sich steif an, und seine Hände waren taub geworden. »Himmel. Nein.«
Hal zog rasch seine Schnupftabaksdose aus der Tasche, kippte das Riechsalzfläschchen heraus, das er darin aufbewahrte, und reichte es seinem Bruder. Grey war ihm dankbar; er war zwar nicht im Begriff gewesen, in Ohnmacht zu fallen, doch die aggressiven Ammoniakdämpfe boten ihm eine Ausrede dafür, dass ihm das Wasser in die Augen stieg und ihm das Atmen schwerfiel.
»Himmel«, wiederholte er und nieste mehrmals heftig. »Ich habe nicht auf ihn gezielt – ich schwöre es, Hal. Ich habe den Schuss verschenkt. Zumindest habe ich es versucht«, fügte er aufrichtig hinzu.
Ganz plötzlich kamen ihm sowohl Lord Enderbys Brief als auch Hals Anwesenheit verständlicher vor. Was eine alberne Torheit gewesen war, die mit dem Morgentau hätte vergessen sein sollen, war nicht nur zum Skandal geworden – oder würde es werden, sobald die Gerüchte Zeit hatten, sich auszubreiten –, sondern möglicherweise sogar zu etwas Schlimmerem. Es war nicht undenkbar, dass er tatsächlich wegen Mordes verhaftet wurde. Ohne jede Vorwarnung tat sich inmitten des gemusterten Teppichs zu seinen Füßen ein Abgrund auf, in dem sein Leben verschwinden konnte.
Hal nickte und reichte ihm sein Taschentuch.
»Ich weiß«, sagte er leise. »So etwas … kommt vor. Dinge, die man nicht beabsichtigt – die man für sein Leben gern zurücknehmen würde.«
Grey strich sich über das Gesicht und warf seinem Bruder im Schutz dieser Geste einen Blick zu. Hal sah plötzlich älter aus, als er war, und es war nicht nur die Sorge um Grey, die sein Gesicht zeichnete.
»Du meinst Nathaniel Twelvetrees?« Normalerweise hätte er dieses Thema nicht berührt, doch beide Männer waren jetzt weniger reserviert als sonst.
Hal musterte ihn scharf, dann wandte er den Blick ab.
»Nein, nicht Twelvetrees. Damals hatte ich keine andere Wahl. Und ich wollte ihn töten. Ich wollte … das, was zu diesem Duell geführt hat.« Er verzog das Gesicht. »Wer in Eile heiratet, hat reichlich Zeit zur Reue.« Er betrachtete den Brief auf dem Tisch und schüttelte den Kopf. Seine Hand strich sanft über Dotties Köpfchen. »Ich lasse es nicht zu, dass du meine Fehler wiederholst, John«, sagte er leise.
Grey nickte wortlos. Hals erste Frau war von Nathaniel Twelvetrees verführt worden. Doch Hals Fehler hatten nichts damit zu tun, dass Grey niemals vorgehabt hatte, jemanden zu heiraten, und es genauso wenig jetzt vorhatte.
Hal runzelte die Stirn und klopfte mit dem zusammengefalteten Brief auf den Tisch. Sein Blick wanderte zu John hinüber, dann legte er den Brief hin, griff in seinen Rock und zog zwei weitere Dokumente hervor. Eines davon war dem Siegel nach eindeutig offizieller Natur.
»Dein neues Patent«, sagte er und reichte es Grey. »Für Crefeld«, sagte er und zog die Augenbraue hoch, als er den verständnislosen Blick seines Bruders sah. »Du wurdest zum Oberstleutnant brevetiert. Hattest du das vergessen?«
»Ich – nun ja … mehr oder weniger.« Er hatte den vagen Eindruck, dass ihm irgendjemand – wahrscheinlich Hal – kurz nach Crefeld davon erzählt hatte, doch er war damals schwer verwundet und nicht in der Stimmung gewesen, an die Armee zu denken, geschweige denn, sich für eine Beförderung auf dem Schlachtfeld zu interessieren. Später …
»Hatte es nicht einige Verwirrung deswegen gegeben?« Grey ergriff das Patent und öffnete es stirnrunzelnd. »Ich dachte, sie hätten es sich anders überlegt.«
»Oh, dann weißt du es also doch noch«, sagte Hal, die Augenbraue immer noch hochgezogen. »General Wiedmann hat dir das Patent nach der Schlacht verliehen. Doch die Bestätigung hat sich verzögert, wegen der Ermittlungen bezüglich der Kanonenexplosion und der folgenden … äh … Aufregung wegen Adams.«
»Oh.« Grey war nach wie vor erschüttert über die Nachricht von Nicholls’ Tod, doch bei der Erwähnung des Namens Adams begann sein Hirn wieder zu arbeiten. »Adams. Oh. Du meinst, Twelvetrees hat die Genehmigung verzögert?« Oberst Reginald Twelvetrees von der Königlichen Artillerie – Nathaniels Bruder und ein Vetter des Verräters Bernard Adams, der dank der Bemühungen Greys im vergangenen Herbst nun im Tower auf seinen Prozess wartete.
»Ja. Der Schuft«, fügte Hal leidenschaftslos hinzu. »Eines Tages werde ich ihn zum Frühstück verspeisen.«
»Nicht meinetwegen, hoffe ich«, sagte Grey trocken.
»Oh nein«, versicherte ihm Hal und rüttelte sanft seine Tochter, damit sie nicht anfing zu quengeln. »Es wird mir ein ganz persönliches Vergnügen sein.«
Trotz seiner Beunruhigung lächelte Grey bei diesen Worten und legte das Offizierspatent beiseite. »Also schön«, sagte er mit einem Blick auf das vierte Dokument, das noch zusammengefaltet auf dem Tisch lag. Der Brief schien etwas Offizielles zu sein und war bereits geöffnet worden; das Siegel war zerbrochen. »Ein Heiratsantrag, eine Mordanklage und ein neues Patent – was zum Teufel ist das? Eine Rechnung von meinem Schneider?«
»Ah, das. Eigentlich wollte ich es dir nicht zeigen«, sagte Hal und beugte sich vorsichtig vor, um Grey den Brief zu reichen, ohne Dottie fallen zu lassen. »Aber angesichts der Umstände …«
Er wartete ungerührt, während Grey den Brief auseinanderfaltete und ihn las. Es war die Bitte – oder die Order, je nachdem, wie man es betrachtete –, Major Lord John Grey möge dem Kriegsgerichtsverfahren gegen einen gewissen Hauptmann Charles Carruthers beiwohnen und sich für dessen Charakter verbürgen. In …
»In Kanada?« Johns Ausruf erschreckte Dottie, die das Gesicht verzog und zu weinen drohte.
»Schsch, Schätzchen.« Hal rüttelte sie sanft und tätschelte ihr hastig den Rücken. »Ist ja schon gut; Onkel John stellt sich nur dumm.«
Grey ignorierte diese Worte und wedelte seinem Bruder mit dem Brief vor der Nase herum.
»Warum zum Teufel steht Charles Carruthers vor dem Kriegsgericht? Und warum in aller Welt lädt man mich als Zeugen vor?«
»Versagen bei der Unterdrückung einer Meuterei«, sagte Hal. »Und wieso du? Anscheinend hat er darum gebeten. Ein angeklagter Offizier darf seine eigenen Zeugen mitbringen, ganz gleich, zu welchem Zweck. Wusstest du das nicht?«
Grey ging davon aus, dass er theoretisch davon gehört hatte. Doch er hatte noch nie einem Kriegsgericht beigewohnt; so etwas kam nicht alle Tage vor, und er hatte keine rechte Vorstellung davon, wie es dabei zuging.
Er warf Hal einen Seitenblick zu.
»Du hast gesagt, eigentlich wolltest du es mir nicht zeigen?«
Hal zuckte mit den Achseln und pustete seiner Tochter behutsam über den Kopf, sodass sich die kurzen blonden Härchen hoben und senkten wie Weizen im Wind.
»Es wäre doch sinnlos gewesen. Ich hatte vor, zurückzuschreiben und zu sagen, dass ich dich als dein Vorgesetzter hier brauche; warum sollte man dich in die kanadische Wildnis schleifen? Aber angesichts deines Talentes für peinliche Situationen … Wie hat es sich eigentlich angefühlt?«, erkundigte er sich neugierig.
»Wie hat sich was – oh, der Aal.« Grey war an die blitzschnellen Gedankensprünge seines Bruders gewöhnt und folgte ihm auch jetzt problemlos. »Nun, es war ein ziemlicher Schock.«
Er lachte – wenn auch zaghaft – über Hals finstere Miene, und Dottie wand sich in den Armen ihres Vaters und streckte die runden Ärmchen flehentlich nach ihrem Onkel aus.
»Du kleine Circe«, sagte er zu ihr und nahm sie Hal ab. »Nein, es war wirklich bemerkenswert. Weißt du, wie es sich anfühlt, wenn man sich einen Knochen bricht? Diese Art Ruck, bevor man den Schmerz spürt, der einem durch Mark und Bein geht, sodass man kurz blind wird und das Gefühl hat, als hätte einem jemand einen Nagel durch den Bauch gebohrt? So war es, nur viel stärker, und es hat länger gedauert. Hat mir den Atem geraubt«, gab er zu. »Ganz buchstäblich. Und ich glaube, mir ist das Herz stehen geblieben. Dr. Hunter – du weißt, der Anatom? – war dabei, und er hat mir auf die Brust geschlagen, um es wieder in Bewegung zu setzen.«
Hal hörte ihm gebannt zu und stellte ihm einige Fragen, die Grey automatisch beantwortete, während er in Gedanken mit dem letzten, überraschenden Kommuniqué beschäftigt war.
Charlie Carruthers. Sie waren gemeinsam junge Offiziere gewesen, wenn auch aus unterschiedlichen Regimentern. Hatten Seite an Seite in Schottland gekämpft und sich beim nächsten Freigang zusammen in London herumgetrieben. Sie hatten – nun, eigentlich konnte man es nicht als Affären bezeichnen – drei oder vier kurze Begegnungen. Es waren verschwitzte, atemlose Viertelstunden in dunklen Ecken, die man bei Tag bequem vergessen oder als betrunkene Eskapaden abtun konnte, über die man nicht mehr sprach.
Das war in jener schlimmen Zeit gewesen, in den Jahren nach Hectors Tod, in denen er das Vergessen suchte, wo immer er es finden konnte – und es oft genug gefunden hatte –, bevor er sich langsam wieder erholte.
Wahrscheinlich hätte er sich gar nicht mehr an Carruthers erinnert, wäre das eine Besondere nicht gewesen.
Carruthers war mit einer interessanten Missbildung zur Welt gekommen – er hatte eine Doppelhand. Carruthers’ rechte Hand sah ganz normal aus und funktionierte auch so, doch an seinem Handgelenk entsprang eine weitere Zwergenhand, die sich nahtlos an ihren Zwilling schmiegte. Dr. Hunter würde wahrscheinlich Hunderte für diese Hand bezahlen, dachte Grey, und sein Magen drohte sich zu verdrehen.
Die Zwergenhand hatte nur zwei kurze Finger und einen Daumenstummel – doch Carruthers konnte sie öffnen und schließen, allerdings nicht, ohne die größere Hand ebenfalls zu öffnen und zu schließen. Der Schock, als Carruthers beide gleichzeitig um Greys Schwanz gelegt hatte, war beinahe genauso außergewöhnlich gewesen wie der Schock durch den Zitteraal.
»Nicholls ist doch noch nicht beerdigt worden, oder?«, fragte er abrupt, denn bei dem Gedanken an den Abend mit dem Aal und an Dr. Hunter musste er Hal mitten im Satz unterbrechen.
Hal musterte ihn überrascht.
»Gewiss nicht. Warum?« Er sah Grey scharf an. »Du hast doch wohl nicht vor, dem Begräbnis beizuwohnen?«
»Nein, nein«, sagte Grey hastig. »Ich musste nur an Dr. Hunter denken. Er, äh, hat einen gewissen Ruf … und Nicholls ist mit ihm zusammen fortgegangen. Nach dem Duell …«
»Was denn für einen Ruf, zum Kuckuck?«, wollte Hal ungeduldig wissen.
»Als Leichenfledderer«, entfuhr es Grey.
Es herrschte plötzliche Stille, während es Hal zu dämmern begann. Er war bleich geworden.
»Du glaubst doch nicht – nein! Wie sollte das möglich sein?«
»Indem … äh … man die Leiche gegen einen Zentner Steine austauscht, kurz bevor der Sarg zugenagelt wird, üblicherweise – zumindest habe ich das gehört«, sagte Grey, so deutlich er konnte, während ihm Dottie die Faust in die Nase steckte.
Hal schluckte. Grey konnte sehen, wie ihm die Härchen am Handgelenk zu Berge standen.
»Ich werde Harry fragen«, sagte Hal nach einer kurzen Pause. »Sie können das Begräbnis noch nicht arrangiert haben, und falls …«
Die beiden Brüder erschauerten unwillkürlich, während sie sich nur zu genau ausmalten, wie ein aufgebrachtes Familienmitglied darauf bestand, den Sargdeckel zu öffnen, um dann festzustellen …
»Vielleicht lieber nicht«, sagte Grey und schluckte. Dottie versuchte jetzt nicht mehr, ihm die Nase zu amputieren, sondern patschte ihm stattdessen auf die Lippen, während er redete. Wie sich das auf seiner Haut anfühlte …
Er löste sie vorsichtig und reichte sie Hal zurück.
»Ich weiß nicht, was Charles Carruthers glaubt, wie ich ihm nützen könnte – aber gut, ich fahre hin.« Er richtete den Blick auf Lord Enderbys Brief, auf Carolines zerknitterte Nachricht. »Ich nehme an, es gibt wohl Schlimmeres, als von Indianern skalpiert zu werden.«
Hal nickte nüchtern.
»Ich habe deine Überfahrt schon arrangiert. Du reist morgen ab.« Er stand auf und hob Dottie hoch. »Da, Schätzchen. Gib deinem Onkel John einen Abschiedskuss.«
SO KAM ES, dass Grey einen Monat später von Bord der Harwood ging. Mit Tom Byrd an seiner Seite bestieg er eins der kleinen Boote, das sie gemeinsam mit dem Bataillon der Louisbourg-Grenadiere, mit dem sie gereist waren, auf einer großen Insel nahe der Mündung des St.-Lorenz-Stroms an Land bringen würde.
Es war der größte Fluss, den er je gesehen hatte, fast eine halbe Meile breit und sehr tief, im Sonnenlicht von einem dunklen Schwarzblau. Auf beiden Seiten des Flusses erhoben sich gewaltige Klippen und gewellte Hügel, die so dicht bewaldet waren, dass der Fels darunter so gut wie unsichtbar war. Es war heiß, und ein leuchtender Himmel spannte sich über ihnen, viel klarer und größer, als er es je anderswo gesehen hatte. Aus der üppigen Vegetation hallte ein lautes Summen wider – Insekten vermutlich, Vögel und das Rauschen des Wassers, obwohl es sich so anfühlte, als sänge die Wildnis vor sich hin mit einer Stimme, die er nur in seinem Innersten hörte. Tom vibrierte an seiner Seite geradezu vor Aufregung und sah sich mit Stielaugen um, damit ihm nur ja nichts entging.
»Da, ist das ein Indianer?«, flüsterte er und beugte sich im Boot dicht zu Grey hinüber.
»Etwas anderes kann er wohl kaum sein«, erwiderte Grey, denn der Herr, der sich da am Landeplatz herumdrückte, war nackt bis auf einen Lendenschurz, eine gestreifte Decke, die er sich über die Schulter geschlungen hatte, und eine Schicht, die dem Glanz seiner Gliedmaßen nach eine Art Fett zu sein schien.
»Ich dachte, sie würden röter sein«, sagte Tom und verlieh damit Greys Gedanken Ausdruck. Natürlich war die Haut des Indianers um einiges dunkler als die seine, doch ihre Farbe war ein schönes Hellbraun, das an getrocknete Eichenblätter erinnerte. Der Indianer schien sie beinahe genauso interessant zu finden wie sie ihn; vor allem Grey betrachtete er gebannt und abwägend.
»Es ist Euer Haar, Mylord«, zischte Tom Grey ins Ohr. »Ich habe Euch doch gesagt, Ihr solltet eine Perücke tragen.«
»Unsinn, Tom.« Gleichzeitig jedoch empfand Grey ein seltsames Kribbeln im Rücken, das ihm die Kopfhaut zusammenzog. Weil er nun einmal eitel war, was sein dichtes blondes Haar betraf, trug er normalerweise keine Perücke, sondern band sich bei offiziellen Anlässen das eigene Haar zusammen und puderte es. Der gegenwärtige Anlass war alles andere als offiziell. Da frisches Wasser an Bord gebracht worden war, hatte Tom heute Morgen darauf bestanden, ihm das Haar zu waschen, und es lag ihm noch lose auf den Schultern, obwohl es längst getrocknet war.
Das Boot lief knirschend auf den Uferkies, und der Indianer warf seine Decke ab und kam herbei, um den Männern dabei zu helfen, es an Land zu schieben. Grey fand sich an seiner Seite wieder, dicht genug, um ihn zu riechen. Grey war noch nie einem Menschen begegnet, der so roch; wie Wild, gewiss – er fragte sich mit leiser Erregung, ob das Fett, das der Mann am Körper trug, vielleicht Bärenschmalz war –, jedoch vermischt mit dem Geruch von Kräutern und Schweiß, wie frisch zerschnittenes Kupfer.
Als sich der Indianer vom Dollbord aufrichtete, sah er Greys Blick und lächelte.
»Hütet Euch, Engländer«, sagte er mit deutlichem französischem Akzent, streckte die Hand aus und fuhr Grey ganz beiläufig mit den Fingern durch das lose Haar. »Euer Skalp würde sich gut am Gürtel eines Huronen machen.«
Das brachte die Soldaten aus dem Boot zum Lachen, und der Indianer wandte sich immer noch lächelnd zu ihnen um.
»Sie sind nicht sehr wählerisch, die Abenaki, die für die Franzosen arbeiten. Ein Skalp ist ein Skalp – und die Franzosen zahlen gut dafür, ganz gleich, welche Farbe er hat.« Er nickte den Grenadieren, die jetzt nicht mehr lachten, freundlich zu. »Ihr kommt mit mir.«
AUF DER INSEL BEFAND sich bereits ein kleines Lager; eine Infanterie-Abordnung unter Hauptmann Woodford – dessen Name Grey mit einem Hauch von Argwohn erfüllte, der sich jedoch Gott sei Dank nicht als Verwandter von Lord Enderbys Familie entpuppte.
»Auf dieser Seite der Insel sind wir einigermaßen sicher«, erzählte er Grey, als er ihm nach dem Abendessen vor seinem Zelt seine Feldflasche mit Brandy anbot. »Aber auf der anderen Seite unternehmen die Indianer regelmäßig Raubzüge – ich habe letzte Woche vier Männer verloren, drei wurden getötet und einer verschleppt.«
»Aber Ihr habt doch Eure eigenen Kundschafter?«, fragte Grey und schlug nach den Moskitos, die in der Dämmerung auszuschwärmen begonnen hatten. Er hatte den Indianer, der sie zum Lager gebracht hatte, nicht wiedergesehen, doch es befanden sich noch andere Indianer im Lager, die meisten an ihrem eigenen Lagerfeuer, doch ein paar hockten mit glänzenden, wachsamen Augen bei den Louisbourg-Grenadieren, die mit Grey auf der Harwood übergesetzt hatten.
»Ja, und den meisten kann man trauen«, sagte Woodford als Antwort auf Greys unausgesprochene Frage. Er lachte, doch ohne jeden Humor. »Zumindest hoffen wir das.«
Er hatte mit Woodford gegessen, sie hatten eine Partie Karten gespielt, und Grey hatte Neuigkeiten aus der Heimat gegen Informationen über den Feldzug eingetauscht.
General Wolfe hatte geraume Zeit in Montmorency unterhalb von Quebec verbracht. Doch alles, was er dort versucht hatte, hatte ihm nur Enttäuschungen eingebracht, und so hatte er diesen Posten aufgegeben und den Großteil seiner Truppen einige Meilen stromaufwärts der Zitadelle gesammelt. Diese, eine bisher uneinnehmbare Festung, thronte auf steilen Klippen über dem Fluss, sodass sie sowohl den Strom als auch die Ebenen im Westen im Visier ihrer Kanonen hatte und die englischen Kriegsschiffe gezwungen waren, sich im Schutz der Nacht vorbeizustehlen – und ihnen selbst das nicht jedes Mal gelang.
»Wolfe scharrt gewiss mit den Hufen, jetzt, da seine Grenadiere hier sind«, prophezeite Woodford. »Er hält große Stücke auf diese Kameraden, hat mit ihnen vor Louisbourg gekämpft. Hier, Oberst, Ihr werdet ja lebendig verspeist – verreibt ein bisschen hiervon auf den Händen und im Gesicht.« Er kramte in seiner Feldtruhe und brachte eine Dose mit einem stark riechenden Fett zum Vorschein, die er über den Tisch schob.
»Bärenschmalz und Minze«, erklärte er. »Die Indianer benutzen es – oder sie schmieren sich mit Schlamm ein.«
Grey nahm reichlich; es war nicht ganz der gleiche Geruch wie der des Kundschafters vorhin, aber er war sehr ähnlich, und Grey empfand es als seltsam verstörend, sich das Fett aufzutragen. Doch es half tatsächlich gegen die blutsaugenden Insekten.
Er hatte kein Geheimnis aus dem Grund für seine Anwesenheit gemacht und erkundigte sich jetzt offen nach Carruthers.
»Wisst Ihr, wo man ihn festhält?«
Woodford runzelte die Stirn und schenkte Brandy nach.
»Gar nicht. Er wurde auf Ehrenwort auf freien Fuß gesetzt und hat in Gareon, wo Wolfe sein Hauptquartier hat, ein Zimmer im Ort.«
»Ah?« Das überraschte Grey ein wenig – doch andererseits bezichtigte man Carruthers ja nicht der Meuterei, sondern des Versagens bei ihrer Unterdrückung – eine seltene Anklage. »Kennt Ihr die Einzelheiten des Falls?«
Woodford öffnete den Mund, als wollte er etwas sagen, doch dann holte er tief Luft, schüttelte den Kopf und trank Brandy. Woraus Grey schloss, dass wahrscheinlich jeder die Einzelheiten kannte, dass aber etwas faul an der Sache war. Nun, er hatte Zeit. Er würde es sowieso direkt von Carruthers erfahren.
Das Gespräch wandte sich allgemeinen Dingen zu, und nach einer Weile sagte Grey Gute Nacht. Die Grenadiere waren fleißig gewesen; am Rand des bereits existierenden Lagers war eine neue kleine Zeltstadt entstanden, aus der verlockende Düfte nach gebratenem Fleisch und gekochtem Tee aufstiegen.
Zweifellos war es Tom gelungen, irgendwo in dem Gewimmel sein Zelt aufzubauen. Doch er hatte keine Eile, es zu finden; er genoss das ungewohnte Gefühl, nach der wochenlangen Enge an Bord des Schiffes festen Boden unter den Füßen zu haben und für sich zu sein. Er schlug einen Bogen um die ordentlich aufgereihten neuen Zelte und hielt sich knapp jenseits des Fackelscheins, sodass er sich angenehm unsichtbar fühlte, ohne die Sicherheit des Lagers zu verlassen – zumindest hoffte er das. Der Wald begann nur ein paar Meter weiter; Bäume und Büsche waren als Umrisse zu erkennen, denn es war noch nicht vollständig dunkel.
Ein schwebender grüner Funke fiel ihm ins Auge, und er spürte, wie Entzücken in ihm aufstieg. Da war noch einer … und noch einer … zehn, ein Dutzend, und plötzlich war die Luft voller Glühwürmchen, sanft blinkende Funken, die wie ferne Kerzen im dunklen Laub glommen. Er hatte schon ein- oder zweimal Glühwürmchen gesehen, in Deutschland, aber nie in solchen Massen. Sie waren pure Magie, so rein wie der Mondschein.
Er hätte nicht sagen können, wie lange er sie beobachtete, während er langsam am Rand des Lagers entlangwanderte, doch schließlich seufzte er und wandte sich der Lagermitte zu, satt, angenehm müde und ohne unmittelbare Aufgaben, um die er sich kümmern musste. Er hatte keine Männer zu befehligen, keine Berichte zu schreiben … eigentlich gar nichts, bis er Gareon und Charlie Carruthers erreichte.
Tom und sein Zelt fand er mühelos, und mit einem friedvollen Seufzer schloss er den Zelteingang und legte seine Oberkleider ab.