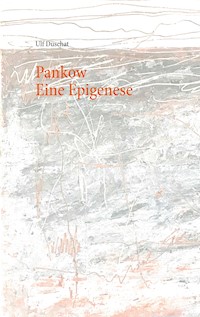
7,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Herbert zieht 1997 mit seiner kleinen Familie vom schönen Bezirk Berlin-Moabit im ehemaligen Westen nach dem noch schöneren Berlin-Pankow und begibt sich mittelbar in eine existenzielle Katastrophe, in deren Verlauf er aus der beeindruckenden Beletage der Familie rausfliegt und sich unmittelbar mit den Realitäten jenseits von bürgerlicher Kleinfamilie konfrontiert wiederfindet. Er beginnt eine mörderische und selbstmörderische Reise durch Psychotherapie, Stahlarbeit und Malerei, die ihn an die Schranken seines Narzissmus und den Versuch ihrer Überwindung führt. Tapfer erklimmt er die Berge, die sich auf seinem Weg türmen, um wiederholt abzustürzen und sich erneut "hoch" zu arbeiten. Er führt das Leben eines unaufhörlich Ertrinken und gierig nach Luft Schnappenden, der mit desillusionierender, sich steigernder Härte gegen sich selbst um seine Identität ringt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 371
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Sie zogen um. Von Moabit nach dem schönen grünen Bezirk Pankow. Es war Herbst 1997 und sie hatten ein halbes Jahr hinter sich, in dem sie intensiv die Wohnung renoviert hatten, die sie durch Beziehungen und Glück bekommen hatten. Sie waren eine kleine Familie und hatten gewollt, dass alles besser wird. Der kleine Sohn Karl war drei Jahre alt und sollte in einer schönen Umgebung aufwachsen. Der neue Wohnort war bürgerlich und von hauptsächlich ehemaligen DDR Menschen bewohnt, von denen sie den Eindruck hatten, dass jeder zweite für die sozialistische Administration gearbeitet hatte. Die Menschen hatten mit der Wende von 1989 eine gewaltige Veränderung der Verhältnisse durchgemacht, persönlich, politisch und wirtschaftlich. Wie viele hatten für die Stasi gearbeitet. Von ihrem Nachbarn auf dem Flur gegenüber ging die Rede, dass er der sozialistische Blockwart des herrschaftlichen Wohnhauses gewesen sei. Die Wohnung war in einem bedauernswerten Zustand, vierzig Jahre DDR Mangelwirtschaft hatten ihre Spuren hinterlassen. Als Erstes schraubten sie die hässliche Holzverkleidung des Flures ab und entsorgten sie. Der Vater hatte Schmerzen bei dieser Arbeit, die er sich nicht erklären konnte. Er sagte seiner Freundin nichts davon. Er litt still. Im Grunde war er nicht bereit, ein neues Leben zu beginnen, aber er beugte sich dem Diktum des Bürgerlichen, das dem Kleinen Glück bringen sollte. Sie waren dabei, aus ihrer wunderschönen Atelieretage auf dem Werkhof in Moabit auszuziehen. Der Vater befand sich mitten im Aufbau seiner Malerkarriere und hatte einige Erfolge gehabt, die aufgrund der Westmöglichkeiten gewachsen waren. Er hörte Beschwerden, dass sie nach dem Osten zogen, was sollten sie dort? „Ihr in Euerm Pankow!“, meinte die Kunstamtsleiterin von Moabit. Was hatten diese Bemerkungen zu bedeuten. Waren die Stadthälften jetzt, acht Jahre nach der Wende, noch nicht zusammengewachsen? Historisch war es nicht mal der Augenblick eines Wimpernschlags. Herbert und Clara waren naiv, sie glaubten an ihr Glück.
Das Haus, in das sie einziehen wollten, gehörte bereits einem Westberliner, einem kauzigen alten Mann, der interessante Mehrfamilienhäuser in Berlin sammelte wie andere Briefmarken. Das ewige alte 'Wer hat, der hat!' hatte auch hier schon Fuß gefasst. Die Ostberliner im Bezirk waren plötzlich dem Kapitalismus ausgeliefert, von dem sie keine Ahnung hatten. Wenn der Vater zum Metzger in der Ossietzkystraße ging, um Rindergehacktes zu kaufen, gab es das nicht und er wurde sofort instinktsicher vom Verkäufer als Wessi identifiziert und reserviert und misstrauisch bedient. Er hatte einen Widerwillen gegen den Wessi. Es musste Herberts Habitus sein, sein selbstbewusstes und verlangendes Auftreten vielleicht, das ihn verriet. Es beruhte jedoch auf Gegenseitigkeit, er 'erkannte' Ossis auch sofort, wie er meinte, an deren anderer Art, sich zu kleiden und an ihren Vitaminmangelgestalten, wie er es ausdrückte. Vielleicht war es das, dass er dieses spezifische Mangelgesicht nicht hatte, das ihn als Wessi denunzierte.
Im April hatten sie den anthroposophischen Hausverwalter, auch ein Wessi, auf Vermittlung des Bildhauerfreundes Manfred aufgesucht und sich um die Wohnung beworben. Er meinte nur „Na, machen Sie erstmal“, und wir konnten uns den Wohnungsschlüssel bei einem Nachbarn abholen, der einen Aufgang weiter wohnte. Auch ein Wessi und der Schlüsselverwalter. Sie klingelten und Christel, die Freundin von Harald, machte auf. „Oh, schön, wenn hier nette Leute einziehen“, sagte sie, „Wir sind nicht nett!“, antwortete Herbert. Sie bekamen die Schlüssel ausgehändigt und konnten die Wohnung betreten. Es war die Eckwohnung in der ersten Etage, hatte fünfeinhalb Zimmer und Küche und Bad. Eine echte Beletage mit alten Parkettfußböden, die dringend neu abgezogen werden sollten. Die Zimmer waren groß und es gab einen kleinen Balkon zur Wolfshagener Straße raus. Der Hauseingang lag hingegen in der Kavalierstrasse. Sie waren begeistert, solche Wohnungen waren im Westen der Stadt zu einem verträglichen Preis nicht mehr zu bekommen. Die Wände waren bereits von den alten Tapeten befreit, was die Akzeptanz der Immobilie wesentlich erhöhte. Die Fenster hatten am meisten unter der jahrzehntelangen Vernachlässigung gelitten. Sie fassten den Entschluss, sie komplett zu renovieren. Und sie wollten die Wohnung. Jetzt fuhren sie jeden Morgen mit ihrem Auto von Moabit nach Pankow, schufteten in der Wohnung und fuhren abends wieder zurück. Sie hängten jeden einzelnen Fensterflügel aus, legten ihn auf Arbeitsböcke und zogen die alte Farbe mit einem Heißluftföhn und Spachtel ab, schmirgelten und verspachtelten, grundierten und strichen ihn außen und innen mit weißer Kunstharzfarbe. Der Vater fragte sich, woher er die Kraft nehmen sollte, das Werk zu bewältigen. Sie kletterten auf die Leitern und zogen auch die Rahmen außen und innen ab, eigentlich wäre die Außenseite Sache des Vermieters gewesen, aber darauf wollten sie sich nicht verlassen, außerdem, wenn sie schon mal bei der Arbeit waren. Die Schmerzen des Vaters vergingen nicht, er fragte sich, was er da machte. Warum malte er nicht seine Bilder. Er hatte eine Art Geburtsschmerzen, wie er sich sagte. War diese Handwerkerstrecke, die sie zurücklegten, der Weg in eine Wiedergeburt oder was sollte es sein? Die Inbesitznahme der Räume war auch eine Eroberung eines unbekannten Terrains in einem unbekannten Land, der ehemaligen DDR-Zugehörigkeit Pankows. Die Eltern waren früher, vor der Geburt des Kleinen, des Öfteren in die DDR gefahren, machten dort Wanderungen in der Natur, die sie im Westen nicht haben konnten oder kauften die billigen Nerchau-Farben oder Literatur ein. Die Besuche waren immer eine Reise ins Exotische eines fremden Landes gewesen. Es fuhren bemerkenswerte unzählige kleine Autos aus Pappe umher, die Häuser Ostberlins waren alle grau und depressiv, in den Restaurants hatte man sich anzustellen und darauf zu warten, dass der Kellner einem einen Tisch zuwies. Auf einer Wanderung kam ihnen mitten im Wald ein Tross von schweren DDR-Volvos entgegen, in denen nur Parteibonzen sitzen konnten. Wenig später kamen sie an das Objekt, wo die Nomenklatura offenbar herkam, ein dunkelbraunes, holzverkleidetes, großes Forsthaus. Man war vielleicht auf der Jagd gewesen. Es war insgesamt ein Erlebnis der Finsternis auf ihrem Weg. Auf dem Rückweg kauften sie meist noch ein Ost Brot, das um vieles besser schmeckte als alles, was man damals im Westen angedreht bekam, auch die Ostschrippe war noch ein wirkliches Brötchen. Heute bekommt man überall in Berlin nur diese elenden, vertrockneten Aufbackbrötchen, die eine Beleidigung des Bäckerhandwerks und des Kunden sind.
Harald und Christel betrieben im Keller des Hauses eine Töpfer- und eine sehr kleine Holzwerkstatt. Sie waren Macher, die man ansonsten in Pankow vermissen musste, woher sollten sie auch kommen, mussten die Leute doch erstmal Kapitalismus üben. Christel fertigte Gefäße auf der Drehscheibe und modellierte Köpfe und Büsten, die sie meist bemalte. Harald war der Tischler und erledigte Aufträge im Bezirk. Die Werkstatt lag zwei Stockwerke unter Herbert, Clara und Karl und hatte einen rückwärtigen Ausgang zu deren Kellerräumen. Sie machten einen Eröffnungsabend, an dem fast ausschließlich Wessis kamen und Wein tranken. Sie trafen einige Bekannte aus der Kunstszene Westberlins. Der Vater fürchtete sich vor der Werkstatt, weil er den Verdacht hatte, er müsse dort hinunter, um in Pankow anzukommen, was in seinen Augen einen Absturz bedeuten könnte. Wenn er die Außenrahmen der Fenster abzog, achtete er darauf, dass kein Abfall nach unten in den Vorgarten der Werkstatt fiel. Nach zwei Monaten hatten Herbert und Clara etwa die Hälfte der Fenster fertig und sie leuchteten auf die Straße hinaus, hoben sich deutlich ab von den anderen Fenstern. Sie waren froh, es bereits so weit geschafft zu haben. Der kleine Sohn wurde in der Caritas Kindertagesstätte angemeldet, damit hatten sie einen Fuß in Pankow an die Erde gesetzt. Jetzt brachten sie ihn jeden Morgen dort hin und holten ihn nachmittags wieder ab. Einmal ging er in der Baustelle herum und sagte unvermittelt „Das ist eine schöne Wohnung!“. Der Vater nahm es als gutes Omen.
Im Sommer fuhr Clara mit dem Kleinen in die Ferien und Herbert arbeitete weiter an der Renovierung. Der Bruder rief an und fragte, ob er, Herbert, im Schöneberger Südgelände mitarbeiten wolle. Sie bauten dort einen sechshundert Meter langen eisernen Weg aus Profilen und Gitterrosten auf den alten Schienen des ehemaligen Güterbahnhofs. Herbert sagte nein, er könne nicht, er hätte noch zu viel zu tun mit der Wohnung. Jetzt stand das komplette große Salonzimmer an, das wollte er fertigbekommen, bis Karl und Clara zurückkamen aus der Schweiz, wo Clara im schönen alten Luzern geboren war. Der Vater schaffte das Werk und das große Fenster strahlte, brachte den Raum gleichsam in Ordnung und ließ hoffen. Clara brachte eine frohe Kunde mit. Renzo, Architekt und Freund aus Luzern, wollte ein Bild von Herbert kaufen. Das passte, war das Geld doch inzwischen knapp geworden. Herbert schickte Abbildungen von seinen Werken und sie einigten sich auf ein mittelgroßes. Es zeigte unzählige schwarze Linien in der Vertikalen und darüber quer eine einsame weiße. Ein dunkles Bild mit einem schmalen Weg des Lichts, eines Architekten würdig. Im Atelier auf dem Werkhof baute Herbert eine sichere Transportkiste und verpackte das Werk sorgfältig. Die Bahnspedition holte es ab und es trat seinen Weg in die Schweiz an. Der Empfänger nahm es an und war es zufrieden, hatte er doch das Original nicht gesehen. Wenig später war das Geld da und es konnte weitergehen. Clara und Herbert gingen ihren Kreuzweg der Renovierungsarbeiten unbeirrt weiter, sie waren dabei, einen echten Sauerstoffpunkt in grau depressiver Umgebung zu schaffen. Im Spätsommer war es soweit, dass alle siebenundachtzig Fensterflügel fertig waren und der Verwalter zur Begutachtung kam. Er befand die Arbeiten für richtig und versprach, im Gegenzug die Parkettböden machen zu lassen. Die kleine Familie nahm sich Anfang des Herbstes einen kurzen Urlaub, während die Fußbodenmacher in der Wohnung die Regie übernahmen. Sie fuhren in die Nordheide in das Haus von Herberts Schwester, das sie ihnen überließ, während sie selber in Ferien war. Sie genossen die Auszeit vom Renovieren und das Spiel mit dem Sohn. An einem der schönen Tage war Herbert mittags so müde, dass er nach oben ins Schlafzimmer ging und sich hinlegte. Er fiel sofort in tiefen Schlaf und träumte, dass sich seine gesamte Verwandtschaft mütterlicherseits, die lebenden und die toten, um sein Lager versammelte und schweigend auf ihn heruntersah. Die Gestalten waren allesamt grau und von großer schattenhafter Präsenz. Als er erwachte, konnte er sich nicht erklären, was der Traum zu bedeuten hatte. Sollte es heißen, dass sie ihn in ihrer Heimat, der Lüneburger Heide willkommen hießen? In der Heimat, sozusagen? Es war kein unangenehmes Gesicht gewesen, trotzdem stand er leicht verstört auf und stieg die Treppe ins Erdgeschoss hinab. Sie gingen mit Karl auf die angrenzende Wiese hinaus und ließen das erste Mal einen Drachen steigen. Herbert hatte vor den Ferien noch einen Antrag auf Ehrenunterstützung durch den Kultursenator beantragt. Er rief seinen Kontostand per Telefon ab und das Geld war eingegangen. Als er es Clara freudig mitteilte, sah er, wie ihr Gesicht sich einschwärzte. Was hatte das zu bedeuten.
Zurück in Berlin waren die Fußböden fast fertig. Herbert machte sich daran, die Küche mit Fliesen auszustatten. Er hatte solch Arbeit noch nie gemacht und ging davon aus, dass es ein veritables Abenteuer werden würde. Er fuhr nach Steglitz und kaufte die Fliesen und den Kleber ein und ließ sich einige Tipps vom Verkäufer geben. Man musste die Kachel geneigt auf den Mörtel setzen und sie mit einer leichten Rechtsdrehung in die Waagerechte bringen, damit sich der Kleber mit ihr richtig verband. Nach unsicherem Anfang gelang ihm die Technik und drei Tage später war das Werk vollbracht. Er strich noch die Fugenmasse mit dem Rakel ein und putzte nach dem Abbinden das Fliesenbild, das er geschaffen hatte. Vom Schrotthändler holte er eine Edelstahlspüle, baute sie ein und die Küche war prinzipiell in Funktion versetzt. Er konnte sich nicht versagen, einen kleinen Stolz bei sich zu vermerken. Die Geburtsschmerzen verließen ihn während all dieser Arbeiten nicht, aber seine Zuversicht stieg leicht an. Jetzt machte er sich daran, die Küche zu streichen. Zu dem Zweck räumte er den Gasherd vor die Küchentür. Als er zwischendurch die Tür öffnete, lag die Gummischlange, die die ganze Zeit draußen auf einem Fensterbrett gelegen hatte und die er nicht angerührt hatte, weil er sie für ein Zeichen hielt, plötzlich auf der Abdeckung des Herdes. Nur die Fußbodenwerker konnten sie dort hingelegt haben. Er verstand es als Warnung, dass die Schlange jetzt in die Wohnung eingedrungen war. „Die ewige alte Schlange...“. Er assoziierte Harald und seine Geschäftigkeiten damit, die für ihn ein Verführungspotenzial beinhaltete. Konnte er doch jeden Augenblick in den Keller abstürzen und seinen Sohn opfern. Er aber wollte und musste Maler bleiben und sich als solcher entfalten. Gleichzeitig terrorisierte ihn der Gedanke, dass er ein soziales Leben führen müsste, mit einer sozial relevanten Arbeit mit gesellschaftlicher Anerkennung, dass die Malerei ein Akt des Willens war und damit suspekt. Seine Ambivalenzen brachten ihn manches Mal an den Rand der Verzweiflung und hatten das Potenzial, ihn verrückt zu machen. Er funktionierte jedoch weiterhin dank der Standfestigkeit und Willenskraft seiner Freundin, die ihn stark machte und die er liebte.
Der kleine Karl hatte seine Freude an all den neuen Freunden in der Kita und entwickelte sich zusehends. Es ergaben sich neue Kontakte mit anderen Eltern für Herbert und Clara. Herbert fand das nicht immer gut, waren es doch ganz andere bürgerliche Existenzen, die sich meist im christlich sanktionierten und stark bürgerlichen Milieu bewegten als es die Freunde des Werkhofs in Moabit taten, die alle freie Handwerker, Künstler und Designer waren. Die Pankower waren alle Menschen, die in gesicherten Verhältnissen standen und feste Anstellungen hatten, in denen sie gut funktionierten. Davon konnte bei Herbert und Clara nicht die Rede sein, sie hatten die Aufgabe zu meistern, die Lebenskunst zu praktizieren. Herbert hatte immer ein leicht schlechtes Gewissen, wenn er diesen guten Bürgern begegnete, mit denen der Staat zu machen war. Da konnte er nicht mithalten und rang um sein Selbstbewusstsein, sein elementares Selbstwertgefühl. Er fühlte sich im Widerspruch zu den Bürgern, die dazu da waren, ihre Kinder zu versorgen und darüber hinaus keine Pflichten hatten. Sie dienten fast alle in vorbildlicher Weise dem christlichen System und wurden mit dem Gefühl belohnt, alles richtig zu machen. Herberts Kreuz war es hingegen, seiner egoistischen Tätigkeit der Malerei zu folgen und die verdammte, schöne Wohnung zu renovieren. Manchmal fühlte er sich einfach nur beschissen. Im Herbst hatten sie alle Fenster und die Hälfte der Türen gestrichen und begannen, die Wände zu streichen. Sie tapezierten nicht, sondern brachten die weiße Dispersion direkt auf den Putz auf. Die Decken nahmen sie sich nicht vor, das hätte bedeutet, die Wohnung perfekt zu machen und das wollten sie nicht. Die Decken gefielen ihnen mit ihrer alten Patina. Als das neue Familiengehäuse bezugsfertig wurde, suchten sie den anthroposophischen Verwalter auf und erhielten einen Mietvertrag, in den er die Ziffern 1, 2, 3 und 4 eintrug. Das war die Miete, die sie ab November zu zahlen hatten. Er fragte Herbert noch, ob er in seiner Bau- und Renovierungstruppe mitarbeiten wolle, der aber verneinte, er hatte erstmal genug von solchen Arbeiten.
In Moabit hatten sie alles gepackt und einen Lkw mit Fahrer und Helfer engagiert und einige Freunde waren gekommen, fürs Kistenschleppen. Nach zwei Stunden war der Wagen voll und fuhr nach Pankow. Bald waren alle Imponderabilien in den neuen Palast hinaufgetragen und die Kleinfamilie war angekommen. Abends, als alle Freunde gegangen waren, saßen sie vorne im Eckzimmer und verzehrten Pizza, sie fühlten eine besondere Befriedigung, der Vater empfand, dass ihnen eine kleine Flucht geglückt war. Sie bauten zuerst die Betten auf und verbrachten ihre erste Nacht im neuen Refugium. Wie gut man schlafen konnte. Sie hatten sich bemerkt als Wessis unter die Ossis gemischt. Clara hatte es leichter mit den Ossis als Herbert. Er gehörte dem Volk der Okkupanten an und merkte es beim Einkaufen im Bezirk, dass man etwas 'gegen ihn hatte'. Viele Pankower erlitten die freundliche Übernahme durch die BRD mehr als dass sie sich darüber freuten. Sie hätten lieber das alte Unterdrückungssystem behalten, in dem sie ihre Privilegien gehabt hatten. Wenn man vierzig Jahre lang auf eine bestimmte Weise sozialisiert wird, lässt sich das nicht über Nacht abschütteln, sie mussten sich völlig neu orientieren und lernen, was es hieß, im Raubtierkapitalismus zu überleben. Aufgrund solcher Erfahrungen mit den Ossis fühlte Herbert sich bald nicht mehr recht wohl in der neuen Umgebung, aber er trug sein Kreuz als Wessi unter Ossis. Die Vermischung der Ostdeutschen mit den Westdeutschen und umgekehrt war das historische Wagnis der Stunde, aber er begriff, es würde Generationen brauchen, um gegenseitiges Vertrauen aufzubauen. Das Schloss Niederschönhausen lag in mittelbarer Nähe zur Wohnung, und dort hatte der Runde Tisch getagt, der die Freiheit wollte. Fragt sich nur, ob sie mit Freiheit den Kapitalismus meinten, von dem sie keine Ahnung hatten. Erst neulich, 2019, hörte der Vater in einem Pankower Kaffee von einem Rentner am Nebentisch „Wir waren eine Familie“, so geht Verklärung, das beste Nahrungsmittel für populistische Verzerrungen und den Vormarsch der Nationalen innerhalb Ostdeutschlands.
Zum Einstand in Pankow machten sie eine Wohnungseinweihungsparty, Herberts Professor von der Universität der Künste kam und Frau und Herr Tesch, der Statiker. Viele Freunde waren da und es floss reichlich des guten italienischen Roten aus der Akazienstraße. Die Teschs verbrachten den ganzen Abend in Karls Kinderzimmer nebenan und spielten mit dem Kleinen. Als sie später gingen, sagten sie den Kauf eines Bildes von Herbert zu, das im Wohnzimmer an der Wand hing. Im Werkhof hatte Herbert den kleinsten der Atelierräume bezogen und das große Atelier, in dem sie gewohnt und gearbeitet hatten, untervermietet. Als Petr ankam, ein stark farbig malender Maler, half Herbert ihm beim Einzug. Sie beluden den Fahrstuhl im Erdgeschoss und versuchten, dessen Türen zu schließen, was nicht gelang. Herbert nahm seinen großen Schlüssel und wollte oben am Rahmen nachhelfen, dabei berührte er den elektrischen Schließer und bekam einen furchtbaren Stromschlag, dreihundertsechzig Volt waren ihm durch den Arm gejagt und versetzten ihm einen ungeheuren Schrecken. Er hatte Glück, weil es ihm gelang, sofort die Hand wegzureißen und weil er auf Gummisohlen stand. Er nahm es als schlechtes Omen. Und der Maler war ihm alles andere als sympathisch, aber es musste Geld für die Miete reinkommen. Herbert hatte in seinem Optimismus und damaligen Größenwahn den Vertrag für die ganze Etage übernommen in der Annahme, dass die Untermieter pünktlich ihre Verpflichtungen einhalten würden. Wie hatte er so naiv sein können. Es war Nachwendezeit und in der ganzen Stadt herrschte Goldgräberstimmung. Und es dauerte nicht lang, dass die Immobilie, ein schöner alter, wilhelminischer roter Backsteinbau mit drei großen Etagen, Begehrlichkeiten weckte und ein Investor auf den Plan trat, der es von der Vermögensverwaltung des Bundes kaufte. Jetzt war es nur noch eine Frage der Zeit, bis alle rausfliegen würden, die nach Modernisierung und Instandsetzung die Mieten nicht mehr würden bezahlen können. Vorerst pendelte Herbert zwischen Pankow und Moabit und malte weiter an seinen Bildern.
Die kleine Familie genoss den ersten Winter in Pankow, sie hatten eine zentralgeheizte Wohnung und mussten keine Kohlen mehr schleppen, um die Allesbrenner zu versorgen. Es kam Weihnachten und sie besorgten eine schöne Tanne und schmückten sie wie man es machte. Der Kleine hatte seine helle Freude am festlichen Geschehen, Oma kam und Onkel und Tante und der jüngere Bruder von Clara aus der Schweiz. Sie brieten eine Gans im Ofen und alles war, wie es zu Weihnachten sein sollte. Das schönste Geschenk des Abends waren die leuchtenden Augen des kleinen Karl. Im Januar gingen Clara und Herbert auf eine Ausstellungseröffnung im Berliner Lapidarium. Es waren hundert Besucher da und aus der Menge trat der Museumsdirektor der Stadt auf Herbert zu und sagte, er würde ins Atelier kommen, wegen der großen grauen Bilder. Er hatte sich bei der Künstlerförderung des Berliner Senats beworben und der Direktor war der Leiter der Ankaufskommission. Das war eine freudige Nachricht, die neue Hoffnung versprach. Mit seiner klugen und begabten, schönen Clara an seiner Seite lebte er sich in Pankow langsam ein. Morgens brachte er den Kleinen auf dem Fahrrad in die Kita, ging seinen Geschäften in Moabit nach und holte ihn nachmittags wieder ab. Sie fuhren durch die Anlagen des Schlosses Niederschönhausen und stiegen im Bürgerpark an der Panke ab und spielten unter den schönen großen Kastanienbäumen. Wenn sie nach Hause kamen, setzte Herbert sich in die Küche, trank einen Kaffee und rauchte. Es gab noch zu tun in der Wohnung, Vorhänge installieren, dazu in den Baumarkt fahren und das nötige Material einkaufen, das letzte Zimmer hinten harrte noch der Renovierung und diente inzwischen als Abstellraum. Es sollte bald Karls Kinderzimmer werden. Abends kochten sie und aßen in der Küche. Karls bevorzugtes Menü bestand aus Spaghetti mit Butter und Gemüserohkost. Clara fuhr freitags ins Atelier eines bekannten Berliner Malers und half ihm, seine Bilder herzustellen, für die er die Methode entwickelt hatte, die Leinwände ungerahmt auf den Boden zu legen und die Farben darüber zu gießen. Manchmal faltete er den Stoff oder zerknüllte ihn und erzielte reizvolle malerische Effekte. Er war schon alt und saß im Rollstuhl und leitete Clara an, die Arbeiten zu machen. Clara verdiente gutes Geld, das sie brauchen konnten.
Der Winter verging und es gab einen konkreten Termin für den Besuch der Ankaufskommission. Anfang April achtundneunzig bereitete Herbert alles im Atelier vor, stellte die großen grauen Bilder im dafür geliehenen geräumigeren Atelier auf. Es klingelte und der Museumsdirektor stand vor der Tür, allein, was Herbert sonderbar vorkam. Sonst brachte er immer einen ganzen Tross von anderen Museums- und Kunstinstitutionsleitern mit, für deren Häuser angekauft werden konnte. Die beiden standen im Atelier und führten ein belangloses Gespräch, der Direktor sah sich nach den Bildern um und wählte das größte. „Ich kann Sie groß machen!“, sagte er unvermittelt. Herbert wunderte sich einigermaßen über diese Ansage und nahm eine ablehnende Pose ein, zeigte ihm seine Seite und verschränkte die Arme vor der Brust. Was sollte das bedeuten? Es dämmerte ihm nur langsam, was der Direktor in Wahrheit wollte. Er wollte Macht ausüben, die Macht desjenigen, der das Geld mitbrachte und er wollte was Körperliches. In Herbert stieg ein altbekannter Ekel auf, den er von seinem Vater her kannte, der evangelischer Pfarrer gewesen war und ihn in seiner Kindheit zweimal sexuell missbraucht hatte. Wie konnte es wahr sein, dass das, was gerade geschah, wirklich geschah?! Dieser Direktor wollte ihn erneut zum Opfer machen und sich an ihm befriedigen. Gott, was hast du für eine perverse Schöpfung erfunden. „Des Satans Engel, der ihn schlagen sollte, dass er sich nicht überhebe?“ In Herbert wurde alles rigorose Ablehnung, er trat vom Direktor zurück und reagierte nicht auf dessen Angebot. Eine halbe Stunde verging und es klingelte erneut. Wie mit abgesprochener Verspätung trat die Sekretärin des Kultursenators ein und übernahm die bürokratische Abwicklung des Bildkaufs. Der Preis wurde festgelegt mit der Bemerkung des Direktors, dass es ja eigentlich soundso viel wert wäre, sie hätten aber nur noch soundso viel. Nachdem das geklärt war, begleitete Herbert ihn zum Ausgang, nicht ohne dass der Direktor ihm unter der Tür in deutlich aggressivem Tonfall zu zischte „Ihr Sohn muss ja was zu essen haben!“. Dann ging er. Auf der Treppe kamen gerade Clara und Karl nach oben und grüßten ihn freundlich. Für Herbert brach eine ganze Welt zusammen. Er ließ sich nichts anmerken und war dankbar für die Ankaufszusage. „Keiner kommt zum Vater denn durch mich“, war es das? Der Direktor machte ihn nicht groß. Am Karfreitag machten Clara, Herbert und Karl einen Besuch in der Innenstadt. Sie spielten in erster Sonne eine Weile auf der Wiese am Berliner Dom und stiegen dann die schmalen Gänge hinauf zum Fuß der gewaltigen Kuppel unter dem goldglänzenden Kreuz. Sie begingen den Rundgang und freuten sich an der Sicht über die Stadt. Am nächsten Morgen brachten sie Karl zur Oma in der Brandenburgischen Straße, die den Kleinen liebte, was auf Gegenseitigkeit beruhte. Sie machten Besorgungen in der Stadt und fuhren nach Pankow. Im Briefkasten fand sich Post vom Kultursenator und die schriftliche Bestätigung des Ankaufs. Wenige Tage später kam die Spedition, verpackte das Bild und lieferte es beim Museum ab. Jetzt war finanziell erstmal Ruhe.
Sie ließen Herberts schwarzen, großen Konzertflügel aus dem Atelier nach Hause transportieren und im Wohnzimmer aufstellen. Seit Karls Geburt hatte Herbert kaum noch gespielt, er versagte es sich, weil er meinte, dass Karl seine Malerei mit auf die Welt gebracht hatte und nicht die wahnwitzige Improvisationsmusik, die er früher auf dem Instrument veranstaltet hatte. Er wollte es sich auch nicht mit den Nachbarn verderben, mit dem Flügel konnte es sehr laut werden. Und sicher war er sich auch nicht, ob das, was er spielte, hörenswert war. Wo war seine ursprüngliche Lust geblieben, sich dran zu setzen und zu spielen, zu explodieren. Wenn er spielte, war er Vulkan, zärtlicher Liebhaber, war er wild, war er kanalisiert und domestiziert gewesen. Wenn er eine Stunde gespielt hatte, wurde er mit dem Gefühl der inneren Reinigung belohnt, hatte er die Töne und Akkorde zum Fließen gebracht wie das herabstürzende, frische, klare Gewässer eines Wasserfalls im Gebirge. Es war wie das Trinken aus frischer Quelle gewesen, das, was er in Wahrheit brauchte. Stattdessen trank er fette Milch an der Leinwand, trug dick die Farben auf und vergiftete sich mit pastosem Öl und Acryl. Er hatte geträumt, wie er in einer großen, hellen Höhle an den schleimigen, gelbsumpfigen Wänden gekratzt und gewischt hatte und wie er sich plötzlich außerhalb der Höhle zwischen den Schenkeln von Gudrun, die die vorherige Bewohnerin des großen Ateliers gewesen war, wiederfand und endlich frei war. Er war ihrem Uterus entkommen, als er nach Pankow zog. Als er intensiv und konzentriert gemalt hatte, hatte er 'Produkte' hergestellt und sie in die Welt gesetzt, „Seid fruchtbar und mehret euch!“ hatte er befolgt und einen Sohn gezeugt. In der Phase der Fruchtbarkeit hatte er Erfolge gehabt und Glück, es hatte einen dritten Kunstpreis gegeben und eine Reihe von Ankäufen und ein Stipendium der Akademie der Künste in der Nähe von Rom. Die Zeichen standen gut für ihn und er hatte Hoffnung gehabt, bis zu dem Tag, als der Direktor im Atelier aufgetreten war. Von dem Tag an hatte er keine Erfolge mehr, der Direktor hatte dem ein Ende gesetzt, weil Herbert ihm nicht zu Willen gewesen war. Er malte zwar weiter, aber beirrt, nicht mehr frei wie vorher, er spürte, er war unten durch im Kunstbetrieb. Auch hatte er überhaupt keine Lust mehr, mit der schwulen Kunstmafia in Berührung zu kommen. Sexuelle Dienstleistungen wollte und konnte er nicht erbringen. Seit dem Besuch des Direktors war nichts mehr, wie es gewesen war. Musste man sich prostituieren, wenn man ein Bein an die Erde kriegen wollte? Ja, man musste. Herbert wurde klar, dass er sich mit seiner Malerei im Schwulensystem bewegte. Er wollte nur noch eins: Raus da! Aber wie sollte er das anfangen, soweit, wie er schon gekommen war. Er hatte ein echtes Problem.
„Und auf dass ich mich nicht der hohen Offenbarung überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch, nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlage, auf dass ich mich nicht überhebe. Dafür ich dreimal zum HERRN gefleht habe, dass er von mir wiche. Und er hat zu mir gesagt: Laß dir an meiner Gnade genügen; denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne. Darum bin ich gutes Muts in Schwachheiten, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen, in Ängsten, um Christi willen; denn, wenn ich schwach bin, so bin ich stark.“
War es das, dass, wenn der Schwache, der Maler, in dieser Gesellschaft sich nicht seiner Schwäche entsprechend unterordnet, also nicht auf der Baustelle ausfegt, er vom System bestraft wird? Dass er sich nicht überhebe? Und wenn er die Strafe nicht annimmt, er mit Armut geschlagen wird? Des Satans Engel, der Direktor?
Das Ehepaar Tesch bot ihnen an, Urlaub in ihrem Ferienhaus in der Nähe von Wolfsburg am Rande der Heide zu machen und stellte es kostenlos zur Verfügung. Herbert und Clara nahmen gerne an und freuten sich auf vier Wochen in der Natur, waren sie doch erholungsbedürftig nach den Anstrengungen des Renovierens und Umziehens. Sie packten ihr Auto voll und machten sich auf den Weg. Es war eine alte Karre und unterwegs fing sie plötzlich an zu brummen. Sie steuerten eine Werkstatt nahe der Autobahn an und hatten Glück. Ein Kfz-Meister nahm sich sofort ihrer an und schweißte kurzerhand das gebrochene Auspuffrohr. Sie zahlten menschenfreundliche zwanzig Mark und setzten ihren Weg fort. Als sie beim Ferienhaus ankamen, war Frau Tesch da und empfing sie. Herbert schien es, dass sie ein gequältes Gesicht machte, als sie seiner ansichtig wurde. Bei einem Besuch im Atelier hatte sie Herbert mit leiser, eindringlicher Stimme zu verstehen gegeben, dass ein weiteres Kind nicht immer gesund zur Welt kommen könnte. Sie sprach aus eigener Erfahrung, eines ihrer drei Kinder war behindert. Ihre Warnung ging ihm seitdem nicht mehr aus dem Sinn. Sie hätte es wohl lieber gesehen, wenn Clara und Karl allein angereist wären, um einen schönen Mutter-Kind-Urlaub zu machen. Sie war eine weise Frau. Das kleine Ferienhaus lag am Rande eines weitläufigen Gartens mit zwei großen Rasenflächen, dicht umsäumt von Rhododendron Büschen und mit einigen hohen Bäumen darin. Frau Tesch wies sie kurz in den Gebrauch des Hauses ein und verabschiedete sich. Herbert nahm ihren schmerzlichen Gesichtsausdruck mit in diese Ferien, die bis auf ein paar sonnige Tage vollkommen verregnet waren. Seine Liebe zu Clara hatte Herbert schwach gemacht. Früher hatte er Stahl verarbeitet, hatte den starken Mann gemacht, der fähig gewesen war, Eisen zu biegen, zu schneiden, zu schweißen und zu schleifen. Sein Bruder Siegfried, ein erfolgreicher Stahlbildhauer, hatte ihn in diese Welt eingeführt. Mit ihm zusammen und auch allein hatte er zahlreiche Projekte bewältigt, die den ganzen Mann erfordert hatten. Auch hatte er eine Serie von farbigen Eisenskulpturen geschweißt, die er in Mahlsdorf ausgestellt hatte. Früher hatte er in Wilmersdorf in seiner Zweizimmerwohnung in der vierten Etage auf dem Hinterhof gesessen und Grafikaufträge bearbeitet, was seiner ersten Ausbildung und einem Studium entsprach. Bis zu dem Tag, als sein Bruder auftauchte und ihn von dort oben herunterholte und mit in die Hochschule am Steinplatz nahm, wo er große Stahlskulpturen für seinen Professor baute und seine eigenen erschaffte. Er führte Herbert in die Welt der dreidimensionalen, körperlichen Gegenstände ein. Für Herbert eine völlig neue Erfahrung, hatte er doch bis dahin nur mit Stift und Pinsel in den ersten beiden Dimensionen gearbeitet.
Herbert und Clara erfreuten sich an ihrem kleinen Sohn, wie er wuchs, wie er herumlief und wenn sie mit ihm im Plastikbecken planschten. Sie feierten ihre kleine, für vier Wochen geschenkte Idylle. Abends saßen sie auf der Terrasse und schauten die Fußballweltmeisterschaft im Fernsehen. Sie machten Ausflüge in die Umgebung, in die Heide, nach Hannover oder Wolfsburg, wo sie das Kunstmuseum besuchten und von Kiefers Arbeit „Zwanzig Jahre Einsamkeit“, ein großer Haufen alter öliger Leinwände, beeindruckt waren.
Als sie in Berlin zurück waren, gab es eine Einladung zu einer Geburtstagsfete im Werkhof. Sie fand im Obergeschoss des Hauses Zwei statt und alle waren da. Es wurde ausgelassen gefeiert, gegessen und getrunken. Auch der Architekt Daniel, den sie in Rom in der Villa Massimo kennengelernt hatten als Herbert sein Stipendium in Olevano Romano hatte, war gekommen. Auf dem Weg zurück nach Pankow sagte Clara, er wolle ihr Arbeit geben, sie einstellen. Herbert nahm die gute Nachricht mit zwiespältigen Gefühlen auf. Bis jetzt hatten sie alles zusammen gemacht, sie waren das Malerpaar, das sich mutig durch die Welt schlug. Herbert liebte seine schöne, kluge Freundin und konnte sich nicht recht vorstellen, was das bedeuten würde. Er konnte nicht lange darüber nachdenken, er musste raus aus seinem Atelier, die Investoren hatten ihn gekündigt. Er bewarb sich beim Bezirksamt Wedding um ein neues Atelier in einem Atelierhaus in der Wiesenstraße und bekam den Zuschlag. Die kleinen und mittelformatigen Bilder konnte er dorthin mitnehmen, die großen passten nicht durch das Treppenhaus. Sein Raum lag im vierten Stock. Er mietete in Pankow eine Autogarage und brachte sie dorthin. Warum mietete er ein neues Atelier, hatte er wirklich noch eine Hoffnung, die das rechtfertigte? Ja, er hoffte. Tertium datur, das Dritte geht, dachte er sich. Am ersten September bezog er den Raum und Clara nahm ihre neue Tätigkeit im Architekturbüro an der Potsdamer Straße auf. Schon am zweiten Tag trug sie einen Trenchcoat, was sie nie getan hatte. Herbert wunderte sich. Es schien ihm ein Akt der Anpassung zu sein. So kannte er sie noch nicht. Er fuhr in sein neues Atelier und fühlte sich vom ersten Augenblick an deplatziert. Einige der Künstlernachbarn kannte er schon, von der Hochschule und aus der Szene. Mit der Frau im Atelier nebenan hatte er mal was gehabt, was er seinerzeit Clara gebeichtet hatte. Aber das war vorbei und sie war jetzt mit einem Maler in der Etage drunter zusammen, wo beide auch wohnten. Herberts Raum war langgestreckt und hatte eine durchgehende Fensterfront, die viel Licht hereinbrachte. Er hängte ein paar Bilder auf, die er betrachtete und sich fragte, ob das noch der richtige Weg war. Eine leichte Verzweiflung ergriff ihn, er spürte, wie ein unschönes Zittern seinen Körper durchlief. Er fühlte sich schlecht, seine geliebte Freundin war nicht bei ihm, aber er musste stark sein oder zumindest so tun. Er war auf einer Insel der Glückseligen im umtosenden Meer des Römischen Weltreichs gelandet. Wie konnte er hier bestehen, hatte er doch hohe Ansprüche an sich selbst als Mann in der kleinen Familie. Die Untermieter in der Etage im Werkhof hatten alle bis auf einen ihre letzten Stromkosten und Mieten nicht bezahlt. Herbert blieb auf seinen Forderungen sitzen und brachte achttausend Mark Schulden mit nach Hause.
Zu Sylvester achtundneunzig besuchten sie die beiden in der Wiesenstraße im Atelier drunter und hatten ein gutes Essen. Gegen Mitternacht fuhren sie zu fünft zum Feuerwerk am Brandenburger Tor. Unterwegs merkte Herbert plötzlich, wie Jörg vom Beifahrersitz aus seine Hand auf seine am Schalthebel legte. Er zog sie erschreckt zurück. Nicht schon wieder! Dachte er. Und hatte das Gefühl, von einer giftigen Viper gebissen worden zu sein. Wie konnte dieser Mensch, von dem er dachte, er lebe in glücklicher Beziehung mit seiner Freundin, das tun? Da war er wieder, der Fluch seines Vaters. Die alte Panik bemächtigte sich seiner, aber er ließ sich nichts anmerken. Er hatte seine Hand verweigert und das musste genügen. Von da an fühlte er sich im Atelier überhaupt nicht mehr wohl. Immer öfter verließ er schon am frühen Nachmittag die Etage und flüchtete nach Pankow, holte den kleinen Karl von der Kita ab und ging mit ihm das Abendessen einkaufen. Nachher zuhause spielten sie zusammen und Herbert war froh, sich geborgen fühlen zu können. Er kochte das Abendessen und wartete, bis Clara von der Arbeit kam. Sie aßen in der Küche zusammen und brachten bald danach den Kleinen ins Bett. Oft war es Herbert, der ihm etwas vorlas bis beide müde wurden. Er schätzte den abendlichen Frieden, der einkehrte und die einzige Erholung vom Tage war. Wenn er und Clara nachts miteinander schliefen, liebte er alles an seiner Freundin, ihren Mund und ihre wunderschönen Brüste und Beine, ihre Hingabe, seine Hingabe an ihre Seele und ihre Klugheit. Wenn er sie umarmte war sie weich und warm und sein Vertrauen war ohne Grenzen. Sie war eine starke Frau, die immer einen festen Standpunkt hatte und ihn konsequent vertrat. Im Bett war sie frei und ungezwungen und offen, die Freuden, die sie sich gegenseitig schenkten, waren köstlich und ja, göttlich. Immer seltener fuhr er abends nochmals ins Atelier, er hatte einfach keine Lust mehr, zu malen. Wenn er es tat, war es ihm ohne Hoffnung. Was aber sollte werden? Verzweifelt verbrachte er ganze Abende zuhause rauchend und Espresso trinkend vor dem Fernseher und hatte ein schlechtes Gewissen seiner Freundin und seinem Sohn gegenüber. Er bekam langsam die Vorstellung, dass er ebenfalls im Architekturbüro arbeiten musste, wenn die Zauberflöte Recht behalten sollte. Aber wie sollte das gehen, er war kein Architekt und kein Bauzeichner. In der Villa Massimo anlässlich einer Autorenlesung, in der Zigarettenpause draußen, hatte Daniel zu ihm gesagt: „Du wirst für uns arbeiten, du weißt es nur noch nicht“. Was sollte das bedeuten? Herbert konnte sich damals vor drei Jahren keinen Reim darauf machen, erst jetzt dämmerte ihm langsam etwas.
Clara erhielt vom Büro den Auftrag, einen Umschlag für eine Broschüre zu gestalten. Die Arbeit brachte sie mit nach Hause und Herbert sah, dass sie einige Mühe damit hatte. Sein Grafiker Herz fing wieder an zu schlagen und er versuchte sich seinerseits. Mit Hilfe des Computers hatte er bald einen Entwurf, den er ausdruckte, zurechtschnitt und falzte. Er fühlte sich in ältere Zeiten versetzt. Als er in Karls Gegenwart Clara den Entwurf reichte, stürzte Karl sich mit angstvoll erschrecktem Gesicht in ihre Arme. Gleichzeitig überkam Herbert ein Gefühl der Schuld und dessen, dass er gerade einen furchtbaren Fehler gemacht hatte. Clara hatte nichts falsch gemacht, er hatte freiwillig gehandelt. Er stand immer in der Gefahr, sich zu symbiotisch an eine Frau zu verlieren und seine eigene Entfaltung zu vernachlässigen. Er dachte, damals, als seine kleine Schwester zur Welt kam, neun Jahre nach ihm, hatte er seinen Stand als Nesthäkchen verloren, als Zweitgeborener, vielleicht wollte er das Trauma reparieren, indem er die symbiotische Beziehung zu seiner Mutter zurückzuholen versuchte. Tat er genau das, als er Clara den Entwurf reichte anstatt das Haus zu verlassen und draußen zu kämpfen? Der Einzige, der jetzt ein Recht auf seine Symbiose hatte, war der kleine Karl. Herbert bekam Angst, als er seine Reaktion sah. Er hämmerte sich in sein Denken ein, dass er seinen Sohn nicht opfern würde, seine Rechte als Erst- und Einziggeborener. Aber in der Folge dieses Geschehens kam die Idee auf, dass Herbert für die Architekten einen Katalog machen könnte. Wie es genau dazu kam, wusste er nicht mehr. Allein, Clara kaufte einen Apple-Computer und brachte die Programme aus dem Büro mit, die er brauchte. Er setzte sich an den Schreibtisch und begann, zu lernen. Clara brachte aus ihrer Praxis einiges Wissen mit, das sie an ihn weitergab. Er begann, Fotos und Texte zu den Bauten und Projekten der Architekten in ein Layout einzuarbeiten. Von Anfang an machte ihm die Tätigkeit Spaß, er lernte schnell und bald stellten sich Erfolge ein. Es war eine ungemein zeitaufwendige und akribische Arbeit, die zu tun war. Und endlich hatte er einen legitimen Grund, zuhause zu bleiben und nicht ins ungeliebte Atelier gehen zu müssen. Und plötzlich war es in Ordnung, den Kleinen zu versorgen, ihn in die Kita zu bringen und abzuholen und danach noch zum Spielplatz zu fahren und mit ihm ausgedehnte Spiele zu spielen, die eigentlich immer Karl sich aussuchte. Manchmal kam aber doch noch die Frage hoch, was er dort machte, zwischen all den Pankower Müttern. Er ließ seine Freundin jeden Tag in den Kampf ziehen und genoss in Ruhe seine häusliche Arbeit.
Clara brachte fast jeden Abend neue Dokumente, Pläne und Fotos auf CD aus dem Büro mit, die verarbeitet werden mussten. Als sie Internet bekamen, schickte sie das meiste auf diesem neuen, wunderbaren Weg. Herbert wusste nicht mehr, wann es anfing, dass er unzufrieden wurde. Er begann wieder, an sich zu zweifeln. Wo sollte er in dieser Sache als Mann bleiben? Er fing an, Clara nachlässig und lieblos zu behandeln, küsste sie abends, wenn sie kam, nur noch widerwillig. Beim Abendessen verbreitete er schlechte Laune, es gab Streit und Auseinandersetzungen. Er fühlte sich nicht mehr als richtiger Mann, nur noch als Hausmann. Nach ein paar Monaten hatte er einen Entwurf des Katalogs fertig. Er druckte ihn aus und fuhr ins Büro, um ihn Daniel zur Korrektur vorzulegen. Während sie am Tisch saßen und das Buch im Einzelnen durchgingen, stellte Clara sich in anderthalb Metern Entfernung auf und zeigte ein schmerzvolles Gesicht, das Herbert nicht deuten konnte. Missbilligte sie seinen Besuch? In dieser Zeit hatte Herbert einen Traum gehabt, in dem Daniel in ihrem Flur zuhause auf ihn zutrat und ihm ein römisches Kurzschwert in den Leib rammte. Hatte Clara Angst um sich oder Herbert? Er fand keine Erklärung. Nach einigen Änderungswünschen segnete Daniel den Entwurf ab und der Weg für die eigentliche Produktion war frei. Und endlich verdiente Herbert mal wieder Geld. Sie gingen zu dritt noch nach unten, das Büro befand sich in der vierten Etage, einen Espresso trinken und Herbert schämte sich, dass er immer noch rauchte. Danach suchten Clara und Herbert die Mall am Potsdamer Platz auf und erwarben eine neue Hose für Herbert.
Zuhause wurde die Stimmung zusehends schlechter und drei Wochen vor Weihnachten neunundneunzig reichte es Clara, sie hielt Herberts Depressivität nicht mehr aus und verlangte von ihm, auszuziehen. Ihre Schweizer Freundin Barbara, eine attraktive Frau, wie er fand, die ebenfalls in Berlin lebte, stellte ihre Einzimmerwohnung, die sie zu der Zeit nicht brauchte, zur Verfügung und Herbert packte einen Koffer und den Computer ins Auto und verzog sich. In den ersten Tagen in der neuen Bleibe konnte er nichts tun, außer zu schlafen, Kaffee zu trinken, zu rauchen und mit dem Rechner rumzumachen. Bald hatte er genug davon und stürzte sich in das Atelier des Bruders und seiner Künstlerkollegen hinab, das sich in einer alten Lokreparaturhalle auf dem Schöneberger Südgelände befand. Sie erkannten seine Not und ließen ihn mitarbeiten. Unversehens fand er sich in der guten, alten Eisenschneiderei wieder, er hatte nicht vergessen, wie diese Dinge vor sich gingen. Gleich fühlte er sich ein wenig männlicher und legitimierter, diente er doch mit der Geländer Produktion für den umgebenden Naturpark dem römisch-christlichen Gemeinwohl. Er holte übers Wochenende Karl zu sich und sofort war die Einsamkeit durchbrochen. Sie fuhren zum Weihnachtsmarkt, bestiegen das Riesenrad und freuten sich an der Aussicht über das Lichtermeer der Stadt und des Rummels unter ihnen, dessen leuchtende Farben zu einem stark bunten, impressionistischen Gemälde verschmolzen. Sie wanderten über den Markt und wunderten sich über die Unzahl von Menschen, die ihrem Vergnügen nachgingen. Das Weihnachtsfest durfte Herbert in Pankow mit seiner Familie verbringen und danach auch wieder einziehen. Er ging jetzt immer in die Halle des Bruders und arbeitete an den Schlosserei Projekten mit, die die Künstlergruppe Odious in Auftrag hatte, darunter ein kleiner Brunnen aus Edelstahl für den Goethe-Garten im Palmen-Garten in Frankfurt am Main, der Teil einer größeren künstlerischen Anlage war, die Odious vor Ort bereits realisiert hatte. Im Frühjahr neunundneunzig packten sie ihre Autos mit Werkzeug voll und machten sich auf nach Frankfurt zur Montage, um der Anlage den letzten Schliff zu geben. Sie kamen im noblen Westend bei einem ehemaligen Banker in dessen großer Vierzimmerwohnung unter. Herbert bekam ein Zimmer nach vorne raus und schlief auf einem Sofa. Jeden Morgen um sieben standen sie auf, frühstückten und gingen zu Fuß in den Garten und arbeiteten bis zum Nachmittag. Jeden Abend, wenn sie erschöpft in der Küche des Bankers saßen und Bier oder Wein tranken, nahm er sein italienisches Kochbuch zur Hand und bereitete ein vorzügliches Essen für die Mannschaft zu. So ließ es sich leben. Im Zimmer des Bankers stand eine halb volle, verschlossene Rotweinflasche, es war die Flasche, aus der er und seine Frau zuletzt getrunken hatten, bevor sie gestorben war. In Herberts Gepäck befand sich ein Brief, den Karl und Clara ihm zum Geburtstag geschrieben hatten. Freudig öffnete er ihn und las die Glückwünsche und einen Satz, in dem Clara ihn „Mein Mann“ nannte. Wohl, weil er auf Montage war und hart arbeitete, sich mit echten Männern maß und den Kampf des Lebens kämpfte. Natürlich hatte sie Recht und er war ein bisschen stolz und glücklich. Mit Herberts Rausschmiss vor Weihnachten hatte sie den Frosch an die Wand geklatscht und jetzt war er auf dem Weg, ein Prinz zu werden.
Zum guten Ende der Arbeiten gab es eine große Eröffnung. Es gab Reden und Prosecco, die Bürgermeisterin war da und alles, was sonst noch Rang und Namen in der Stadt hatte. Die Künstler hatten sich echt feine schwarze Anzüge auf Firmenkosten geleistet und machten eine gute Figur. Sie führten eine kleine Malocher Performance auf, mit kreischender und Funken sprühender Flex. Am nächsten Tag packten sie und fuhren zurück nach Berlin. Herbert durfte den großen 500er Mercedes steuern, den sich der eine großmannssüchtige Bildhauer leistete. Das Auto fuhr sich wie Butter und schnell waren sie zurück in Berlin. Herbert stieg an der Wohnung seiner Mutter aus, um mit ihr die Renovierung zu besprechen, die er in ihrer neuen Wohnung in Rotenburg an der Wümme machen sollte. Glücklich fuhr er nach Pankow und umarmte seine Familie.





























