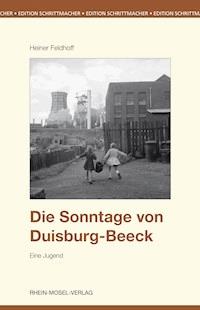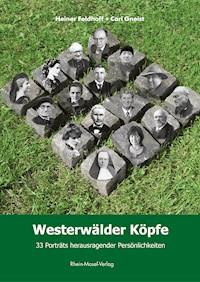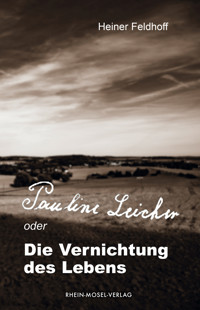
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Rhein-Mosel-Vlg
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Eine Erinnerung an Pauline Leicher (1904 – 1941), Opfer der NS-Euthanasie Pauline Leicher, 1904 in Lautzert im Westerwald geboren, war geistig behindert; den Nazis galt sie als »unwertes Leben«. 1941 wurde sie in der Gaskammer von Hadamar ermordet. Trotz fehlender Quellen und Dokumente – es existiert keine einzige Fotografie von ihr – hat Heiner Feldhoff wesentliche Ereignisse aus ihrem 37-jährigen Leben zusammentragen können. Der Weg dieser Recherche macht deutlich, wie sehr Verdrängung und Tabuisierung das Gedenken an die Opfer der NS-Euthanasie bis heute erschweren. Ein sehr persönlicher Appell gegen das Vergessen, eine engagierte Erinnerung an die Verbrechen damals in Hadamar und anderen sogenannten Tötungsanstalten. Und ein ganz eigener Aufruf zur Wachsamkeit heute.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 149
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© 2023 – e-book-AusgabeRHEIN-MOSEL-VERLAGZell/MoselBrandenburg 17, D-56856 Zell/MoselTel 06542/5151 Fax 06542/61158Alle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-89801-940-8Ausstattung: Stefanie ThurUmschlag Foto: Landschaft über Hadamar, Peter Lindlein
Heiner Feldhoff
Pauline Leicher
oder
Die Vernichtung des Lebens
Erinnerung an Pauline Leicher (1904 – 1941) Opfer der NS-Euthanasie
Rhein-Mosel-Verlag
Vorbemerkung
Eigentlich fühlte ich mich nicht stark, nicht gesund genug, mich mit einem so traurigen Thema abzugeben, noch weniger, dies in einem durchgängigen Trauerton zu tun. Ja, ich war entsetzt gewesen wie selten zuvor, von kaltem Grausen erfüllt, als ich in Hadamar durch den historischen Keller ging, allein, auf mich allein angewiesen, und ich brauchte Wochen, Monate, um mich von dem unsichtbar und dennoch unmittelbar präsenten Schrecken der Verbrechen, der Tötungen, der Gasmorde einigermaßen freizumachen, zurückzufinden zu Worten eingebildeter, halbwegs souveräner Abwehr oder gar Verarbeitung des Pauline-Schicksals. Ihr Vorname war mir dabei eher eine Hilfe; sein Klang hatte etwas Widerständiges, als wenn er erinnern wollte an Glaube, an Liebe, an Hoffnung, bloß worauf? Das blieb offen, aber ich schrieb‘s auf, schrieb’s in mein Nächtebuch, schrieb mich mitten in diesen Schmerz, diese Finsternis hinein und doch so weit weg von dem, was da geschehen war in Hadamar, im Monat Mai vor achtzig Jahren.
Und irgendwann wurde mir Paulines Lebensgeschichte zur Herzensangelegenheit. Wurde mir, lasst es mich sagen, Leicher ums Herz.
Aber wenn es darauf ankäme, die Spuren unseres Daseins zu verwischen? Und die so gut wie vergessene Pauline schon auf dem besten Wege war, dieses Ziel zu erreichen?
Auf der Suche nach einer Vergessenen
Keine Spur von Pauline auf dem Friedhof meines Dorfes, in welches es mich vor Jahrzehnten verschlagen hatte. Auf dem Denkmal für die Gefallenen aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg entdeckte ich unter den Inschriften den Namen Gustav Leicher, daneben das Datum 9.12.43. Ihr Bruder war also im Alter von 37 Jahren tot geblieben, wie man hier sagt. Ich wollte bei dieser Gelegenheit auch einen Blick werfen auf das Gräberfeld mitsamt dem neuen Urnenterrain. So viele, die ich gekannt habe, liegen hier, finden hier ihre letzte Unruhe. Von der Landstraße donnerte der inzwischen geradezu endlose Verkehr herüber. Vor allem ist es der örtliche Schwerkraftverkehr, doch mehr und mehr brummen und jaulen die internationalen Transporter vorbei, Lkws aus Litauen, aus Polen, aus Belarus, die auch an Gustavs früherem Wohnhaus vorbeirumpeln, wo seine Witwe Elise noch zwei Jahrzehnte weitergelebt hat.
Am Friedhof in Lautzert (Thomas Lindelauf, Lautzert)
Der Totenhof von Lautzert wird ganz gewiss nicht deine letzte Ruhestätte sein, sage ich mir jedesmal, wenn ich selbst hier vorbeifahre, hier findest du in Ewigkeit keine Ruhe, die Totenruhe wird hier fortwährend, naturgemäß tagsüber brutaler als des Nachts, gestört. Es hat, unstatthaft angemerkt, vielleicht auch sein Gutes, dass der Pauline dieser Ort, der ehedem ein Ruheort gewesen sein mag, erspart geblieben ist, vorenthalten worden ist, wie eben auch ihrem Bruder Gustav, der, ich wiederhole mich, im Krieg bei Tscherkassy in der Ukraine gefallen ist. Auf diesem Friedhof kann sich bestatten lassen, wer will, ich will es nicht. Oder doch?
Die Dorfbewohner seien ihm, Gustav Leicher, dankbar, heißt es auf dem Denkmal (das naturgemäß nach dem Zusammenbruch des Dritten Reiches zu beiden Seiten hat erweitert werden müssen) neben anderen Namen wie Sohnius, Lütsch und Hering. Eine Familie Hering aus Lautzert hat der große August Sander einmal fotografiert, eine Familie Leicher niemals. Übrigens finden sich hier nahebei auch sehr schön gelegene Friedhöfe, zum Beispiel gleich in den Nachbardörfern Oberdreis und Rodenbach oder ein paar Kilometer entfernt in Herschbach am Ende der wundervollen Laurentius-Allee.
Es gibt Menschen, die kennen ihr eigenes Geburtsdatum nicht, bedingt etwa durch Krieg und Flucht. Und von manchen Verstorbenen ist der genaue Tag ihres Todes unbekannt. Das berühmteste Beispiel ist der Gottessohn, Jesus aus Nazareth in Galiläa. Er sei 4 v. Chr. geboren, sagen die Wissenschaftler, und mit 37 Jahren hingerichtet worden, als Unschuldiger. Wie auch die junge Frau aus Lauzereth, schreibe ich hier falsch und kühn, wie auch Pauline Leicher aus Lautzert im Westerwald. Über Jesus ist viel, vielleicht zuviel geschrieben worden, über Pauline praktisch kein Wort, keine Ortschronik, kein Heimatjahrbuch erwähnt sie. Ihre Lebensdaten sind amtlich erfasst, aber falsch, jedenfalls das Todesdatum.
Und damit fing für mich ihre Geschichte an. Sie sei am 28. Mai 1941 verstorben, hieß es im Sterberegister meiner Verbandsgemeinde, eine offizielle Lüge, die noch 80 Jahre später nicht korrigiert worden war. In Wahrheit, wie sich herausstellen sollte, ging Pauline den Tod ins Gas am 6. Mai, drei Wochen vorher. Im selben Alter also wie ihr Bruder. Im selben Alter wie der König der Juden, verhöhnt, wie auch der Erlöser, von ihren Mördern: Ihr Tod sei für sie eine Erlösung gewesen, hieß es im Schreiben der Mordanstalt, in welchem von einer plötzlichen schweren Krankheit die Rede war, der sie erlegen sei. Dieser Brief an die Familie Leicher in Lautzert ist nicht erhalten, wie es ja nichts, gar nichts Konkretes, Persönliches, von ihr Hinterlassenes gibt, die Auslöschung war eine endgültige, eine totale.
Ich habe diese Herausforderung angenommen und bin den Spuren und Indizien gefolgt. Was hier zu lesen sein wird, ist keine leichte Kost. So hat es einmal eine hessische Justizministerin bezeichnet, ein Ausdruck der Hilflosigkeit, mir wird es ähnlich passieren im Laufe dieser Beschreibung eines Lebens zum grundbösen Tod hin. Wer fürchtet, das alles nicht fassen zu können, lese langsam, lese ein paar Sätze laut, lasse es womöglich erst einen Robusteren lesen, lege das Büchlein eine Weile weg und versuche es erneut. Nein, der Leser, die Leserin muss nicht nach Hadamar fahren, jedenfalls sei er gewarnt, es ist dort nicht zum Aushalten. In diesem Buch ist ja in der Hauptsache nur von einer einzigen Person die Rede, aber auch von ihren neunundachtzig Schicksalsgefährtinnen am Tag ihrer Ermordung, und von den anderen, über neunhundert, die in der ersten Jahreshälfte 1941 aus der Heil- und Pflegeanstalt Andernach nach Hadamar verlegt, von den zehntausend, die hier in die Gaskammer getrieben wurden.
Zu Beginn des 20er Jahres hielt uns alle die Corona-Drangsal in ihrem Bann, sie verdrängte mich aus den Lesesälen der Archive und schien den Beginn der Arbeit auf den Sankt-Nimmerleinstag verschieben zu wollen, was mir sehr zupass kam, ich fühlte mich seit langem an jene Erzähler im Werk von Thomas Bernhard erinnert, die eine Geistesarbeit im Sinne haben, aber schon beim ersten Satz scheitern. In Wahrheit drückte auch ich mich vor der Aufgabe und fand immer neue Ausflüchte und Hinderungsgründe: die Verschwiegenheit des Dorfes, die unauffindbaren, verschwundenen Dokumente und nicht zuletzt mein Menschenrecht auf Selbstschutz: Warum denn ich? Aber ich saß schon zu lange in diesem grauen Bus Richtung Hadamar, in diesem Bus des Grauens, von dem noch die Rede sein wird.
Eine der ersten öffentlichen Spuren führte mich nach Andernach. Hier hatte man an meinem Geburtstag 1996 – den ich erwähne, um deutlich zu machen, dass ich nicht anders kann, als das alles persönlich zu nehmen –, hier also, nicht am Ort, aber immerhin in der Stadt der früheren Heil- und Pflegeanstalt, der vormaligen Provinzirrenanstalt und der nachmaligen Landesnervenklinik, der heutigen Rhein-Mosel-Fachklinik, einen sogenannten Spiegelcontainer aufgestellt in Erinnerung an die aus Andernach nach Hadamar in den Tod transportierten Patienten.
Mit einem Freund fuhr ich von Neuwied über die Rheinbrücke nach Andernach, wo wir in der Stadtmitte im alten engen Parkhaus herumkurvten, um einen Stellplatz zu finden, was nur mit Mühe und dem Überfahren einer Begrenzungsschwelle gelang. Aber ich wusste sogleich, wir waren auf der richtigen Spur, wir waren in Sichtweite der Christuskirche. Draußen im Park erblickten wir sogleich den rostbraunen Stahlcontainer, er war weniger klobig und unschön, als ich erwartet hatte.
Ich hatte angenommen, man könne hineingehen, um die hier versammelten Namen zu lesen, aber er war verschlossen. Wir starrten durch die Glasscheibe, was zum Teil vom kalten Licht der Wintersonne erschwert wurde. Der Freund wollte angesichts der 880 Namen rasch aufgeben, aber ich wollte nicht vergeblich hergekommen sein, und richtig, unten in der drittletzten Reihe entdeckte ich meine Pauline, Pauline L., das musste sie sein. Es gab zwar, soweit wir etwas sehen konnten, eine zweite Pauline, aber keine mit dem Anfangsbuchstaben L, nein, wir hatten die Pauline L. gefunden, Pauline Leicher aus L., Pauline Leicher aus Lautzert, nach Jahrzehnten aus den Aufnahmebüchern der Provinzial Heil- und Pflegeanstalt »überführt« in diese Sammlung von Opfernamen. Im Sinne der Gedenktafel nun auch aus ihrem spurlosen Verschwinden befreit, noch immer freilich im Halbanonymen. Bis 2016 wurden die Nachnamen der Ermordeten nur abgekürzt angegeben.
Spiegel-Container Andernach (Peter Lindlein, Betzdorf)
Nach Andernach entstand bei mir, selbst bei einem Schreckensthema wie diesem, so etwas wie die Spannung einer kriminalistischen Recherche, zu der sich dann im Erfolgsfall die Genugtuung gesellen würde. Und da ich das ja alles aufschreiben wollte, kam ein weiterer Skrupel hinzu – ob denn die mögliche Freude am Gelingen einer Gedenkschrift überhaupt statthaft sei? Indes, beruhigte ich mich, es muss eine gewisse Balance geben, das eine ist ohne das andere nicht zu bewältigen, kommt erst gar nicht in Gang, eine Balance zwischen dem mörderischen Ernst und dem Weiterleben im Wort. Außerdem ist es die Pauline selbst, die mich als ihren Schreiber ausgesucht hat, sage ich mir mittlerweile, und lasse diese Aussage hier stehen, ohne weitere Begründung.
Kann denn ein Mann über eine Frau schreiben? Ja. Ein sogenannter Normaler über einen Geistesgestörten? Ja. Ein Niederrheiner über einen Westerwälder? Ja. Ein Lebender über einen Toten? Ja.
Irgendwann also würde mich mein Weg auch direkt nach Hadamar führen. Doch alles zu seiner Zeit. Wer sich dorthin begibt, sollte im schönen Gemünden einen Halt machen. Auf dem Wandgemälde der alten Dorfkirche erteilt ein geistesabwesend, überwirklich dreinblickender Christus seinen Segen ins Leere. Ja, der Abgebildete blickte seltsam durch mich hindurch, als ich ihn jüngst aufsuchte und ihm nahe sein wollte, dem Menschensohn, der, so sind wir unterwiesen, zu Lebzeiten ein Fürsprecher für alle Mühseligen und Verstörten und von Dämonen Heimgesuchten gewesen sein soll und noch heute als Ansprechpartner gilt für alle Unvollkommenen, Untauglichen, Unbrauchbaren, letzten Endes, mach nur so weiter, müsste in dieser Liste ein jeglicher genannt werden, Instabile, Hinfällige, Anfällige wir alle, und unter uns dieser Covid-19-Leugner, der dich Maskierten plötzlich am Busbahnhof anspuckt.
Spiegel-Container Andernach (Peter Lindlein, Betzdorf)
Vor der evangelischen Kirche – das ist der Zusammenhang, aus dem ich mich manchmal hier wegstehle, der Leser hat’s schon gemerkt – wird auf steinernen Tafeln, die an einer dekorativen Bruchsteinmauer angebracht sind, der Opfer der beiden Weltkriege und des Nationalsozialismus gedacht, so wörtlich. Gemünden, sagte der Ortspfarrer Wengenroth in einem Interview mit dem Südwest-Fernsehen, Gemünden sei früher eine Nazi-Hochburg gewesen, aber jetzt nazifrei. Neben den Tafeln ist seit einigen Jahren, vom Gemeinderat initiiert, eine Erinnerungsstele aufgestellt, mit der Inschrift: »Wir gedenken der Euthanasieopfer Ilse Wengenroth, Lina Wengenroth, Lore Wolf«. Der Pfarrer, inzwischen zum Dekan des Dekanats Westerwald aufgestiegen, hat mit den genannten Frauen, deren Namenauf den Tafelnin Majuskeln festgehalten sind, familiär nichts zu tun, auch der Bürgermeister Dietmar Wolf nicht, den ich anrief. Er erzählte mir noch, aus der Gemeinde seien 31 Juden in Auschwitz umgekommen. Im »Netz« las ich dann von der örtlichen Theatergruppe in Gemünden, sie nennt sich Fratze-im-Kopp. Zu dem Jahr für Jahr bei ihren Aufführungen im Dorfgemeinschaftshaus umjubelten Ensemble gehören immer wieder auch Söhne, Töchter aus Familien namens Wengenroth und Wolf. Eine Mordsgaudi jedesmal, naturgemäß mit Happyend.
Von der stellvertretenden Vorsitzenden der Dekanatssynode hörte ich später, da ich unbedingt wissen wollte, wie dieser Erinnerungsprozess zustande gekommen war, der Dekan habe ihr dazu nichts sagen können, und zu ihrem Befremden auch der aus Gemünden stammende Finanzfachmann des Dekanats nichts, merkwürdig, sagte die Synodale, eine Sensible, wir duzen uns. Auch sie habe einmal mit Schülern ihres Gymnasiums die Gedenkstätte Hadamar besucht und das Gesehene dort nur schwer verkraften können, es sei ihr noch lange nachgegangen. Seither habe sie eine Beschäftigung mit dem Euthanasie-Thema vermieden. Sie müsse jetzt aber das Telefongespräch beenden, sagte sie, auch in Corona-Zeiten wolle sie als Organistin ihrer Gemeinde in der Übung bleiben. Ich stellte mir vor, wie sie in der leeren Kirche Orgel spielte. Mit Fried und Freud ich fahr dahin.
Und ich? Sollte ich wirklich fortfahren mit meinen Nachforschungen zum Lebenslauf der Pauline Leicher? Und das Risiko eingehen, nach monatelangen Einschränkungen durch die Pandemie, nach jahrelangem Verweilen im Grauen, so hat es Hannah Arendt gesagt, in eine Depression zu fallen, die, auch im Falle des Überlebens, das eigene Leben möglicherweise verkürzen würde, da mir eine kühle, nüchterne, distanzierte Darstellung nicht möglich wäre? Letzten Endes müsste ich doch Pauline bis zum Ort ihrer Vernichtung begleiten, bis vor die Gaskammer – nein, jetzt nicht, heute nicht, ich weiß wirklich noch nicht wie und ob überhaupt.
Zu meiner Verzögerungstaktik, wenn nicht gar Vermeidungsstrategie, gehören die Abschweifungen ins Jetzt, meine Schreibaktion T4 (Erklärung später) droht Opfer von Covid-19 zu werden, täglich versorgt uns die Regierung mit neuen Nachweisen ihrer Fehlbarkeit, und wir setzen dennoch, in großer Mehrheit, gehorsam gegenüber der Obrigkeit, unser öffentliches Leben als Maskenträger fort, nuscheln vor uns hin und verstehen einander nicht. Aber überall kommt mir nun eine Pauline entgegen, zum Beispiel eine Nichte über Facetime aus Berlin, oder als schnelles Foto von einer Neugeborenen aus München, als Todesanzeige in der Rhein-Zeitung, Ausgabe Neuwied – und, ich krieg’s eben nicht mehr aus’m Kopp: in Hadamar 1941 hieß die schlimmste Schwester, nein, Aufseherin, nein, Mordgesellin, mit Vornamen ebenfalls Pauline. Ich höre Schreie, ich höre Gelächter im Dunkel.
Nicht nur namentlich stellt sich mir Pauline in den Weg, dies geschieht auch indirekt, zum Beispiel als ich jüngst das neue Buch eines japanischen Autors meines Alters aufschlug und die Anfangssätze las: »Ich möchte hier von einer jungen Frau erzählen. Auch wenn ich zugeben muss, dass ich so gut wie nichts von ihr weiß.« Der Erzähler kennt weder ihren Namen noch kann er sich an ihr Gesicht erinnern. Ich dagegen habe wenigstens den Namen, ihren Mädchennamen, ihren Rufnamen, den ich vor dem endgültigen Verschwinden bewahren will. Aber auch ich habe keinerlei Bild von ihrem Gesicht, es existiert keine einzige Fotografie. Pauline Leicher; ein Mensch des 20. Jahrhunderts, im Sinne August Sanders: und dass es kein Bild von ihr gibt, ist noch aussagefähiger, als gäbe es eines.
Noch einmal fragte ich daher den Urneffen, mit dem ich Monate zuvor an seiner Haustür gesprochen hatte, nach alten Familienfotos, als ich ihn am Waldrand wiedersah. Ich hatte damals bei dem ahnungslosen jungen Mann nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen wollen und nur sehr vorsichtig gesagt, ich forschte nach dem Schicksal einer vor langer Zeit verstorbenen weiblichen Verwandten seiner Familie. Diesmal sprach er von einer Kiste mit Schwarz-Weiß-Fotos, so mit gezackten Rändern. Sind auch welche vom alten Haus dabei? fragte ich. Ja, das könne sein, das sei sehr klein gewesen.
Gut, ich werde also etwas über diese Pauline Leicher schreiben, über meine Pauline, wie ich zu mir selbst immer öfter sage, wie ich ja auch seit langem immer von meinem Paul spreche, meinem Paul Deussen aus Oberdreis, dem Philosophen, dem Indologen, dem Freund Nietzsches. Es gibt da einen Zusammenhang, nicht nur weil sie beide aus derselben Ortsgemeinde stammen, auch hierzu später mehr. Ich werde die Pauline nicht unter den Tisch fallen lassen, unter meinen Schreibtisch, auch wenn mir ein Mann aus dem Dorf, Karl-Heinz, den ich mitten im Oberdreiser Wald getroffen hatte, aufs liebenswürdigste nahelegte, darauf zu verzichten, das könne doch nur böses Blut erzeugen, unschönes Gerede entstehen lassen – ich werde von ihrem schrecklichen Schicksal erzählen, von den an ihr vollzogenen Verbrechen. Es ist geradezu deine Pflicht, sage ich mir, es gibt keinen anderen hier vor Ort, der die Zeit dafür, der die Wörter, der die Unabhängigkeit dafür hat, das, was nach so langer Zeit gesagt werden muss, jetzt endlich zu sagen, der, als Zugezogener, die Unvoreingenommenheit hat, festzuhalten, was damals geschehen ist und wovon niemand mehr sprechen will, es sei denn hinter vorgehaltener Hand und ohne Ohrenzeugen mitten im Wald.
Es muss doch einer, sagte ich zu dem Karl-Heinz, aufmerksam machen auf unsere Pauline, wenigstens diese letzte Ehre muss ihr zuteil werden, damit ihr Name nicht getilgt sei für alle Zeiten. Diesen posthumen Triumph, nämlich dass ihre Ausmerzung, wie es damals in geheimen Papieren im Klartext hieß, eine totale gewesen ist, dass ihr Gnadentod, wie es in heuchlerischster Bösartigkeit offiziell hieß, praktisch ungeschehen gemacht worden ist, kann man doch ihren Mördern nun wahrlich nicht überlassen. Ich hatte den Karl-Heinz bei seinem täglichen Waldgang mitsamt dem ihn begleitenden Hund, den er, wenn ich ihn ihn rufen höre, zu meiner Freude Caprice genannt hat, in jenem Waldstück zwischen der alten Eibe und den Ruinen der früheren Tonzeche getroffen. Die Pauline sei ja nicht ganz richtig im Kopp gewesen, sagte Karl-Heinz, so sagen wir hier, er zwinkerte mir zu. Fratze im Kopp.
Ich hatte mich gewundert, wieviel er, der Jüngere, gehört und behalten hat von der Pauline, anders als die uralten Dorfbewohner, die ich gefragt hatte, und die überhaupt nichts dazu zu sagen gewusst hatten, sie hätten davon noch nie etwas gehört und nannten gleich den Namen eines anderen aus der Nachbarschaft, den könne ich ja fragen. Kein Sterbenswörtchen kam ihnen über die Lippen, die entfernten Angehörigen wussten nicht einmal etwas von Paulines Existenz. Auf meine Frage nach einem Familienfoto, auf dem sie vielleicht zu sehen gewesen wäre, zuckten sie nur mit den Achseln, immerhin sei das ja schon fast achtzig Jahre her und in der Kriegszeit sei vieles abhanden gekommen. Wollten sie partout nicht an ein Familiengeheimnis rühren, das sie als schändlich empfanden? Hätten sie, bei ehrlicher Ahnungslosigkeit, nicht neugierig werden müssen, elektrisiert, alarmiert nachfragen müssen?