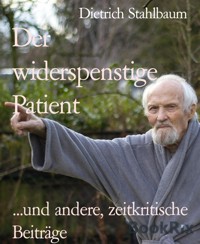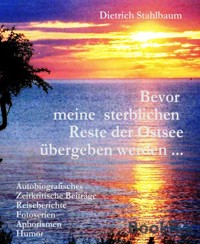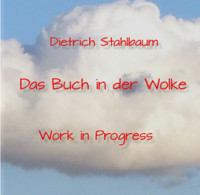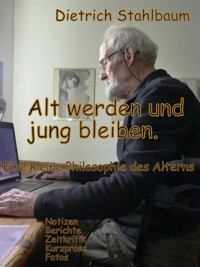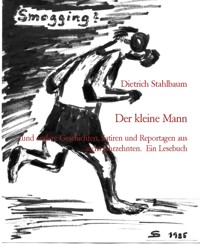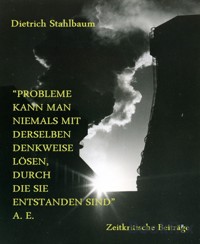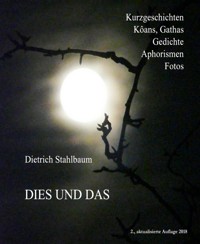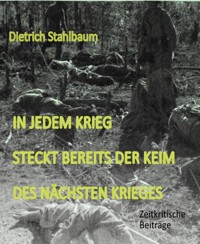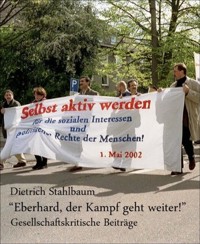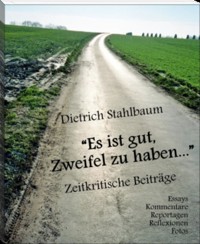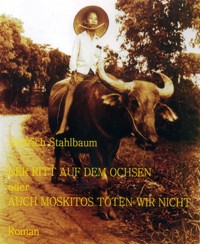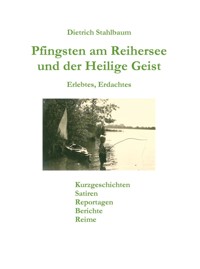
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Literatur nach der Maxime „Vielfalt statt Einfalt“: Storys aus fast neunzig ereignisreichen Lebensjahren des Autors – vom Ende der Weimarer Republik bis zur Gegenwart. Auch Realsatiren sind dabei. Spontane Einfälle. Fotos. Dies ist die 2., vollständig überarbeitete und aktualisierte Auflage 11. Juli 2020.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Pfingsten am Reihersee und der Heilige Geist
Erlebtes, Erdachtes
BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenMeine ersten anatomischen Kenntnisse
Meine ersten anatomischen Kenntnisse waren vor circa 87 Jahren: „Im Gerippe sitzt der Pfulz.* Der Bauch ist an den Beinen festgewachsen.“
----------
* gemeint war: der Puls
Pfingsten am Reihersee
Zu Pfingsten holte mein Vater unsere beiden Faltboote aus dem Winterquartier und machte sie flott, und wenn das Wetter es erlaubte, fuhren wir – Vater, Mutter und ich – am Samstag Nachmittag auf dem Reihersee* nach „Stahlbaumsruh“, wo wir zum ersten Mal im Jahr das Zelt aufschluge
Eines Morgens um vier oder fünf wurden wir von Stimmen in der Ferne geweckt. Männerstimmen. Sie bewegten sich auf uns zu. Unser Zelt stand unten am Seeufer auf einer Wiese. Bald waren sie so nah, dass wir sie verstehen konnten. Sie „sangen“ immer wieder dasselbe:
Ju Ooope, ju Ooope,
wi sinn noch nich besoope!
Dass sie es dennoch waren, sahen wir dann auch durch das kleine Gazefenster: zwei torkelnde Silhouetten im Gegenlicht, hoch oben am Rande der Wiese, wo sonst Rehe im Morgendunst standen. Die beiden Männer waren ebenso friedlich und zogen ihres Wegs aus einem Waldstück in das andere, bis wir sie nicht mehr hörten. Wahrscheinlich haben sie dort zwischen den Primeln ihren Rausch ausgeschlafen.
-----
* bei Friedland/Ostpreußen, heute Prawdinsk
* * *
Deutschland 1933
Bis 1931, als ich fünf Jahre alt war, gab es für mich nur Menschen, die ich gut leiden mochte, und solche, die ich nicht leiden konnte. Juden und Kommunisten gab es für mich noch nicht. Ich begann damals, unsere Stadt, eine ostpreußische Kleinstadt, allein zu erforschen: ihre Gassen und Gossen, die Geschäfte und Werkstätten, die Stadtmauer, den Wallgraben und den verfallenen Friedhof mit den Grabkreuzen der 1813 im Kampf gegen Napoleon gefallenen Russen. Dieser Friedhof lag hinter der Kirche, einem sechzig Meter hohen, roten Backsteinkoloß aus dem Jahre 1312. Ich sah dem Hufschmied bei der Arbeit und den Kutschern beim Kartenspiel zu. Sie saßen beim Kolonialwarenhändler in der Hinterstube und tranken im Winter heißen Grog. Es gelang mir immer wieder, meiner Mutter und der Aufsicht unserer Hausgehilfin zu entkommen. Einmal öffnete ich ein großes Tor und schob mich durch den Spalt. Ein merkwürdiger Geruch schlug mir entgegen. Hunde begannen zu bellen und, als ich näher an sie herantrat, zu heulen wie ein Rudel hungriger Wölfe. Sie standen in großen Zwingern. Dann versuchten sie, ihre Schnauzen durch die Drahtmaschen zu stecken. Aus einem Schuppen kam ein alter Mann heraus. Er hatte einen schwarzen Bart und auf dem Kopf eine Mütze mit einem abgegriffenen Schirm. Wahrscheinlich haben ihn damals schon, vor 33, selbsternannte Herrenmenschen jedes Mal, wenn er ihnen auf der Straße begegnet ist, gezwungen, vor ihnen die Mütze zu ziehen. Er sah mich freundlich an. „Brauchst keine Angst zu haben, Jungchen“, sagte er. „Es sind junge Hunde. Die tun dir nichts.“
„Was machst du da?“ fragte ich.„Komm, ich zeigs dir!“
Ich ging mit ihm in den Schuppen. Ich sah nun, was da so roch: Felle geschlachteter Tiere, innen zum Teil noch roh. Sie hingen an Drähten und lagen gebündelt herum. „Die verarbeite ich und verkaufe sie“, sagte er. Er sprach hochdeutsch, mit einem fremden Akzent. Dann sah ich ihm zu, wie er die Felle mit Seifenlauge auswusch und an die Drähte hängte, damit sie trockneten.
Es wurde dunkel, und ich wollte nach Hause, aber der alte Mann sagte: “Wirst Hunger haben, Jungchen. Komm, ich geb dir was mit.“ Er ging ins Haus, und ich hörte ihn mit einer Frau sprechen, in einer Sprache, die ich noch nie gehört hatte. Er brachte mir etwas, das aussah wie gebackener Kuhfladen, zwei Stücke. „Das ist unser Brot, sagte er. Iß man! Es schmeckt gut. Es ist nur anders gemacht als eures.“ Ich war natürlich neugierig und biß hinein. Es schmeckte wirklich gut. Ich lief nach Hause, um es meinen Eltern zu zeigen.
Mein Vater stand schon hinter der Tür, einer Glastür, und schimpfte, weil ich so spät nach Hause gekommen war. Er sah den Fladen, nahm ihn mir aus der Hand und trug ihn, zwischen Daumen und Zeigefinger geklemmt, zum Abfalleimer. Er wusch sich die Hände. Er schrie mich an: „Weißt du, was das ist? Das ist Matze! Judenmatze! Da gehst du nicht wieder hin!“
Ich habe selten meinen Vater so in Wut gesehen wie an diesem Abend. Er hat nie mehr mit mir darüber gesprochen.
Friedland/Ostpreußen, heute Prawdinsk, Marktplatz Nr. 15, wo wir gewohnt haben, Napoleonhaus, Laubenhaus
Wir wohnten in einem Eckhaus am Marktplatz und an einer kleinen Nebenstraße. Die Praxis meines Vaters, er war Zahnarzt, befand sich im Erdgeschoß. Der Behandlungsstuhl stand am Fenster. Von hier aus hatte er den ganzen Marktplatz im Blick: das große Karree, mit Kopfsteinen gepflastert, die alten Kastanien, die Häuserfronten mit Geschäften, Gaststätten, einem kleinen Hotel, einer Arzt- und einer Anwaltspraxis. Schräg gegenüber war ein Textilienladen. Ich weiß heute nicht mehr, was Herr Pätzold, dem dieser Laden gehörte, in seinem Schaufenster ausgestellt hatte. Aber ich kann mich an einen Spiegel erinnern. Der Spiegel hatte bisher im Laden gestanden und den Kunden bei der Anprobe gedient. Jetzt war er im Schaufenster, in einer Ecke, und da sah ich unser Haus – in diesem Spiegel. Ich konnte sogar Einzelheiten erkennen: die Eingangstür mit der Treppe, den Balkon, die Fenster der Praxis und des Warteraums. Dann fiel mir auf, daß an der Tür des Ladens ein Pappschild hing. Ich konnte noch nicht lesen; deshalb habe ich erst viel später erfahren, was das Schild bezwecken sollte und wer es dort angebracht hatte. Genauso ging es mir mit dem Glaskasten auf dem Bürgersteig gegenüber dem Laden. In dem Kasten hingen Schrifttafeln und eine Zeitung. Plötzlich sah ich meinen Vater in Herrn Pätzolds Spiegel. Er kam aus unserer Haustür herausgesprungen. Er rannte, im weißen Kittel, quer über den Markt – auf mich zu. Ein kleiner Köter lief bellend hinter ihm her. Leute guckten sich nach ihm um. Ein Pferd, das einen Jagdwagen zog, erschrak vor der weißen Gestalt und bäumte sich auf. Ich stand wie angenagelt da. Mein Vater nahm mich an die Hand und zog mich fort, ohne etwas zu sagen. Wortlos gingen wir über den Markt ins Haus zurück. Hier erst erklärte er mir, der Laden gehöre einem Juden, wir Deutschen dürften da nichts kaufen. Ich solle da nicht mehr hingehen. Ein paar Tage später waren das Schaufenster und die Tür mit Brettern vernagelt. „Pätzold ist weggezogen“, sagte mein Vater. Auch der Fellhändler war nicht mehr da. Das muß im Jahre dreiunddreißig gewesen sein.
[Aus meinem zeitdokumentarischen, autobiografischen Roman Der Ritt auf dem Ochsen oder Auch Moskitos töten wir nicht, Aachen 2000, S. 35 ff., vergriffen, jetzt als eBook im BookRix-Verlag 2012
Erst Kaiser-treu, dann Hitler-treu. Von deutschem Bürgertum
„Ist dein Vater Parteiführer gewesen?“
„Nein, aber er war Mitglied der Partei, seit 33. Er hatte 1930 in unserer Stadt eine Ortsgruppe des Deutschen Luftsportverbandes gegründet. Er hatte sein junges Leben lang vom Fliegen geträumt, und dieser Traum sollte nun verwirklicht werden. Es wurden drei Fluggleiter gebaut. Das sind fliegende Schaukelstühle aus Kieferholmen und Sperrholz, Tragflächen und Leitwerk mit Leinwand überspannt und lackiert. Diese Apparate wurden von einem Gummiseil auf einem kleinen Hügel am Stadtrand in die Luft katapultiert. Angeschnallt und durch einen ledernen Sturzhelm geschützt, saß man am Steuerknüppel und flog immerhin einige Minuten lang.
Der Deutsche Luftsportverband wurde 1933 als Nationalsozialistisches Fliegerkorps gleichgeschaltet. Diese Organisation bildete die künftigen Militärpiloten im Segel- und zum Teil auch im Motorflug aus und warb in der Öffentlichkeit für die Deutsche Luftwaffe.
Ich war dreizehn, als meine Segelflugausbildung begann. Wir wurden also schon als Kinder auf den Krieg vorbereitet.“
„Du bist systematisch zum Nazi erzogen worden; dein Vater war vor 33 nicht in der Partei, aber doch wohl schon ein Nazi?“
„Er hatte sehr früh seine Eltern verloren und ist in der Obhut seiner älteren Schwestern aufgewachsen. Sie haben ihn nicht zum Militaristen gemacht. Er hat seinen Vater vermißt und einen Übervater gefunden.“
„Hitler.“
„Ja. Mein Vater ist am Ende des ersten Weltkrieges als junger Soldat in deutschnationales Fahrwasser geraten, und als Zwanzigjähriger hat er in einem Freikorps, in einer der präfaschistischen, paramilitärischen Verbände, die sich nach dem ersten Weltkrieg in Deutschland gebildet hatten, im Baltikum gegen die Rote Armee gekämpft. Dann studierte er Zahnmedizin und gehörte einer präfaschistischen Studentenverbindung an. Die Backe hat er sich allerdings nicht zerhauen lassen. Er wollte ja Zahnarzt werden.“
"Die Backe zerhauen – wie? Womit?“
„In den schlagenden Verbindungen war es seit den 1850er Jahren üblich, bei den Mensuren, beim Fechten, sich Schmisse, Verletzungen, an der Backe anzubringen und sie eitern zu lassen, damit dicke Narben entstehen. Diese sollten später die Doktoren als akademische Helden ausweisen. Die älteren Heldensemester, in Altherrenschaften organisiert, verhalfen den jüngeren Heldensemestern nach deren Studium zu einem guten Posten und ebneten ihnen eine Karriere. Mein Vater hatte eine solche Erkennungsmarke nicht.“
„Er wollte kein Held sein. Was dann?“
„Er war ein eher ängstlicher, ein sehr sensibler Mensch. Er war rücksichtsvoll und behutsam. Ein sehr liebenswerter Mensch. Alles andere als ein Haudegen.“
„Ein sanfter Idealist?“
„Er nahm die Parole Volksgemeinschaft, mit der den Massen nationale und soziale Solidarität suggeriert wurde, sehr ernst. Dennoch setzte er sich nicht mit unserer Hausangestellten an einen Tisch. Das Dienstmädchen mußte seine Malzeiten allein in der Küche einnehmen. Einmal hat er, wie mir meine Mutter später erzählt hat, sich überwinden müssen, eine Proletarierwohnung zu betreten. Ich war zu den Arbeiterkindern ins Haus gegangen und, als mein Vater hereintrat, unter die Ehebetten gekrochen. Minna hatte Urlaub, und meiner Mutter wollte er wohl den Anblick des Elends ersparen. Du gehst nicht wieder zu Kommunistenkindern! befahl er mir nachher. Ich war fünf oder sechs.“
„Volksgemeinschaft…“
„Im Grunde litt er unter der materiellen Not anderer und half, wo er helfen konnte. Er hat die Ärmsten unserer Stadt ohne Honorar behandelt. Selbst den russischen Kriegsgefangenen, die, von einem auf einem Hocker sitzenden Altreservisten mit aufgepflanztem Bajonett bewacht, bei uns im Flur warten mußten, hat mein Vater Füllungen, ja sogar Kronen und Brücken eingesetzt – ohne Honorar, und ihnen Zähne gerettet. Er hätte sie herausreißen sollen. Ebenso verfuhr er bei den sogenannten Fremdarbeitern und Fremdarbeiterinnen. Ein besiegter Feind, hat er einmal gesagt, muß menschlich behandelt werden. Sonst bist du selber kein Mensch. Ohne Zähne oder mit kaputten würden sie verhungern.“
„Dann war er also auch ein Humanist, ein deutscher Humanist.“
„Das war er wohl, mit allen seinen Widersprüchen. Er verabscheute Brutalität. Er hat verfaulte Zähne gezogen und vereiterte Zahnhöhlen gesäubert. Aus dieser Zahnarztperspektive hat er die Verbrechen des Staates gesehen, falls ihm überhaupt klar geworden ist, was da passierte. Denn sie wurden geheimgehalten oder als Maßnahmen zum Schutze des deutschen Volkes verschleiert. Mein Vater, staatsfromm und autoritätshörig, verehrte Hitler wie einen Gott. Ich habe Tränen in seinen Augen gesehen, als er vorm Volksempfänger – so hießen unsere Radioapparate – saß und Hitler reden hörte. Was Der Führer sagte, das war für ihn jenseits aller kritischen Überlegungen.“
„Und deine Mutter?“
„Sie war neunzehn, als ich geboren wurde, und in allem unerfahren. Sie stammt aus einer völkisch-deutschnational gesinnten Familie und gehörte als junges Mädchen dem Luisenbund an. Viele junge Mädchen haben damals die Königin Luise von Preußen, die in Tilsit mit Napoleon zusammentraf, um mildere Friedensbedingungen zu erwirken, angehimmelt. Nach ihr wurde der Bund genannt. Die Luisentöchter veranstalteten Kaffeekränzchen, strickten in Tischdecken vaterländische Symbole ein, sangen dementsprechende Lieder und stopften Vierzehnachtzehn den Frontsoldaten die Socken. Im zweiten Weltkrieg war meine Mutter im NS-Frauenbund.“