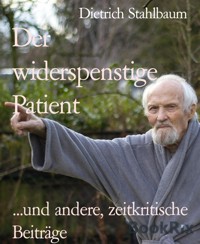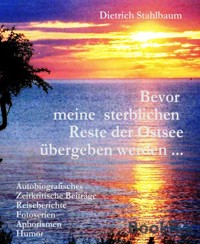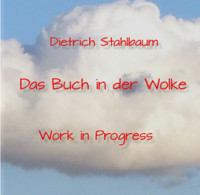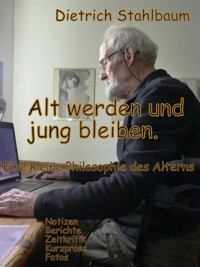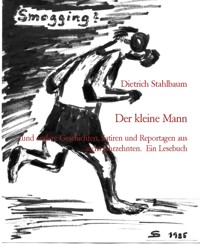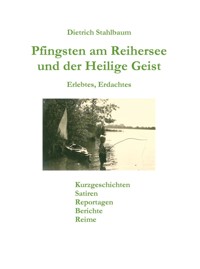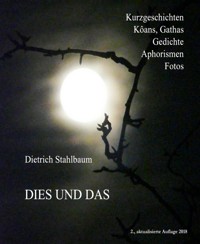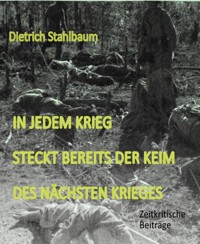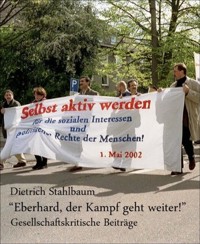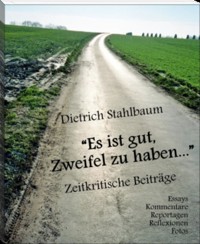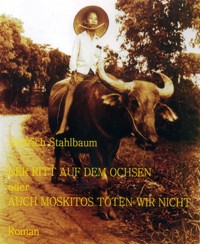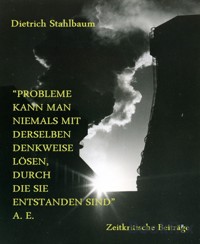
Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind E-Book
Dietrich Stahlbaum
2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Der Titel dieses Buches sind Worte von Albert Einstein. Der Physiker war auch Philosoph und Zeitkritiker. Er forderte zu kreativem Denken und Umdenken auf. Wie sehr das nötig ist, demonstriert Dietrich Stahlbaum hier in seinem 7. eBook. Es beginnt mit einem kritischen Rückblick auf seine militaristische „Sozialisation“ in der Nazizeit. Es folgen Bildberichte über Vietnam und den Krieg, an dem der Autor als Fremdenlegionär teilgenommen hat (1951-54). Ein Zeitsprung in die Gegenwart (2012-13): Aufsätze, Kommentare, Leserbriefe, Aphorismen, die sich dem Mainstream widersetzen, zu: Geschichte und Politik, Ökologie, Religion und Glauben (Christentum, Islam), Kirche und Staat (Laizismus), Atheismus, Philosophie, Aufklärung. Ein Autorenportrait (Wolfgang Beutin). Zeitgemäßes über Gautama Buddha und „den Buddhismus“, ein zen-buddhistisches Kôan. Yoga (Fotoserie). Rezension eines Buches des koreanischen Philosophen Ynhui Park über die Krise der technologischen Zivilisation und deren Überwindung. Fotoserie von Flugapparaten vom Schulgleiter zum Gyrocopter. Und schließlich: Humor in Bild und Text.
2., überarbeitete und aktualisierte Auflage 2020.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind
Zeitkritische Beiträge. Buch IV der Reihe "Mit Buddha, mit Immanuel Kant"
Für alle Menschen, die über den Tellerrand hinaus blicken (wollen).BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenI. Autoritärer Geist, militaristische Ideologie und Erziehung
In der "Kaiserzeit" herrschte bis zum Ende des Ersten Weltkriegs in Deutschland ein autoritärer Geist mit militaristischer Ideologie und Erziehung. Dies hat besonders junge Männer derart geprägt, dass sie in der Weimarer Republik Pazifismus und Demokratie nicht internalisieren (verinnerlichen) konnten.
Deshalb wurden sie Nazis aus innerer Überzeugung wie mein Vater, der 1920 am Kapp-Putsch beteiligt war und 1933 die Hitlerfahne schwenkte. Dementsprechend wurde ich erzogen: im preußischen Geist militaristisch-deutsch-nationalistisch.
Vorbilder meiner Generation waren in Geschichtsbüchern, im Schulunterricht und bei der "Hitlerjugend" Feldmarschälle, Generäle und andere Soldaten, die wir als Kriegshelden bewundern sollten und zumeist auch haben. Einige von ihnen gab es in der Verwandtschaft, andere waren ehemalige Mitschüler.
Am 14. September 1935 - ich war noch nicht ganz neun Jahre alt - hielt Hitler eine Rede vor 50 000 Jungen. Er rief uns damals zu: "Seid flink wie die Windhunde, zäh wie Leder, hart wie Kruppstahl!"
Wer nicht dabei war, hörte es am "Volksempfänger" oder las es am nächsten Tag in der Zeitung.
Es wurden geflügelte Worte. Sehr viele von uns nahmen sie sich zu Herzen, und Väter verstanden dies als Erziehungsauftrag. So war es verpönt, Gefühle zu zeigen, die "eines deutschen Jungen" unwürdig seien, vor allem Angst, Schmerzen, Trauer.
Wir hatten früh angefangen,
Soldat zu spielen. Holzschwerter und Holzgewehre wurden bald ersetzt durch maßstabgerechtes Kriegsspielzeug.
Als Pimpfe lernten wir, mit Karte und Kompass umzugehen und uns "wie Soldaten" im Gelände zu orientieren. Als Zwölf- oder Dreizehnjährige schossen wir mit Kleinkalibergewehren auf Zielscheiben, und jedes Jahr im Herbst fanden große Geländespiele statt, an denen mehrere tausend Jungen teilgenommen haben. Unsere vormilitärische Ausbildung war so perfekt, dass wir nach zwei, drei Wochen Kasernenhofdrill und Schießübungen mit scharfen Infanteriewaffen an die Front geschickt werden konnten.
Im Zweiten Weltkrieg wurden junge, hoch dekorierte Offiziere zu uns in die Schule und zum HJ-Dienst geschickt. Wer wie ich schon zuhause vorprogrammiert war, ließ sich begeistern und eiferte ihnen nach.
Der Soldatentod wurde zum "Heldentod" umgemünzt.
Ich erinnere mich an eine junge Baroness, die HJ-Führer auf das Rittergut ihrer Schwiegereltern eingeladen hatte, um den "Heldentod" ihres Mannes zu feiern.
Ein Leutnant war es gewesen, kaum viel älter als wir, ein ehemaliger Mitschüler, ein paar Klassen über uns.
Die junge Soldatenwitwe führte uns zu einem eigens für diese Feier errichtet en Hausaltar, und stolz zeigte sie uns alles, was sich darauf befand: Briefe, Fotos, Uniformstücke und Orden. "Er ist für den Führer gefallen", sagte sie. Der Stolz hatte ihre Trauer verdrängt.
Ich weiß nicht, was die anderen "Hitlerjungen" dabei empfanden. Mich hat dieses Erlebnis nur in meinem Glauben an "Führer, Volk und Vaterland" bestärkt. Ich konnte nicht früh genug Soldat werden,
... um eine Offizierskarriere anzustreben.
Dass wir damals um unsere Kindheit und Jugend betrogen worden sind, habe ich erst später begriffen, nach 1945. Da wurde ich gründlich über den Faschismus aufgeklärt und wendete mich davon ab, nicht aber vom Militarismus.
Das Soldatentum hatte ich noch in den Knochen. Der Traum von der Offizierskarriere war ja nicht realisiert worden... Deshalb konnte ein ziviler Beruf, den ich erlernte, mich nicht befriedigen.
Dies alles war mir damals nicht bewusst. Sonst hätte ich dagegen steuern und vernunftgemäß handeln können.
Dann hätte ich auch den Konflikt mit den Altnazis in Familie und Verwandtschaft, der nie offen ausgetragen werden konnte, und den Kulturschock, den ich nach der Währungsreform empfunden habe, überwunden, wäre in Deutschland geblieben oder aus Frankreich wieder zurückgekehrt und nicht nochmals Soldat geworden.
Eine untypische Vita eines jungen kleinen Mannes, soweit es den inneren Konflikt (Faschismus, Trauerarbeit und Kulturschock) betrifft, während der Militarismus in den Knochen mit dem Prinzip Befehl-und-Gehorsam – gehorchen und kommandieren, dem Herrschaftsprinzip, der unbewusste Motor war, der, neben äußeren Gründen, damals auch so viele andere Deutsche in die Legion getrieben hat.
Ich hatte unmittelbar nach Kriegsende 1945 keine Traumata, trotz schlimmer Erlebnisse. Es war auch nicht der sinnlose Tod von Menschen auf beiden Seiten der Front, der mich berührt hat, sondern die Ermordung eines Tieres:
Im Sommer 44 pausierte ich in einer Gruppe Soldaten auf einer Weide in Nordfrankreich, als einer von uns, ein älterer Gefreiter, seine Maschinenpistole in Anschlag brachte und auf ein Pferd, das friedlich neben uns graste, schoss.
Ich sehe noch heute, wie das Tier, von mehreren Kugeln an Kopf und Hals getroffen, blutüberströmt taumelte und zusammenbrach. Wir anderen, alle sehr junge Soldaten, waren sprachlos und blieben es. Wir haben nie darüber gesprochen. –
Die Traumata kamen erst viele Jahre später, Jahre nach meiner Rückkehr aus Vietnam. Ich war verheiratet, und auch meine Frau bemerkte es. Es war in den 60er, 70er Jahren. Ich wurde Nacht für Nacht an die Wand gestellt und habe auf Gewehre gestarrt, habe manchmal Unverständliches geredet, herumkommandiert, um mich geschlagen und sehr oft aufgeschrien.
Warum diese Traumata so spät aufgetreten sind, lässt sich tiefenpsychologisch erklären:
Die Kriegserlebnisse 1944/45 waren lange Zeit von Konflikten, von dem Erkenntnisschock (Naziverbrechen) und von Tagesereignissen überlagert. Erst nach 1954, nach dem Vietnamkrieg, lösten sich die psychischen Blockaden, verdrängte Kriegserlebnisse tauchten auf, und ich begann, sie zu verarbeiten. Schon während dieses Krieges hatte ich mich vom Bellizismus ab- und dem Pazifismus zugewendet.
II. „INDOCHINA“-KRIEG, VIETNAM, DIE SCHLACHT VON DIEN BIEN PHU, LÉGION ÉTRANGÈRE
Bilder aus Vietnam 1951
1. Teil: Menschen, Landschaften
Hanoi und Umgebung
Stationiert in Hanoi, in der Cité Universitaire im Ortsteil Bach Mai, war ich jeden freien Tag unterwegs, allein oder mit meiner vietnamesischen Freundin Lai.
Wir beide durchstreiften die Stadt und die nähere Umgebung, so weit, wie der Rikschafahrer uns zu fahren bereit war. Denn an den Rändern der Stadt und am anderen Ufer des Roten Flusses begannen die Gebiete, die am Tage weitgehend unter französischer Kontrolle waren, nicht jedoch nachts. Dann waren es Partisanen, die Aktionen vorbereiteten, Straßen und Wege verminten und befestigte Stützpunkte der Kolonialtruppen angriffen oder Wachposten überrumpelten, sie töteten oder entwaffneten und laufen ließen.
Der Krieg war hier allgegenwärtig, sichtbar und unsichtbar. Nachts hörten wir in Bach Mai Schüsse und Explosionen vom anderen Ufer des Flusses.
Ich stand hier mit den Menschen auf gutem Fuß, denn ich suchte immer wieder den Kontakt zur Bevölkerung und ließ sie verstehen, dass ich ihr Freund, nicht ihr Feind bin.
Lai übersetzte, was ich sagte, bald auch das, was ich dachte. Sie sprach fließend französisch.
Meine Einstellung zur Bevölkerung muss sich herumgesprochen haben: Ich konnte mich sogar spät nachts allein in der Rikscha aus der Innenstadt zur Kaserne fahren lassen, ohne dass mir etwas passiert ist.
Andere Legionäre und Kolonialsoldaten fand man am Morgen im Gebüsch, erwürgt, erschlagen, erstochen, oder sie waren verschwunden; manchmal tauchten ihre Leichen in einem der nahen Teiche wieder auf.
Oft war ich auch ohne meinen Schutzengel im Delta des Roten Flusses unterwegs, auf einem alten, knatternden Motorrad, das ich mir für ein paar Piaster bei einem Vietnamesen ausleihen konnte, und besuchte Dörfer im weiteren Umfeld der Stadt Hanoi.
Ich habe viel fotografiert und zeige hier eine Auswahl der Bilder. Den größten Teil davon habe ich von sehr kleinen Positiven aus meinen Alben scannen müssen, weil die Negative nicht mehr brauchbar sind. Dementsprechend ist die Qualität.
In Bac Mai am Rande Hanois:
Markt:
In den Straßen von Hanoi
Hausbau:
Apotheker:
Kesselschmiede:
Straßenfeger. Ho Chi Minh?:
Piasterschein, die Währumg der Vietminh. Links: Ho Chi Minh: