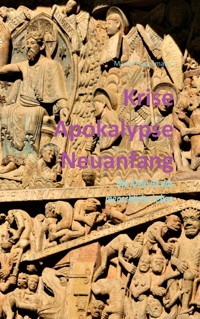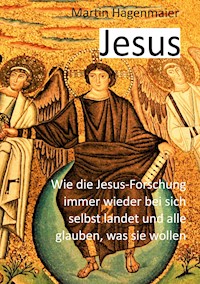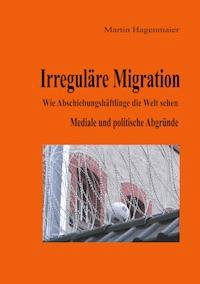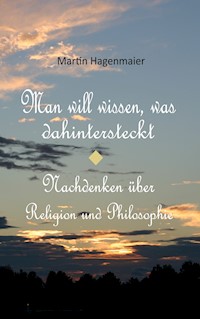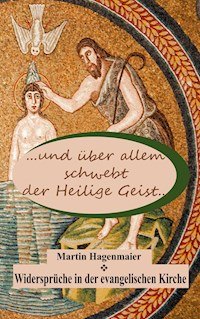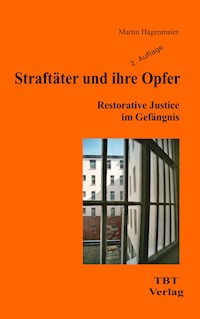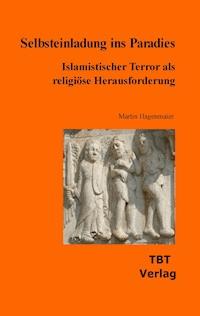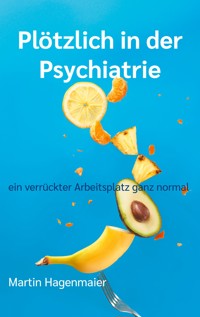
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Als Seelsorger in der Psychatrie, das war die zweite Station des Autors in seinem Berufsleben. Als junger Mann in dieses Arbeitsfeld zu geraten,war eine besondere Herausforderung, zudem als einziger seiner Berufsgruppe unter zahlreichen Ärzteinnen und Ärzten. Später waren auch Psychloginnen ud Psycologen darunter. Er erzählt in diesem Buch, was ihn als Theologen umtrireb, welchen Menschen er begegnete und wie normal das Alltägliche im Irrenhaus verläuft.Wie kann man den verschiedenen Gruppen von Kranken begegnen? Welche Fallstricke liegen herum und wie man sich mit dem psychiatrischen Milieu arrangieren? Trauriges wie das Sterben kommt ebenso zu Sprache wie Albernes, wenn die Patienten sich über so genannte "Irrenwitze" totlachen.Aber im Mittelpunkt steht die Aufgabe, Seelsorge zu betreiben in der unklaren Mischung zwischen kirchlich-theologischen und psychiatrischen Lebenswelten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 203
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
„Mein“ Krankenhaus
Das Schönste sind die Skurrilitäten
Die Anfänger
Der erste Fall
Wie es kam, dass ich Anfänger wurde
Das Milieu der Psychose und die "Reform" der Psychiatrie
Die Wahnvorstellungen sind gar nicht so unrealistisch
Beispiel forensische Psychiatrie
Missbrauch
Sexualstraftäter
Psychiatrie soll das Problem beseitigen
Abgestempelt – Sein
Heinrich und das Geld
Ein Brandstifter, der keiner sein mag…
Direkte Kommunikation
Schwierigkeiten mit der Sucht
Frau X.
Lernen von den "Programmen" anderer
Eine Gruppe in der Suchtabteilung
Versuch einer Interpretation
a.
Die Motivation geht vornehmlich von den Mitarbeitern aus
b.
Kumpanei
c.
Die Inszenierung eines Untergangs
d.
Aggression und Hilflosigkeit
e.
Strafe muss sein!
f.
Jeder Rückfall besteht aus kleinen Schritten
g.
Welche seelsorgerlichen Aspekte lassen sich an diesen Analyseversuch anschließen?
Probleme der Gegenübertragung
Sucht als Problem mit nachvollziehbarem Verlauf: Zwei Fälle
Eine neue Erfahrung der Rolle.
Alt - Werden und Sterben
Wachsäle
Zu Gast unter Ausländern
Trostpreise – Musik auf der Frauenstation
Begegnungen „der anderen Art“
Muss ich sterben?
Emil
Peter
Maßstäbe
Theologie in der Psychiatrie – unmöglich?
Nach Gottes Willen?
Gemeinschaft und Gebet
Nicht nur auf Wunder hoffen
Der Rückfall
Die bleibende Stadt
„Mein“ Krankenhaus
Es ist ein wenig merkwürdig, dass ich das ehemalige Landeskrankenhaus „mein Krankenhaus“ nenne. Ich habe dort vierzehn Jahre als evangelischer Seelsorger gearbeitet. Es war also nicht „mein“ Krankenhaus. Aber es war doch mein Krankenhaus, in dem ich meine Tage verbrachte. Dort hat auch meine Frau gearbeitet. Dort sind meine Kinder in den Kindergarten gegangen. Dort waren wir sozusagen zu Hause.
In Zahlen ganz kurz umrissen: Damals 1150 Betten, sieben Abteilungen, 30 Ärzte, insgesamt rund 850 Beschäftigte, die in den verschiedensten Berufen arbeiten, vor allem als Schwestern und Pfleger, aber auch psychologisch, in der Verwaltung oder in der Ausbildung Tätige, nicht zu vergessen die SozialpädagogInnen. Nicht nur, aber besonders unter den Patientinnen und Patienten sind mir im Laufe der Jahre viele zu „alten Bekannten“ geworden. Bei den Mitarbeitenden kommt es eher zu „normalen oder kollegialen Kontakten“. Was anfangs als Bestätigung für die Erfolglosigkeit der Psychiatrie auf mich wirkte, erscheint mir heute beinahe als natürlicher Vorgang. Oft freute ich mich sogar, wenn jemand wieder eingeliefert wurde, so als sei er nun nach einiger Abwesenheit wieder zu Hause. Doch leider sind es oft dramatische Umstände, die ihn oder sie wieder hergebracht haben; distanziert nennt man das wohl das Scheitern an der „Realität“ oder psychiatrisch „neuen Schub“ oder „Rückfall“.
Was mich in den Jahren am meisten berührt hat, war der gewaltsame Tod von Klaus Grabowski im Lübecker Landgericht. Nicht, dass ich nicht hätte verstehen können, was da geschehen war, sondern deshalb, weil es einen Menschen getroffen hatte, in den ich viel Zeit und auch viel „Arbeit“ investiert hatte, von dem ich viel gelernt hatte. Es war einer meiner ersten „Fälle“ in der Psychiatrie. Ich hörte die Nachricht von dem Geschehen im Radio und war damit tagelang beschäftigt. Er hatte eine typische Karriere hinter sich; eine Zeit lang erschien es, als sei er ausgestiegen aus seiner Laufbahn, die ihn in immer schwierigeres persönliches und auch rechtliches „Fahrwasser“ geführt hatte, bis dann aus „heiterem Himmel“ der Mord an der kleinen Anna geschah. Mir kam bei diesem Menschen die Gefährdung hautnah zu Bewusstsein, in der Menschen, die mit der Psychiatrie als Patienten zu tun haben, sich befinden. Mir scheint, man kann nie genau sagen, zu wessen Nachteil die sich anhäufende Aggressivität ausgeht, aber irgendwo schafft sie sich Luft. Sei es im Mord oder Selbstmord oder auch in der Akzeptation der eigenen Handlungsunfähigkeit, in der Ausstoßung aus der Familie, die meist schon lange vor den ersten spektakulären Ereignissen begonnen hat, sofern eine Familie überhaupt da war, in dem allmählichen Herausgleiten, dessen Fortschreiten man wohl, dessen Ursache man nicht so deutlich erkennen kann. Jedenfalls ist es ein Spiel auf Leben und Tod, das der Mensch in und um die Psychiatrie herum erfährt oder spielt.
Da ist dann auch der Selbstmord auf den vorbeilaufenden Bahnschienen, der gleich mehrere mit schweren Schuldgefühlen zurückließ, der auch von meiner Seite wohl vorauszuahnen war. Auch der, der ihn begangen hat, war ein netter Mensch mit einer "Drogenkarriere". Eine „schwachsinnige“ Frau, die sich im Schneesturm auf dem Gelände des Krankenhauses verlaufen hatte, konnte nicht wiedergefunden werden und lag viele Tage später tot unter einem Baum.
Menschen wie alle sind es, verstrickt in vielfältige Schwierigkeiten, verfolgt vom Pech, Menschen, die sich immer so anstellen, dass der Schuss im entscheidenden Moment nach hinten losgeht. Menschen, die nie gelernt haben, sich ein Bild ihrer Zukunft zu machen, Menschen, die ihre Lage nicht ertragen, sondern die Wellen über sich zum Zusammenschlagen bringen. Auf der anderen Seite aber Menschen, die im Vergleich zum „normalen Nachbarn“ unendlich anspruchsvoll erscheinen, wenn sie gleich in Gruppen die Forderung nach ausführlicher Beschäftigung erheben. Menschen, die mit dem bisschen, was sie haben, nicht umgehen können, deshalb nehmen, was immer sie bekommen, seien es Kontaktmöglichkeiten, sei es eine materielle Zuwendung. Menschen, die die herrlichsten Gedanken haben: „Ich bringe der Welt den Frieden!“ und gleichzeitig ihr eigenes Leben mit dem maßlosen Anspruch versehen: „Wenn ich nicht gleich hier 'rauskomme, dann geht heute noch die Welt unter.“ Menschen, die die erste Freiheit zur Flucht benutzen, um dann entweder etwas ganz Schlimmes zu tun (selten) oder aber sich am Abend Hilfe suchend an die nächste Polizeistation zu wenden (häufiger).
Und diese Menschen sind umgeben von anderen, die hier ihr Geld verdienen, zu denen auch ich gehörte. Da gibt es solche, die nur dieses verfolgen, aber in der Mehrzahl eben doch die anderen, die aus ihrem gesunden Menschenverstand keinen Hehl machen und nach alter von Generationen vererbter Methode mit mehr oder weniger Direktheit früher oder später die „Kranken“ von der Unmöglichkeit ihres Verhaltens überzeugen wollen. Im Normalfall läuft das alles seinen Gang. Im Extremfall müssen dann eben doch der Gurt und die Spritze her.
Und wer das miterlebt hat, wie jemand sich selbst verbrennen möchte, indem er sich beim Toilettengang den Bart anzündet, der kann nicht sagen, dass eine solche Haltung absurd sei.
Also: Umgeben von Menschen, die eben auch ohne Komplikationen durchs Leben zu kommen versuchen. Man kann auch nicht sagen, dass nicht ein dicker Kern von beabsichtigter Zuwendung in uns steckt und sich auswirkt, wenn man auch sehen muss, wie sehr doch die ewige Wiederkehr des Gleichen einem Menschen schließlich auch einen mehr oder weniger harten Panzer der Routine verpasst. Irgendwann einmal hat auch der Motivierteste die Auseinandersetzung satt und sieht darauf, dass der Laden läuft.
Es gibt auch Schwerpunkte, an denen sich die Todesfälle häufen. Jährlich waren es immer zwischen 120 und 160. Menschen, die hierher geschickt wurden, sei es mit dem Arm des Gesetzes, sei es vom Arzt, die hier zwei Wochen oder auch drei Monate leben. Mancher sagt während dieser Zeit nicht ein Wort und stirbt dann. Er wird weggefahren, sein Bett wird frei für den nächsten. Kaum ist Zeit, sie kennen zu lernen - bei den einen; andere sind dagegen allen so vertraut geworden, dass ihr Tod wirklich als Verlust empfunden wurde und alle noch einige Tage sich die neue Lage im Zimmer xy klar machen mussten.
Da gibt es dann auch manchmal eine Beerdigung, zu der Angehörige kommen. Soll ich da der traurigen Realität Platz geben und mit den Angehörigen froh sein, dass es endlich soweit ist, weil „man dieses Leiden doch wirklich nicht mit ansehen konnte“? Oder soll ich die inzwischen eingeschliffenen Worte von der „Akzeptation des Schwachen“, der auch in Gottes Hand bleibt, hersagen?
Einmal hatte ich während einer Beerdigung eine Art Schlüsselerlebnis. Der Tote war ein damals so genannter „Oligophrener“. Er konnte nicht schreiben, rechnen und lesen und sich auch nicht selbst anziehen. Er sagte auch nichts. Aber seine Mutter und seine Schwester, die mir vor der Beerdigung noch von seiner Kindheit erzählten, stießen sich während der „Ansprache“ an und lächelten sich an, als ich eben dieses ganz abweichend von meinem Konzept wiedergab: „Als er klein war, wurde er schon immer von den Kindern auf dem Schulhof gehänselt, obwohl man damals äußerlich eigentlich noch nichts von seinen Schwierigkeiten bemerken konnte. Seine große Schwester versuchte ihn zu beschützen!“
Diese belanglose unscheinbare Kleinigkeit machte mir, während sie so geschah, klar: „Dieser Mensch, der hier als „Anstaltsinsasse“ beerdigt wird, war ein Kind! Ein Kind, auf dem die Hoffnung seiner Mutter genauso ruhte wie auf jedem anderen Kind dieser Welt. Das sagt mehr als alle Beteuerungen der Mitmenschlichkeit, die ja doch nur den Verdacht zerstreuen wollen und sollen, der "Irre" sei in Wirklichkeit gar kein richtiger Mitmensch.
Das ist das Problem mit dem ich mich immer wieder herumschlagen musste: Alle Diagnostik, alle Distanzierung hilft nicht an dem Menschen vorbei, der unter die „Irren“ gefallen ist. Er zeigt mir auch meine Möglichkeiten: die Möglichkeiten des Menschen, aus sich, aus Umständen oder aus anderem heraus einer zu werden, der sich nicht zurechtfindet oder von den anderen nicht mitgetragen werden kann. Nach einiger Zeit ist da nichts mehr, was ungewöhnlich wäre. Das Ungewöhnliche wird gewöhnlich, das sonst unter der Hand Gesagte hinaus geschrieen. Gemütszustände werden in breitester Vergröberung vorgeführt.
In der Mitte all dieser Geschehnisse und Menschen steht eine Berufsgruppe, die für alles verantwortlich ist: die Psychiater. Ihnen gegenüber klappt der übliche Verhaltsablauf noch am besten. Selbst der Mensch, der sonst seine Mitmenschen grob ausfällig behandelt und deshalb von ihnen zurückgewiesen wird, reißt sich bei der Visite, so gut es geht, zusammen und nimmt die Haltung an, die man von einem „normalen Menschen“ verlangt. Wenn sich das „verrückte Verhalten“ einmal bei der Visite durchsetzt, dann ist die allerhöchste Alarmstufe erreicht. Wenn jemand sich selbst vor der ärztlichen Autorität nicht beugt, muss er wirklich „echt verrückt“ sein! Fortschritte in der Genesung erkennt die Anstalt am Verhalten des Patienten gegenüber dem Arzt. Wenn er oder sie sich zu zügeln wissen, geht es aufwärts.
All das spielt sich am Rande einer Kleinstadt ab, die zwar zum Teil von der Arbeit im Krankenhaus lebt, aber mit dem „Klotz“ von 1150 Betten eigentlich nichts Richtiges anzufangen weiß. Die Menschen gehen hinein und heraus, aber wer das nicht muss, der tut es auch nicht. Es sei denn, man will sich (heutzutage) eine Ausstellung im Hans-Rahlfs-Haus anschauen oder eine andere eher seltene Veranstaltung mit richtigem Öffentlichkeitscharakter besuchen.
Wer „von da unten“ kommt, wird im Stadtbild geduldet und auch nach dem Gottesdienst mit Handschlag begrüßt. Es gibt auch eine Gruppe von Frauen, die zum Kaffee einlädt - und das ist eine Menge an Zuwendung. Aber im Ganzen bleibt die Trennung.
Das ist aber keine bösartige Trennung. Es ist einfach Alltag. Ein Sternjournalist versuchte einmal anlässlich eines Kindermordes in Reinbek, den ein entlaufener Patient begangen hat, die Neustädter Bevölkerung mit der Frage zu ködern, ob es ihnen gleich sei, dass hier Mörder frei herumlaufen. Er bekam die Antwort, damit könne man gut umgehen. Außerdem sei hier noch nie was passiert.
Dass Leute, die abhauen wollen, sich natürlich erst mal aus dem Staub machen, um sich nach fünf oder sechs Kilometern an Hunger oder Durst zu erinnern, band ihm niemand auf die Nase. Deshalb trifft es oft die etwas weitere Umgebung, während im Ort selbst so eine Art sozialer Kontrolle schlimmere Aktionen verhindert. Freilich geht mal jemand ‚für Herrn oder Frau Doktor einkaufen’. Aber wenn das so sein sollte, kann ein kurzer Rückruf die Sache aufklären und die Sachen wandern wieder ins Regal. Fertig. Da muss kein Aufstand gemacht werden ….
Die Toten der Anstalt werden auf demselben Friedhof wie die anderen Stadtbewohner beerdigt. Dennoch wurde mir die Lage blitzartig klar, als ein „Normaler“ mich fragte: „Warum liegt denn mein Kollege auch in dieser Reihe. Kommen die Selbstmörder auch hierher?“ Gemeint waren die Reihengräber, die ich mit meinen zwölf bis 16 Beerdigungen pro Jahr von Reihe zu Reihe „fülle“.
Das war also das Krankenhaus, das ich meine, wenn ich von Psychiatrie spreche. Es war gegenüber meinem Dasein als Gemeindepastor die verkehrte Welt. Was in der Gemeinde als das „unbegreifliche, lange Leiden des Toten“ in die Rede bei der Beerdigung einging, das war nun meine Realität. Das unbegreifliche, lange Leiden wird entlarvt als Leben im Krankenhaus, das eigentliche Leben, genauer: das was man darunter zu verstehen pflegt, rutschte in die Rolle des Lebens vor der Einlieferung, in die Rolle, aus der der Mensch nun ausgestiegen ist oder aussteigen wird. Aber es war nicht nur die Welt von hinten. Es war auch die Welt, in der die Rollen, die man sonst peinlich genau beachten muss, zumindest teilweise außer Kraft gesetzt sind. Hier gab es dafür die Rollen des Krankenhauses, die auch ihre Eigengesetzlichkeit entwickeln und die Anstalt zu dem machen, was sie ist: Zum wohlgeordneten Sammelbecken von Unbegreiflich - Begreiflichem.
Das Schönste sind die Skurrilitäten
Dass dabei bei allem Ernst auch manchmal Skurriles passiert, ist wohl von selbst klar. Das Schönste war wohl der Morgen, an dem einer der Psychologen, warum auch immer, von einer ansonsten nicht weiter auffälligen Lanzeitpatientin mit den Worten begrüßt wurde: „Guten Morgen, Herr …, hast Du heute Dein Fickmaschinchen vergessen?“
Beim Abendmahl mit Gästen von außerhalb brach es, nachdem er den „Wein“ (Saft) bekommen hatte, mit den Worten „Christi Blut – für Dich vergossen“ aus einem der Teilnehmer heraus: „Verdammt – das schmeckt!“
Die Mutter einer Schülerin, die mit Ihrer Tochter das Konzert des Gymnasiums im Festsaal besuchte, staunte nicht schlecht, als der von Wuchs kleine Mann neben ihr zu ihr sagte: „Sogar der Richter hat gesagt, ich bin nicht schuld. Was läuft mir der Kerl ins Messer!“ Sie sah darin keinen Grund, nun mit ihrer Tochter schreiend das Weite zu suchen, sondern freute sich über diese interessante Äußerung und über die Veranstaltung.
Ein älterer Herr mit Gehstock, langjähriger Patient, stand während des Gottesdienstes auf, ging bis zur Eingangstür des Festsaales und setzte sich bei offener Tür auf die Treppe und den Hut auf seinen Kopf. Da ich gerade die Predigt hielt, fiel mein Blick genau dort hin. Normaler Weise störten mich solche Dinge nicht. Aber an dem Tag schien es mir, als sei einigen kalt. Daher schickte ich jemand hin, um die Tür zu schließen. Kaum war das geschehen, ging sie wieder auf, der Türschließer bekam das mit und ging erneut, sie zu schließen. Aber der ältere Herr hielt seinen Stock in die Tür. Da sagte ich, dann soll er das eben lassen. Es würde dann auch so gehen. Nach dem Gottesdienst fragte ich nach. Die Antwort: „Ich wollte rauchen. Wenn ich dazu auf die Toilette gehe, höre ich die Predigt nicht. Deshalb habe ich mich an die offene Tür gesetzt. Dann kann ich beides.“ Welch ein Eifer für das Evangelium und die Zigarette!!
Nicht nur Patienten, auch ich selber war hin und wieder skurril unterwegs. Ein Patient fragte mich, ob ich ihn in den Garten rauslassen könnte. Ich dachte kurz nach. ‚Den Menschen kenne ich doch aus der Forensik… wenn der hierher auf die Aufnahme verlegt worden ist, kann er wohl raus.’ In allen anderen Fällen war klar: bei solchen Fragen das Dienstzimmer aufsuchen und sich Klarheit verschaffen. Diesmal ließ ich ihn einfach in den Garten. … Zwei Tage später rief mir der Arzt aus der Forensik zu: „Da haben Sie aber Glück gehabt!“ Auf mein erstauntes Gesicht hin erzählte er mir: „Patient soundso hat in Lübeck mit einer Spielzeugpistole eine Bank überfallen und 5.000 ausgezahlt bekommen. Aber an der nächsten Ecke wurde er natürlich schon von der Polizei erwartet. Später fragte ihn der Staatsanwalt, wie er denn um Gottes willen aus der Klinik rausgekommen sei. Antwort: ‚Der Pastor hat mich rausgelassen.’ Da antwortete der Staatsanwalt: ‚Jetzt halten Sie aber mal die Luft an. Den Pastor beschuldigen, da schlägt’s dreizehn!’ Die Sache wurde zur Akte gegeben, der Patient wieder – diesmal endgültig - in die Forensik gebracht. Ich sage ja: Glück gehabt!“, schloss der Arzt seine Erzählung. Was für ein Vertrauen setzte dieser Staatsanwalt in die Diener der Kirche!!
Regelmäßig versah einer der Ärzte den psychiatrischen Dienst im Gesundheitsamt einer etwas entfernt liegenden Kreisstadt. Ich konnte darauf vertrauen, dass er mir jedes Mal Grüße von ‚meiner Frau’ mitbrachte: „Ihre Frau lässt Sie diesmal besonders herzlich grüßen!“ sagte er jetzt. „Es geht ihr wieder so gut, dass ich fürchte, wir müssen sie bald einweisen. Sind Sie damit einverstanden?“ Er freute sich über diesen gelungenen Gag! Wenn ‚meine Frau’ im Krankenhaus war, sagte sie zu mir nichts, sondern winkte nur aus dem Fenster, wenn ich vorbei ging.
Im Besucherraum saß Herr Z. mit seiner Frau und seinem Sohn. Die Patientin war die Frau. Auf mein ‚Guten Tag!’ hin stand Herr Z. auf und fragte, ob ich der Pastor sei. Dann müsse er mit mir sprechen. „Sie wissen, dass meine Frau eine ganz große Katastrophe erwartet. Wie gehen sie damit um?“ „Ich versuche, sie als Gesprächspartnerin ernst zunehmen.“ „Sie wissen auch, dass meine Frau Ihre Worte und Ihre Person ihrerseits sehr ernst nimmt. Sie verehrt Sie geradezu.“ „Mir ist das noch nicht aufgefallen. Ich fand Ihre Frau eigentlich immer reserviert bis kritisch – nicht Frau Z.?“ Sie sagte nichts. Daraufhin er: „Sie sind gut. Ernstnehmen. Aber was tun Sie, wenn bei Ihnen ein Lastwagen voll Salz angeliefert wird?“ „Da habe ich keine Phantasie mehr. Das ist ja bereits die Katastrophe!“ „Na sehen Sie! Ich weiß nicht ob man Kranke ernst nehmen kann.“ „Aber was wollen Sie sonst tun? Wenn Sie es nicht tun, bestellt sie eben aufgrund von Ablehnungsempfindungen einen Lastwagen voll Salz.“ Wir wurden uns nicht einig. Schon bei wahrscheinlich eher Gesunden ist die Verständigung manchmal schwierig.
Eine Patientin kam mit einem Zettel zu mir. Darauf stand „Durchwahl 400 – bitte anrufen“. Gehorsam wählte ich die Nummer. Am anderen Ende sagte der verdutzte Pförtner: „Legen Sie ganz schnell auf, Herr Pastor. Sie haben den Feueralarm gewählt.“ Ein Moment des Nachdenkens hätte mich vor diesem Anruf bewahrt.
Es dauerte einige Zeit. Aber immer wieder forderten uns die Patienten auf, doch mal einen Witz zu erzählen. Da ich kein heftiger Witzerzähler bin, war mir dieses Anliegen nicht so richtig nachvollziehbar. Am Ende bat ich darum, dass sie uns Witze erzählen. Und das taten sie. Der erste Witz war sogleich ein damals so genannter „Irrenwitz“. Die Gruppenmitglieder lachten sich echt kaputt und fügten noch weitere Irrenwitze mit wachsender Begeisterung hinzu. So kam es, dass wir im Irrenhaus uns über Irrenwitze kaputtlachen mussten und gar nicht zu unserem Thema kamen. Auf die Frage, was daran eigentlich so witzig sei, begannen sie erneut heftig zu lachen. Und dann kam der letzte:
„Guten Tag, Herr Professor!“ „Guten Tag, Fritz! Wie geht’s heute?“ „Ach, eigentlich ganz gut.“ „Sie haben heute wieder ihren Hund dabei!“ „Ja“, antwortete Fritz und zog seine Zahnbürste hinter sich her: „Komm, Fiffi!“ Am nächsten Tag begegneten sich die beiden wieder: „Herr Professor, ich weiß, dass das nicht mein Hund, sondern meine Zahnbürste ist, die ich hinter mir herziehe.“ „Dann freue ich mich sehr, dass Sie jetzt Fortschritte machen!“ Das war’s fürs Erste. Als der Professor außer Sichtweite war, drehte sich Fritz um: „Haha, dem haben wir’s gezeigt, Fiffi!“
Was daran so witzig ist, war zu erklären nicht notwendig. Keine(r) und jede(r) wusste es, aber niemand hätte es in Worte fassen können.
Die Anfänger
Die Anfänger sind Menschen, die anderen helfen wollen, die sich in die Auseinandersetzung mit den Phänomenen hineinknien. Sie sehen im Kranken keinen Patienten, sondern einen Mitmenschen. Sie machen das normale Spiel der Kontaktsuche mit den Patienten: „Mag mich! Ich bin doch ein netter Mensch! Ich interessiere mich wirklich für dich!“ Dahinter steht: „Hoffentlich werde ich hier akzeptiert!“ Aber dahinter steht auch: „Es muss die Anstalt menschlicher werden!“
Der Anfänger bringt neue Ideen mit. Je schneller er sie durchsetzen kann, desto eher bleiben sie vom Rollback der Anstalt verschont. Das Rollback der Anstalt ist aber zum wenigsten eine Bosheit der Altgedienten. Die sind froh, wenn diese oder jene Hoffnungslosigkeit durch irgendetwas Neues ein wenig verschoben wird, wiewohl sie natürlich ihr Revier verteidigen müssen. Das sind sie sich selbst und auch den Anfängern schuldig. Nein - das Rollback der Anstalt ist die Häufung der Momente, in denen bei großem emotionalen Einsatz einfach nichts von der Stelle geht, der Punkt, an dem nach einem ersten durch frisches Engagement angefachten Erfolg ein Rückschlag einsetzt, in dem die erste Auseinandersetzung oder offene Ablehnung von der Seite derer, denen man helfen möchte, verarbeitet werden muss. Das Rollback der Anstalt findet in jedem früher oder später selber statt.
Jeder reagiert darauf anders. Der eine verlässt die Psychiatrie ganz, der andere sucht sich eine Spezialaufgabe, bei der er durch methodisches Vorgehen und kleine Patientenzahl einen größeren Erfolg erhofft. Der Dritte zieht dann doch lieber in die Großstadt, wo mehr Ablenkung vorhanden und evtl. sogar noch „wissenschaftliches Terrain“ zu finden ist. Als ob es auf dem Land keine Wissenschaft gäbe! Der vierte wird nun einfach zum knochenharten Diagnostiker.
Seinen Weg muss ein jeder finden. Schlimm ist es, wenn er nicht in seinem Inneren bei aller Realitätsnähe, der er nicht entfliehen kann, wenn er in der Anstalt bleibt, ein wenig von seinem Anfängerdasein bewahrt.
Wenn das erhalten bleibt, wird jeder für sich außerhalb der diagnostischen und therapeutischen Bahnen ab und zu Menschen finden, denen er wirklich helfen kann. Da kommt es nicht auf seinen Dienstgrad an. Das trifft auf alle zu, die in der Psychiatrie arbeiten, und da einmal Anfänger waren. Wer es nicht verkraften kann, mit Enttäuschungen zu leben, Ohnmacht zu ertragen und alles für menschlich zu halten, was so geschieht, der wird in der Psychiatrie nicht einmal Anfänger. Er hat bestenfalls hereingeschaut. Und wer sich nicht ganz unmenschlich von den Menschen, die er zu betreuen hat, bei aller Nähe einmal distanzieren lernt, wird bestenfalls selbst Patient.
Die Anfänger sehen die Fehler der Anstalt krass und deutlich: "kaum Therapie", keine dauernde Zuwendung, kein Nachholen der meist als missglückt interpretierten frühkindlichen Beziehungen, kein Teamgeist, der sich in endlosen gemeinsamen Besprechungen ausdrückt, keine gemeinsame Einstellung gegenüber dem vorgefundenen Phänomen. Er entdeckt, dass hier jeder „nur“ ums Überleben kämpft. Und er nimmt sich vor, dass ihm das nicht passieren soll. Er bemüht sich um Kontakte mit Gleichgesinnten. Er sucht eine Front, in die er sich einreihen kann. Hier muss sich doch etwas ändern lassen! Es muss doch eine Therapie (= Heilung) möglich sein! Die heimliche oder offene Darstellung der Altgedienten, dass sie das alles auch schon einmal durchgemacht hätten, kommt ihm selbstgerecht vor und einfach auch unmenschlich. Und sicher: je nach Vehemenz gelingt es in der Tat, zunächst einmal eine Bresche in das Bollwerk zu schlagen: ‚Sie haben alle genickt, als ich meinen neuen Plan vortrug.’ ‚Sie haben nicht aggressiv reagiert! Kann man mehr erwarten?’
Doch schon nach kurzer Zeit teilen sich die Anfänger. Die einen sind unnachgiebig! Sie wollen nicht nur eine lächerliche Bresche. Sie wollen die Mauer schleifen! Die anderen aber finden hinter der Mauer doch dies und das, was sie interessiert, was sie vom Mauerschleifen ablenkt. Wenn so die Gruppe der Anfänger gespalten ist und das ist sie über kurz oder lang immer, beginnt der stille, aber plötzliche Rückzug derer, die die ganze Mauer weghaben wollten. Das gibt den anderen die Erfahrung, wenn vielleicht auch mit verschiedenen Mitteln, so doch für dieselbe Sache zu arbeiten wie die Altgedienten. Die einen sehen darin den beginnenden Hospitalisierungsprozess der anderen, die anderen die Selbstgerechtigkeit und fehlende Realitätsnähe der einen.
Ich gehöre zu denen, die für die anderen der Hospitalisierung zum Opfer fielen. Doch ich glaube, den Anfänger immer noch ganz tief in mir zu tragen: Immer wieder glaube ich ganz unverschämt, bei allem, was ich an Arbeit mache, irgendetwas zu finden, was diesem und jenem wirklich hilft. Oder auch nur durch Zuwendung diesem und jenem wirklich helfen zu können. Und ich glaube auch immer noch, dass viele andere das auch wollen und empfinden. Es ist gleichsam eine Parusieverzögerung, die da stattgefunden hat.
Wer die Hoffnung auf den „Durchbruch“ aufgibt, der kann mit Menschen, die so schwer in Not sind wie die in der Psychiatrie, nicht ehrlich arbeiten wollen. Er wird zum Gefängniswärter.
Wer aber meint, an dem (noch) fehlenden Durchbruch seien nur die sturen Altgedienten schuld, der sollte nicht mit Kranken arbeiten. Er opfert sie nur seinen Interessen.
Sicherlich werden andere das ganz anders sehen. Es ist die einzige Möglichkeit, in der Psychiatrie in Bewegung zu bleiben die, dass andere alles ganz anders sehen.