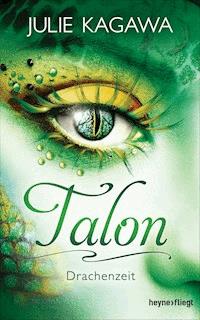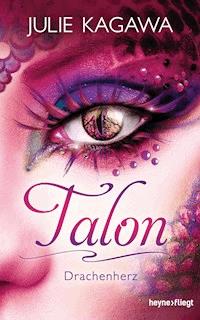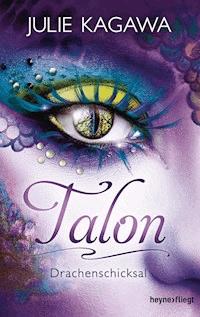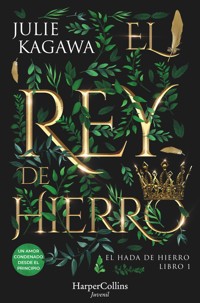13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Plötzlich Prinz
- Sprache: Deutsch
Wenn du der Bruder der mächtigsten Herrscherin des Feenreichs bist, entkommst du deinem Schicksal nicht
Der achtzehnjährige Ethan Chase wäre gern so wie alle anderen an seiner Highschool. Doch seit er denken kann, ist sein Leben alles andere als normal. Denn als Kind wurde er von den Feen nach Nimmernie verschleppt. Und wen die Feen einmal in ihrer Gewalt hatten, den lassen sie nicht mehr los. Ihre Macht reicht bis in den hintersten Winkel der Menschenwelt hinein. Ethan muss erkennen, dass es sinnlos ist, sich vor ihnen zu verstecken. Und so nimmt er sein Schicksal an und kehrt nach Nimmernie zurück.
Schau dich nie nach ihnen um. Tu einfach so, als wären sie nicht da – das ist die goldene Regel, mit der Ethan Chase jeden Ärger zu vermeiden sucht. Ärger, den ihm seine ältere Schwester Meghan Chase eingehandelt hat, die in Nimmernie, dem Land der Feen, lebt und dafür gesorgt hat, dass die Grenzen zur Menschenwelt durchlässiger werden. Wo Ethan geht und steht, ereignen sich seltsame Dinge. Immer sieht es so aus, als sei er daran schuld. Wie zum Beispiel an dem mysteriösen Feuer in der Bibliothek seiner alten Schule, die er daraufhin verlassen muss. Als Ethan am ersten Tag an seiner neuen Highschool persönlich angegriffen wird, kann er die Boten Nimmernies allerdings nicht mehr länger ignorieren. Er muss sich seinem verhängnisvollen Erbe stellen, um sich und seine Familie vor dem Schlimmsten zu bewahren – und um ein Mädchen zu retten, von dem er bislang nicht einmal wusste, dass er eigentlich unsterblich in sie verliebt ist …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 638
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
JULIE KAGAWA
Plötzlich Prinz
DAS ERBE DER FEEN
Aus dem Amerikanischen von
Charlotte Lungstraß
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.Replace outdated disclaimer texts as necessary, make sure there is only one instance of the disclaimer.
Die Originalausgabe erscheint unter dem Titel The Iron Fey – The Lost Prince bei Harlequin Teen, Ontario
Copyright © 2012 by Julie Kagawa
Copyright © 2014 der deutschsprachigen Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Redaktion: Petra Müller
Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design, München
Herstellung: Claudia Mayer
Satz: Christine Roithner Verlagsservice, Breitenaich
ISBN 978-3-641-12863-0V003
www.penguin.de
Für Guro Ron,
in Erinnerung an all die »Tapferkeitsmale«,
die ich mir in seinem Kurs
eingefangen habe.
Teil Eins
1 – Der Neue
Mein Name ist Ethan Chase.
Und ich glaube nicht, dass ich meinen achtzehnten Geburtstag erleben werde.
Das soll kein melodramatischer Spruch sein, es ist einfach eine Tatsache. Ich wünschte nur, ich hätte nicht so viele Leute in dieses Chaos mit reingezogen. Sie sollten nicht meinetwegen leiden müssen. Besonders nicht … sie. Gott, könnte ich in meinem Leben irgendetwas rückgängig machen, dann hätte ich ihr niemals meine Welt gezeigt, die verborgene Welt, die uns umgibt. Ich wusste, dass ich sie da hätte raushalten müssen. Sobald man sie sieht, lassen sie einen nicht mehr in Ruhe. Sie lassen einen niemals wieder gehen. Hätte ich damals Stärke bewiesen, wäre sie jetzt nicht hier und würde gemeinsam mit mir auf den Tod warten.
Das alles fing an, als ich auf eine neue Schule kam – wieder einmal.
Der Wecker klingelte um sechs Uhr früh, aber ich war bereits seit einer Stunde wach und bereitete mich auf den nächsten Tag in meinem verdrehten, völlig verkorksten Leben vor. Ich wünschte, ich wäre einer dieser Typen, die aufstehen, sich ein Shirt anziehen und damit fertig sind, aber traurigerweise verläuft in meinem Leben nichts derart normal. Heute zum Beispiel hatte ich getrocknetes Johanniskraut in die Seitentasche meines Rucksacks gestopft und neben Stiften und Block auch eine Dose Salz eingepackt. Außerdem hatte ich jeweils drei Nägel in die Sohlen der neuen Stiefel geschlagen, die Mom mir für dieses Schuljahr gekauft hatte. An der Halskette unter meinem T-Shirt hing ein Kreuz aus reinem Eisen, und in diesem Sommer hatte ich mir die Ohren durchstechen lassen, in denen nun Metallstecker funkelten. Ursprünglich hatte ich auch einen Ring in der Lippe und einen Stab in der Augenbraue gehabt, aber als ich damit heimgekommen war, hatte Dad einen Tobsuchtsanfall bekommen. Am Ende durfte ich nur die Ohrstecker behalten.
Seufzend musterte ich mich im Spiegel, um sicherzugehen, dass ich möglichst unnahbar aussah. Manchmal erwischte ich Mom dabei, wie sie mich traurig ansah, als würde sie sich fragen, wo ihr lieber kleiner Junge hinverschwunden war. Früher hatte ich braune Locken gehabt, genau wie Dad, aber irgendwann hatte ich mir eine Schere geschnappt und strähnige, fransige Stacheln daraus gemacht. Früher hatte ich auch strahlend blaue Augen gehabt, wie meine Mom und – nach allem, was man so hört – meine Schwester. Doch im Laufe der Jahre waren sie immer dunkler geworden, heute war es eher ein rauchiges Blaugrau. Dad scherzt immer, das müsse davon kommen, dass ich ständig so finster dreinschaue. Früher habe ich auch nicht mit einem Messer unter der Matratze, Salz auf dem Fensterbrett und einem Hufeisen über der Tür geschlafen. War nicht »grüblerisch«, »feindselig« und »unmöglich«. Früher habe ich oft gelächelt und laut gelacht. Was heute nur noch äußerst selten vorkommt.
Ich weiß, dass Mom sich Sorgen macht. Dad behauptet, das sei normales Teenagergehabe, dass ich eine »Phase« durchmache und sich das irgendwann auswachsen werde. Sorry, Dad, aber mein Leben ist alles andere als normal. Und ich weiß nicht, wie ich anders damit klarkommen soll.
»Ethan?« Moms leise, zögerliche Stimme drang durch die Zimmertür. »Es ist schon nach sechs. Bist du wach?«
»Bin schon auf.« Ich griff nach dem Rucksack und schlang ihn mir über die Schulter. Mein weißes T-Shirt war auf links gedreht, sodass am Kragen das Etikett zu sehen war. Noch so eine kleine Marotte, an die meine Eltern sich inzwischen gewöhnt hatten. »Ich komme gleich.«
Nachdem ich meinen Schlüssel eingesteckt hatte, verließ ich das Zimmer. Eine vertraute Mischung aus Resignation und Anspannung breitete sich in mir aus. Also gut, bringen wir den Tag hinter uns.
Ich habe eine bizarre Familie.
Von außen betrachtet würde man niemals darauf kommen. Wir scheinen vollkommen normal zu sein: eine nette amerikanische Familie in einer netten Vorstadtsiedlung, wo die netten Straßen sauber und die Nachbarn alle – welche Überraschung – nett sind. Vor zehn Jahren haben wir noch im Sumpf gelebt und Schweine gezüchtet. Vor zehn Jahren waren wir noch arme Hinterwäldler, aber dafür glücklich. Das war vor dem Umzug in die Stadt, vor unserer Rückkehr in die Zivilisation. Mein Dad hat es anfangs gehasst, immerhin war er sein Leben lang Farmer gewesen. Für ihn war es schwierig, sich anzupassen, aber irgendwann hatte er es geschafft. Mom überzeugte ihn davon, dass wir unter Menschen sein müssten, genauer gesagt, dass ich unter Menschen sein müsste und diese dauerhafte Isolation nicht gut für mich sei. So hat sie es Dad verkauft, aber natürlich kannte ich ihre wahren Beweggründe. Sie hatte Angst. Angst vor ihnen, Angst davor, dass sie mich wieder stehlen, dass ich noch einmal von Feen entführt und ins Nimmernie verschleppt werden könnte.
Wie gesagt, meine Familie ist bizarr. Und das ist noch nicht einmal das Schlimmste.
Irgendwo dort draußen habe ich noch eine Schwester. Eine Halbschwester, die ich seit Jahren nicht mehr gesehen habe, was allerdings nicht daran liegt, dass sie zu viel zu tun hätte, verheiratet wäre oder auf einem anderen Kontinent leben würde.
Nein, es liegt daran, dass sie eine Königin ist. Eine Feenkönigin, eine von ihnen, die nie wieder nach Hause zurückkehren kann.
Wenn das nicht schräg ist, was dann?
Natürlich kann ich das niemandem sagen. Normalen Menschen bleibt die Welt der Feen verborgen, die Magie macht es ihnen unmöglich, sie wahrzunehmen. Die meisten Menschen würden einen Kobold nicht einmal dann bemerken, wenn er ihnen die Nase abbeißt. Es gibt ein paar Sterbliche, die mit dem Blick gestraft sind, was bedeutet, dass sie all die Feen sehen können, die in dunklen Ecken und unter ihren Betten lauern. Diese Menschen wissen, dass jenes seltsame Gefühl, beobachtet zu werden, nicht ihrer Einbildung entspringt und die Geräusche aus Keller und Dachboden nicht daher kommen, dass das Haus sich setzt.
Bin ich nicht ein Glückspilz? Ich bin einer von ihnen.
Natürlich machen meine Eltern sich meinetwegen Sorgen, Mom ganz besonders. Die Leute halten mich ja jetzt schon für merkwürdig, gefährlich, vielleicht sogar verrückt. Wenn man überall Feen sieht, bleibt das nicht aus. Denn wenn die Feen wissen, dass man sie sehen kann, machen sie einem das Leben zur Hölle. Letztes Jahr war ich von der Schule geflogen, weil ich angeblich die Bibliothek in Brand gesteckt hatte. Was sollte ich sagen? Dass ich unschuldig war, weil ich lediglich versucht hatte, einem Haufen Dunkerwichtel zu entkommen, die mich bis dorthin verfolgt hatten? Und das war nicht das erste Mal gewesen, dass ich wegen der Feen in Schwierigkeiten geraten war. Ich war ein »Problemkind«, über das die Lehrer nur mit gesenkter Stimme sprachen, einer dieser stillen, gefährlichen Typen, von denen jeder erwartet, dass sie irgendwann wegen eines schrecklichen Verbrechens in den Abendnachrichten auftauchen. Manchmal machte mich das wütend. Mir war egal, was sie von mir dachten, aber für Mom war es schwierig. Also versuchte ich, mich anständig zu benehmen, so sinnlos das auch sein mochte.
Dieses Jahr kam ich auf eine neue Schule, in ein neues Umfeld, wo ich Gelegenheit zu einem »Neuanfang« hatte. Aber das würde nichts ändern. Solange ich die Feen sah, würden sie keine Ruhe geben. Ich konnte nichts anderes tun, als mich und meine Familie zu schützen und zu hoffen, dass ich niemanden mehr verletzte.
Als ich runterkam, erwartete mich Mom bereits am Küchentisch. Dad war nirgendwo zu sehen. Er machte die Nachtschicht bei UPS und schlief oft bis in den Nachmittag hinein. Normalerweise begegnete ich ihm nur beim Abendessen und an den Wochenenden. Was allerdings nicht hieß, dass er in seliger Unwissenheit lebte, was mich anging – sicherlich kannte Mom mich besser, aber Dad hatte keinerlei Probleme damit, Strafen zu verhängen, wenn er glaubte, ich sei nachlässig oder wenn Mom sich beschwerte. Vor zwei Jahren hatte ich einmal eine Vier in Bio bekommen, was dann auch meine letzte schlechte Note gewesen war.
»Der große Tag«, begrüßte mich Mom, als ich den Rucksack auf den Tresen warf und den Orangensaft aus dem Kühlschrank nahm. »Und du weißt ganz sicher, wie du zu der neuen Schule kommst?«
Ich nickte. »Ich hab’s in das Navi im Handy eingespeichert. Es ist nicht weit, wird schon klappen.«
Sie zögerte. Nein, sie fand es nicht gut, dass ich allein hinfahren wollte. Dabei hatte ich mir den Arsch aufgerissen, um mir ein eigenes Auto leisten zu können. Der verrostete, grau-grüne Pick-up, der neben Dads Laster in der Einfahrt stand, repräsentierte einen ganzen Sommer harter Arbeit: Burger wenden, Geschirr spülen, Böden voller verschütteter Getränke, Essensresten und Kotze schrubben. Wochenenden mit Überstunden, an denen ich anderen in meinem Alter dabei zusehen durfte, wie sie abhingen, mit ihren Freundinnen knutschten und mit Geld um sich warfen, als wüchse es auf Bäumen. Ich hatte mir diesen Wagen verdient, da würde ich bestimmt nicht mit dem verdammten Bus zur Schule fahren.
Aber da Mom mich mit diesem traurigen, fast ängstlichen Blick ansah, seufzte ich schwer und murmelte: »Soll ich dich anrufen, wenn ich angekommen bin?«
»Nein, Liebes.« Mom richtete sich auf und winkte ab. »Ist schon gut, das musst du nicht. Aber bitte … nimm dich in Acht.«
Ich hörte auch das, was sie unausgesprochen ließ: Nimm dich vor ihnen in Acht. Errege nicht ihre Aufmerksamkeit. Lass nicht zu, dass sie dich in Schwierigkeiten bringen. Versuch diesmal, auf dieser Schule zu bleiben.
»Mach ich.«
Sie stand noch eine Weile unschlüssig herum, dann drückte sie mir einen Kuss auf die Wange und schützte Aktivität vor, indem sie im Wohnzimmer verschwand. Ich trank meinen Saft aus, goss mir noch ein Glas ein und stellte den Karton in den Kühlschrank zurück.
Als ich die Tür zuwarf, löste sich einer der Magnete und landete klappernd auf dem Boden, sodass der Zettel, den er festgehalten hatte, herabsegelte. Samstag: Kali-Vorführung. Als ich ihn aufhob, spürte ich ein nervöses Kribbeln im Magen. Vor sieben Jahren hatte ich angefangen, die philippinische Kampfsportart Kali zu lernen, um mich besser vor dem schützen zu können, was dort draußen auf mich lauerte. Kali hatte mich fasziniert, weil man dabei nicht nur lernte, sich mit bloßen Händen zu verteidigen, sondern auch mit Stöcken, Messern und Schwertern. In einer Welt voller dolchbewehrter Kobolde und schwertschwingendem Feenadel wollte ich auf alles vorbereitet sein. An diesem Wochenende war unsere Gruppe für eine Vorführung bei einem Kampfsportturnier gebucht, und ich würde daran teilnehmen.
Zumindest, wenn ich es schaffte, mir bis dahin keinen Ärger einzuhandeln. Was bei mir schwieriger war, als es sich anhörte.
Mitten im Herbstsemester an einer neuen Schule anzufangen ist zum Kotzen.
Ich muss es wissen. Für mich ist das nichts Neues: die verwirrende Suche nach dem Schließfach, die neugierigen Blicke auf den Fluren, der Gang der Schande durch das Klassenzimmer, wenn man auf dem Weg zu seinem Tisch von über zwanzig Augenpaaren verfolgt wird.
Vielleicht sind ja wirklich aller guten Dinge drei, dachte ich missmutig und ließ mich auf meinen Stuhl fallen, der Gott sei Dank ganz hinten in einer Ecke stand. Zwei Dutzend Blicke bohrten sich in meinen Schädel, doch ich ignorierte sie. Vielleicht schaffe ich es diesmal ja durch ein Halbjahr, ohne rausgeworfen zu werden. Ein Jahr noch – gewährt mir noch ein Jahr, dann bin ich frei. Wenigstens zitierte mich die Lehrerin nicht vor die Klasse, um mich allen vorzustellen. Das wäre mehr als peinlich gewesen. Ich hatte noch nie begriffen, warum sie eine solche Demütigung für nötig hielten. Auch ohne am ersten Tag derart ins Rampenlicht gezerrt zu werden, war es schwer genug, sich einzufügen.
Na ja, einfügen würde ich mich ja sowieso nicht.
Während ich weiterhin die neugierigen Blicke spürte, die immer wieder in meine Ecke wanderten, konzentrierte ich mich darauf, bloß nicht hochzusehen und mit niemandem Augenkontakt aufzunehmen. Ich hörte das Getuschel, sank noch mehr in mich zusammen und starrte auf mein Englischbuch.
Plötzlich landete etwas auf meinem Tisch: ein zusammengefalteter Zettel, der offenbar aus einem Block herausgerissen worden war. Noch immer blickte ich nicht auf, ich wollte gar nicht wissen, wer das Ding geworfen hatte. Vorsichtig ließ ich das Papier unter die Tischplatte gleiten und entfaltete es in meinem Schoß.
Bist du der Typ, der seine alte Schule abgefackelt hat? Ziemlich krakelige Handschrift.
Seufzend zerknüllte ich den Zettel. Die Gerüchte waren also schon im Umlauf. Großartig! Anscheinend hatte ich es bis in die Lokalzeitung geschafft: Jugendlicher Delinquent flieht vom Schauplatz seines Verbrechens. Da allerdings niemand bezeugen konnte, dass ich die Bibliothek angezündet hatte, war ich nicht im Gefängnis gelandet. Wenn auch nur knapp.
Irgendwo rechts von mir kicherte und tuschelte es, dann landete ein weiterer Zettel auf meinem Arm. Diesmal hätte ich die nervige Nachricht fast ungelesen weggeworfen, aber dann siegte die Neugier, und ich riskierte einen Blick.
Hast du im Jugendknast echt einen abgestochen?
»Mr. Chase.«
Miss Singer kam mit verkniffenem Gesicht auf mich zu. Vielleicht sorgte aber auch nur der strenge, dunkle Dutt auf ihrem Kopf dafür, dass sich die Gesichtshaut spannte und die Augen hinter den Brillengläsern so schmal waren. Mit klirrenden Armreifen streckte sie die Hand aus und wackelte auffordernd mit den Fingern. Ihr Ton war unnachgiebig. »Her damit, Mr. Chase.«
Ohne sie anzusehen, hob ich die Hand mit dem Zettel. Ruckartig entriss sie ihn mir. Einen Moment später sagte sie leise: »Kommen Sie nach der Stunde zu mir.«
Verdammt. Knapp eine halbe Stunde hier, und schon hatte ich Ärger. Nicht gerade ein gutes Omen für den Rest des Schuljahres. Ich ließ die Schultern hängen und schottete mich gegen die bohrenden Blicke ab, während Miss Singer nach vorne ging und mit dem Unterricht fortfuhr.
Nach dem Ende der Stunde blieb ich auf meinem Platz und hörte zu, wie die anderen ihre Stühle rückten, sich Taschen umhängten und zur Tür drängten. Sie redeten und lachten und fanden sich zu ihren üblichen Cliquen zusammen. Während ein Schüler nach dem anderen verschwand, hob ich den Blick und ließ ihn über die wenigen wandern, die noch im Raum waren. Ein blonder Junge mit Brille an Miss Singers Pult quasselte ohne Punkt und Komma auf die Lehrerin ein, die leicht amüsiert zuhörte. Sein eifriger Hundeblick ließ zwei Rückschlüsse zu: Entweder war er schwer verliebt, oder er bewarb sich um den Platz des Klassenstrebers.
An der Tür standen ein paar Mädchen, die wie Tauben zusammengluckten und albern kicherten. Einige der Jungs starrten sie im Vorbeigehen an und hofften, einen Blick zu erhaschen, wurden jedoch enttäuscht. Ich schnaubte leise. Viel Glück! Mindestens drei dieser Schönheiten gehörten zum Typ schlanke, umwerfende Blondine, was einige noch durch extrem kurze Röcke betonten, die ihre langen, gebräunten Beine ins richtige Licht rückten. Ganz offensichtlich gehörten sie zur Cheerleader-Clique, was bedeutete, dass ein Typ wie ich – und jeder andere, der weder eine Sportskanone noch ein reicher Schnösel war – bei ihnen keine Chance hatte.
Eines der Mädchen drehte sich um und sah mich an.
Hastig wandte ich den Blick ab – hoffentlich hatte das keiner bemerkt. Ich wusste nur zu gut, dass Cheerleaderinnen normalerweise mit großen, übertrieben besitzergreifenden Footballspielern liiert waren, die erst zuschlugen und dann Fragen stellten. Und ich wollte nicht an meinem ersten Tag an einen Spind oder eine Toilettenwand gedrückt werden und eins auf die Fresse kriegen, nur weil ich es gewagt hatte, die Freundin des Quarterbacks anzusehen. Wieder hörte ich Getuschel und stellte mir vor, wie sie mit dem Finger auf mich zeigten. Dann drangen schockiertes Quietschen und Keuchen zu mir herüber.
»Sie macht es wirklich«, zischte jemand, kurz bevor leise Schritte zu hören waren. Eines der Mädchen hatte sich vom Rudel gelöst und kam zu mir rüber. Na großartig!
Geh weg, dachte ich und rückte weiter Richtung Wand. Hier gibt es nichts, was du wollen oder brauchen könntest. Ich bin bestimmt nicht hier, damit du beweisen kannst, dass du keine Angst hast vor dem neuen bösen Buben, und ich habe keine Lust auf einen Kampf mit deinem hirnverbrannten Freund. Lass mich in Ruhe.
»Hi.«
Ergeben drehte ich mich um und starrte in das Gesicht eines Mädchens.
Sie war kleiner als die anderen, eher der freche, niedliche Typ als eine elegante Schönheit. Ihre langen, glatten Haare waren rabenschwarz, und die Strähnen, die ihr Gesicht umrahmten, hatte sie leuchtend blau gefärbt. Die dunkle Jeans über ihren Turnschuhen schmiegte sich an die schlanken Beine, war aber nicht übertrieben eng. Warme, braune Augen blickten auf mich herab, während sie die Hände auf dem Rücken verschränkte und von einem Fuß auf den anderen trat, als würde es ihr schwerfallen, lange stillzustehen.
»Das mit dem Zettel tut mir leid«, fuhr sie fort, während ich mich stumm nach hinten lehnte und sie wachsam musterte. »Ich habe Regan gesagt, sie soll es lassen, Miss Singer hat Augen wie ein Falke. Wir wollten dich nicht in Schwierigkeiten bringen.« Als sie lächelte, erstrahlte der ganze Klassenraum. Das war gar nicht gut; ich wollte nicht, dass hier irgendetwas erstrahlte. Vor allem wollte ich nicht, dass mir irgendetwas an diesem Mädchen auffiel, besonders nicht die Tatsache, dass sie extrem attraktiv war. »Ich bin Kenzie. Also, eigentlich Mackenzie, aber alle nennen mich nur Kenzie. Wehe, du nennst mich Mac, dann haue ich dir eine rein.«
Ihre Freundinnen tuschelten miteinander, einige von ihnen gafften ganz offen, während andere nur verstohlen zu uns herübersahen. Plötzlich kam ich mir vor wie ein Tier im Zoo. Leise Verbitterung stieg in mir auf. Für sie war ich nur eine Kuriosität: der gefährliche Neue, den man anstarren und über den man tratschen konnte.
»Und du bist …?«, legte Kenzie vor.
Ich wandte demonstrativ den Blick ab. »Nicht interessiert.«
»Okay. Wow.« Sie klang überrascht, allerdings nicht wütend. Noch nicht. »Das … kam unerwartet.«
»Gewöhn dich dran.« Innerlich zuckte ich bei dem Ton in meiner Stimme zusammen. Ich führte mich auf wie ein Arsch, das war mir klar. Außerdem war mir klar, dass ich damit jede Chance auf Akzeptanz an dieser Schule zunichtemachte. Man redete nicht so mit einer niedlichen, beliebten Cheerleaderin, ohne damit zum absoluten Außenseiter zu werden. Sie würde zu ihren Freundinnen zurückgehen, sich mit ihnen das Maul zerreißen und Gerüchte in die Welt setzen, die mich für den Rest des Jahres zu einem Geächteten machten.
Gut, versuchte ich mir einzureden. Genau das will ich ja. So wird niemand verletzt. Sie sollen mich nur alle in Ruhe lassen.
Allerdings … machte das Mädchen keine Anstalten, wieder zu gehen. Aus dem Augenwinkel beobachtete ich, wie sie sich gegen einen Tisch lehnte, die Arme verschränkte und mich mit einem schiefen Grinsen musterte. »Kein Grund, gleich fies zu werden«, sagte sie vollkommen unbeeindruckt. »Ich bitte dich nicht um ein Date, Machoman, ich will nur deinen Namen wissen.«
Warum redete sie überhaupt noch mit mir? Hatte ich mich nicht klar ausgedrückt? Ich wollte mich nicht mit ihr unterhalten. Ich wollte keine Fragen beantworten. Je länger ich mit jemandem sprach, desto größer war das Risiko, dass sie etwas bemerkten, und dann würde der ganze Albtraum von vorne losgehen. »Ethan«, murmelte ich mit Blick auf die Wand und fügte gepresst hinzu: »Und jetzt verzieh dich.«
»Wow, ganz schön feindselig.« Offenbar hatten meine Worte nicht den gewünschten Effekt. Statt sich abgestoßen zu fühlen, schien sie das Ganze … spannend zu finden. Was zum Teufel war hier los? Ich widerstand dem Drang, sie direkt anzusehen, spürte aber, dass sie immer noch grinste. »Ich wollte nur nett sein, immerhin ist heute dein erster Tag hier. Bist du immer so, wenn du jemanden kennenlernst?«
»Miss St. James.« Die Stimme der Lehrerin hallte durch den Raum. Als Kenzie sich umdrehte, spähte ich kurz zu ihr hinüber. »Ich muss mit Mr. Chase sprechen«, fuhr Miss Singer fort und lächelte Kenzie freundlich an. »Bitte gehen Sie zu Ihrem nächsten Kurs.«
Kenzie nickte. »Natürlich, Miss Singer.« Sie schaute kurz über die Schulter und erwischte mich dabei, wie ich sie ansah. Bevor ich den Blick abwenden konnte, grinste sie mich an. »Wir sehen uns noch, Machoman.«
Ich beobachtete, wie sie zu ihren Freundinnen zurückschlenderte, die sie kichernd und tuschelnd umringten. Mit einigen aufdringlichen Blicken in meine Richtung traten sie auf den Flur hinaus und ließen mich mit der Lehrerin allein.
»Bitte kommen Sie zu mir nach vorne, Mr. Chase. Ich will nicht durch das halbe Klassenzimmer schreien.«
Widerwillig stand ich auf, ging zur ersten Reihe und fläzte mich dort auf einen Stuhl. Miss Singer warf mir über die Brille hinweg einen strengen Blick zu, bevor sie zu einem Vortrag über ihre Nulltoleranzpolitik in Bezug auf Störenfriede ansetzte, um mir anschließend zu versichern, dass sie vollstes Verständnis für meine Situation habe und dass ich doch etwas aus mir machen könne, wenn ich mich nur etwas anstrengte. Als ob das so einfach wäre.
Vielen Dank, aber die Mühe können Sie sich sparen. Das habe ich alles schon tausend Mal gehört: Wie schwierig es sein muss, an eine neue Schule zu kommen und ganz von vorne anzufangen. Wie problematisch die Situation zu Hause sein muss. Tun Sie doch nicht so, als wüssten Sie, was ich durchmache. Sie kennen mich nicht. Sie wissen nicht das Geringste über mein Leben. Das tut niemand.
Und wenn es nach mir ginge, würde sich daran auch nie etwas ändern.
Die nächsten beiden Stunden brachte ich ebenfalls hinter mich, indem ich alle um mich herum ignorierte. Als es zur Mittagspause klingelte, sah ich zu, wie die Schüler zur Cafeteria schlenderten, dann drehte ich mich um und lief in die entgegengesetzte Richtung.
Meine Mitschüler gingen mir langsam auf die Nerven. Ich wollte raus, weg von den Menschenmassen und den neugierigen Blicken. Bloß nicht alleine an einem Tisch hocken und ständig fürchten, dass jemand zu mir kam und »reden« wollte. Keiner von ihnen würde das aus reiner Freundlichkeit tun, da war ich mir sicher. Inzwischen hatten dieses Mädchen und ihre Freundinnen die Geschichte von unserer Begegnung bestimmt in der gesamten Schule verbreitet, vielleicht noch etwas ausgeschmückt, etwa, wie ich sie wüst beschimpft und trotzdem angebaggert hätte. So oder so wollte ich mich nicht mit wütenden Jungs und empörten Fragen herumschlagen. Ich wollte einfach nur meine Ruhe haben.
Als ich auf der Suche nach einem stillen Eckchen, in dem ich ungestört essen konnte, in einen anderen Flur abbog, stieß ich auf genau das, was ich hatte vermeiden wollen.
Ein Junge drückte sich mit hängenden Schultern an die Schließfächer und sah sich mit gehetztem Blick um. Vor ihm hatten sich zwei größere Typen aufgebaut, beide breit wie Schränke. Drohend starrten sie auf ihn herab. Einen Moment lang dachte ich, der Junge hätte Schnurrhaare. Dann richtete sich sein flehender Blick auf mich, und unter dem strohblonden Pony funkelten mich orange leuchtende Augen an. Auf seinem Kopf wuchsen zwei pelzige Ohren.
Leise stieß ich einen Fluch aus, für den Mom mir den Kopf abgerissen hätte. Diese beiden Idioten hatten ja keine Ahnung, was sie da machten. Natürlich konnten sie nicht sehen, was der Junge in Wirklichkeit war. Der »Mensch«, den sie sich vorgeknöpft hatten, war einer von ihnen, ein Feenwesen, zumindest zum Teil. Der Begriff Halbblut schoss mir durch den Kopf, während ich krampfhaft die Tüte mit meinem Essen umklammerte. Warum? Warum wurde ich sie nie los? Warum verfolgten sie mich auf Schritt und Tritt?
»Lüg mich nicht an, du Freak«, sagte einer der Athleten gerade und rammte die Schulter des Jungen gegen den Spind. Er hatte kurze, rotblonde Haare und war ein wenig kleiner als sein stiernackiger Begleiter, wenn auch nicht viel. »Regan hat dich gestern an meinem Auto gesehen. Findest du es etwa witzig, dass ich fast von der Straße abgekommen wäre?« Wieder schubste er ihn, sodass die Schränke blechern schepperten. »Diese Schlange ist da bestimmt nicht von allein reingekrochen.«
»Ich war’s nicht!«, protestierte das Halbblut und wich hastig zurück. Als er den Mund aufmachte, blitzten seine spitzen Eckzähne auf, was die beiden Sportler natürlich nicht bemerkten. »Ich schwöre, Brian, ich war’s nicht.«
»Ach ja? Dann hat Regan also gelogen, wie?«, fragte Brian und wandte sich an seinen Freund. »Ich glaube, der Freak hat Regan gerade als Lügnerin bezeichnet, das hast du doch auch gehört, oder, Tony?« Tony ließ drohend die Knöchel knacken, während Brian sich wieder zu dem Halbblut umdrehte. »Das war nicht besonders schlau, du Loser. Warum gehen wir nicht mal auf die Toilette? Da kannst du deine Bekanntschaft mit der Schüssel auffrischen.«
Na großartig! Das hatte mir gerade noch gefehlt. Am besten wäre es, sich umzudrehen und zu gehen. Er ist eine halbe Fee, erinnerte mich der rationale Teil meines Gehirns. Wenn du dich da einmischst, lenkst du damit hundertprozentig ihre Aufmerksamkeit auf dich.
Das Halbblut sank mit trostloser, aber resignierter Miene in sich zusammen, als wäre es eine solche Behandlung bereits gewöhnt.
Ich seufzte schwer. Dann tat ich etwas sehr Dummes.
»Mann, bin ich froh, dass es hier genau solche gorillaartigen Schwachköpfe gibt wie an meiner alten Schule«, sagte ich, ohne mich von der Stelle zu rühren. Verblüfft fuhren sie zu mir herum, und ich grinste breit. »Was ist los? Hat Daddy euch diesen Monat das Taschengeld gekürzt, sodass ihr es aus den Losern und Freaks rausprügeln müsst? Reicht es euch nicht, im Training andere zu verdreschen?«
»Wer zum Teufel bist du?« Brian, der kleinere von beiden, baute sich drohend vor mir auf. Immer noch grinsend hielt ich seinem Blick stand. »Ist das vielleicht dein Lover?«, fragte er mit erhobener Stimme weiter. »Hast wohl Todessehnsucht, Schwuchtel?«
Damit zogen wir natürlich die allgemeine Aufmerksamkeit auf uns. Schüler, die bisher weggesehen und so getan hatten, als würden sie die drei bei den Spinden nicht bemerken, scharten sich um uns, als könnten sie die Gewalt bereits riechen. Mit zunehmender Geschwindigkeit machte ein geflüstertes »Schlägerei« die Runde, bis ich das Gefühl hatte, die ganze Schule hätte sich versammelt, um das kleine Drama zu beobachten, das sich in diesem Flur entspann. Das Halbblut, auf dem die beiden rumgehackt hatten, warf mir einen entschuldigenden Blick zu und verzog sich. Unauffällig verschwand er in der Menge. Gern geschehen, dachte ich nur und widerstand dem Impuls, die Augen zu verdrehen. Tja, ich hatte mir den Mist selbst eingebrockt – also musste ich ihn auch selbst wieder auslöffeln.
»Das ist der Neue«, grunzte Brians Begleiter, stieß sich von den Spinden ab und trat hinter seinen Freund. »Der von der Southside.«
»Ach ja.« Brian blickte kurz über die Schulter, dann wieder zu mir. Verächtlich schürzte er die Lippen. »Du bist der Typ, der seinen Zellengenossen im Knast abgestochen hat«, verkündete er mit lauter Stimme, damit es auch alle mitbekamen. »Nachdem du deine Schule abgefackelt und einen Lehrer mit dem Messer bedroht hast.«
Erstaunt zog ich eine Augenbraue hoch. Ach, echt? Das ist mir neu.
Schockiertes Keuchen und leises Gemurmel ging wie ein Lauffeuer durch die Reihen der umstehenden Zuschauer. Morgen würde das die ganze Schule wissen. Ich fragte mich, wie viele erfundene Verbrechen ich dieser sowieso schon langen Liste dann noch hinzufügen konnte.
»Du hältst dich wohl für ’ne ganz harte Nummer, Schwuchtel.« Angestachelt von seinem Publikum drängte sich Brian noch dichter an mich heran. Ein fieses Grinsen breitete sich auf seinem Gesicht aus. »Dann bist du eben ein Brandstifter und ein Krimineller, was soll’s? Glaubst du vielleicht, ich hätte deswegen Angst vor dir?«
Okay, zumindest eins noch.
Ich richtete mich auf und trat meinem Gegner dabei fast auf die Zehen. »Brandstifter?« Mein Grinsen stand seinem in nichts nach. »Und ich dachte schon, du wärst so dämlich, wie du aussiehst. Hast du dieses lange Wort heute im Unterricht gelernt?«
Mit wutentbrannter Miene holte er aus. Da wir so dicht voreinander standen, kam ein ziemlich heftiger rechter Haken auf mich zu. Ich duckte mich und schlug nach seinem Arm, sodass seine Faust gegen die Wand krachte. Lautes Geschrei und anfeuernde Rufe brachen los, als Brian wütend herumwirbelte und noch einmal zuschlug. Diesmal drehte ich mich weg und hielt die Fäuste dicht am Gesicht wie ein Boxer, um mich verteidigen zu können.
»Das reicht!«
Wie aus dem Nichts tauchten mehrere Lehrer auf und zogen uns auseinander. Fluchend versuchte Brian, sich an einem von ihnen vorbeizudrängeln, um wieder an mich heranzukommen, doch ich ließ mich widerstandslos zur Seite ziehen. Ich wurde so fest am Kragen gepackt, als bestünde die Gefahr, dass ich mich losreißen und um mich schlagen würde.
»Ins Büro des Direktors, Kingston«, befahl der Lehrer, der Brian bereits den Flur entlangzerrte. »Bewegen Sie sich.« Mit einem finsteren Blick auf mich fuhr er fort: »Sie auch, Neuling. Und Sie sollten beten, dass bei Ihnen kein Messer gefunden wird, sonst werden Sie schneller suspendiert, als Sie gucken können.«
Auf dem Weg zum Büro des Direktors entdeckte ich das Halbblut, das mich aus dem Schutz der Menge heraus beobachtete. Seine ernsten, grimmigen und immer noch orange leuchtenden Augen verfolgten mich, bis man mich um die nächste Ecke geschleift hatte.
2 – Das Halbblut
Mit verschränkten Armen ließ ich mich auf den Besucherstuhl im Büro des Direktors fallen und wartete darauf, dass der Mann auf der anderen Seite des Schreibtischs uns zur Kenntnis nahm. Auf der Mahagoniplatte stand ein goldenes Schild mit der Aufschrift Richard S. Hill, Direktor. Der Inhaber dieses Namens hatte uns allerdings kaum angesehen, seit wir reingebracht worden waren. Sein Blick klebte an einem Computerbildschirm. Der kleine Mann mit dem schütteren Haar und der Hakennase hatte die schmalen Augenbrauen mürrisch zusammengezogen. Mit gespitzten Lippen starrte er auf den Monitor und ließ uns warten.
Nach ein oder zwei Minuten stieß Mr. Sportskanone auf dem Nebenstuhl ungeduldig den Atem aus.
»Äh, brauchen Sie mich noch?«, fragte er und machte Anstalten, sich zu erheben. »Ich kann doch gehen, oder?«
»Kingston.« Endlich sah der Direktor hoch. Nach einem fragenden Blick auf Brian runzelte er wieder die Stirn. »Sie haben am Wochenende ein großes Spiel, nicht wahr? Ja, Sie dürfen gehen. Aber achten Sie darauf, dass es keinen Ärger mehr gibt. Ich will nichts mehr von irgendwelchen Schlägereien in den Fluren hören, verstanden?«
»Sicher, Mr. Hill.« Brian stand auf, bedachte mich mit einem triumphierenden Grinsen und schlenderte hinaus.
Na, das ist ja mal fair. Die Sportskanone landet den ersten Schlag, aber wir dürfen die Siegeschancen unseres Teams ja nicht gefährden, nicht wahr? Ich wartete darauf, dass der Direktor sich nun mir zuwenden würde, aber der las schon wieder, was sein Computer ihm verriet. Also lehnte ich mich zurück, schlug die Beine übereinander und starrte sehnsüchtig zur Tür hinaus. Außer dem Ticken einer Uhr war in dem kleinen Zimmer nichts zu hören, allerdings blieben immer wieder Schüler vor der Tür stehen und starrten mich durch das kleine Fenster hindurch an, bevor sie ihrer Wege gingen.
»Sie haben eine beeindruckende Akte, Mr. Chase«, sagte Hill irgendwann, ohne aufzublicken.
Fast wäre ich zusammengezuckt.
»Schlägereien, Schulschwänzerei, versteckte Waffen, Brandstiftung.« Er schob seinen Stuhl zurück, und endlich richteten sich die kalten, dunklen Augen auf mich. »Möchten Sie dem noch etwas hinzufügen? Zum Beispiel einen Angriff auf den Starquarterback der Schule, gleich an Ihrem ersten Tag? Mr. Kingstons Vater gehört übrigens dem hiesigen Schulausschuss an, falls Sie das noch nicht wussten.«
»Ich habe nicht angefangen«, murmelte ich. »Er hat mich zuerst geschlagen.«
»Ach, tatsächlich? Sie haben also gar nichts getan?« Die farblosen Lippen des Direktors verzogen sich zu einem schmalen Lächeln. »Er hat aus heiterem Himmel zugeschlagen?«
Ich sah ihn offen an. »Er und sein Footballkumpel waren kurz davor, den Kopf eines Schülers in die Toilette zu tunken. Ich habe eingegriffen, bevor es dazu kommen konnte. Mr. Quarterback fand es nicht lustig, dass ich ihm diesen Spaß verdorben habe, also hat er versucht, mir eine zu verpassen.« Ich zuckte mit den Schultern. »Tut mir leid, aber mir gefällt mein Gesicht genau so, wie es jetzt ist.«
»Diese Einstellung bringt Sie nicht weiter, Mr. Chase«, erwiderte Hill stirnrunzelnd. »Sie hätten einen Lehrer holen sollen, der hätte sich der Sache angenommen. Sie bewegen sich sowieso schon auf dünnem Eis.« Er verschränkte die dürren, spinnenartigen Finger und lehnte sich vor. »Da heute Ihr erster Tag bei uns ist, lasse ich Sie noch einmal mit einer Verwarnung davonkommen. Doch ich werde Sie im Auge behalten, Mr. Chase. Und wenn Sie das nächste Mal aus der Reihe tanzen, werde ich weniger nachsichtig sein. Haben wir uns verstanden?«
Wieder zuckte ich mit den Schultern. »Meinetwegen.«
Ein gefährliches Funkeln trat in seine Augen. »Halten Sie sich für etwas Besonderes, Mr. Chase?« Jetzt klang seine Stimme verächtlich. »Denken Sie wirklich, Sie wären der einzige ›problematische Jugendliche‹, der je in diesem Büro gesessen hat? Ich kenne Typen wie Sie, und sie enden alle gleich: im Gefängnis, auf der Straße oder tot in irgendeiner Gosse. Wenn Sie diesen Weg einschlagen wollen, machen Sie ruhig so weiter. Steigen Sie aus, landen Sie in einem Job ohne Perspektive. Aber vergeuden Sie nicht die Zeit dieser Schule, an der man Ihnen etwas beibringen will. Und ziehen Sie nicht jene, die ein Ziel vor Augen haben, mit sich runter.« Ruckartig deutete er mit dem Kopf auf die Tür. »Verschwinden Sie aus meinem Büro. Ich will Sie hier drin nicht noch einmal sehen.«
Stinksauer erhob ich mich und schlüpfte durch die Tür.
Auf dem Flur war niemand mehr. Offenbar waren alle in ihren Klassen, ergaben sich dem komatösen Zustand nach dem Essen und zählten die Minuten bis zum Ende der letzten Stunde. Kurz überlegte ich, ob ich einfach nach Hause fahren, diese jämmerliche Schule und den damit verbundenen Neuanfang hinter mir lassen und die Tatsache akzeptieren sollte, dass ich niemals ganz normal irgendwo reinpassen würde. Ich würde niemals die Chance dazu bekommen.
Aber ich konnte nicht nach Hause, denn dort wäre Mom. Sie würde kein Wort sagen, aber sie würde mich mit diesem traurigen, schuldbeladenen und enttäuschten Ausdruck in den Augen ansehen. Mom wünschte sich so sehr, dass ich es schaffte, dass ich ganz normal wäre. Ihre ganze Hoffnung ruhte darauf, dass diesmal endlich alles klappte. Wenn ich eher nach Hause kam, ganz egal aus welchem Grund, würde Mom mir sagen, ich solle es morgen einfach noch mal versuchen, und dann würde sie sich wahrscheinlich in ihrem Zimmer einschließen und weinen.
Und das ertrug ich nicht. Das wäre schlimmer als der Vortrag, den Dad mir halten würde, wenn er herausfand, dass ich geschwänzt hatte. Außerdem hatte er in letzter Zeit eine Vorliebe für Hausarrest entwickelt, und ich wollte nicht schon wieder einen riskieren.
Es sind nur noch ein paar Stunden, sagte ich mir und machte mich widerstrebend auf den Weg zu meinem Mathekurs, der inzwischen – hurra, hurra – bestimmt schon halb vorbei war. Warum entschieden die Schulen eigentlich immer, Trigonometrie direkt nach dem Mittagessen anzusetzen, wenn alle nur noch vor sich hindämmerten? Die paar Stunden überstehst du auch noch. Was soll denn jetzt noch passieren?
Ich hätte es besser wissen müssen.
Als ich um die nächste Ecke bog, breitete sich in meinem Nacken dieses kalte Kribbeln aus, das sich immer einstellte, wenn ich beobachtet wurde. Normalerweise hätte ich es ignoriert, aber in diesem Moment war ich wütend und deswegen weniger konzentriert als sonst. Mit einer schnellen Bewegung fuhr ich herum und sah mich um.
Neben der Toilette am Ende des Flurs stand das Halbblut und beobachtete mich. Seine Augen glühten orange, und die Spitzen der pelzigen Ohren drehten sich ruckartig in meine Richtung.
Neben ihm schwebte etwas auf und ab, eine kleine humanoide Gestalt mit surrenden Libellenflügeln und dunkelgrüner Haut. Mit riesigen, schwarzen Augen blinzelte sie mich an und fletschte die rasiermesserscharfen Zähne, dann schoss sie mit voller Geschwindigkeit zu den Deckenfliesen hinauf.
Bevor ich nachdenken konnte, folgte ihr mein Blick. Die Blumenelfe blinzelte überrascht, und sofort erkannte ich meinen Fehler.
Wütend zwang ich mich, den Blick wieder zu senken, doch es war zu spät. Verdammt. Dämlicher, dämlicher Fehler, Ethan. Mit weit aufgerissenen Augen blickte das Halbblut zwischen der Blumenelfe und mir hin und her. Vor Verblüffung stand ihm der Mund offen. Der Junge wusste es. Er wusste, dass ich sie sehen konnte.
Und nun wussten sie es auch.
Es gelang mir, dem Halbblut aus dem Weg zu gehen, indem ich mich in meinen Kurs flüchtete. Nach der letzten Stunde schnappte ich mir meinen Rucksack, schob mich durch die Tür und hielt krampfhaft den Blick gesenkt, in der Hoffnung, nur schnell hier wegzukommen.
Dummerweise verfolgte er mich bis auf den Parkplatz.
»Hey!« Er schloss zu mir auf, als wir den Platz überquerten. Ohne ihn zu beachten, lief ich weiter, den Blick starr geradeaus gerichtet. Hartnäckig trottete er an meiner Seite. »Hör mal, ich wollte mich bedanken. Für das, was du da drin getan hast. Vielen Dank, dass du eingegriffen hast, dafür schulde ich dir was.« Er schwieg, als erwartete er, dass ich nun etwas sagen würde. Als das nicht geschah, fügte er hinzu: »Ich bin übrigens Todd.«
»Meinetwegen«, brummte ich, ohne ihn anzusehen. Er runzelte die Stirn – offenbar irritierte ihn meine Reaktion –, während ich weiter unfreundlich geradeaus starrte. Bloß weil ich dich vor der Sportskanone und ihrem Schlägerkumpel gerettet habe, sind wir noch lange keine Freunde. Ich habe deinen kleinen Begleiter gesehen. Du spielst mit dem Feuer, und damit will ich nichts zu tun haben. Geh weg. Todd zögerte kurz, dann trabte er schweigend weiter hinter mir her. Nein, er verschwand wohl nicht so bald.
»Ähm, also …« Wir hatten das Ende des Parkplatzes erreicht, und er senkte die Stimme. Ich hatte meinen Pick-up so weit wie irgend möglich von den Mustangs und Camaros meiner Mitschüler ferngehalten, um auch in diesem Punkt nicht aufzufallen. »Seit wann kannst du sie denn schon sehen?«
Mir drehte sich fast der Magen um. Wenigstens sagte er nicht die Feen oder das Feenvolk, denn ihren Namen laut auszusprechen sorgte unter Garantie dafür, dass man ihre Aufmerksamkeit auf sich zog. Ob er es absichtlich vermied oder einfach nur unwissend war, konnte ich nicht sagen. »Ich habe keine Ahnung, wovon du redest«, erwiderte ich kühl.
»Und ob!« Mit grimmiger Miene baute er sich vor mir auf, sodass ich stehen bleiben musste. »Du weißt, was ich bin«, beharrte er, jetzt ohne jede Subtilität. Mit flehendem Blick beugte er sich zu mir, in seinen Augen spiegelte sich Verzweiflung. »Ich habe dich gesehen, und Distel hat auch bemerkt, wie du geschaut hast. Du kannst sie sehen, und du weißt auch, wie ich in Wirklichkeit aussehe. Also spiel hier nicht den Dummen, ja? Ich weiß es. Wir beide wissen es.«
Okay, jetzt ging mir der Junge so richtig auf die Nerven. Und was noch schlimmer war: Je länger ich mit ihm redete, desto mehr lenkte das ihre Aufmerksamkeit auf mich. Seine kleinen »Freunde« beobachteten uns wahrscheinlich gerade, und das machte mir Angst. Was auch immer dieses Halbblut von mir wollte – das musste jetzt und hier ein Ende haben.
Mit einer hässlichen Grimasse grinste ich ihn an. »Wow, du bist ja echt ein Freak. Kein Wunder, dass Kingston es auf dich abgesehen hat. Hast du heute Morgen vielleicht vergessen, deine kleinen Glückspillen zu nehmen?«
Wut und Scham blitzten in Todds orangefarbenen Augen auf, und ich fühlte mich wie ein richtiger Arsch. Trotzdem fuhr ich genauso höhnisch fort: »Klar, ich würde gerne noch länger mit dir und deinen imaginären Freunden plaudern, aber ich habe noch einige reale Sachen zu erledigen. Warum ziehst du nicht los und schaust, ob du irgendwo ein Einhorn findest?«
Sein Gesicht verfinsterte sich zusehends. Ich schob mich an ihm vorbei und ging weiter, in der Hoffnung, dass er mir nun nicht mehr folgen würde. Und diesmal ließ er es tatsächlich bleiben. Doch ich kam keine drei Schritte weit, bevor seine nächste Offenbarung mich innehalten ließ.
»Distel weiß das von deiner Schwester.«
Jeder Muskel meines Körpers verkrampfte sich, und mein Magen zog sich schmerzhaft zusammen.
»Dachte ich mir doch, dass dich das interessieren könnte.« In Todds Stimme schwang leiser Triumph mit. »Sie hat sie im Nimmernie gesehen. Meghan Chase, die Eiserne Königin …«
Ruckartig wirbelte ich herum, packte ihn am Kragen und riss ihn so heftig nach vorne, dass er stolperte. »Wer weiß es sonst noch?«, zischte ich. Todd machte sich möglichst klein und legte die Ohren an. »Wer hat sonst noch von mir erfahren? Wer weiß, dass ich hier bin?«
»Keine Ahnung!« Todd hob abwehrend die Hände, und kurze Krallen blitzten auf. »Manchmal ist Distel nicht so leicht zu verstehen, okay? Sie hat nur gesagt, dass sie weiß, wer du bist – der Bruder der Eisernen Königin.«
»Wenn du das irgendjemandem erzählst …« Ich ballte die Faust und musste den Drang unterdrücken, ihn zu schütteln. »Wenn du es einem von denen erzählst, dann schwöre ich …«
»Werd ich nicht!«, kreischte Todd, und plötzlich wurde mir bewusst, was für ein Bild ich abgeben musste: die Zähne gefletscht, die Augen weit aufgerissen wie ein Irrer. Ich holte tief Luft und zwang mich zur Ruhe. Todd entspannte sich etwas und sagte mit einem verblüfften Kopfschütteln: »Wow, mach dich locker, Mann. Dann wissen sie eben, wer du bist, das ist doch nicht das Ende der Welt.«
Mit einem höhnischen Grinsen versetzte ich ihm einen Stoß. »Du musst ja verdammt behütet aufgewachsen sein.«
»Ich wurde adoptiert«, giftete Todd zurück, nachdem er sein Gleichgewicht wiedergefunden hatte. »Was glaubst du denn, wie leicht es ist, immer so zu tun, als wäre ich menschlich, wenn nicht einmal meine eigenen Eltern wissen, was ich bin? Keiner hier versteht mich, keiner ahnt, wozu ich fähig bin. Ständig trampeln sie auf mir herum, da wehre ich mich eben.«
»Dann hast du also wirklich die Schlange in Kingstons Auto getan.« Angewidert schüttelte ich den Kopf. »Ich hätte zulassen sollen, dass er deinen Kopf in die Toilette steckt.«
Todd rümpfte die Nase und zog sein Shirt zurecht. »Kingston ist ein Arsch«, meinte er nur, als würde das alles rechtfertigen. »Er glaubt, ihm gehöre die ganze Schule und dass er die Lehrer und den Direktor in der Tasche hätte. Hält sich für unantastbar.« Ein hinterhältiges Grinsen huschte über sein Gesicht, und die orangefarbenen Augen funkelten. »Manchmal erinnere ich ihn ganz gern daran, dass das nicht so ist.«
Ich seufzte schwer. Tja, geschieht dir ganz recht, Ethan. So etwas passiert eben, wenn man sich mit denen einlässt. Selbst die Halbfeen können es nicht lassen und müssen den Menschen bei jeder sich bietenden Gelegenheit irgendwelche Streiche spielen.
»Die Unsichtbaren sind die Einzigen, die mich verstehen«, fuhr Todd fort, als wollte er mich unbedingt überzeugen. »Sie wissen, was ich durchmache. Und sie sind nur zu gerne bereit, mir zu helfen.« Sein Grinsen wurde breiter, irgendwie bedrohlich. »Genauer gesagt, sind Distel und ihre Freunde gerade dabei, das Leben unserer Sportskanone ein wenig unangenehmer zu gestalten.«
Mir lief es kalt den Rücken runter. »Was hast du ihnen versprochen?«
Er blinzelte verwirrt. »Was?«
»Sie tun nie etwas ohne Gegenleistung.« Ich machte einen Schritt auf ihn zu, woraufhin er prompt zurückwich. »Was hast du ihnen versprochen? Was bekommen sie dafür?«
»Ist doch egal.« Das Halbblut zuckte abwehrend mit den Schultern. »Der Idiot hat es verdient. Außerdem: Wie viel Schaden können zwei Blumenelfen und ein Herdmännlein schon anrichten?«
Ich schloss genervt die Augen. O Mann, du hast ja keine Ahnung, wo du dich da reingeritten hast. »Hör zu.« Ich schlug die Lider wieder auf. »Welche Deals du auch eingegangen bist, was für Verträge du auch geschlossen hast – hör auf damit. Du kannst ihnen nicht trauen. Sie werden dich benutzen, einfach weil das in ihrer Natur liegt. So sind sie eben.« Todd zog skeptisch eine Augenbraue hoch. Frustriert fuhr ich mir durch die Haare; wie konnte man nur so unwissend sein? Und wie hatte er es geschafft, so lange am Leben zu bleiben, ohne das Geringste dazuzulernen? »Lasse dich niemals auf einen Vertrag mit ihnen ein. Das ist die erste und wichtigste Regel. So etwas läuft nie so ab, wie du dir das vorstellst, und sobald du zugestimmt hast, hängst du drin. Du kommst da nicht mehr raus, ganz egal, was sie verlangen.«
Todd schien noch immer nicht überzeugt zu sein. »Wer hat dich denn zum großen Feenexperten ernannt?«, spottete er, und ich zuckte kurz zusammen, als er das verhängnisvolle Wort aussprach. »Du bist ein Mensch, du hast doch keine Ahnung, wie das ist. Dann habe ich mich eben auf ein paar Deals eingelassen und ein paar Versprechungen gemacht. Was geht es dich an?«
»Gar nichts.« Ich trat zurück. »Aber zieh mich bloß nicht in das Chaos mit rein, das du hier gerade anrichtest. Ich will nichts mit ihnen zu tun haben, und mit dir auch nicht, kapiert? Ich wäre heilfroh, wenn ich sie niemals wiedersehen würde.« Ohne auf eine Antwort zu warten, drehte ich mich um, stieg in mein Auto und knallte die Fahrertür hinter mir zu. Dann trat ich so heftig aufs Gas, dass ich mit quietschenden Reifen vom Parkplatz raste, ohne weiter auf das einsame Halbblut zu achten, das im Rückspiegel immer kleiner wurde.
»Wie war’s in der Schule?«, fragte Mom, als ich durch die Fliegentür stürmte und meinen Rucksack auf den Tisch knallte.
»Schön«, murmelte ich auf direktem Weg zum Kühlschrank. Seufzend machte sie mir Platz, da sie genau wusste, dass es zwecklos war, mit mir ein Gespräch anzufangen, wenn ich so ausgehungert war. Ich entdeckte die übrig gebliebene Pizza vom Vorabend, schob zwei Stücke in die Mikrowelle und schlang ein drittes kalt hinunter. Dreißig Sekunden später wollte ich mit meinem Teller in mein Zimmer verschwinden, doch Mom stellte sich mir in den Weg.
»Das Büro des Schulleiters hat mich angerufen.«
Mutlos ließ ich die Schultern hängen. »Ach ja?«
Mit einer strengen Geste zeigte Mom auf den Küchentisch, also ließ ich mich auf einen Stuhl fallen. Der Appetit war mir vergangen. Sie setzte sich mir gegenüber und musterte mich beunruhigt. »Gibt es da etwas, das du mir sagen möchtest?«
Ich rieb mir die Augen. Es hatte keinen Sinn, es zu verheimlichen, wahrscheinlich wusste sie es ja sowieso schon – zumindest kannte sie die Version, die Hill ihr aufgetischt hatte. »Ich bin in eine Schlägerei geraten.«
»Ach, Ethan.« Die Enttäuschung in ihrer Stimme schmerzte wie tausend Nadelstiche. »Gleich am ersten Tag?«
Es war nicht meine Schuld. Zu gerne hätte ich das gesagt, aber diese Entschuldigung hatte ich schon so oft vorgebracht, dass sie an Bedeutung verloren hatte. Keinerlei Ausreden brachten hier was. Also zuckte ich nur mit den Achseln und ließ mich tiefer in den Stuhl sinken, um ihr nicht in die Augen sehen zu müssen.
»War es … war es einer von denen?«
Das war ein Schock. Mom sprach so gut wie nie von den Feen, wahrscheinlich aus demselben Grund wie ich, weil sie glaubte, dadurch ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Lieber verschloss sie die Augen davor und tat so, als würden sie nicht existieren, als würden sie nicht dort draußen lauern und uns beobachten. Das war einer der Gründe, warum ich nie offen mit ihr über meine Probleme sprach. Das jagte ihr einfach viel zu große Angst ein.
Ich dachte einen Augenblick darüber nach, ihr von dem Halbblut und seinen unsichtbaren Freunden zu erzählen, die sich in den Schulfluren herumtrieben. Aber wenn Mom davon erfuhr, nahm sie mich vielleicht wieder von der Schule. Und auch wenn ich nichts so sehr hasste, wie in diese Klasse zu gehen, wollte ich doch nicht noch einmal einen »Neuanfang« durchziehen müssen.
»Nein«, antwortete ich also und spielte an meinem Teller herum. »Es waren einfach zwei Arschlöcher, denen jemand Manieren beibringen musste.«
Mom stieß ein frustriertes, missbilligendes Stöhnen aus – das konnte sie gut. »Ethan«, fuhr sie dann mit scharfer Stimme fort, »das ist nicht deine Aufgabe. Wir hatten das doch alles schon.«
»Ich weiß.«
»Wenn du so weitermachst, werden sie dich wieder rausschmeißen. Und ich habe keine Ahnung, wo wir dich dann noch hinschicken könnten. Ich weiß nicht …« Zitternd holte sie Luft und drückte eine Hand auf die Augen.
Jetzt fühlte ich mich wie ein Riesenarsch. »Es tut mir leid«, sagte ich leise. »Ich werde … mir mehr Mühe geben.«
Ohne hochzusehen, nickte sie. »Diesmal werde ich deinem Vater noch nichts sagen«, erklärte sie mit schwacher Stimme. »Und iss nicht zu viel Pizza, sonst hast du beim Abendessen keinen Hunger mehr.«
Ich stand auf, schlang mir den Rucksack über die Schulter und griff nach meinem Teller. In meinem Zimmer angekommen, schob ich mit dem Fuß die Tür hinter mir zu.
Ich setzte mich an meinen Schreibtisch, aß meine Pizza und fuhr halbherzig den Laptop hoch. Die Geschichte mit Kingston und natürlich das Gespräch mit dem Halbblut hatten mich nervös gemacht. Ich sah mir auf YouTube Trainingsvideos verschiedener Kali-Schüler an, suchte nach Schwächen in ihren Angriffen und überlegte mir, wie ich ihre Verteidigung umgehen würde. Anschließend griff ich, einfach um etwas zu tun zu haben, nach meinen Rattanstöcken und stellte mich mitten im Zimmer auf, um ein paar Bewegungsabläufe durchzugehen. Dabei drosch ich auf imaginäre Ziele ein, die alle das Gesicht von Brian Kingston hatten, achtete aber darauf, weder Wände noch Decke zu streifen. Da ich schon einige Löcher in die Trockenbauwände geschlagen hatte, natürlich nicht absichtlich, durfte ich nach Dads Regel nur noch im Freien oder im Dojo trainieren. Aber inzwischen war ich viel besser geworden, und was er nicht wusste …
Gerade als ich mit meiner Übung fertig war, nahm ich am äußersten Rand meines Gesichtsfeldes eine Bewegung wahr und drehte mich um. Vor dem Fenster hockte eine schwarze, dürre Kreatur, die aussah wie eine große Spinne mit überdimensionierten Ohren, und starrte mich an. Ihre Augen leuchteten im Dämmerlicht neongrün.
Mit einem leisen Fluch sprang ich vor, doch sobald das Wesen begriff, dass es entdeckt worden war, stieß es ein alarmiertes Summen aus und war von einem Moment auf den nächsten verschwunden. Ich riss das Fenster auf und spähte in die Dunkelheit hinaus, um den gerissenen kleinen Plagegeist aufzuspüren, aber er war nirgendwo zu sehen.
»Verdammte Gremlins«, knurrte ich. Sorgfältig sah ich mich in meinem Zimmer um, um herauszufinden, ob alles an seinem Platz war. Ich überprüfte die Lampen, meine Uhr und den Computer; zu meiner großen Erleichterung funktionierte noch alles. Beim letzten Mal, als ein Gremlin in meinem Zimmer aufgetaucht war, hatte er einen Kurzschluss in meinem Laptop ausgelöst, sodass ich ihn von meinem Taschengeld hatte reparieren lassen müssen.
Gremlins waren eine ganz spezielle Feenart. Sie gehörten zu den Eisernen Feen, was hieß, dass keine meiner Feen-Abwehr- und Schutzmaßnahmen bei ihnen funktionierte. Eisen machte ihnen nichts aus, Salzbarrieren hielten sie nicht ab, und Hufeisen über Türen oder Fenstern waren wirkungslos. Sie waren so sehr an die Menschenwelt gewöhnt, mit Metall, Wissenschaft und Technik derart eng verbunden, dass die alten Zauber und Schutzrituale zu antiquiert waren, um ihnen etwas anhaben zu können. Mit Eisernen Feen hatte ich nur selten Probleme, aber sie waren einfach überall. Wahrscheinlich konnte nicht einmal die Eiserne Königin sie alle im Auge behalten.
Die Eiserne Königin. In meinem Magen bildete sich ein schmerzhafter Klumpen. Ich schloss das Fenster, legte die Sticks weg und setzte mich wieder vor den Computer. Mehrere Minuten lang starrte ich die oberste Schreibtischschublade an. Natürlich wusste ich ganz genau, was dort drin war. Aber sollte ich mich noch mehr quälen, indem ich es rausholte?
Meghan. Denkst du überhaupt noch an uns? Seit sie vor fast zwölf Jahren aus unserer Welt verschwunden war, hatte ich meine Halbschwester nur ein paar Mal gesehen. Sie war nie lange geblieben, nur wenige Stunden, um nachzusehen, ob es allen gut ging, dann war sie wieder weg. Vor unserem Umzug hatte ich mich wenigstens darauf verlassen können, dass sie zu meinem Geburtstag und an den Feiertagen auftauchte. Doch je älter ich wurde, desto seltener kam sie zu Besuch. Irgendwann war sie dann ganz weggeblieben.
Ich beugte mich vor und zog mit einer schnellen Bewegung die Schublade auf. Meine verschollene ältere Schwester war ein weiteres Tabuthema in diesem Haus. Sobald ich auch nur ihren Namen sagte, war Mom eine Woche lang deprimiert. Offiziell war meine Schwester tot. Meghan war nicht mehr Teil unserer Welt, sie war eine von ihnen, und wir mussten so tun, als existierte sie nicht.
Aber dieses Halbblut wusste von ihr. Und das konnte noch Schwierigkeiten geben. Als ob ich nicht schon genug davon hätte, als ob es nicht ausreichte, dass ich der übellaunige Verbrecher war, der Rowdy, mit dem man seine Tochter nicht ausgehen ließ. Nein, jetzt wusste auch noch jemand von meiner Verbindung zur Welt der Feen.
Zähneknirschend knallte ich die Schublade wieder zu und ging nach unten. In meinem Kopf herrschte ein einziges Chaos. Ich war ein Mensch, und Meghan war weg. Was auch immer irgendein Halbblut behauptete, ich gehörte nicht in deren Welt. Ich würde auf dieser Seite des Schleiers bleiben und mich einfach nicht darum kümmern, was im Feenland passierte.
Ganz egal, wie sehr es versuchte, mich zu verschlingen.
3 – Feen in der Sporttasche
Tag zwei.
In der Hölle.
Mein »Kampf« mit dem Quarterback und die anschließende Diskussion beim Direktor waren natürlich nicht unbemerkt geblieben. Auf den Fluren wurde ich angestarrt, es wurde getuschelt und mit gedämpften Stimmen spekuliert. Meine Mitschüler wichen vor mir zurück, als hätte ich die Pest. Und die Lehrer musterten mich so finster, als befürchteten sie, ich würde unvermittelt jemanden schlagen oder ein Messer ziehen.
Mir war das egal. Vielleicht hatte Direktor Hill ihnen gesagt, was in seinem Büro abgelaufen war; vielleicht hatte er mich aber auch als hoffnungslosen Fall dargestellt, denn solange ich mich ruhig verhielt, ignorierten sie mich weitgehend.
Abgesehen von Miss Singer, die mich während der Stunde mehrmals aufrief, um sicherzugehen, dass ich auch aufpasste. In gelangweiltem Tonfall beantwortete ich ihre Fragen zu Don Quichotte und hoffte, dass ihr das genügte, um mich nicht weiter zu nerven. Sie schien angenehm überrascht zu sein, dass ich meine Hausaufgaben gemacht hatte. Auch wenn ich etwas abgelenkt gewesen war, weil ich mir Sorgen darüber machte, dass Gremlins in der Nähe meines Computers herumlungerten.
Nachdem sie zu ihrer Zufriedenheit festgestellt hatte, dass ich gleichzeitig zuhören und aus dem Fenster starren konnte, ließ sie mich endlich in Ruhe, und ich konnte ungestört weitergrübeln.
Wenigstens waren Kingston und sein Kumpel heute nicht da, allerdings fiel mir in einem meiner Kurse auf, wie selbstzufrieden Todd wirkte. Immer wieder sah er zu dem leeren Tisch des Quarterbacks hinüber, nickte leicht und grinste. Das beunruhigte mich zwar, aber ich schwor mir, mich da rauszuhalten. Es war nicht meine Sache, wenn sich das Halbblut mit dem für seine Launenhaftigkeit berüchtigten Schönen Volk einlassen und sich die Finger verbrennen wollte.
Beim letzten Klingeln schnappte ich mir meinen Rucksack und stürmte nach draußen, um so hoffentlich eine Wiederholung der gestrigen Szene zu vermeiden. Auf dem Flur entdeckte ich Todd, der mich ansah, als wollte er mit mir reden, aber ich tauchte hastig in der Menge unter.
An meinem Spind stopfte ich Bücher und Hausaufgaben in meinen Rucksack, schlug die Tür zu und … stand plötzlich Kenzie St. James gegenüber.
»Hi, Machoman.«
O nein. Was wollte die denn? Mir wahrscheinlich eine reinwürgen wegen der Schlägerei. Wenn sie zu den Cheerleadern gehörte, war sie vielleicht mit Kingston zusammen. Je nachdem, welchem Gerücht man glauben wollte, hatte ich den Quarterback entweder übel vermöbelt oder ihm mitten auf dem Flur gedroht und anschließend den Arsch versohlt bekommen, bevor die Lehrer uns trennten. Keine dieser Geschichten war sonderlich schmeichelhaft, und ich hatte mich bereits gefragt, wann mich deswegen jemand anmachen würde. Allerdings hatte ich nicht damit gerechnet, dass ausgerechnet sie es sein würde.
Ich wandte mich ab, aber sie stellte sich mir geschickt in den Weg. »Nur einen Moment!«, forderte sie und baute sich vor mir auf. »Ich will mit dir reden.«
Ich schenkte ihr einen der kalten, feindseligen Blicke, die Dunkerwichtel zögern ließen und einmal sogar zwei Fenixmännlein vertrieben hatten. Kenzie rührte sich nicht vom Fleck, sie schien wild entschlossen zu sein. Also fügte ich mich in mein Schicksal. »Was?«, knurrte ich. »Willst du mir mitteilen, dass ich deinen Freund in Zukunft besser in Ruhe lassen sollte, wenn ich weiß, was gut für mich ist?«
Irritiert runzelte sie die Stirn. »Welchen Freund?«
»Den Quarterback.«
»Oh.« Mit einem abfälligen Schnauben rümpfte sie die Nase. Das sah irgendwie niedlich aus. »Brian ist nicht mein Freund.«
»Ach nein?« Das überraschte mich wirklich. Ich war mir absolut sicher gewesen, dass sie mir wegen der Schlägerei die Hölle heißmachen wollte, vielleicht mit ein paar Drohungen, dass ich es bereuen würde, wenn ich ihren kostbaren Footballstar anrührte. Warum sonst sollte dieses Mädchen mit mir reden wollen?
Kenzie machte sich meine Verblüffung zunutze und schob sich noch einen Schritt näher an mich heran. Ich schluckte nervös, unterdrückte aber den Impuls zurückzuweichen. Sie war ein ganzes Stück kleiner als ich, was ihr aber völlig egal zu sein schien. »Keine Sorge, Machoman, ich habe keinen Freund, der dir auf der Toilette auflauern könnte.« Ihre Augen funkelten belustigt. »Wenn es darum geht, verpasse ich dir wenn überhaupt höchstpersönlich eine.«
Sie würde es zumindest versuchen, kein Zweifel. »Was willst du?«, fragte ich wieder. Dieses seltsame, fröhliche Mädchen verwirrte mich mehr und mehr.
»Ich schreibe für die Schülerzeitung«, erklärte sie, als wäre das die natürlichste Sache der Welt. »Und ich hatte gehofft, du würdest mir einen Gefallen tun. Ich interviewe immer die Schüler, die erst mitten im Jahr hier anfangen, du weißt schon, damit die Leute sie besser kennenlernen können. Und wenn du dich dazu imstande fühlst, würde ich gerne so ein Interview mit dir machen.«
Das zweite Mal innerhalb von dreißig Sekunden war ich sprachlos. »Du bist Redakteurin?«
»Na ja, eigentlich eher Reporterin. Aber weil die anderen den technischen Kram hassen, kümmere ich mich auch ums Layout und so.«
»Bei der Schülerzeitung?«
»Ja, dort werden Reporter normalerweise eingesetzt.«
»Aber … ich dachte …« Krampfhaft versuchte ich, meine Gedanken zu ordnen. »Ich habe dich mit den Cheerleaderinnen gesehen«, sagte ich dann, was fast einer Anschuldigung gleichkam. Kenzie zog die schmalen Augenbrauen hoch.
»Und …? Da hast du gedacht, ich wäre auch eine Cheerleaderin?« Achselzuckend fuhr sie fort: »Ist nicht mein Ding, aber danke für das Kompliment. Ich komme mit Höhen nicht so gut klar und schaffe es kaum einmal durch die Turnhalle, ohne hinzufallen und mir irgendwo wehzutun. Außerdem müsste ich mir dazu die Haare blondieren, und davon kriegt man nur brüchige Spitzen.«
Mir war nicht ganz klar, ob sie das ernst meinte, aber so oder so konnte ich nicht länger bleiben. »Hör mal, ich habe gleich noch einen Termin«, erklärte ich ihr, was nicht einmal gelogen war. Am Abend hatte ich noch eine Kali-Stunde bei Guro Javier, und wenn ich da zu spät kam, wurde ich mit fünfzig Liegestützen und hundert mörderischen Sprints bestraft – wenn er seinen großzügigen Tag hatte. Guro war Pünktlichkeit äußerst wichtig. »Können wir ein anderes Mal weiterreden?«
»Gibst du mir denn ein Interview?«
»Ja, gut, okay!« Frustriert winkte ich ab. »Wenn du mich dann in Frieden lässt.«
Sie strahlte. »Und wann?«
»Mir egal.«
Was sie nicht weiter störte. Offenbar ließ sie sich von nichts aus der Ruhe bringen. Noch nie war mir jemand begegnet, der in Anbetracht von so viel Arschigkeit so unerschütterlich fröhlich blieb. »Na ja, hast du vielleicht eine Telefonnummer?« Irgendwie klang ihre Stimme so, als fände sie das alles lustig. »Ich kann dir auch meine geben, wenn dir das lieber ist. Aber das würde dann natürlich heißen, dass du mich anrufen müsstest …« Sie musterte mich zweifelnd und schüttelte den Kopf. »Hmmm, nein, vergiss es, gib mir lieber deine. Irgendetwas sagt mir, dass ich dir meine Nummer auf die Stirn tätowieren könnte und du trotzdem nicht daran denken würdest anzurufen.«
»Meinetwegen.«
Während ich die Zahlen auf einen Zettel schrieb, kam mir der Gedanke, wie verrückt das war – ich gab einem süßen Mädchen meine Nummer. Das hatte ich noch nie getan, und wahrscheinlich würde es auch nie wieder passieren. Wenn Kingston das wüsste … Wenn er auch nur sehen würde, wie ich mit ihr sprach, würde ich wahrscheinlich eine Gehirnerschütterung davontragen, auch wenn sie nicht seine Freundin war.