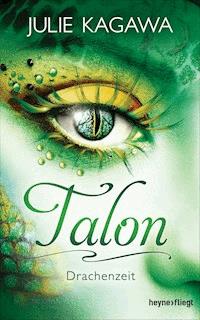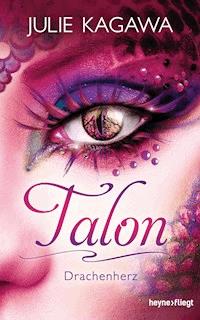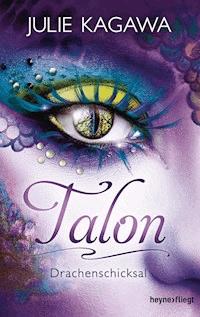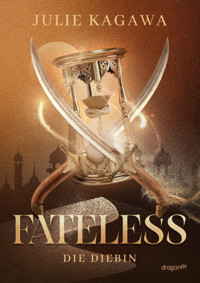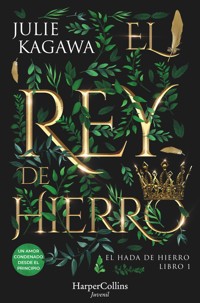5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Unsterblich
- Sprache: Deutsch
Dunkelheit ist über die Welt gekommen, die Städte liegen in Trümmern, und selbst die Vampire sind nicht mehr in Sicherheit. Niemand weiß das besser als die toughe Allison Sekemoto, denn ihr wurde von dem gefährlichen Vampirmeister Sarren das genommen, was ihr am Teuersten war. Begleitet von ihrem geheimnisvollen Schöpfer Kanin und ihrem Blutsbruder Jackal nimmt Allie die Verfolgung Sarrens auf, um sich an ihm zu rächen. Doch Sarren lockt Allie in eine Falle, und plötzlich steht viel mehr auf dem Spiel als nur die Erfüllung von Allies Racheplänen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 581
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
JULIE KAGAWA
Unsterblich
TOR DER
EWIGKEIT
Roman
Aus dem Amerikanischen von
Charlotte Lungstrass-Kapfer
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Das Buch
Seit ihrer Verwandlung zur Vampirin hat Allison Sekemoto darum gekämpft, sich ihre Menschlichkeit zu bewahren. Als ihr der grausame Vampirmeister Sarren jedoch ihre große Liebe Zeke nimmt, kennt Allies Wut keine Grenzen mehr: Sie wird alles daran setzten, Zeke zu rächen – auch wenn das bedeutet, dass sie ihre dunkle Seite, die sie so lange unterdrückt hat, akzeptieren muss. Gemeinsam mit ihrem Schöpfer Kanin und ihrem Blutsbruder Jackal macht Allie Jagd auf Sarren. Die Spur führt sie nach Eden, die letzte Vampir freie Zone, die es auf Erden noch gibt. Und plötzlich steht für Allie und ihre Freunde viel mehr auf dem Spiel, als nur die Erfüllung ihrer Rachepläne …
Julie KagawasUnsterblich-Reihe im Heyne-Verlag:
Tor der Dämmerung
Tor der Nacht
Tor der Ewigkeit
Die Autorin
Julie Kagawa wurde in Sacramento, Kalifornien, geboren, bevor sie im Alter von neun Jahren mit ihrer Familie nach Hawaii umzog. Schon in ihrer Kindheit war das Schreiben ihre große Leidenschaft. Langweilige Schulstunden vertrieb sie sich damit, all die Geschichten festzuhalten und zu illustrieren, die ihr im Kopf herumspukten. Nach Stationen als Buchhändlerin und Hundetrainerin wurde sie schließlich Autorin und feierte mit ihrer Plötzlich Fee-Reihe ihren internationalen Durchbruch. Von Julie Kagawa sind außerdem die Plötzlich Prinz- und die Unsterblich-Reihe sowie Talon – Drachenzeit im Heyne Verlag erschienen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Titel der amerikanischen Originalausgabe
TheForever Song – Blood of Eden 3
Deutsche Erstausgabe 02/2017
Redaktion: Sabine Thiele
Copyright © 2014 by Julie Kagawa
Copyright © 2017 der deutschsprachigen Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design, München,
unter Verwendung von shutterstock/Lovelybird
Satz: Christine Roithner Verlagsservice, Breitenaich
ISBN 978-3-641-17181-0V003
www.heyne.de
Für Nick –
deine Ideen sind unvorstellbar wertvoll für mich.
Und für meine Leser –
eure Tränen nähren meine Muse.
»Ich erwarte nicht, dass du das verstehst,
kleines Vögelchen. Ich erwarte nur, dass du singst.
Sing für mich, sing für Kanin,
schenke uns ein wundervolles Lied.«
Sarren
ERSTER TEIL
DÄMON
1
Das Tor des Außenpostens hing lose in den Angeln und schwang quietschend hin und her. Immer wieder prallte es gegen die Mauer, ein rhythmisches Klopfen, das die drückende Stille durchdrang. Der kalte Wind fegte durch die Öffnung und trug den Geruch von Blut heran, der wie eine dicke Decke alles andere erstickte.
»Er war hier«, sagte Kanin leise. Der Meistervampir hob sich wie eine dunkle Statue von dem weißen Schnee ab. Reglos stand er neben mir, vollkommen gelassen, aber in seinen Augen stand Besorgnis. Ich hingegen musterte den Zaun teilnahmslos, während der Wind an meinem Mantel und meinen langen schwarzen Haaren zerrte.
»Ist es überhaupt sinnvoll hineinzugehen?«
»Sarren weiß, dass wir ihn verfolgen«, antwortete er gedämpft. »Er will, dass wir das sehen. Wir sollen wissen, dass er es weiß. Wenn wir durch dieses Tor treten, wartet dahinter wahrscheinlich etwas ganz Spezielles auf uns.«
Mit knirschenden Schritten tauchte Jackal hinter uns auf, auch sein schwarzer Mantel bauschte sich hinter ihm. Seine gelben Augen funkelten grausam, als er das Tor eingehend studierte. »Na dann«, sagte er und präsentierte grinsend seine Reißzähne. »Wenn er sich schon die Mühe gemacht hat, etwas zu inszenieren, sollten wir den Psycho nicht warten lassen, oder?«
Strotzend vor Selbstbewusstsein marschierte er durch das Tor und betrat die winzige Siedlung dahinter. Nach kurzem Zögern folgten wir ihm.
Hinter der Mauer wurde der Blutgeruch schlagartig stärker, doch auf dem schmalen Pfad zwischen den Häusern rührte sich nichts. Die schäbigen Hütten aus Holz und Wellblech lagen still in der Dunkelheit, und selbst weiter hinten kamen wir nur an schneebedeckten Vorgärten und leeren Gartenstühlen vorbei. Alles schien intakt und unversehrt zu sein. Keine Leichen. Wir betraten nur wenige Häuser, aber auch hier gab es keine verstümmelten Körper in den Betten oder blutverschmierte Wände. Wir fanden nicht einmal tote Tiere auf der kleinen, zertrampelten Weide am Ende der Hauptstraße – nur Schnee und Leere.
Und trotzdem war hier alles von Blutgeruch durchdrungen, er hing schwer in der Luft und ließ den Hunger in mir brüllend erwachen. Ich kämpfte ihn nieder und biss die Zähne zusammen, um nicht frustriert zu knurren. Es war schon zu lange her, ich brauchte Nahrung. Der Geruch machte mich fast wahnsinnig, und die Tatsache, dass hier keine Menschen mehr waren, half auch nicht gerade. Wo steckten die alle? Ein ganzer Außenposten konnte ja nicht so mir nichts, dir nichts verschwinden.
Doch dann umrundeten wir die Weide und gingen zu der Scheune hinauf, die auf dem Hügel dahinter stand. Dort fanden wir die Dorfbewohner.
Neben dem Gebäude stand ein riesiger, toter Baum. Seine knorrigen Äste ragten wie krumme Finger in den Himmel hinauf und bogen sich unter dem Gewicht Dutzender Körper, die kopfüber an ihnen befestigt waren. Dicke Seile hielten die Gliedmaßen der Männer und Frauen an den Zweigen. Sogar einige Kinder schaukelten im Wind, ihre steifen, weißen Arme pendelten schlaff hin und her. Man hatte ihnen die Kehle aufgeschlitzt, sodass das vergeudete Blut den Schnee am Fuß des Baumes dunkel färbte. Trotzdem hätte mich der Geruch fast umgehauen, und ich ballte krampfhaft die Fäuste, als der Hunger mein Innerstes mit glühenden Klauen bearbeitete.
»Tja.« Mit verschränkten Armen musterte Jackal den Baum. »Irgendwie festlich, oder?« Seine Stimme klang angespannt, offenbar hatte auch er die Grenzen seiner Selbstbeherrschung erreicht. »Das dürfte wohl der Grund dafür sein, dass wir zwischen hier und New Covington keinen einzigen Blutsack gefunden haben.« Knurrend schüttelte er den Kopf und bleckte die Zähne. »Langsam geht mir dieser Kerl so richtig auf die Eier.«
Ich unterdrückte den Hunger und versuchte, mich zu konzentrieren. »Aber James, du wirst doch wohl kein Mitleid mit den wandelnden Blutkonserven haben, oder?«, spottete ich. Manchmal waren die Wortgefechte mit Jackal das Einzige, was mich ablenken konnte. Er verdrehte prompt die Augen.
»Nein, Schwesterlein, ich bin nur empört darüber, dass sie die Dreistigkeit besitzen, tot zu sein, sodass ich sie nicht mehr aussaugen kann«, erwiderte er zähnefletschend. Solche Wutausbrüche waren bei ihm eine Seltenheit. Hungrig starrte er die Toten an. »Verdammter Sarren«, sagte er. »Wenn ich diesen Psychopathen nicht unbedingt tot sehen wollte, würde ich sagen, wir geben die Sache auf. Wenn es so weitergeht, müssen wir sowieso bald von der Spur abweichen, damit wir einen Blutsack aufstöbern können, dessen Kehle noch ganz ist. Womit wir dem Dreckskerl wahrscheinlich genau in die Hände spielen.« Mit einem tiefen Seufzer drehte er sich zu mir um. »Das wäre alles viel einfacher, wenn du den Jeep nicht geschrottet hättest.«
»Zum letzten Mal«, knurrte ich, »ich habe dich lediglich auf die Straße hingewiesen, die nicht blockiert war. Ich habe nicht die Nägel ausgestreut, damit du drüberfährst.«
»Allison.«
Kanins leise Stimme machte unserem Streit ein Ende, und wir drehten uns zu ihm um. Unser Schöpfer stand mit grimmiger Miene an der Ecke der Scheune und winkte uns zu sich heran. Nachdem ich mir den Baum mit seinem gruseligen Behang noch einmal angesehen hatte, ging ich zu ihm. Wieder spürte ich den beißenden Hunger. Die Scheune roch sogar noch durchdringender nach Blut als die Äste des Baumes. Eine Seite war fast vollständig damit bedeckt: In dicken, vertikalen Linien klebte es am Holz, bereits eingetrocknet und schwarz.
»Gehen wir weiter«, bestimmte Kanin, als Jackal und ich neben ihn getreten waren. Seine Stimme war ruhig, aber ich wusste, dass er genauso hungrig war wie wir alle. Vielleicht war es bei ihm sogar schlimmer, da er sich noch immer von seinem Beinahe-Tod in New Covington erholte. »Hier gibt es keine Überlebenden«, fuhr er mit einem finsteren Blick auf den Baum fort, »und uns läuft die Zeit davon. Sarren erwartet uns bereits.«
»Wie kommst du darauf, alter Mann?«, wollte Jackal wissen. »Okay, das hier war sicher das Werk dieses Psychos, aber das könnte er doch auch einfach so zum Spaß getan haben. Bist du sicher, dass er mit uns rechnet?«
Stumm zeigte Kanin auf die blutverschmierte Wand vor uns. Genau wie Jackal sah ich sie mir noch einmal an, konnte aber nichts erkennen. Na ja, abgesehen von einer Wand voller Blut eben.
Jackal hingegen lachte leise. »Oh, du verdammter Mistkerl.« Grinsend schüttelte er den Kopf und ließ den Blick an der Scheunenwand hinaufwandern. »Wie niedlich. Mal sehen, ob du auch noch so witzig bist, wenn ich dich mit deinem eigenen Arm zu Tode prügele.«
»Was denn?« Offenbar entging mir hier etwas. Wieder starrte ich auf die Bretter und fragte mich, was die beiden anderen Vampire dort entdeckt hatten. »Was ist so lustig? Ich sehe gar nichts.«
Seufzend stellte sich Jackal hinter mich und zog mich am Kragen rückwärts. »Hey!« Ich wehrte mich heftig. »Lass los! Was soll der Scheiß?«
Ohne mich zu beachten, ging er weiter und schleifte mich mit. Nach ungefähr zwölf Schritten blieb er stehen, und ich konnte mich endlich losreißen. »Spinnst du?«, fragte ich ihn zähnefletschend. Jackal zeigte nur wortlos auf die Scheune.
Als ich mich zu der Wand umdrehte, blieb ich wie erstarrt stehen. Aus dieser Entfernung konnte ich sehen, was Kanin und Jackal gemeint hatten.
Sarren, du kranker Dreckskerl, dachte ich und spürte, wie sich der bereits vertraute Hass in mir ausbreitete. Das wird mich nicht aufhalten, und es wird dich nicht retten. Wenn ich dich finde, wirst du den Tag verfluchen, an dem du das erste Mal meinen Namen gehört hast.
In ungefähr drei Meter hohen Buchstaben hatte er mit Blut eine Frage an die Scheune geschrieben. Und diese Frage war der unwiderlegbare Beweis dafür, dass Sarren sehr wohl wusste, dass wir hinter ihm her waren. Und dass wir ihm wahrscheinlich direkt ins Netz gehen würden.
SCHON HUNGRIG?
Wir hatten New Covington vor zwei Wochen verlassen.
Zwei Wochen lang waren wir über die endlosen, schneebedeckten Straßen gewandert. Zwei Wochen durch kalte Wildnis oder tote, verlassene Siedlungen. Leere, von Efeu umrankte Häuser in einsamen Straßen, wo es nichts gab außer rostigen Autowracks am Bordstein. Keine Regung, nur hin und wieder kleinere oder größere Tiere, die sich die Gebiete zurückeroberten, wo früher die Menschen geherrscht hatten. Der Jeep hatte – wie Jackal es so wortgewandt dargestellt hatte – den Geist aufgegeben, weshalb wir zu Fuß weitermussten, immer hinter einem Irren her, der genau wusste, dass wir ihm folgten. Und der uns immer einen Schritt voraus war.
Was hatte Kanin gesagt? Uns lief die Zeit davon. In gewisser Weise stimmte das wahrscheinlich sogar. Denn Sarren hatte etwas bei sich, was für viele von uns das Ende bedeuten konnte. Vielleicht sogar für die ganze Welt. Sarren war im Besitz einer mutierten Form der Roten Schwindsucht, also des Virus, das vor sechzig Jahren die Welt zerstört hatte. Allerdings hatte diese Mutation noch einen hässlichen Nebeneffekt: Sie tötete auch Vampire. Wir drei – Jackal, Kanin und ich – waren diesem Virus in New Covington ausgesetzt worden und hatten das Grauen dieser Seuche hautnah miterlebt. Menschen hatten sich in hirnlose Irre verwandelt, die sich kreischend und lachend das Fleisch von den Gesichtern kratzten und alles attackierten, was ihnen über den Weg lief. Bei Vampiren waren die Auswirkungen sogar noch entsetzlicher: Das Virus zehrte ihr totes Fleisch auf, sodass sie von innen heraus verfaulten. Bei unserer letzten Konfrontation mit Sarren hatten wir erfahren, dass der geisteskranke Vampir New Covington nur als eine Art Testgelände benutzt hatte und dass seine wahren Absichten noch viel teuflischer waren.
Er wollte alles auslöschen: alle Menschen, alle Vampire. Reinen Tisch machen, so hatte er es genannt, und dafür sorgen, dass die Welt sich endlich selbst heilen konnte. Und wenn er dieses Virus noch einmal freisetzte, wäre es wirklich unaufhaltsam.
Allerdings gab es eine kleine Schwachstelle in seinem Plan.
Wir hatten ein Gegenmittel. Oder zumindest hatten wir eines gehabt. Jetzt befand es sich in Eden, dem letzten Ort der Hoffnung auf dieser Welt. Und genau darauf hatte Sarren es abgesehen: Er wollte das Gegenmittel, entweder um es zu vernichten oder um es gegen uns zu verwenden. Er glaubte, wir würden ihm nach Eden folgen, um ihn zu stoppen, um ihn davon abzuhalten, unseren letzten Ausweg zu zerstören oder das Virus freizusetzen. Er dachte, wir wollten die Welt retten.
Einen Scheißdreck wusste er. Mir war Eden vollkommen gleichgültig. Genauso wie das Virus, das Gegenmittel oder der Rest der Welt. Für mich machte es keinen Unterschied, ob die Menschen ein Mittel gegen das Verseuchtenvirus fanden oder ob sie Sarrens neue Seuche eindämmen konnten. Menschen bedeuteten mir nichts, nicht mehr. Sie waren das Futter, ich war der Vampir. Die Zeiten, in denen ich vorgegeben hatte, etwas anderes zu sein als ein Monster, waren vorbei.
Aber Sarren würde ich umbringen.
Er würde sterben für das, was er getan, für das, was er zerstört hatte. Ich würde ihn in Stücke reißen, würde ihn leiden lassen. In jener Nacht in New Covington, als wir dem Wahnsinnigen das letzte Mal gegenübergestanden hatten, waren wir zu viert gewesen. Als ich ihm den Arm abgetrennt hatte und er in die Finsternis geflohen war, nur um später zurückzukehren und das Schlimmste seiner Verbrechen zu verüben. Wir vier: ich, Jackal, Kanin und … noch einer. Aber an ihn durfte ich jetzt nicht denken. Er war fort. Und ich war noch immer ein Monster.
»Hey.«
Plötzlich ließ sich Jackal zu mir zurückfallen. Ein paar Schritte vor uns marschierte Kanin stetig die Straße entlang, die sich über die gefrorenen Felder zog. Der Außenposten mit seinen abgeschlachteten Bewohnern lag bereits einige Kilometer hinter uns, und endlich hatte der Wind auch den Blutgeruch fortgetragen. Den Hunger besänftigte das allerdings nicht; sogar in diesem Moment spürte ich ihn, ein dumpfes Ziehen, das bei der leisesten Provokation sofort zu brennendem, nacktem Verlangen anwachsen konnte. Er richtete sich sogar gegen Jackal, voller Wut darüber, dass er kein Mensch war, dass ich nicht einfach herumwirbeln und ihm die Fangzähne in den Hals schlagen konnte. Jackal schien davon glücklicherweise nichts zu merken.
Ich ignorierte ihn und starrte stur geradeaus. Momentan war ich weder in der Stimmung, mich mit ihm zu streiten, noch wollte ich mir seine verdrehten, nervigen Sprüche anhören. Was meinen Bruder im Blute natürlich nicht aufhalten konnte.
»Also, Schwesterlein«, begann er, »ich habe mir ein paar Gedanken gemacht. Wenn wir Sarren endlich eingeholt haben, wie sollen wir den alten Scheißkerl dann eigentlich töten? Ich fände ja Verstümmelung und Folter am besten, so lange wir es eben aushalten.« Er schnippte mit den Fingern. »Hey, vielleicht können wir ihn auch draußen anbinden, halb in der Sonne, halb im Schatten, das ist immer spannend. Das habe ich vor einigen Jahren mal mit einem Untoten gemacht, der mir tierisch auf die Nerven gegangen ist. Das Licht erreichte zuerst seine Füße und ist dann hochgekrochen bis zu seinem Gesicht. Es hat echt lange gedauert, bis er endlich den Löffel abgegeben hat. Am Schluss hat er mich angefleht, ihm den Kopf abzuhacken.« Er kicherte fröhlich. »Wie gerne würde ich Sarren so sterben sehen. Aber natürlich nur, wenn dein empfindsames Gemüt sich dadurch nicht gestört fühlt.«
Er grinste breit, und seine goldenen Augen schienen sich durch meine Schläfe brennen zu wollen. »Wollte dich nur ein wenig aufheitern, kleine Schwester, falls du wieder mal einen auf blutendes Herz machen willst. Aber wenn du irgendwelche Ideen hast, wie wir den alten Psycho um die Ecke bringen sollen, würde ich sie gerne hören.«
»Mir egal«, antwortete ich ausdruckslos. »Mach was du willst. Solange mir der letzte Schlag zusteht, ist mir der Rest total egal.«
Jackal war empört. »Na, das klingt aber nicht nach Spaß.«
Ohne ihm zu antworten, beschleunigte ich meine Schritte, um von ihm wegzukommen. Prompt legte er einen Zahn zu und schloss wieder zu mir auf.
»Komm schon, Schwesterlein, wo ist der nervtötende Moralapostel geblieben, der mir alle zehn Sekunden ins Gesicht gesprungen ist? So macht es ja gar keinen Spaß mehr, dich zu verarschen.«
»Warum redest du dann überhaupt noch mit mir?«, erwiderte ich, ohne ihn anzusehen. Jackal seufzte übertrieben schwer.
»Weil mir langweilig ist. Und der alte Mann ist ja auch nicht gerade eine Stimmungskanone.« Mit dem Kopf deutete er auf Kanin, der weiter Abstand zu uns hielt. Meiner Meinung nach hörte Kanin jedes Wort, trotzdem drehte er sich nicht um und wirkte auch sonst nicht so, als würde er lauschen. Jackal war das wahrscheinlich sowieso egal. »Außerdem interessiert mich deine Meinung über unseren brillanten, aber geisteskranken Serienmörder.« Mit einer ungeduldigen Handbewegung umfasste Jackal die weiten Felder ringsum. »Es ist ein langer Weg bis nach Eden, und mein Gefühl sagt mir, dass wir vor der Futterinsel wohl keine Blutsäcke mehr finden werden – zumindest keine lebenden. Die Vorstellung, dem Irren gegenüberzutreten, während Kanin und du halb wahnsinnig sind vor Hunger, gefällt mir ganz und gar nicht.«
Stirnrunzelnd musterte ich ihn. »Was ist denn mit dir?«
»Oh, meinetwegen musst du dir keine Sorgen machen, Schwesterlein.« Jackal grinste breit. »Ich bin nicht so leicht kleinzukriegen. Damit wollte ich eigentlich nur sagen, dass diese nervige Politik der verbrannten Erde, die Sarren hier anwendet, es dir sehr schwer machen wird. Noch ein paar Tage wie heute, dann wird der nächste Mensch, der uns über den Weg läuft, in Stücke gerissen werden – und zwar von dir.«
Ich zuckte mit den Schultern. Jackals Erkenntnis war nicht sonderlich überraschend, und mir war klar geworden, dass es mich wirklich nicht mehr kümmerte. Wo auch immer Sarren hinging, und sei es die hinterletzte Ecke des Landes, ich würde ihm folgen. Was er auch tat, egal wie weit er flüchtete und wie schnell er rannte, ich würde ihn einholen, und dann würde er für seine Taten bezahlen. »Na und?«, fragte ich und konzentrierte mich wieder auf die Straße. »Ich bin ein Vampir. Wen interessiert’s?«
»Oh, bitte.« Ich hörte Mitleid in seiner Stimme und Ekel. »Langsam ist es mal gut mit diesem ›Ist mir alles egal‹-Mist. Du weißt ganz genau, dass du dich irgendwann damit auseinandersetzen musst.«
Eine kalte Faust schloss sich um meine Eingeweide. Jackal sprach nicht mehr vom Hunger, das war klar. Erinnerungen stiegen in mir auf – Erinnerungen an ihn –, aber dann erschien das Monster und verschluckte sie, bevor ich etwas fühlen konnte. »Ich habe mich damit auseinandergesetzt«, erwiderte ich ruhig.
»Nein, hast du nicht.« Plötzlich klang die Stimme meines Bruders knallhart. »Du hast es nur begraben. Und wenn du das nicht bald in den Griff bekommst, wird es zum blödesten Zeitpunkt plötzlich wieder auftauchen. Wahrscheinlich genau dann, wenn wir Sarren gegenüberstehen. Denn so arbeitet der Verstand dieses Psychopathen: Er weiß genau, wann er was sagen muss, um uns aus der Bahn zu werfen und sich so einen Vorteil zu verschaffen. Und dann wird entweder er dich töten, wenn du am Boden bist – was mich wirklich nerven würde –, oder ich muss es selbst tun.«
»Vorsicht, Jackal.« Kalt und leer klang das, weil ich einfach nichts spürte, nicht einmal jetzt. »Man könnte sonst meinen, dass ich dir am Herzen liege.«
»Gott bewahre, Schwesterlein.« Mit einem abfälligen Grinsen trat Jackal einen Schritt zurück. »Dann halte ich eben meinen Mund. Aber wenn wir Sarren einholen und er etwas sagt, das dich fertigmacht, erwarte ja nicht, dass ich dir das Händchen halte.«
Da musst du dir keine Sorgen machen, dachte ich, während Jackal kopfschüttelnd davonging. Wieder flackerte eine verschwommene Erinnerung auf, und mein innerer Dämon verscheuchte sie. Es gibt nichts mehr, was mich fertigmachen könnte. Nichts, was Sarren sagt, berührt mich noch.
Wir marschierten noch einige Kilometer durch die leere, unter Eis und Schnee verborgene Landschaft, bis die Sterne verblassten und ein feiner rosa Schimmer im Osten erschien. Als bei mir gerade ein gewisses Unwohlsein einsetzte, verließ Kanin die Straße und hielt auf eine graue, halb eingestürzte Scheune zu, die am Rand eines zugewucherten Feldes stand. Daneben ragte ein verrostetes Silo auf. Drinnen war es muffig, und überall lagen zersplitterte Holzbalken und schimmelige Strohbündel herum. Aber es war dunkel und abgelegen, und das Dach hatte keine Löcher, durch die das Sonnenlicht eindringen konnte. Ohne auf Jackals Gejammer über verdreckte, rattenverseuchte Schlafplätze zu achten, schob ich die Tür einer halb verrotteten Pferdebox auf und entdeckte hinter einem modernden Heuhaufen eine abgeschiedene Ecke. Ich setzte mich hin, lehnte mich an die Wand und schloss die Augen.
Im ersten Moment kamen die Erinnerungen wieder hoch, wie die Bruchstücke eines anderen Lebens stiegen sie aus der Dunkelheit empor. Ich sah eine andere Scheune vor mir, ganz ähnlich wie diese hier, aber warm und feucht, erfüllt von leisen Tiergeräuschen und murmelnden Stimmen. Heu, Laternen und Zufriedenheit. Ein geflecktes Zicklein auf meinem Schoß, zwei Menschenkinder rechts und links, die mir dabei zusahen, wie ich das Tier fütterte.
Das Monster erhob sich. Damals war ich ebenfalls hungrig gewesen, und ich hatte zugesehen, wie die beiden Kinder eingeschlafen waren. Völlig ahnungslos hatten sie ihre Hälse dem Vampir dargeboten, an den sie sich unwissentlich gekuschelt hatten. In meiner Erinnerung beugte ich mich vor, näherte mich der Kehle des einen Kindes, meine Reißzähne glitten aus dem Kiefer und … voller Entsetzen hatte ich mich zusammengerissen. Ich war aus der Scheune geflohen, bevor ich endgültig die Kontrolle verlor und zwei unschuldige, schlafende Kinder abschlachtete.
In meinem Inneren grinste das Monster abfällig. Das schien verdammt lange her zu sein. Ein ganzes Leben. Jetzt brannte der Hunger wieder in mir und vernebelte mir das Hirn, sodass ich sehnsüchtig an diese schlafenden Kinder zurückdachte. So verwundbar hatten sie neben mir gelegen. Dann stellte ich mir vor, wie ich mich auch noch das letzte Stückchen runterbeugte und es zu Ende brachte.
Die nächste Nacht war wie die vergangene. Noch mehr leere Felder und Wildnis, hin und wieder ein Waldstück. Noch mehr unberührter, knirschender Schnee unter den Stiefeln und die endlose Straße, die uns nach Nordosten führte. Noch mehr nagender Hunger in meinem Inneren, der mich dünnhäutig und unberechenbar machte. Ich konzentrierte mich darauf, einen Fuß vor den anderen zu setzen, und versuchte den dumpfen Schmerz zu ignorieren, der einfach nicht verschwinden wollte. Dabei spürte ich das Monster, es verharrte gefährlich dicht unter der Oberfläche. Ein kaltes, finsteres Ding, immer auf der Suche, rastlos knurrend. Es hörte das Trippeln kleiner Pfoten in der Dunkelheit, die Waschbären, Opossums und anderen nachtaktiven Wesen, die ungesehen herumstöberten. Es spürte die vorbeifliegenden Fledermäuse und roch den tiefen, langsamen Atem der schlafenden Rehe, die sich im Unterholz aneinanderkuschelten. Es wollte angreifen, sich auf jedes dieser Lebewesen stürzen und sie zerfetzen, bis ihr heißes Blut in den Schnee spritzte und durch unsere Kehlen floss. Doch es wusste ebenso gut wie ich, dass es reine Energieverschwendung wäre, Tiere zu jagen. Das würde den Hunger nicht besänftigen. Nur eine ganz bestimmte Beute konnte die innere Leere füllen, und die war nirgendwo zu finden.
Also gingen wir weiter: Kanin vorweg, Jackal und ich hinterher. Drei Vampire, die keine Ruhepausen brauchten, denen Kälte, Müdigkeit oder Anstrengung nichts anhaben konnten, marschierten durch eine zerstörte Welt, die für die meisten Menschen den Tod bedeutete. Was sich ehrlich gesagt bei fast allen bereits bewahrheitet hatte.
Und Sarren war gerade dabei, auch noch den Rest zu erledigen.
Plötzlich blieb Kanin mitten auf der Straße stehen und drehte sich mit wachsamer Miene zu uns um. Überrascht und ein wenig alarmiert hielt ich inne. Seit unserem Aufbruch in New Covington hatten wir uns kaum unterhalten. Der Meistervampir war schweigend und unnahbar gewandert, ohne sich nach seinen beiden Nachkommen umzusehen. Mir war das nur recht. Ich hatte ihm auch nicht viel zu sagen. Zwischen uns ragte jetzt eine hohe Mauer auf. Natürlich spürte ich seine Enttäuschung, registrierte seine Blicke, wenn Jackal seine grausamen, menschenverachtenden Sprüche losließ … und ich nicht reagierte. Nicht einmal Kanins stillschweigende Missbilligung würde etwas daran ändern, dass ich ein Monster war.
»Da kommt jemand«, stellte Kanin fest und suchte die Straße hinter uns ab. Ich drehte mich ebenfalls um und schaltete alle Sinne auf höchste Stufe, aber das wäre gar nicht nötig gewesen. Motorengeräusche hallten durch die Dunkelheit, und sie kamen näher.
Sofort flammte der Hunger auf, und das Monster, das ja sowieso in Lauerstellung lag, regte sich voller Vorfreude. Fahrzeuge waren gleichzusetzen mit Menschen, also mit Nahrung. Ich stellte mir vor, wie ich mich in seinen Hals verbiss, das warme Blut in meinem Mund. Allein beim Gedanken daran wuchsen meine Reißzähne, und ich knurrte gierig.
»Haltet euch zurück«, befahl Kanin und ging an mir vorbei. Trotzig fletschte ich die Zähne, aber er hatte mir bereits den Rücken zugedreht und bemerkte es nicht. »Runter von der Straße, alle beide«, fuhr er fort. Das Motorengeräusch wurde lauter, und zwischen den Bäumen blitzten Scheinwerfer auf. »Kaum jemand geht das Risiko ein anzuhalten, wenn nachts auf einer einsamen Straße drei Fremde auftauchen. Es ist besser, wenn sie einen einzelnen, unbewaffneten Wanderer sehen und keine Gruppe.« Schärfer wiederholte er: »Runter von der Straße, Allison.«
Jackal hatte sich bereits zurückgezogen und verschmolz mit den Schatten am Straßenrand. Kanin sah mich nicht einmal an, sondern behielt die heranrasenden Lichter im Blick. Knurrend verließ ich den Betonstreifen und schob mich hinter einen großen, knorrigen Baum. Während ich wartete, tobte der Hunger in meinem Bauch, und der Dämon beobachtete mit kaum zu zügelnder Wut das Geschehen.
Die Lichter wurden heller, dann bog ein ehemals weißer Van um die Ecke, der jetzt nur noch von Rostflecken zusammengehalten wurde. Kanin trat vor und winkte mit weit ausgestreckten Armen. Das Fahrzeug raste auf ihn zu, sodass er voll im Licht der Scheinwerfer stand.
Es wurde nicht langsamer. Stattdessen steuerte es direkt auf Kanin zu und beschleunigte noch weiter, dann streckte ein brutal aussehender Mann den Kopf aus dem Beifahrerfenster. Grinsend hob er eine schwarze Pistole und zielte damit auf den Fremden auf der Straße.
Kanin sprang zurück, gleichzeitig knallten mehrere Schüsse, und es blitzte grell. Mit quietschenden Reifen und laut hupend schoss der Van vorbei. Als ich das raue Lachen hörte, ging das Monster in mir brüllend zum Angriff über. Kurz bevor der Wagen mit mir auf einer Höhe war, sprang ich auf die Straße und zog mein Schwert. Während der Van an mir vorbeiraste, hieb ich knurrend auf den Vorderreifen ein, durchtrennte dabei die Gummischicht und prallte so heftig mit der Klinge gegen das Metall der Felge, dass Funken aufstoben. Mit einem unkontrollierten Ruck brach das Fahrzeug aus, schlitterte über die Straße und landete frontal an einem Baum. Ich sprang hinterher, getrieben von dem brennenden Hunger und dem wild brüllenden Monster in mir. Fahrer und Beifahrer lagen reglos und blutend an der zersplitterten Frontscheibe, aber dann öffnete sich knirschend die Seitentür, und zwei weitere Männer kletterten aus dem Wrack. Beide hatten Pistolen in der Hand, und zwar nicht gerade kleine. Der Erste hob taumelnd seine Waffe, als ich auf ihn zustürmte. Mein Schwert blitzte auf, dann brüllte er wild, als die Pistole zusammen mit seinen beiden Armen auf der Straße landete. Sein Freund stieß einen unverständlichen Fluch aus und wollte fliehen. Er schaffte es immerhin bis zum Straßenrand, bevor ich ihn von hinten ansprang und ihm die Reißzähne ins Genick schlug.
Blut strömte in meinen Mund, warm und berauschend. Ich knurrte genüsslich und überließ mich ganz diesem Gefühl, spürte, wie der Mensch in meinen Armen schlaff wurde. Warum war ich nur je davor zurückgescheut? Es wollte mir einfach nicht mehr einfallen.
»Na großartig: Wir hatten vier Menschen, jetzt sind zwei tot, und einer blutet aus wie eine geplatzte Benzinleitung.« Die gereizte Stimme drang durch mein Hochgefühl. Ich hob den Kopf, bis mir das warme Blut übers Kinn lief, und entdeckte Kanin und Jackal neben dem zerstörten Van. Kanin beobachtete, wie der armlose Mann stöhnend und schluchzend über den Boden kroch; offenbar war er schon halb im Delirium. Jackal hingegen starrte mich an. Halb belustigt, halb angewidert fuhr er fort: »Oh, mach dir meinetwegen keine Umstände. Genieß du deinen Blutsack, ich bin sowieso nicht besonders hungrig.«
Ich schluckte, ließ meine Reißzähne zurück in den Kiefer gleiten und fühlte mich plötzlich schuldig. Kanin und Jackal hatten ebenfalls mit dem Hunger zu kämpfen, und ich behielt die einzige verfügbare Futterquelle ganz für mich. Vampire nährten sich nicht von Toten, nicht einmal von ganz frisch Verstorbenen. Trank man von einem Leichnam, hatte das denselben Effekt wie bei einem Tier: Man konnte den Hunger nicht stillen. Ganz abgesehen davon, dass die meisten Vampire es ekelhaft fanden. Unsere Beute musste menschlich und lebendig sein, so lautete eine der uralten, unergründlichen Regeln, nach denen wir lebten. Eine der Regeln, die man einfach nicht infrage stellte.
Ich schleppte meine Beute ein Stück weit zu Jackal hinüber, der am Straßenrand stand und mich belustigt, aber gleichzeitig gereizt musterte. »Hier.« Ich schob den Mann in seine Richtung. Wie eine Gummipuppe fiel er auf den Asphalt. »Er atmet noch, glaube ich. Ich bin mit ihm fertig.«
Jackal verzog den Mund. »Ich will deine Brosamen nicht, Schwester«, erklärte er abfällig. Ich grinste nur.
»Gut. Kann ich dann den Rest haben?«
Er warf mir einen mörderischen Blick zu, ging zu dem Mann und zog ihn hoch. Der Kopf fiel schlaff nach hinten und gab den blutverschmierten Hals frei. Jackal versenkte seine Zähne in dem noch unberührten Teil seiner Kehle.
Ich drehte mich wieder zu dem Van um, wo Kanin gerade den Armlosen sanft zu Boden gleiten ließ, wo er leblos in sich zusammensackte. Seine Armstümpfe bluteten nicht mehr, und seine Haut war kalkweiß. Wie viel Blut Kanin wohl noch aus ihm herausbekommen hatte, bevor er gestorben war? Wahrscheinlich nicht viel, aber selbst ein bisschen war besser als gar nichts. Ich hätte ihm nur einen Arm abschneiden sollen. Oder vielleicht einen Fuß. Dann hätte er auch nicht mehr weglaufen können.
Irgendwo tief in meinem Inneren wandte sich ein Teil von mir entsetzt von diesen Gedanken ab. Das war die alte Allison, die noch ein bisschen menschlich gewesen war und mich nun anbrüllte, dass das falsch war, dass ich nicht so sein müsse. Aber ihre Stimme war ganz leise, kaum zu verstehen. Ich begann zu zittern, aber schon kam das Monster und begrub sie unter kalter Gleichgültigkeit. Es ist zu spät, dachte ich, während sich wieder schützende Taubheit in mir breitmachte. Ich wusste, was ich war. Mitgefühl, Gnade, Reue – das alles hatte im Leben eines Vampirs keinen Platz. Die alte Allison war stur, es würde eine Weile dauern, bis sie endgültig starb, aber inzwischen hörte ich ihre Stimme immer seltener. Irgendwann würde sie ganz verschwinden.
Sobald mein vampirischer Gleichmut wieder fest im Sattel saß, konzentrierte ich mich auf meinen Schöpfer. Kanin hatte den Toten liegen lassen und spähte gerade in das Innere des Vans. Für einen Moment huschte Schmerz über sein Gesicht, bevor es wieder ausdruckslos wurde. Neugierig ging ich zu ihm und schaute in den Wagen.
Dort lag noch eine Leiche, eine junge Frau, vielleicht ein oder zwei Jahre älter als ich, in einem verdreckten weißen Hemdkleid. Ihre Hände waren vor dem Körper gefesselt, und sie lag zusammengekrümmt an der Wand des Fahrzeugs, den Kopf in einem unnatürlichen Winkel verdreht. Blonde Locken fielen ihr ins Gesicht, und ihre glasigen blauen Augen starrten ins Nichts.
Oh nein. Sie war eine Gefangene, eine Unschuldige. Das ist meine Schuld. Einen Augenblick lang wurde mir übel. Die toten Augen des Mädchens schienen mich zu durchbohren, stumm erhoben sie Anklage: Ich hatte sie getötet. Vielleicht hatte ich ihr nicht die Kehle herausgerissen oder ihr den Kopf abgeschlagen, aber tot war sie trotzdem, und es war meine Schuld.
Ich spürte Kanins Blick im Rücken und hörte, wie Jackals Stiefel knirschend die dünne Schneeschicht zermalmten, als er hinter uns auftauchte und mir über die Schulter schaute. »Hm.« Bei ihm klang das so, als hätte er gerade auf dem Bürgersteig einen toten Vogel entdeckt. »Tja, jetzt wissen wir wenigstens, warum die Arschlöcher es so eilig hatten. Nur dumm, dass sie es nicht geschafft hat – ich könnte schon noch einen Snack vertragen.« Vorwurfsvoll rümpfte er die Nase und fuhr fort: »Der Mensch, den du mir großzügigerweise überlassen hast, war kaum mehr als eine Vorspeise.«
»Ich wusste doch nicht, dass sie da drin war«, murmelte ich, ohne mich umzudrehen. Keine Ahnung, ob ich mich damit vor Kanin, vor Jackal oder nur vor mir selbst rechtfertigte. »Ich wusste es nicht …«
Aber das war keine Entschuldigung. Mir war das genauso bewusst wie Kanin. Stumm wandte er sich ab und ging davon, doch wie immer sagte sein Schweigen mehr als tausend Worte.
»Na ja.« Jackal zuckte mit den Schultern. »Kann man jetzt nichts mehr machen. Sieh es als Erinnerung daran, wie verdammt anfällig diese Blutsäcke sind. Die brechen sich doch schon das Genick, wenn man sie nur schief ansieht.« Nachdem er mich kurz gemustert hatte, fuhr er grinsend fort: »Mach dir nicht zu viele Vorwürfe, Schwesterlein. Was hatte sie denn schon zu erwarten? Nicht gerade das tollste Leben, bei den Aussichten. Du hast dem Blutsack einen Gefallen getan, glaub mir.«
Wieder wanderte mein Blick zu dem toten Mädchen, und ich spürte, wie das Monster sich an mich heranschlich, kalt und pragmatisch, um die Schuldgefühle zu ersticken. Was interessiert es dich?, flüsterte es mir ein. Dann hast du eben noch einen Menschen mehr getötet. Sie war nicht die Erste, und sie wird nicht die Letzte gewesen sein. Sie sind die Beute, du bist der Vampir. Wir töten, das gehört zu unserem Wesen.
»Ja.« Seufzend wandte ich mich ab, weg von dem Van, der Frau und ihrem starren, anklagenden Blick. Jackal hatte recht, jetzt konnte ich sowieso nichts mehr tun. Das Mädchen war bedeutungslos, eine Tote mehr auf der endlosen, ewigen Liste. Kanin war bereits weitergegangen, und wir mussten uns beeilen, um nicht den Anschluss zu verlieren. So ließen wir den Wagen, seine abgeschlachteten Insassen und einen weiteren, kleinen Teil meiner Menschlichkeit hinter uns zurück.
2
Drei Nächte später stießen wir auf einen Kadaver.
Genauer gesagt fanden wir ihn stückchenweise. In einem dunklen Fleck im Schnee lagen seine Überreste, kaum mehr als die abgenagten, blanken Knochen irgendeiner glücklosen Kreatur. So wie es aussah, war der Körper regelrecht in Stücke gerissen und dann mitten auf der Straße liegen gelassen worden. Wir befanden uns gerade mal wieder in einer verlassenen Kleinstadt. Die Straße führte zwischen verfallenen Häusern hindurch, die völlig zugewuchert und morsch waren. Die Dächer hingen bereits durch, die Fenster waren eingeschlagen. An einer Ecke gab es einen alten Spielplatz mit schneebedeckten Schaukeln und einer verrosteten Rutsche, die verbogen in einer Ecke lag. Leer, genau wie alles andere ringsum.
»Sarren?«, fragte ich in die Runde, während ich das zerbrochene Skelett mit einer Mischung aus Gereiztheit und Apathie musterte. Es war nicht menschlich, also keine Verschwendung und nichts zu bedauern. Trotzdem rebellierte der Hunger gegen das vergossene Blut und verlangte, befriedigt zu werden. Jetzt reichten sogar die Spuren eines Gemetzels aus, um ihn anzustacheln. Ich wünschte mir, er würde einfach Ruhe geben.
Kanin schüttelte den Kopf.
»Nein«, sagte er leise. »Sarren würde sich nicht mit einem Tier abgeben. Nicht, wenn er uns eine Botschaft hinterlassen will. Außerdem ist es zu frisch, das ist erst heute Nacht geschehen.«
»Verseuchte«, riet ich also, woraufhin er grimmig nickte. »Können wir sie umgehen?«
»Versuchen können wir es«, überlegte Kanin, was ihm ein abfälliges Schnauben von Jackal einbrachte. »Aber wir dürfen nicht von diesem Weg abweichen. Wir müssen Eden so bald wie möglich erreichen, damit wir Sarren – wenn wir schon nicht vor ihm da sind – davon abhalten können, das Virus einzusetzen.« Sein Blick wanderte zum Horizont. »Ich fürchte, es könnte bereits zu spät sein.«
Leise Sorge regte sich in mir. Ich kannte einige Menschen in Eden. Leute, für die ich alles riskiert hatte, nur um sie in ihre vampirfreie Zuflucht zu führen: Caleb, Bethany, Silas und Theresa. Was, wenn Sarren vor mir dort war und das grässliche Virus freisetzte? Was, wenn ich Eden endlich erreichte und dann alle, die ich gekannt hatte, tot waren? Oder noch schlimmer: infiziert, blutend und davon besessen, sich selbst zu zerfleischen? Ich dachte an den fröhlichen Caleb, die schüchterne kleine Bethany und die liebe, geduldige Theresa. Sie waren völlig ahnungslos. Sie dachten, in Eden wären sie sicher, und nun waren ein Irrer und eine entsetzliche Seuche auf dem direkten Weg zu ihnen. Ich begann zu zittern, und sofort stieg die Dunkelheit in mir auf, um mich abzuschirmen. Wenn Sarren Eden vor uns erreichte, waren diese Menschen tot. Ich konnte nichts für sie tun, und es war auch nicht mehr meine Aufgabe, sie zu beschützen. Sie waren unwichtig. Ich wollte einfach nur meinen Feind aufspüren und ihn zerfetzen, um dann jeden Teil seiner Überreste einzeln zu begraben.
Wieder spürte ich Kanins grimmigen, prüfenden Blick auf mir. Als wüsste er genau, was ich gerade dachte, weil er ja sowieso immer wusste, was mir durch den Kopf ging. Ohne mit der Wimper zu zucken, begegnete ich diesem Blick, das Monster starrte ohne jedes Schuldgefühl zurück. Es war noch gar nicht so lange her, da wäre ich eingeknickt, hätte mich aufgeregt und versucht, es besser zu machen. Jetzt hatte ich nicht einmal mehr genug Willenskraft, um mich darum zu kümmern, was Kanin von mir hielt.
Doch er sagte nichts. Wortlos wandte er sich ab und marschierte mit schweren Schritten Richtung Nordosten. Und wir folgten ihm.
Es fing wieder an zu schneien, große Flocken landeten auf meinem Kopf und meinen Schultern. Wir passierten Hausruinen, geplünderte Geschäfte und Tankstellen und jede Menge rostige Autowracks. Aus den Rissen im Asphalt und aus einigen Hausdächern wuchsen Bäume empor, deren nackte Zweige wie Skelette in den Himmel zeigten. Mit ihren Wurzeln sprengten sie Stein, Holz und Beton – nach und nach verschlang die Natur die ganze Stadt. Noch einmal sechzig Jahre, dann wäre sie wohl komplett verschwunden. In sechzig Jahren würde es vielleicht überhaupt keine Spuren der menschlichen Zivilisation mehr geben.
Wir schoben uns zwischen einigen ineinander verkeilten uralten Autos hindurch und erreichten so eine Kreuzung.
Kanin blieb mitten auf der Straße stehen und zog abrupt seinen Dolch. Mit einem kurzen Aufblitzen landete die schmale, tödliche Klinge in seiner Hand. Der Vampir rührte sich nicht. Als wir sahen, wie unser Schöpfer in Reglosigkeit verfiel, erstarrten Jackal und ich ebenfalls.
»Sie kommen«, sagte Kanin leise.
Ohne zu zögern, griffen wir nach unseren Waffen und bauten uns neben Kanin auf. Der ehemalige Banditenkönig holte ein Feuerwehrbeil unter seinem langen Mantel hervor und ließ es entspannt in der Hand kreisen. Am Kopf der Waffe klebte getrocknetes Blut. Ich zog mein Katana-Schwert aus der Scheide, hielt die gebogene, rasiermesserscharfe Klinge auf Augenhöhe bereit und lauschte angestrengt.
Schritte. Schlurfende Schritte im Schnee, und zwar eine ganze Menge. Von allen Seiten. Hinter den Autos registrierte ich Bewegung, entdeckte bleiche, ausgemergelte Gestalten, die zwischen den Wracks herumhuschten. Heisere Schreie und raues Zischen ertönten, Krallen glitten kreischend über Metall, und der Wind trug den ekelhaften Gestank von Tod heran.
»Wurde aber auch Zeit«, knurrte Jackal und präsentierte mit einem trotzigen Grinsen seine Reißzähne, während er die Waffe über den Kopf hob. Seine Stimme hallte unheimlich durch die Nacht, woraufhin das Geschrei ringsum sofort lauter wurde. »Kommt schon, ihr kleinen Pisser. Ich bin ganz scharf drauf, jemandem den Kopf abzureißen.«
Als wollte sie ihm antworten, sprang eine der Kreaturen auf das Autodach direkt neben ihm. Sie sah annähernd menschlich aus, auch wenn ihre Haare total verklebt waren und die bleiche Haut an dem spindeldürren Körper spannte. Und sie stank nach Tod. Irre weiße Augen ohne erkennbare Iris oder Pupille starrten fiebrig zu uns herunter, bevor der Verseuchte die schartigen Zähne fletschte und sich heulend auf uns stürzte.
Jackal wirbelte herum, sodass die Kreatur direkt auf der Klinge des Beils landete, bevor sie mit dem Kopf voran gegen eine Autotür geschleudert wurde. Ein dumpfer Knall ertönte, Glas splitterte und dunkles Blut spritzte gegen die Seitentür, dann fiel der Verseuchte mit eingedrücktem Schädel in den Schnee. Jackal hob den Kopf und stieß ein herausforderndes Brüllen aus, während der bleiche, kreischende Schwarm über Autodächer und Motorhauben krabbelte, um an uns heranzukommen. Mein inneres Monster reagierte mit einer eifrigen Erwiderung, und ich ließ ihm seinen Willen.
Mit gespreizten Klauen flog ein Verseuchter auf mich zu. Noch bevor er mich berührte, zog ich das Schwert hoch, traf genau in der dürren Körpermitte und zerteilte ihn in einem Regen aus Blut in zwei Hälften. Ein zweiter hechtete über die Motorhaube eines Vans, doch ich fuhr herum und trennte ihm aus der Bewegung heraus den Kopf ab. Als der Schädel vor meinen Füßen landete, erfüllte mich wilder Triumph, und ich sprang fauchend auf das Dach des Vans, um den heulenden Schwarm zu erwarten. Immer mehr Verseuchte krochen über die Wagen hinweg, grapschten nach meinen Füßen und versuchten, auf den Van zu klettern, um mich in die Menge hinunterzuziehen. Ich tanzte regelrecht über das Blech, sprang von Dach zu Dach und schlitzte jene auf, die mir folgten. Hände, die nach mir griffen, wurden einfach abgehackt.
Unten kämpften Jackal und Kanin Seite an Seite, trotz ihrer Unterschiede ein tödliches Gespann. Jackals Beil wirbelte durch die Luft und traf mit knochenbrechender Wucht sein Ziel. Er zerschmetterte Schädel, rammte seine Feinde gegen Wracks oder in den Asphalt. Kanins schmaler, funkelnder Dolch hingegen bewegte sich so schnell, dass er nicht zu erkennen war, während sich der Vampir elegant zwischen den um sich schlagenden Verseuchten hindurchschob und mit chirurgischer Präzision Kehlen aufschlitzte und Köpfe abtrennte. Die beiden brauchten keine Hilfe, sie kamen gut allein zurecht.
In dem kurzen Moment, in dem ich mich auf Kanin und Jackal konzentrierte, landete ein Verseuchter neben mir auf dem Autodach und holte zum Schlag aus. Ich wich zurück und wollte ihn aufschlitzen, doch da breitete sich ein brennender Schmerz in meinem Gesicht aus, als seine Krallen meine Wange zerfetzten.
Ich sah rot. Brüllend sprang ich mitten in den Schwarm hinein und machte mein Schwert zum absoluten Vernichtungswerkzeug. Gliedmaßen und Köpfe flogen, als ich mir einen Weg durch die Horde bahnte. Mein innerer Dämon genoss das Chaos und die Zerstörung, bei jedem gefallenen Angreifer heulte er freudig auf, während ich den Schnee und die Autos ringsum mit dunklem Blut einfärbte.
Plötzlich fiel ein Schatten über mich, und ein Brüllen ertönte, das sogar die Erde beben ließ. Ich wirbelte herum und sah einen gigantischen Verseuchten vor mir. Das fast zwei Meter große Ungetüm füllte kurz mein gesamtes Blickfeld aus, dann erwischte mich seine dicke, mit Krallen bewehrte Hand an der Schläfe, und mein Kopf schien zu explodieren. Ich wurde gegen ein Auto geschleudert und landete krachend an einer Scheibe, während der Riese wieder brüllend zum Angriff überging.
Im letzten Moment warf ich mich zur Seite, sodass der Verseuchte nur das Auto traf und seine Krallen mit einem schrillen Kreischen tiefe Gräben in das Blech zogen. Trotz seiner enormen Größe war auch er kaum mehr als Haut und Knochen. Unter den deutlich sichtbaren Rippen bildete sein fahler Bauch ein tiefes Tal, das sich fast schon gegen die Wirbelsäule zu drücken schien. Gleichzeitig hatte er breite Schultern, und die dicken, deformierten Arme hingen bis zu seinen Knien. An jedem Finger wuchs eine sichelartige Klaue. Der Riese schrie mich an und sprang, doch ich rollte mich ab und zielte beim Hochkommen mit dem Schwert auf seine Körpermitte. Die Klinge durchtrennte ein paar Rippen, woraufhin die Kreatur laut heulend zu mir herumfuhr.
Blut tropfte mir in die Augen und behinderte meine Sicht. Ich blinzelte und schüttelte kurz den Kopf, versuchte mich zu konzentrieren. Der Verseuchte brüllte noch immer und schlug mit beiden Armen zu. Mit aller Kraft rammte ich ihm meine Waffe in den Unterarm. Die Klinge drang zwar tief ein, doch gleichzeitig wurde ich durch die Wucht des Angriffs von den Füßen gerissen und landete rückwärts im Schnee. Das Vieh war verdammt stark, ich würde wohl eine lebensnotwendige Stelle treffen müssen, um es endgültig loszuwerden.
Ohne das Schwert loszulassen, stemmte ich mich auf alle viere hoch. Doch bevor ich aufstehen konnte, packte mich jemand am Genick, hob mich hoch und rammte mich mit tödlicher Kraft gegen den Asphalt. Ich spürte, wie meine Nase und mein Kiefer brachen, dann breitete sich explosionsartig der Schmerz hinter meinen Augen aus. Das Ding knallte mich noch dreimal auf den Boden, wobei mit jedem Treffer weitere Knochen zermalmt wurden, dann drehte es sich um und warf mich gegen das nächste Auto. Wieder splitterte Glas und bohrte sich in meine Haut, sodass sich frischer Schmerz zu den bestehenden Qualen in meinem Schädel gesellte. Der Verseuchte knurrte triumphierend und schlurfte wieder los, während meine Benommenheit plötzlich von nicht zu bändigender Wut verdrängt wurde.
Ohne weiter auf meine Schmerzen zu achten, schnappte ich mir das Katana-Schwert, das neben mir auf der Motorhaube gelandet war, und brüllte dem Riesen, der sich gerade über mich beugte, meine Herausforderung entgegen. Als seine dicke Faust auf mich zukam, wich ich geschickt aus, sodass sein Arm wieder nur im Blech landete, wo er eine tiefe Delle hinterließ. Fauchend sprang ich meinen Feind an, zog mich an seinem Ellbogen hoch und schlug mit aller Kraft zu. Das Schwert durchtrennte sein Schlüsselbein, glitt durch den bleichen Körper und schlitzte ihn vom Hals bis zum Bauch auf.
Der Riese geriet aus dem Gleichgewicht, die beiden Hälften drifteten auseinander, dann fiel er auf den Asphalt, zuckte noch einmal und lag still. Mit gefletschten Zähnen hob ich mein Schwert und suchte nach dem nächsten Angreifer, aber die Nacht ringsum war still geworden. Die Horde war verschwunden, sie lag in Einzelteilen überall verstreut, nur der faulige Gestank ihres Blutes hing noch in der Luft. Ich war allein.
Und ich war verletzt. Alles schmerzte, innen und außen. Ich brauchte Nahrung, Blut. Ich musste jagen, aber hier gab es keine Beute. Die Schmerzen in meinem Inneren ließen bereits nach. Mir war klar, dass mein Körper sich selbst heilte, aber jetzt war auch der Hunger wieder da. Verdammt großer Hunger …
»Tja, Schwesterlein, ich schäme mich nicht, es zu sagen: Das war fast schon beeindruckend.«
Die höhnische, provokante Stimme ertönte direkt hinter mir. Getrieben vom Hunger wirbelte ich herum und fletschte fauchend die Zähne. Ein paar Schritte entfernt stand ein Vampir, der nach Blut und Macht roch und gerade entsetzt die gelben Augen aufriss. Älter als ich, wahrscheinlich stärker als ich, aber das hatte mich noch nie aufgehalten. Gereizt verzog ich die Lippen und trat mit erhobenem Schwert vor ihn.
»Schwester.« Die Stimme des Vampirs klang warnend, außerdem hob er beide Hände. In einer hielt er ein blutverschmiertes Feuerwehrbeil. »Mach keinen Blödsinn und reiß dich zusammen. Ich würde dein Hirn nur ungern hier auf dem Asphalt verteilen.«
Diese Stimme klang irgendwie komisch, fast schon vertraut. Kannte ich ihn etwa? Das verwirrte mich, und ich zögerte. Aber dann flammte der beißende Schmerz in mir wieder auf und verschlang mich. Mit einem Zischen schleuderte ich dem Vampir meine Herausforderung entgegen. Überraschenderweise ging er nicht darauf ein.
»Allison.«
Zwischen den Autowracks trat ein zweiter Mann hervor und ging zielstrebig auf mich zu. Von dieser dunklen Gestalt ging eine solche Macht aus, dass ich instinktiv zurückwich. Der erste Vampir war jetzt unwichtig – dieser hier war viel älter und viel, viel stärker als wir beide.
»Einer der Mistkerle hat sie so richtig erwischt«, hörte ich den ersten Vampir sagen, was wirklich überhaupt keinen Sinn ergab. »Sie ist kurz vor der Raserei. Erkennt keinen von uns.«
Der Ältere sah mich mit seinen dunklen Augen so durchdringend an, dass mich die nackte Angst packte. Gegen ihn konnte ich nicht kämpfen, er würde mich in Stücke reißen. Fauchend wich ich zurück und machte mich zur Flucht bereit, nur weg von dieser Furcht einflößenden Macht.
»Allison, halt.« Die weiche, beschwörende Stimme des Meisters drang bis in mein Innerstes und hielt mich an Ort und Stelle fest. »Sieh mich an«, fuhr er fort, und ich musste einfach gehorchen. »Kläre deinen Geist«, sagte er leise. Seine Worte beschwichtigten das finstere Chaos in meinem Inneren. »Du kennst mich. Du weißt, wer du bist.« Seine Stimme floss wie Wasser durch meinen Körper, wurde immer vertrauter, und die blinde Wut ließ langsam nach. »Erinnere dich«, befahl der Meistervampir und starrte mich weiter zwingend an. »Erinnere dich daran, was wir erreichen wollen.« Plötzlich wurde seine Stimme unnachgiebig und streng. »Du darfst dich nicht in der Raserei verlieren. Das werde ich nicht zulassen. Wer bin ich?«
Endlich kehrte die Erinnerung zurück. Ich schloss die Augen, sank gegen die Motorhaube und ließ den Kopf hängen. »Kanin«, flüsterte ich, als alles wieder da war. Ich spürte die drückenden Reißzähne an meiner Lippe, das Blut aus der Kratzwunde auf meiner Wange, die Verletzungen im Inneren meines Körpers. Fordernd brandete der schmerzende Hunger in mir auf, aber ich drängte ihn noch einmal ins Dunkel zurück.
Knirschende Schritte, dann stand er vor mir und blickte auf mich herunter. Heiße Scham brannte in mir. Ich hatte die Kontrolle verloren. Ich hatte versprochen, dass mir genau das nie wieder passieren würde, und jetzt war es fast geschehen. Nur ein kleiner Schritt noch, und ich wäre in einen Blutrausch verfallen, hätte die Kontrolle über meinen Hunger verloren und alles angegriffen, was sich bewegt.
Nein, Allison, mach dir nichts vor. Die Wahrheit ließ sich nicht länger verleugnen, und mir wurde kalt. Du hast nicht die Kontrolle über den Dämon verloren – diesmal hast du ihn eingeladen. Du hast freiwillig nachgegeben. Und Kanin weiß das.
»Wie schwer sind deine Verletzungen?« Mein Schöpfer klang ernst und missbilligend. Ich ballte die Fäuste und presste sie gegen das Blech, unterdrückte das Schamgefühl und die letzten Reste des Hungers, dann stand ich auf und sah ihn an.
»Ich werde es überleben«, antwortete ich bewusst neutral. Mit einer ruckartigen Bewegung schüttelte ich das Blut von meinem Schwert und schob es zurück in die Scheide. Nein, ich würde mich nicht schuldig fühlen, ich würde nicht zulassen, dass Kanin mir wegen dem, was ich fast getan hätte, ein schlechtes Gewissen einimpfte. Ich war schwer verletzt gewesen, und der Blutrausch gehörte nun einmal zum Leben eines Vampirs dazu. Früher oder später verloren wir alle mal die Kontrolle.
»Ich war unvorsichtig«, ergänzte ich leise und wandte mich von meinem Schöpfer ab. Jackal wartete am Straßenrand – ihm konnte ich mich leichter stellen als Kanin. Mein Bruder im Blute hatte die Arme vor der Brust verschränkt und grinste mich höhnisch an, aber das war immer noch erträglicher als der enttäuschte Blick eines Meistervampirs. »Wird nicht wieder vorkommen.«
»Doch, wird es«, widersprach Kanin und ging an mir vorbei, schlug dann allerdings eine andere Richtung ein als vorher. Verwirrt schaute ich ihm hinterher.
»Wo willst du hin?«
»Wir lassen die Spur ruhen«, erklärte Kanin sachlich. »Sarren wird warten müssen. Wir müssen auf die Jagd gehen, bevor einer von uns tatsächlich dem Blutrausch verfällt.« Womit wohl ich gemeint war.
»Nein«, knurrte ich und marschierte hinter meinem Schöpfer her, der sich überrascht umdrehte. »Es geht mir gut, Kanin. Wir müssen das nicht machen.«
»Allison.« Kanin kniff die Augen zusammen. »Von uns dreien bist du momentan am gefährdetsten. Du versuchst nicht einmal, die Kontrolle zu behalten, und das Monster lauert bei dir dicht unter der Oberfläche. Wenn du der Raserei so nah bist, bringt das uns alle in Gefahr. Im Moment bin ich mir nicht sicher, ob du in Gegenwart von Menschen Zurückhaltung üben könntest. Und noch viel weniger weiß ich, ob du es überhaupt versuchen würdest.«
Nicht die leise Missbilligung in seiner Stimme traf mich, sondern die Trauer, die Reue. Als hätte er versagt. Als wäre er früher einmal stolz auf mich gewesen, würde aber nun daran zweifeln, ob es richtig gewesen war, mich in diese Welt einzuführen, mich zum Vampir zu machen.
Und plötzlich wurde ich wütend. Wütend, weil er es schaffte, dass ich mich für etwas schämte, was ein grundlegender Teil meines Wesens war. Denn ganz egal, wie sehr ich mir einredete, dass es nicht so war, wie sehr ich es auch leugnen mochte, ich wollte eben doch, dass er stolz auf mich war – und das machte mich so wütend. Und weil er immer mehr von mir erwartete, mich an irgendeinem lächerlichen Standard maß, den ich sowieso nie erreichen konnte.
Mit hoch erhobenem Kopf sah ich ihn an. »Vielleicht würde ich das tatsächlich nicht«, sagte ich achtlos. »Was geht es dich an?«
In seinem reglosen Gesicht blitzte Kummer auf, bevor es wieder in Gleichgültigkeit verfiel. »Das habe ich dich nicht gelehrt, Allison«, sagte er so leise, dass nur ich ihn hören konnte. »Wo ist deine Stärke geblieben?«
Ich zuckte nur mit den Schultern. »Vielleicht habe ich erkannt, dass es sinnlos ist, und dass ich nicht für den Rest der Ewigkeit gegen meine Natur ankämpfen will. Vielleicht habe ich erkannt, dass Jackal eben doch recht hat.«
»Nein.« Plötzlich schwang in Kanins Stimme eine beängstigende Härte mit. »Du benutzt deinen inneren Dämon lediglich dazu, dich vor dem zu verstecken, was du in Wahrheit empfindest. Denn du fürchtest dich vor dem, was es bedeutet, davor, dass es schmerzhaft sein könnte. Es ist schließlich viel einfacher, ein Monster zu sein, als sich der Wahrheit zu stellen.«
Wütend fletschte ich die Zähne. »Na und?« Ich wollte Kanin eine Reaktion entlocken, irgendeine Gefühlsregung, aber er zuckte nicht einmal mit der Wimper. »Ich habe es versucht, Kanin, und wie ich das habe. Aber weißt du, was ich herausgefunden habe?« Angewidert verzog ich die Lippen. »Wir sind Monster. Ganz egal, wie lange ich dagegen ankämpfe, ich werde immer den Drang verspüren zu jagen, zu töten, zu vernichten. Das hast du mir doch selbst beigebracht, schon vergessen? Die Sache mit …«, mein Verstand weigerte sich, seinen Namen auch nur zu denken, »… mit diesem Menschen, das war dumm und falsch, und irgendwann hätte ich ihn getötet. Es war … besser, dass er gestorben ist.« Ich erstickte fast an diesen Worten, zwang mich aber, weiterzumachen und es zu glauben. »Irgendwann hätte jemand ihn gegen mich eingesetzt. Jetzt gibt es nichts mehr, was mich zurückhalten würde.«
»Nun gut.« Kanins Stimme klang hohl. »Wenn du das nächste Mal vor dem Abgrund stehst, werde ich dich also nicht zurückholen. Aber ich warne dich, Allison.« Sein Blick wurde stechend. »Es ist ein Unterschied, ob man aufgrund von Hunger oder im Blutrausch tötet oder ob man sich dem Monster ergibt. Wer einmal fällt, wer einmal freiwillig diese Grenze überschreitet, der verändert sich – unwiderruflich.«
Reglos starrten wir uns an, ein Kräftemessen der Monster zwischen Autowracks und toten Verseuchten, während ringsum lautlos der Schnee vom Himmel fiel. Kanins Blick war kalt, trotzdem spürte ich keine Wut an ihm, nur erschöpfte Resignation, Reue und ein klein bisschen Trauer. Da wurde mir klar, dass er mich verstand. Besser als die meisten kannte er die Verlockungen des Monsters, wusste, wie schwer es war, diesen grundlegenden Teil unseres Wesens zu verleugnen. Es enttäuschte ihn, dass er nun noch jemanden an den Dämon verloren hatte, aber er verstand es. Ob Kanin während seines unfassbar langen Daseins wohl auch schon seiner inneren Finsternis nachgegeben hatte? War es überhaupt möglich, ewig durchzuhalten?
Ich beschloss, dass es mir egal war. Sollte Kanin doch tun und denken, was er wollte. Ich war trotzdem ein Monster, und daran würde sich auch nichts ändern.
»Wie dem auch sei«, unterbrach Jackal ungeduldig unseren Schlagabtausch, »ich will dieses fesselnde kleine Familiendrama ja nicht stören, aber gehen wir jetzt dann mal auf die Jagd, oder wollt ihr hier stehen bleiben und euch anstarren, bis die Sonne aufgeht?«
Wir wanderten Richtung Norden, also in genau die entgegengesetzte Richtung von Eden und Sarren. Ich wollte die Suche nicht verschieben, wollte nicht, dass unser Ziel einen noch größeren Vorsprung bekam. Aber Kanin bestand darauf, und wenn Kanin auf etwas beharrte, war daran nicht zu rütteln. Also marschierten wir die Nacht durch, vorbei an Wäldern, Feldern und gut zwischen Schneebergen und zugewucherten Baumgruppen versteckten Resten einer zerstörten Zivilisation.
Kanin ignorierte mich völlig und ging ohne sich umzusehen vorneweg. Eigentlich unterschied sich sein Verhalten nicht sonderlich von dem in den anderen Nächten, aber jetzt hatte es etwas Kaltes, Abweisendes an sich. Anscheinend hatte er sich von mir losgesagt. Ich redete mir ein, dass es mich nicht kümmerte. Kanins Werte waren nicht länger die meinen. Außerdem irrte er sich, was mich betraf. Es stimmte nicht, dass ich die Nachwirkungen jener Nacht in New Covington verdrängte oder das Monster dazu benutzte, mich von dem Schmerz abzuschirmen. Ich hatte schlicht und einfach akzeptiert, was ich war. Was ich von Anfang an hätte akzeptieren sollen.
»Also, Schwesterlein«, begann Jackal irgendwann und schloss mit seinem ewigen Grinsen im Gesicht zu mir auf. »Sieht ganz so aus, als würden wir jetzt im selben Boot sitzen. Wie fühlt sich das an, zu Kanins vielen Enttäuschungen zu gehören?«
»Halt die Klappe, Jackal«, murmelte ich fast schon gewohnheitsmäßig. Und wusste doch, dass er es nicht tun würde.
»Ach, das ist halb so wild«, fuhr er fort und deutete mit dem Kopf auf Kanin. »Jetzt musst du dir wenigstens nicht mehr anhören, wie er ständig von seinen blöden Blutsäcken faselt und darüber, wie man ›das Monster unter Kontrolle hält‹. Nach ein paar Monaten wird das echt eintönig.« Mit einem verschlagenen Lächeln fügte er hinzu: »Ist es hier unten bei uns nicht viel entspannter, Schwesterherz? Jetzt, wo du seine lächerlich hohen Erwartungen hinter dir gelassen hast? Endlich kannst du anfangen, so zu leben, wie es sich für einen Vampir gehört.«
»Willst du mit deinem Gequatsche eigentlich auf irgendwas Bestimmtes hinaus?«
»Eigentlich schon, ja.« Für einen kurzen Moment wirkte er fast ernst. »Ich will wissen, was du so vorhast, nachdem wir Sarren eingeholt und die Scheiße aus ihm herausgeprügelt haben. Der alte Mann wird dann wohl keinen von uns mehr haben wollen, nachdem du ja jetzt endlich die Tatsache akzeptiert hast, dass dir Blut ganz hervorragend schmeckt, und er dem ja eher ablehnend gegenübersteht. Wo willst du hin, wenn die Sache gelaufen ist? Natürlich immer vorausgesetzt, du überlebst. Und falls unser geliebter Schöpfer nicht beschließt, uns beide ›zum Wohle der Menschheit‹ auszulöschen.«
»Keine Ahnung«, antwortete ich, ohne den letzten Teil weiter zu beachten. Kanin würde sicher nicht versuchen, mich umzubringen, aber … vor langer Zeit hatte er einmal versucht, Jackals Leben zu beenden. War ich so tief in seiner Achtung gesunken, dass Kanin mich und Jackal nun auf eine Stufe stellte? Zwei Fehler, die er niemals auf die Welt hätte loslassen dürfen?
»Keine Ahnung, wo ich danach hingehe«, sagte ich noch einmal und ließ den Blick durch die Bäume wandern. Irgendwie konnte ich mir nicht vorstellen, an einem Ort zu bleiben – bestimmt nicht unter Menschen, die mich hassten und fürchteten, und die ich systematisch einen nach dem anderen töten würde, um mich zu nähren. Vielleicht würde ich einfach bis in alle Ewigkeit durch die Gegend ziehen. »Spielt schätzungsweise auch keine Rolle.«
»Tja, dann könnte ich dir einen Vorschlag unterbreiten«, erwiderte Jackal fröhlich. »Komm mit mir zurück nach Old Chicago.«
Überrascht schaute ich ihn an. Offenbar meinte er das Angebot vollkommen ernst. »Warum?«, fragte ich vorsichtig. »Bisher hatte ich nicht den Eindruck, dass du gerne teilst.«
»Dein Gedächtnis arbeitet aber auch ziemlich selektiv, oder?« Jackal schüttelte empört den Kopf. »Was habe ich dir denn die ganze Zeit gesagt, Schwesterlein? Dieses Angebot habe ich dir auch früher schon gemacht, mehrmals sogar, aber du warst ja so vernarrt in deine heiß geliebten Blutsäcke, dass du es nicht einmal in Erwägung gezogen hast. Nein, ich dulde keine anderen Blutsauger in meiner Stadt, aber du bist ja nicht irgendein beliebiger Vampir von der Straße. Du gehörst zur Familie.« Er grinste so breit, dass seine Reißzähne aufblitzten. »Und gemeinsam könnten wir großartige Dinge vollbringen. Denk mal drüber nach.«
Immer noch misstrauisch fragte ich: »Und was für ›großartige Dinge‹ wären das so?«
Jackal lachte. »Zunächst einmal könnten wir an der geplanten Vampirarmee arbeiten, wenn wir erst das Heilmittel aus Eden haben, davon habe ich dir ja bereits erzählt. Wir hätten dann unsere eigene Vampirstadt, und die anderen Prinzen müssten vor uns zu Kreuze kriechen. Wir könnten über alle herrschen, du und ich. Was sagst du dazu?«
»Und das alles würdest du einfach so mit mir teilen?« Ich warf ihm einen skeptischen Blick zu. »Was würde dich denn daran hindern, mir ein Messer in den Rücken zu rammen, sobald wir uns mal nicht einig sind?«
»Das tut weh, Schwesterlein.« Übertrieben gekränkt sah Jackal mich an. »Bei dir klingt das ja so, als wäre ich die personifizierte Unvernunft. Reicht es dir denn nicht, dass ich meine süße kleine Schwester kennenlernen will, meine einzige lebende Verwandte neben Kanin?«